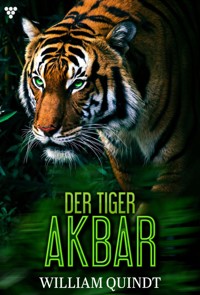30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der schwarze Jaguar
- Sprache: Deutsch
Den großen Katzen – Löwen, Tigern, Leoparden – gilt die Leidenschaft des jungen russischen Dompteurs Wladimir Ssabenjew. In Wien lernt er Susy kennen, die die Tiere liebt wie er. Sie heiraten und nehmen das Angebot eines reichen Amerikaners an, in seiner Tierschau in Florida zu arbeiten. Auch aus Hollywood kommen vielversprechende Aufträge für Dressurnummern. Sie sind glücklich, bis Susy sich eines Tages in die Idee verrennt, einen schwarzen Jaguar, Noar, zu zähmen – etwas, was bis dahin noch keinem Menschen gelungen ist. Packend erzählt der große Tierschriftsteller William Quindt die Geschichte von der Fremdheit zwischen Mensch und Tier. Wenn Sie die Geschichte von Susy hören wollen, von Susy aus Wien und dem samtschwarzen Untier vom Amazonas, an dem sie verdarb, dann kann nur ich Ihnen diese Geschichte erzählen. Susy spricht zwar noch viel, aber was sie redet, ist dummes Zeug, und Pat – nun, Pat ist ein Mädchen aus Kalifornien, sie hat damals das schwarze Untier ausgelöscht und damit alle Verstrickungen gelöst, aber von ihr werden Sie nichts hören als dürre und nackte Tatsachen, ›facts‹, wie sie sagt. Jedoch sind die Tatsachen in dieser Geschichte nur von geringer, vielleicht von keiner Bedeutung. Eine böse Geschichte, Herr, eine düstere Geschichte, ich weiß nicht, ob es Ihnen angenehm sein wird, wenn ich sie erzähle. Denn ich kann nur berichten, was ich erlebt habe und wie ich es erlebte, ich muss also immer wieder oder immer nur von mir selbst sprechen. Ich selbst … Sehen Sie mich hier sitzen im Singapore-Stuhl auf der Veranda meines Wohnwagens! Im Wagen schläft Pat, die Bäume rings um den Platz rauschen leise im warmen Wind der Sommernacht. Ich habe das Dach zurückgeschlagen, die Sterne kreisen funkelnd über den Himmel. Mir gegenüber dunkelt eine lange Wagenreihe, und auch hinter ihren Gitterwänden wandern Sterne. Das sind die Augen der Löwen und Tiger und Leoparden, die mir anvertraut sind und mit denen ich befreundet bin, mehr als hundert Tiere. Ich sitze und sehe zu ihnen hinüber, hinter meinem Rücken läuft der Zirkuszaun, er trennt mich und meine Tiere von der Welt. So ist es mein ganzes Leben hindurch gewesen, und so finde ich es gut, denn die Welt jenseits des Zirkuszaunes ist mir unverständlich, fremd, und erscheint mir oft grausam feindlich. Aber ich weiß nicht, ob ich den Menschen von jenseits des Zaunes nicht ebenso unverständlich bin wie sie mir. Haben Sie auch das leise, dunkle Röhren gehört? Das war der Tiger Prinz, er hat vor zwei Tagen seinen Dompteur angefallen und hat sich noch nicht wieder beruhigt. Das grelle Getöse jetzt eben kam aus dem Elefantenstall. Sie schlafen nur wenige Stunden, die großen Tiere, sie fressen allzu viel, um lange geruhig schlafen zu können, sie stehen auf, um sich auf die andere Seite zu legen, auch lösen sie sich ab in der Wache. Ja, auch hier im Zirkusstall wacht immer ein Tier über den Schlaf der anderen. Aber, bitte, achten Sie darauf, dass ich nicht vom Elefanten spreche, denn das nimmt dann kein Ende, wer sich auf den Elefanten setzt, bestimmt nicht mehr über seinen Weg. Der Tigerdompteur? Er liegt im Krankenhaus, wir rechnen drei Monate bis zu seiner Genesung, er hat Glück gehabt, eh bien, que voulez vous, c'est le bonbon du métier. Ich soll also erzählen. Nein, die Sprache macht mir keine Schwierigkeiten, Sie hören es wohl. Ich spreche ein wenig schwer und langsam, dunkel und hart, ja, ja, ich weiß. »Wie ein Bär sprichst du das Deutsche!«, lachte Susy immer, Susy aus Wien. Das Französische soll ich besser sprechen, aber ich komme auch gut durch die Balkanländer und von Italien und Spanien bis Südamerika. In den beiden letzten Jahrzehnten jedoch ist mir das Amerikanische wert geworden. Wenn die Tiere sprechen könnten, meine ich, würden sie einen herzhaften Slang aus dem mittleren Westen sprechen – nur die Bären nicht, die Bären und die Wölfe und die Luchse sprechen russisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
WLADIMIR SSABANJEW
MAITRE LABORDE, BELLUAIRE
LES CRIS DES NUITS
SCHLOSS IM SCHNEE
SUSY
BIGGEST ANIMAL FARM OF SILVERSPRINGS
ARBEIT IM TRAUMLAND
DER MANN AUS COOCH BEHAR
GREATEST SHOW ON EARTH
DIE PANTHER-MEUTE
CURA UND CARA
SCHWARZES KATZERL
NOAR
VAE VICTIS
SCHREI IM KÄFIG
VERGITTERTES LEBEN
PAT
Der schwarze Jaguar – 1 –Der schwarze Jaguar
William Quindt
WLADIMIR SSABANJEW
- 1 -
Wenn Sie die Geschichte von Susy hören wollen, von Susy aus Wien und dem samtschwarzen Untier vom Amazonas, an dem sie verdarb, dann kann nur ich Ihnen diese Geschichte erzählen. Susy spricht zwar noch viel, aber was sie redet, ist dummes Zeug, und Pat – nun, Pat ist ein Mädchen aus Kalifornien, sie hat damals das schwarze Untier ausgelöscht und damit alle Verstrickungen gelöst, aber von ihr werden Sie nichts hören als dürre und nackte Tatsachen, ›facts‹, wie sie sagt. Jedoch sind die Tatsachen in dieser Geschichte nur von geringer, vielleicht von keiner Bedeutung. Eine böse Geschichte, Herr, eine düstere Geschichte, ich weiß nicht, ob es Ihnen angenehm sein wird, wenn ich sie erzähle. Denn ich kann nur berichten, was ich erlebt habe und wie ich es erlebte, ich muss also immer wieder oder immer nur von mir selbst sprechen.
Ich selbst … Sehen Sie mich hier sitzen im Singapore-Stuhl auf der Veranda meines Wohnwagens! Im Wagen schläft Pat, die Bäume rings um den Platz rauschen leise im warmen Wind der Sommernacht. Ich habe das Dach zurückgeschlagen, die Sterne kreisen funkelnd über den Himmel. Mir gegenüber dunkelt eine lange Wagenreihe, und auch hinter ihren Gitterwänden wandern Sterne. Das sind die Augen der Löwen und Tiger und Leoparden, die mir anvertraut sind und mit denen ich befreundet bin, mehr als hundert Tiere. Ich sitze und sehe zu ihnen hinüber, hinter meinem Rücken läuft der Zirkuszaun, er trennt mich und meine Tiere von der Welt. So ist es mein ganzes Leben hindurch gewesen, und so finde ich es gut, denn die Welt jenseits des Zirkuszaunes ist mir unverständlich, fremd, und erscheint mir oft grausam feindlich. Aber ich weiß nicht, ob ich den Menschen von jenseits des Zaunes nicht ebenso unverständlich bin wie sie mir.
Haben Sie auch das leise, dunkle Röhren gehört? Das war der Tiger Prinz, er hat vor zwei Tagen seinen Dompteur angefallen und hat sich noch nicht wieder beruhigt. Das grelle Getöse jetzt eben kam aus dem Elefantenstall. Sie schlafen nur wenige Stunden, die großen Tiere, sie fressen allzu viel, um lange geruhig schlafen zu können, sie stehen auf, um sich auf die andere Seite zu legen, auch lösen sie sich ab in der Wache. Ja, auch hier im Zirkusstall wacht immer ein Tier über den Schlaf der anderen. Aber, bitte, achten Sie darauf, dass ich nicht vom Elefanten spreche, denn das nimmt dann kein Ende, wer sich auf den Elefanten setzt, bestimmt nicht mehr über seinen Weg. Der Tigerdompteur? Er liegt im Krankenhaus, wir rechnen drei Monate bis zu seiner Genesung, er hat Glück gehabt, eh bien, que voulez vous, c’est le bonbon du métier.
Ich soll also erzählen. Nein, die Sprache macht mir keine Schwierigkeiten, Sie hören es wohl. Ich spreche ein wenig schwer und langsam, dunkel und hart, ja, ja, ich weiß. »Wie ein Bär sprichst du das Deutsche!«, lachte Susy immer, Susy aus Wien. Das Französische soll ich besser sprechen, aber ich komme auch gut durch die Balkanländer und von Italien und Spanien bis Südamerika. In den beiden letzten Jahrzehnten jedoch ist mir das Amerikanische wert geworden. Wenn die Tiere sprechen könnten, meine ich, würden sie einen herzhaften Slang aus dem mittleren Westen sprechen – nur die Bären nicht, die Bären und die Wölfe und die Luchse sprechen russisch.
Nein, ich bin kein Russe, ich bin kein Russe mehr. Ich bin ein Mann von dieser Seite des Zirkuszaunes. Nur innerhalb dieses Zaunes bin ich beheimatet, jenseits ist nichts als Fremde und Feindlichkeit für mich in allen Ländern dieser Erde. Ja, ich habe sie ziemlich alle durchwandert, der Zirkuszaun ist mir dabei sehr wert geworden. Mein Pass? Jetzt dürfen Sie getrost so wegwerfend lächeln, wie überall in der Welt die Uniformierten lächeln, sobald er ihnen auf den Tisch gelegt wird. Mein Pass ist kein vollgültiger, kein »richtiger« Pass – ein Nansen-Pass, ja, jawohl, zu Befehl! Fridtjof Nansen – Herr, wenn es nicht ein paar große, alte Männer in eurer Welt geben würde, lohnte es sich kaum, gelegentlich über den Zirkuszaun zu sehen.
Ich heiße Wladimir. So rief man mich in meiner Jugend, so nennen mich alle, die ich kenne. Weil mein Vater den gleichen Namen trug, nannte man mich früher mitunter auch Wladimir Wladimirowitsch, und in meinem Nansen-Pass finde ich auch noch den anderen Vatersnamen verzeichnet, »Ssabanjew …«, aber wann denke ich schon einmal daran, dass ich wirklich auch noch Ssabanjew heiße! Dagegen habe ich noch einen zweiten Vornamen, auf den ich recht stolz bin, Anatoli nämlich, nach meinem Paten, der mich über das Taufbecken hielt, nach dem großen und berühmten Anatoli Durow, der ein Jugendfreund meines Vaters gewesen ist.
Sie wissen nichts von Anatoli Durow, Herr? Dann werden Sie mir verzeihen, wenn ich nichts von den Büchern und Filmen wusste, deren Titel Sie mir genannt haben. Anatoli Durow ist einer der ganz großen Namen in der Welt der russischen Zirkusmenschen, vielleicht ist er ihr größter Name. Er war ein Clown, ein Clown mit Tieren. Darüber hinaus hatte er Verstand, Geist, und, was viel mehr ist, er hatte Herz. Als er noch Kadett war, verschwor er sich einmal mit den anderen Knaben zur Rache an dem Aufseher, der sich als gemein und niederträchtig erwiesen hatte. Ihn traf das Los, den Hund des verhassten Mannes aufzuhängen. Er versuchte es und versagte vor den Augen des Tieres, die voll Demut und Trauer und Anklage auf den Henker blickten. Anatoli brach zusammen und erwachte erst nach Tagen im Lazarett. Als er viele Wochen später von einem bösen Nervenfieber genesen war, hatte er sich dem Tier, dem fremden und stummen Bruder, verschworen, dem Tier und vielleicht damals schon jener Wissenschaft, die Sie Tierpsychologie nennen. Weil er mit den Tieren leben, ihren Verstand studieren und ihre Seelen ergründen wollte, ging er zum Zirkus und wurde Tierclown. Und wurde berühmt weit über Russlands Grenzen hinaus. Denn da er die Tiere liebte und sich darum mit ihnen verstand, brachte er sie in der Manege zu ganz außerordentlichen Leistungen. Er schrieb auch Bücher über seine vierfüßigen und gefiederten Freunde, nicht wehleidige, süßliche, wie die alten Tanten sie schreiben, er schrieb Bücher von genauer und wissenschaftlich exakter Beobachtung, und er galt auch den Gelehrten als ein bedeutender Mann. Und das russische Volk liebte ihn heiß, weil er aus der Manege heraus ohne Furcht die Machthaber verspottete und sie der Lächerlichkeit preisgab. Er war kein politischer Mensch, er war kein Doktrinär, aber er hatte die große Ehrfurcht vor allem Leben, die dem guten Menschen innewohnt, er hatte sich den Tieren zugewandt, aber er wollte auch die Menschenwürde unverletzt sehen, und darum griff er alle an, die diese Würde verletzten und sich eben deshalb für besonders würdig hielten, vom Zaren bis hinab zum letzten Schimmelreiter irgendeiner Polizeiwachstube. Weil er aber die Würde des Menschen unangetastet sehen wollte, kämpfte er für die Freiheit und wurde auf diesem Wege zum Vorkämpfer der großen Revolution.
Er hat noch alles erlebt und ist daran gestorben. Als der große Krieg Europa mit seinen Schrecknissen überzog, verstummte er im Gram über das Elend der Menschen. Als die Revolutionen aufbrannten, zerbrach er. Er war kein politischer Mensch, er konnte keine abstrakten Ziele aufstellen, er konnte nicht fraglos einer Theorie folgen, er sah nur, dass Menschen an Menschen sterben mussten. Er hatte sich in Kummer und Leid hinter dem Zirkuszaun vergraben, er hat mit seinen Tieren gelebt, er hat seine Bücher geschrieben. Als er gestorben war, tat ein Wassiliy, als wenn er schon immer der große Anatoli Durow gewesen wäre. Und wiederum später verunglückte Anatolis Sohn auf der Jagd, und ein entfernter Vetter, der wiederum Anatoli heißt, trägt den Namen und spielt die Rolle des großen Unvergessenen. Herr, er mag ein guter Mensch sein, aber wir kennen ihn nicht, wir wollen ihn nicht einmal kennen, wir haben den großen Anatoli Durow allzu sehr geliebt.
Anatoli Durow war mein Pate, weil er der Freund meines Vaters war. Mein Vater besaß eine Menagerie, die ihm von seinem Vater, seinem Großvater, seinem Urgroßvater überkommen war. Ich wurde in Suchum geboren, am Schwarzen Meer. Heute hat man dort große Institute errichtet, in denen die russischen Wissenschaftler Intelligenz und Seelenleben der Menschenaffen erforschen, damals überwinterten wir in dieser Stadt, um in ihrem warmen Klima unsere Bären um den Winterschlaf zu betrügen. Meine Mutter starb bei meiner Geburt, ich wuchs neben meinem Vater auf und unter den zweihundert Tieren seiner Menagerie, den Bären und Bären und Bären, den vielen Wölfen, den wilden und halbwilden Hunden, den Luchsen und Mardern und Zobeln, den wenigen Löwen, dem einen großen Elefanten, der Meute von Schneepanthern aus dem Tian-Schan und vom Amur.
Mein Vater ließ keinen Menschen an mich heran, er zog mich allein mit seinen Händen auf. In späteren Jahren hat er mir mitunter erzählt, wie er Amme und Kindermädchen bei mir gespielt hat, und jedes Mal lachte er dabei, dass die Lampe an der Decke unseres Wohnwagens schaukelte, als sei dieser Wagen ein Schiff im Sturm auf hoher See. Ich sehe ihn noch heute vor mir, ich gleiche ihm wohl, aber er war größer und stärker, als ich es heute bin, breit und schwer. Er hatte braunes, krauses, langes Haar, sein Gesicht ertrank im Bart. Und immer trug er das buntbestickte Russenhemd und die knielangen Stiefel. Ich bin glattrasiert und scheitele mein Haar, das über der Stirn zurücktritt und an den Schläfen ergraut, das Hemd, das Sie sehen, habe ich mir in Bondstreet schneidern lassen, und ich liebe Wildlederschuhe mit Kreppsohlen – aber niemals werde ich lachen können, so frei und froh und stark, wie mein Vater lachte.
Dreimal am Tage, so erzählte er, fütterte er mich ab, bis mir Milch und Lebertran aus den Mundwinkeln rannen, dann tauchte er den Zipfel eines Leinenlappens in seine Wodkaflasche und steckte ihn mir in den Mund, danach pflegte ich gut und tief zu schlafen, und er war sicher vor jeder Störung. Schrie ich doch einmal, sah er nach, ob er mich trockenzulegen hatte und erneuerte die alkoholische Feuchtigkeit im Leinenlappen. Als dieses Verfahren einige Male nicht half, griff er zu der Methode der Eskimomütter. Er nahm den Mund voll mit eiskaltem Wasser und spritzte mir, sobald ich zu schreien begann, dieses Wasser im dünnen Strahl in Gesicht und Mund. Danach ließ ich bald das Schreien und wurde ein stilles, sehr braves Kind.
Für ein solches hatte er gute Verwendung, er war ja ein Schausteller, hatte für guten Besuch seiner Menagerie zu sorgen und war sein eigener Anpreiser und Ausrufer. Niemals, so meinte er noch viele Jahre später, war ihm diese Arbeit so leicht gefallen wie in meinen ersten Lebensjahren. Seine Stallburschen bildeten eine Kapelle und trommelten und trompeteten das Publikum zusammen. Wenn sich genügend Menschen eingefunden hatten, nahm Vater mich aus meiner Wiege, verstaute mich in ein schleifengeschmücktes Steckkissen und ließ Alanka, eine große sibirische Bärin, aus ihrem Käfig. Sie richtete sich auf und war um zwei Köpfe größer als mein großer und starker Vater. Er legte ihr das Steckkissen in den Arm, hakte sie unter, wie ein kleiner Mann sich bei einer großen Frau einhängt, und so wanderten die beiden dann auf die kleine Bühne hinaus, die Holztreppe hinab, einmal hinauf und wieder zurück vor der Menagerie. Und die Leute drängten sich und sahen meinen Vater und die große Bärin, und sie sahen mich, und ich pflegte, so erzählte Väterchen, bei solchen Spaziergängen fröhlich zu krähen und begierlich nach Alankas Nase zu greifen. Und Alanka neigte ihren Schädel, der viel größer war als ich, sanft über mein Gesicht, blies bisweilen zärtlich darüber hin, nahm dann meine Kinderfaust zwischen ihre Zähne und nuckelte daran wie ich an meinem Leinenlappen. Und wenn der Vater mit uns in die Menagerie zurückkehrte, drängten ihm alle Leute nach, und keiner blieb draußen. Dann wanderten sie die langen, langen Wagenreihen entlang und bewunderten und bestaunten die fremden und wilden Tiere. Und am Ende des Stallganges, in einem kleinen Rundzelt, durften sie gegen ein geringes Sonderentree meinen Vater bewundern, der ihnen dressierte Bären und Wölfe vorführte, unsere alte Elefantin sich auf ihre Hinterbeine erheben oder einen Löwen durch den Reifen springen ließ.
Als ich dann aber zehn Jahre alt war, stand ich allein in dem großen Zwinger, die Wölfe und Bären, die ich arbeiten ließ, hatte ich selbst abgerichtet, und die Arbeit dieser gemischten Gruppe war die beste Dressur, die unsere Menagerie zeigte. Mein Vater war sehr stolz auf mich und stellte mir am ersten Abend, nach der Suppe, eine ganze Flasche klaren Wodka auf den Tisch. Aber ich schob sie ihm lächelnd zurück, ich war ihm tief zu Dank verpflichtet, die mit Wodka getränkten Leinenlappen hatten mir für mein Leben den Geschmack an allen scharfen und schweren Getränken genommen. Mein Vater trank tief bestürzt die Flasche allein aus, hinterher weinte er bitterlich. Er hatte mich, so meinte er, um das Beste beraubt, das ein Russe im Leben finden kann. Denn was wohl sollte besser für einen Russen sein, als Wodka trinken und dabei vergessen, dass er ein Russe ist? Ich aber bin ihm noch heute dankbar, denn ich bin durch die Welt gefahren, ich habe tausend gute Männer und Frauen kennengelernt, ich habe gesehen, wie sie beim Schnaps Stärke, Trost oder Frieden suchten, und ich weiß, dass er nichts ist als ein listiger und gemeiner Mörder. Er ist eine Flucht, ich weiß, ich weiß, aber ich weiß auch, dass er eine dumme und unsaubere Feigheit ist.
Aber nun dürfen Sie nicht denken, Herr, dass ich mich zum Richter über andere Menschen machen will – nur damals, in meiner großen Jugend und meinem Vater gegenüber, fand ich wohl härtere Worte, als sie nötig gewesen wären. Denn ich hatte meine Form gefunden und erfüllte sie, wie ich von ihr erfüllt war. Ich war Wladimir und lebte mit den Tieren, sie waren mein Reich, sie waren mein Land, bei ihnen allein war ich beheimatet, die Welt, die hinter unserem Zaun lag, war unwirklich, war wesenlos. Dazu liebte ich in jenen jungen Jahren zum ersten Mal drei finnische Luchse, groß wie meine Schneepanther, aber noch stärker im Gebäude als sie. Wir hatten sie vor kurzer Zeit bekommen, sie waren von einer bestürzenden, aggressiven Wildheit, ich verbrachte meine Tage vor ihrem Käfigwagen wie im Gebet, ich liebte sie sehr. Damals war es, dass ich zum allerersten Mal von meiner Bestimmung ahnte – mit den Bären und Wölfen, mit Elefanten und Kamelen, den Hunden und Stieren war ich gut Freund und stand mich mit ihnen wie Bruder mit Bruder. Die Katze aber – ausgenommen dem Löwen – der für mich keine rechte Katze ist, sondern im Ausdruck und Wesen etwas Stierhaftes hat, Wildstierhaftes meinetwegen, die Katzen liebte ich: unsere Schneepanther, diese Luchse aus Finnland.
Sie waren Teufel, diese drei, keiner von ihnen hat geruht, von meiner knabenhaft überströmenden Liebe Notiz zu nehmen, aber dessen bedurfte das Kind, das ich damals war, auch nicht. Liebe allein, die sich um die Erfüllung müht, ist nicht nur das Glück der Jugend, sie ist auch alles Glück, das ein Mann finden kann. Hingegen scheint mir die Liebe, die bereits tausendfältige Erfüllungen gefunden hat, gefährlich und todbringend. Ich bin an solcher Liebe gescheitert, Susy scheiterte, Pat – nun, Pat ist aus Kalifornien, ich weiß nicht, ob sie Sinn hat für das, was wir Liebe nennen, wir Menschen aus dem alten Europa. Wenn man ihr davon sprechen will, wendet sie sich ab und geht davon … Aber auch ich will jetzt nicht von solcher Liebe sprechen, sondern von dem jungen Wladimir in der Menagerie seines Vaters.
Bären und Bären und Bären in den Käfigwagen. Wenn mein Vater mit seinen Freunden trank, nannten sie ihn Medwjed, das ist das russische Wort für Bär. Er lachte dazu, er wusste, dass er dem Bären glich: stark und schwer und doch wieder von verblüffend rascher Gewandtheit, gutmütig und schlau, töricht, sorglos und dann wieder voll kalter Klugheit – und oftmals dahintosend in überwältigter Lust oder krachendem Zorn. Er war wie ein Bär, er liebte die Bären, seine Menagerie war zuerst eine Ausstellung von Bären. Bären aus den Karpaten und aus dem Kaukasus, Bären vom Ural, aus dem Land Sibir, aus der Mandschurei, von der nördlichen Küste, Riesenbären sogar aus dem fernen Alaska. Und neben den Bären musste er Wölfe haben, viele Wölfe, seine »Mörderchen« nannte er sie und zähmte sie zu braven und willigen und treuen, wenn auch immer etwas scheu bleibenden Hunden. Und viele Schneepanther dazu, sie waren ihm sein schönstes Spielzeug, und er war zärtlich zu ihnen wie eine Mutter zu ihren Kindern. Und all das flinke kleine Raubzeug der Marder und Wildkatzen hinter dem Drahtgeflecht ihrer Käfige, und als er merkte, dass es mir die Luchse angetan hatten, überschüttete er mich mit Luchsen, die er aus allen Teilen Russlands und der weiten Welt kommen ließ. Und sah mit dröhnendem Lachen meinen Versuchen zu, diese Tiere zu zähmen, was mir durch die Jahre niemals recht gelingen wollte. Und die Kamele, die Zebras, die Yaks und die weißen ungarischen Stiere mit ihren gewaltigen Hörnern in ihrer Spreu. Und die eine Elefantin, Barinja nannten wir sie, weil sie das größte und vielleicht auch das klügste und gewiss das nobelste von allen unseren Tieren war. Und die wenigen Löwen, mit denen wir unsere Sorgen hatten, wenn wir im Frühjahr den Kaukasus querten, hinter den wir uns vor den Schneestürmen des Winters verkrochen hatten, um dann bis in den späten Herbst hinein durch den Wind der großen russischen Ebene zu ziehen, vom Schwarzen Meer bis nach Archangelsk, von den Städten an den Hängen des Urals bis nach Petrograd und Reval.
Und Chan darf ich nicht vergessen, unseren Mandschu-Tiger, fünf Zentner schwer, er glich einem Dämon und hatte das Gemüt eines Bernhardiners, zwanzig Jahre lang hat er unter der Hut und in der Freundschaft meines Vaters gelebt.
Und ich neben meinem Vater und mit all diesen Tieren. Nein, mir wurde nichts geschenkt, ich habe in den Ställen gearbeitet wie einer jener Burschen, die mein Vater bezahlte, ich habe gemistet und gestriegelt, geschlachtet, gefüttert und gemolken, habe die Zelte aufgeschlagen und abgerissen, unsere Wagen auf die Loren unseres Sonderzuges verladen und sie im nächsten Ort wieder abgeladen und aufgebaut. Als aber mein Vater sah, dass ich eine gute Hand für die Tiere hatte, ließ er mich mit ihnen arbeiten, ich wurde sein erster Dresseur, und damit hatte die Arbeit für mich niemals mehr ein Ende. Und nur einen einzigen Lohn kannte ich – ein Pferd zu satteln und reiten, weit und lang durch die Steppe reiten. Ach, ich will auch davon nicht sprechen, weil ich sonst kein Ende finde, aber wer nicht durch unsere Steppen geritten ist, der weiß nichts vom Reiten und weiß nichts vom Pferd.
Auf andere Weise fand ich nicht hinter dem Zirkuszaun hervor, und ich habe niemals eine Schule von innen gesehen. Mein Vater hätte mich wild aufwachsen lassen können, niemand hätte ihn dafür belangt, und ich wäre ein Analphabet geworden, wie er einer war, der sich dessen fröhlich brüstete, um dann jeden Kaufmann, jeden Pferdehändler voll Behagen zu übervorteilen. Aber er sorgte dafür, dass ich ein gutes Maß von Bildung bekam. In irgendeiner Stadt las er den schiefen Nikita von der Straße auf, der geradenwegs aus Sibirien kam. Ein ehemaliger Student, den man wegen politischer Umtriebe auf den Trakt geschickt hatte, die Straße, die in die Verbannung führt, und der in fünf Jahren gnadenloser Bergwerksarbeit zerbrochen war an Leib und Seele. Mein Väterchen setzte ihn an die Kasse und ernannte ihn zu meinem Lehrer. Und der schiefe Nikita, der immer so aussah, als würde er im nächsten Augenblick aus seinen hohen Stiefeln kippen, war ein guter Lehrer, nachdem ich ihn mir zu solchem Amt erzogen hatte. Im Anfang nämlich war er unsicher und wagte, mir bei irgendeinem geringen Anlass eine Ohrfeige zu geben. Dafür habe ich ihn mit der kurzen Peitsche verprügelt, mit der ich meine Wölfe dressierte, hinterher haben wir uns ausgezeichnet verstanden. Ich lernte lesen und schreiben, Nikita sorgte auch dafür, dass ich immer zu lesen hatte, und das war eine großartige Angelegenheit. Danach lernte ich rechnen, und das schlug böse aus für das schiefe Männchen, denn ich kam rasch dahinter, dass und wie er meinen guten Vater bei seinen Abrechnungen betrog. Ich sagte ihm nichts davon und auch meinem Vater nicht, aber ich beredete das Väterchen, eine andere Kontrolle einzuführen, er tat mir den Gefallen, und damit hatte ich Nikita das Handwerk gelegt. Er versuchte es allerdings noch einmal auf eine andere Weise, da habe ich dann ernsthaft unter vier Augen mit ihm reden müssen, danach lebten wir in Frieden. Nikita ließ mich mit all den Dingen ungeschoren, mit denen man sich sonst unnütz durch die Jahre in der Schule herumquälen muss, nur, um sie mit dem letzten Schultag endlich vergessen zu können. Dagegen hat er sich in Naturgeschichte, Erdkunde und in den Fremdsprachen sehr anstrengen müssen, um meinen Wünschen gerecht zu werden, umso mehr, weil der größte Teil des Unterrichtes in die Morgenstunden fiel, in denen ich mit meinen Tieren arbeitete. Viele und sehr gehaltvolle Vorträge hat mir der schiefe Nikita durch die Gitter des Dressurkäfigs gehalten, in dem ich saß, meine Tiere beobachtete, sie spielen oder auch etwas arbeiten ließ. Aber ich habe nicht schlecht gelernt auf diese Weise.
Nun, er hat mir die Augen geöffnet und mir die Welt gezeigt. Aber schon nach einigen Jahren brauchte ich ihn nicht mehr, ich konnte auf eigenen Füßen die Wege gehen, die er mir gewiesen und aufgetan hatte. Nur war es gut, dass man bei ihm immer Bücher fand, immer neue, immer solche, die man noch nicht gelesen hatte. Und ich las viel in meinen jungen Jahren, untertags und in den Nächten auch. Jedoch habe ich in den Nächten doch wohl mehr geträumt als gelesen.
Vielleicht waren sie am schönsten, Nächte und Träume, wenn wir im Herbst aus dem weiten Russland heimkehrten zum Schwarzen Meer, um uns hinter den Kaukasus zu verkriechen, in Suchum, unserem Stammsitz, der Stadt, die darauf bestand, dass wir den Winter in ihr verbrachten. Dann sang und stürmte der große Wind, der vor dem Winter einherlief, so stark und betörend, dass ich die Nächte damit verbringen konnte, ihm zuzuhören. Dann brannten im langen Menageriezelt die großen Öfen, ich lag zwischen ihnen auf meinem Strohsack, ich lauschte dem Wind, ich hörte die Feuer knistern – und das sind die zwei großen Melodien meines Lebens geblieben für mich bis heute. Und selbstverständlich die Stimmen der wilden Tiere, sie bilden die erste, die großartigste, die oberste aller Melodien.
Und dann träumte ich unter diesen Melodien – unter den Stimmen der Tiere, ihre Gesichter und ihre Wildheit vor meinen Augen, unter dem russischen Wind und dem knisternden Feuerspiel in den Ofen. Und die Zeltplane wich hin, das große Russland glitt unter mir davon, und dann war ich im Lande Sibir, mitten im endlosen Urman, mitten in der grenzenlosen Taiga, und auf tausend Meilen im Umkreis brannte kein anderes Feuer als das meine. Und ich saß einsam in der Nacht, Schnee fiel, Wind weinte, im vereisten Wald schrien die Luchse. Aber die Wölfe zogen wie Wachen um mein Haus aus starken Baumstämmen, nahe mir blies der warme Atem der Bären aus ihrem Winternest, und neben mir lag Tanja, die Schneeleopardin, und ihr seidener Leib streckte sich unter meiner streichelnden Hand.
Jede Jugend hat ihre Träume – dies war der meine. Ich habe ihn durch die Jahre geträumt, Nacht für Nacht diesen einen Traum. Ich denke, es war, weil mir der Zaun unserer Menagerie nicht sicher genug erschien, weil mich die Menschen, die Häuser, die Straßen, die Städte bedrängten, die ich jenseits des Zaunes sehen musste, weil ich mich nach größerer Sicherheit sehnte, nach der Einsamkeit ohne Grenzen, die mich allein ließ mit meinen Tieren und mit den großen Melodien dieser Welt, dort, wo diese Welt noch singt, dort nämlich, wo sie noch wild ist und nichts als wild.
Ich hätte in meinem guten Bett und in meinem Wagen schlafen sollen, mein Vater sagte mir das oft genug, ich tat es fast nie. Für die Nachtwachen waren unsere Stallburschen da, aber die verließen sich sehr bald auf mich, trollten sich allabendlich in die Stadt und vertranken das Geld, das sie tagsüber von den Besuchern – »Na tschaj!« – »Für Tee!« – eingesammelt hatten. Sie mochten über mich lachen, und sicherlich hätten sie im höhnischen Vergnügen über mich gebrüllt, wenn sie um meine Träume gewusst hätten, meine Träume von tausend Meilen Einsamkeit, für sie war die Schnapskneipe das Paradies. Aber ich meine noch heute, dass unsere Kinderträume unser Bestes sind, ihre schmerzliche Süße vertieft sich mit den Jahren und mit unserer Erkenntnis, dass wir unsere besten Träume niemals verwirklichen können – und deshalb träume ich wohl noch heute bisweilen diesen alten Traum, ja, auch neben der schlafenden Pat, und kann mich noch heute an ihm berauschen.
Sonst lachten die jungen Arbeitsburschen nicht über mich, denn ich war der junge Herr und sah ihnen scharf auf die Finger – dass die Arbeit getan wurde, und dass sie gut getan wurde, dass vor allem meine Tiere ihr volles Recht bekamen und dass ihnen keine Ungerechtigkeit, kein Leid widerfuhr. Die Arbeit war hart und schwer, das ewige Reisen, das ewige Einpacken, Verladen und Wiederaufbauen unserer Welt, die eine Zauberwelt für jene Menschen war, die zu uns kamen. Und auch meine Arbeit war nicht leicht, denn die Männer, die ich zu beaufsichtigen hatte, waren zumeist rohe Tunichtgute, die oftmals im bürgerlichen Leben versagt hatten, sich in der strengen und harten Arbeit unserer wandernden Zelte aber doch zumeist weit besser bewährten, als zu erwarten war. Ja, es gab nicht wenige unter ihnen, die schon nahe daran gewesen waren, Verbrecher zu werden, sich aber im Zusammenleben mit unseren Tieren wieder fingen und sich der ehrlichen Arbeit für diese Tiere und wohl auch der harten Freiheit unserer ewigen Wanderschaft verschrieben. So ging es, bis auf wenige krasse Katastrophen mit renitenten Trunkenbolden, recht friedlich und fast familiär zu in unserer Menagerie, die Leute taten ihre Arbeit und taten sie gut, meine Tiere bekamen ihr Recht und ich alle Zeit, vormittags mit den Tieren zu proben, nachmittags mit ihnen vor dem Publikum zu arbeiten und in den Nächten bei ihnen, mit ihnen zu träumen.
Und niemals haben diese frechen und leichtlebigen Burschen unserer Stallungen geahnt, dass ich eine nicht unwichtige Sache von ihnen lernte, ehe sie quälend für mich werden konnte, und dass die Art, die ich ihnen absah, mich für mein Leben vor vielem Missgeschick bewahrte. Das war die Sache mit den Frauen. Sie wurde sehr wichtig für mich, sie begann mich zu verwirren, ich war wohl sechzehn, vielleicht schon siebzehn Jahre alt. Natürlich wusste ich längst alles von den Geschlechtern und hatte alles gesehen, bei den Tieren und auch bei den Menschen. Es hatte mich abgestoßen, ich fand es schmutzig und gemein, meine Träume waren mir lieber. Umso verwirrter wurde ich, als die Sucht in mir aufstand, nicht zu beruhigen war, sondern wuchs und wuchs und mich zu knechten begann. Ich ertappte mich dabei, dass ich weibliche Besucher anstarrte und ihnen nachsah, ich hielt mich für sehr verworfen, als ich mich wünschen fühlte, mit diesen fremden, sehr fremden Frauen das zu tun, was der Tiger Chan vor meinen Augen mit der Tigerin Schura getan hatte, was Grischa, unser altes Faktotum, im Heu des Futterzeltes mit Warja getrieben hatte, unserer Köchin, die kaum jünger war als er. Sie hatten mich nicht gesehen, als ich unvermutet dieses Zelt betrat, es war nur ein Augenblick, dann war ich davongelaufen, es hatte mir Monate vor ihnen gegraust, sie schienen mir der letzte Auswurf der Menschen. Und nun brannte es in mir, und ich schämte mich über alle Maßen.
Dann sah ich auf meiner abendlichen Runde um die Zelte, dass unsere Burschen, wenn sie zum Trinken gingen, draußen von Frauen erwartet wurden, die sich ihnen anschlossen. Und ich sah junge Mädchen, saubere und gutgekleidete, ich sah geputzte Bürgerfrauen unseren Zaun umschleichen. Und ich sah sehr wohl, wie sie mich musterten, sie hatten mich im Käfig bei den Tieren gesehen und wussten, dass ich der Sohn des Besitzers war. Und ich konnte in ihren Augen lesen, wie ich in den Augen meiner Tiere lesen gelernt hatte. Zuerst gab es einige lachhafte Missverständnisse, ich hörte auf das, was die Mädchen oder Frauen mir erzählten, und nahm es ernst – wie hingerissen sie waren von unseren Tieren, wie sie glühten nach unserem Leben, wie sie verdorren mussten in ihren Kleinbürgerstuben. Aber die dritte, die ich durch den Zaun schlüpfen ließ und auf meinen Strohsack vor den Tierkäfigen nahm, war eine junge Zigeunerin, und die sagte mir, worauf es ankam, ihr und den anderen Frauen. Das war vor der vergitterten Zelle meines Lieblings, Tanja, der Schneeleopardin, sie hat damals zugesehen und hat bei allen anderen zugesehen, es wurde die einfachste Angelegenheit der Welt – draußen hinter dem Menageriezelt standen in jeder Stadt die Frauen und warteten, dass man sie holte, um mit ihnen zu tun, wozu sie geboren waren. Und so ist es mein Leben hindurch geblieben. Man hatte die Wahl, man brauchte nur zu winken, die Frauen waren immer bereit, und böse nur die, die man verschmähte.
Nein, ich spreche nicht von den Frauen, nicht mehr als jeder Mann. Aber wenn Sie mich fragen, so meine ich, dass es kein ganz ehrliches Spiel ist, das die Frauen mit uns spielen oder doch mit Euch, den Bürgern. Sie wollen in unserem besonderen Ansehen stehen, aber dieses Ansehen ruht auf unserer Verschwiegenheit. Und wer das weiß, der findet den Kult besonderen Wertes, den die Frauen mit sich selbst treiben und dem auch wir Männer dienen sollen – nun, er findet ihn komisch und eben nicht ehrlich. Entschuldigen Sie schon, aber ich komme aus den Staaten, in denen jedes rasche Frauenwort schwerer wiegt als alle gute Männerrede, ich muss hier im alten Land einmal ein anderes Wort sprechen. Wenn sie sich, die Frauen, zu ihrem Fleisch und Blut bekennen wollten, wie wir dummen Männer das tun, wäre das Leben leichter. Die Frau selbst müsste den Anspruch aufgeben, dass sie an sich eine unbezahlbare Kostbarkeit darstellt, dass der Mann ein Kavalier zu sein und dass er zu zahlen hat, vom ersten Glas Tee bis zur standesgemäßen Versorgungsehe und noch nach dieser. Aber schließlich sind das Dinge, die Euch angehen und nicht mich, ich reise durch die Welt, und jenseits des Zirkuszaunes stehen die willigen und fordernden Frauen bereit. Eine gute Einrichtung, ich habe meine Freude an ihr gehabt, die Frauen haben mir meine Träume niemals getrübt, nicht meine Gemeinschaft mit den Tieren gestört, nicht einmal von meinem Liebeswerben um unsere unzähmbaren Luchse haben sie mich abhalten können.
Ja, ich richtete Bären ab, Braunbären und Schwarzbären und auch die Riesen aus Alaska, und ich hatte mich gut abgefunden mit ihrer gefährlichen, launenhaften Unberechenbarkeit. Ich dressierte Rudel von Wölfen und hielt sie durch Jahre in Zucht und Arbeit, sie galten mir bald nicht mehr als ärgerlich scheue, reich zigeunerhafte Hunde. Ich baute aus den Schneeleoparden eine Zirkusnummer, die überall begeistert aufgenommen wurde, und Tanja, die Kluge und Weiche und Schöne, war der Star dieser Gruppe. Ich habe die Rinder und Zebras exerzieren lassen und habe Dromedaren Schritte der Hohen Schule beigebracht – das alles war zwar nicht leicht, aber es war selbstverständlich. Es kostete Zeit und Arbeit und viel Geduld, aber diese Arbeit trug ja ihren Lohn in sich selbst, man war mit den Tieren zusammen, man fühlte sich in sie ein, man lernte sie verstehen und nahm es wie einen Dank, endlich auch von ihnen verstanden zu werden.
Bei den Luchsen nützte das alles nichts, nützte nichts die Geduld, nichts alle Versuche der Einfühlung, nicht Zuneigung noch Liebe, bei den Luchsen gab es weder Verstehen noch Dank. Unsere Menagerie war voll von ihnen, Väterchen machte sich einen Spaß daraus, ich sagte es schon, mich unter Luchsen zu begraben, wie er sich selbst unter seine Bären vergrub. Zuerst und zumeist gab es natürlich die leichtgefleckten polnischen Luchse, neben ihnen die eisengrauen Sibirier mit der sich rundenden Bartkrause. Aber wir hatten auch Pardelluchse aus Spanien, Kanadier mit ihren bärtig schweren Häuptern, und immer wieder, stumpfrot, mit silbergrauem Reif überflogen, die stärksten Tiere ihrer Art, Luchse aus Finnland und Skandinavien. Starkknochige Branten, schimmernde Raubkatzengebisse, hohe Läufe, Stummelschwanz und Pinselohren, sich sträubende Bärte und glasklar grelle Augen, brennend im unbesiegbaren Hass und strahlend in einer mörderischen Klugheit. Ich meine, es ist diese Klugheit gewesen, die ich in den Luchsaugen las, neben der trotzigen und unzähmbaren Wildheit, die mich wie magisch zu den Tieren gezogen hat. Eine Klugheit, die von ganz anderer Art war als die menschliche, als die Barinjas, unserer großen Elefantin, unseres Chans, des Mandschu-Tigers, ganz anders als die Klugheit Tanjas, der zärtlichen Schneeleopardin. Es war die Klugheit des Geschöpfes, das wild ist, wild und nichts anderes. Noch wissen wir nichts von solcher Klugheit und daher auch nichts von diesen Tieren.
Sie blieben wild, alle diese vielen Luchse, so große Mühe ich mir auch mit ihnen gegeben habe. Ich opferte ihnen alle meine Zeit, alle Hingabe, zu der nur die Jugend fähig ist, alle meine Künste, die ich gelernt hatte im Umgang mit schwierigen und nicht ungefährlichen Tieren. Im Winter ließ ich einen Sonderbau aufschlagen, nur für die Luchse bestimmt. Ich ließ sie einzeln in einen großen Käfig, ich gesellte mich zu ihnen, es brauchte Wochen, ehe sie mich in diesem Käfig duldeten, Monate, ehe sie aus meinen Händen ihr Futter nahmen. Und sie beugten sich nie, bei meiner ersten Bewegung, bei meiner ersten Forderung standen sie mir gegenüber, schlagbereit die Pranke gelüftet und zeigten mir ihr teuflisch zorniges Gesicht: gesträubter Bart, gleißende Fangzähne und ungebrochen trotzige Augen! Herrliche Tiere, wunderbare Tiere, ich bin noch heute in sie vernarrt! Und heute wie damals in meinen jungen Jahren bin ich der Überzeugung, dass jedes Tier zähmbar ist, man muss sich nur einstellen können auf dieses Tier, man muss den einen, ganz besonderen Zugang finden. Aber damals suchte ich diesen Zugang durch Jahre vergeblich, diese ausgewachsenen Tiere spotteten aller Bemühungen. Ich hätte es gern mit Jungtieren versucht, aber wir bekamen keine durch den Handel, und die Nachzucht in unserer Menagerie wollte mir nicht recht glücken. Und so lebte ich also weiter durch die Jahre, lebte im Paradies und lebte als unglücklich Liebender.
Viele Menschen gingen durch den Wanderwagen meines Vaters. Nicht Menschen aus dem Publikum, sondern Leute vom Fach, sie kamen aus aller Welt, aus den Ländern Europas und Asiens, sogar ein amerikanisches Ehepaar lernte ich kennen, sie dressierten Bären und kauften von meinem Vater. Er handelte und vermittelte Kauf und Tausch, so kamen vor allen Dingen Tieraufkäufer zu ihm, Menagerieleute, Zirkusdirektoren, Artisten, Dresseure und Dompteure. Je älter ich wurde, umso öfter wurde ich nach der letzten Vorstellung in Vaters Wohnwagen gerufen, dort saß ich mit den Besuchern zusammen, sprach mit ihnen, und sie erzählten mir von der Welt, von der ich nichts wusste. Bis dahin war mir diese Welt auch nicht sonderlich interessant gewesen, nur ungern verließ ich den schützenden Zaun unserer Menagerie. Ich mochte die Städte nicht, nicht die Ödnis der steinernen Straßen, die bunten Fenster der Geschäfte, die doch zumeist nur unnützen und sündteuren Tand handelten, ich fürchtete mich vor den Menschen, die sich im ununterbrochenen Zug durch die Straßen schoben und drängten. Ich lebte mit meinen Tieren, ich war in manchen Dingen geworden wie sie, eine unvermutete menschliche Berührung war mir wie ein schreckliches Signal, das schneidend meinen Körper durchfuhr, ihn sich straffen ließ in Abwehr und Kampfbereitschaft – ja, ich war wohl für das Leben unter den Menschen der großen Städte schon damals verloren.
Was diese Fremden nun aber erzählten, das füllte doch meinen Kopf und ließ bisweilen mein Herz schneller schlagen. Von wandernden Zeltstädten, die sechshundert, achthundert, tausend Tiere mit sich führten, ganze Elefantenherden, Hunderte von Raubtieren, Marställe aller edlen Pferderassen. Von großen Spielzelten, die sechstausend, achttausend Menschen fassten, von großen exotischen Artistengruppen auf dem gelben Sand der Manege, von niegeahnten, niegedachten Tierdressuren. Von Dompteuren, die gleich Königen durch alle Länder dieser Erde fuhren, hochbezahlt, weltberühmt, und, was mir wichtiger war, von ihrer Arbeit, von ihren neuen oder sensationellen Tricks mit Löwen und Tigern und Bären. Und heimlich durfte ich dann bei mir denken, dass ich in meiner Stille ebenso gute, ebenso schwierige Arbeit leistete wie diese Männer und Frauen mit den großen Namen, denen die Welt zu Füßen lag. Und immer wieder die Schilderungen der großen Zelte, der festen Bauten in Wien und Berlin, in London und Paris, in Hamburg und in San Franzisko. Samtene Logen, hoch und weit sich schwingendes Gestühl, Musikkapellen in Frack und weißer Binde, seidene Kostüme, blitzender Schmuck und Fluten elektrischen Lichtes über allem, über Publikum und Manege – besser, schöner, großartiger noch als in irgendeinem Theater.
Ja, diese Schilderungen schlichen sich nun in meine Träume und bestimmten sie mitunter. Vielleicht, bevor man in die große Einsamkeit des Landes Sibir zog, vielleicht lohnte es sich doch, vorher durch diese reiche, bunte, sich in den Fluten elektrischen Lichtes badende Welt zu ziehen, durch die großen Manegen dieser Erde, mit einem Löwenvolk, mit einem Tigerrudel über die Varietébühnen, auf denen man das Niegeahnte, das bis dahin unmöglich Gewesene zeigte – dressierte finnische Luchse!
Ja, nun träumte ich zwei Träume in meinen einsamen Nächten, den von der großen Einsamkeit in den Winterwäldern und den vom festlichen Siegeszug durch die Theater und Zirkusse dieser Welt. Aber wenn dieser zweite Traum zu stark wurde, holte ich mir am anderen Morgen ein Pferd aus dem Stall, sattelte es und ritt bis zum Mittag durch die Steppe, dann wusste ich wieder, dass ich niemals freiwillig meine Tiere verlassen würde, Väterchen, das sich unendlich breitende russische Reich, meines Herzens große Heimat.
So gingen die Jahre meiner Jugend dahin, heute weiß ich, dass sie die glücklichste Zeit meines Lebens gewesen sind – unter der Hand meines Vaters, der alle wirklichen Sorgen von mir fernhielt, mit meinen Tieren, den Tigern und Löwen, den Bären und Wölfen und auch mit den unzähmbaren Luchsen. Ja, auch und gerade mit den Luchsen, selbst mit den Frauen und Mädchen, denen ich nachts den Zaun öffnete – mit allem, ach, mit allem …
Sie gingen dahin, diese Jahre, und ich merkte kaum, wie sich die Welt verfinsterte. Es war Krieg, aber ich blieb unter der Hand meines Vaters. Wie er das gemacht hat, weiß ich heute noch nicht, aber ich blieb vom ersten bis zum letzten Tag unbelästigt von allen Uniformierten. Nur mit den nun immerfort wechselnden Stallburschen hatte man seinen Ärger, und man konnte nicht mehr so frei reisen wie zuvor, weil zumeist die Bahnen blockiert waren vom Militär. Aber als dann dieser Krieg zu Ende war, brach die Hölle über uns herein – ach, was sage ich, die Hölle, hundert Höllen waren es, sie rangen miteinander, sie durchdrangen sich oder lösten sich ab im tosenden Wechsel …
Was damals geschah – Zusammenbruch des Zarenreiches, das morsch und zerfault war bis ins innerste Mark, Recken des Volkes, das die Morgenröte lang erträumter Freiheit aufsteigen sah über den Bergen, dann kamen versprengte Freischärler mit Knuten und Maschinengewehren und stellten durch Massenhinrichtungen die Ordnung wieder her. Und dann toste es über uns weg im ständigen Wechsel, und nur das blieb sich gleich, dass jede Truppe, die uns besetzte, vorgab, uns befreien zu wollen, und die Massenhinrichtungen blieben sich gleich, und die Häuser, die durch die Nacht brannten wie die Fackeln, und die verröchelnden Schreie der Frauen, die um Gnade, die um Menschlichkeit flehten. Tartaren und Moslems, Armenier und Türken – sie kamen in Flut und gingen in Ebbe und kamen wiederum geflutet und ebbten abermals zurück, sie errichteten Reiche und Republiken in unserem Land, und da war die Föderative Republik von Transkaukasien und war später der Kaspische Zentralrat, und beide konnten sich nicht halten, da war der Krieg mit den Armeniern, da war eine türkische, eine englische Besetzung, und dann wieder ergossen sich Truppen in allen Uniformen des westlichen Europas über uns – Herr, ich kann es noch heute nicht in guter Ordnung erzählen, die Mörser stampften das Korn, ich wurde aus dem Tiegel gestoßen.
Da war an einem Nachmittag plötzlich ein Kerl in unserem Zelt, angetan mit dem lang schlampenden Mantel einer fremden Uniform, eine Binde am Arm, deren Farben ich noch nie gesehen hatte, und stoppelbärtig wie ein Vagabund. Er marschierte mit unsicheren Schritten – besoffen war das Schwein! – bis zur Mitte der Menagerie, nahm das Gewehr von seiner Schulter, stellte den Kolben auf die Erde und stützte beide Hände über die Mündung. Er sah sich herausfordernd um, dann begann er zu brüllen wie ein kranker Stier, und er glaubte wohl, unsere Sprache zu sprechen, aber beim ersten Wort wussten wir, dass er kein Sohn unseres Landes war. Ein Hergelaufener, ein Standstörzer, ein Landsknecht, dem es gleich war, wer ihm den Sold zahlte, wenn er nur zu fressen hatte, zu saufen, Männer zu erschlagen und Weiber zu schänden. Draußen vor den Mauern knatterten die Salven der Hinrichtungen, in der Stadt schrien die Frauen – der hier wollte ein bisschen morden nach eigenem Gelüst. Er schrie uns an, er beschimpfte uns, der Strolch erklärte uns für faule Lumpen, wir sollten arbeiten in den Fabriken, Waffen schmieden für die glorreiche Armee, der er angehörte, und die Tiere, so verkündete er, waren überflüssige Fresser, die Tiere würden erschossen, und zwar sogleich und von ihm. Und nahm das Gewehr hoch und zielte auf den Tiger Chan, dem er gegenüberstand und der ihn ansah mit den tieftraurig klugen Augen, welche die Tiger immer dann haben, wenn sie hinter den Gittern liegen und träumen.
Ich stand ein paar Schritte dem Mann zur Seite und hatte einen langen eisernen Kratzer in der Hand, denn in diesen Jahren des Leutemangels hatte ich mich längst wieder daran gewöhnt, bei der Reinigung der Käfige mitzuarbeiten. Ich schwang diese lange Stange und schlug, über den Gewehrlauf weg, das Eisen dem Mann quer durch das Gesicht – ich glaube nicht, dass er noch viel geschossen hat in seinem späteren Leben. Er stürzte nach hinten über, er wälzte sich und schrie wie ein Verdammter, dieser Unwissende, dieser Gottlose, der Tiere hinter ihren Gittern ermorden wollte.
Und dann war ein großes Lärmen und Geschrei, viele Männer stürzten herein, fremde, nie gesehene Uniformen, verschlampte Zivilanzüge mit den fremden Binden am Ärmel, sie rissen ihre Flinten vom Rücken, aber nun waren auch unsere Leute herbeigekommen, es gab Worte und Widerworte, Reden und Gezänk und hier und da auch Handgreiflichkeiten, und ich wog meinen Kratzer in der Hand und wusste nicht recht, ob ich dreinschlagen oder ob ich besser Chan, den Mandschu-Tiger, aus seinem Käfig lassen sollte, denn er stand nun gereckt und sah sehr interessiert auf die schreienden Eindringlinge, und ich wusste gut, dass er mir helfen würde, sie aus dem Zelt zu jagen.
Aber dann wurde ich plötzlich von hinten ergriffen, die Arme wurden mir an den Leib gepresst, das Eisen entfiel meinen Händen, ich wurde aufgehoben und davongetragen. Wild wollte ich mich zur Wehr setzen, aber dann hörte ich eine bekannte Stimme und fühlte, dass es mein Vater war, der mich ergriffen hatte. Trotzdem zappelte ich nach Kräften, ich wollte frei sein und den fremden Lumpen an den Hals gehen, sie hatten Gewehre, sie konnten unsere Tiere erschießen – aber Väterchen ließ mich nicht und trug mich davon. Dann riss er eine Wagentür auf und warf mich hinein. Es war das Abteil der alten Warja, unserer Köchin. Er zwang mich zu Boden und schob mich tief unter das Gestell, in dem ihr Strohsack lag. Und wie er den Wagen verließ, kam sie schon selbst, dick und schnaufend, ich sah, dass sie sich die Kleider vom Leibe riss, dann warf sie sich auf den Strohsack, dass eine Wolke von Staub mich überrieselte, zog die Decke über sich und begann zu klagen, zu jammern und zu weinen, wie wenn sie am Sterben sei. Und ich hatte begriffen und lag still. Draußen hörte ich das Lärmen, es ebbte ab und schwoll wieder an, es kam näher und verlor sich wieder. Einige Male wurde die Tür aufgerissen, Männer schauten herein, Warja wehklagte und weinte, ich hörte die Stimme meines Vaters, der von Warjas Krankheit erzählte, und dann flog die Tür wieder in das Schloss. Und abermals Lärm und Geschrei, sie suchten mich, und ich wusste, sie hätten mich getötet, weil ich einen der ihren am Mord gehindert hatte. Und der Lärm schwoll ab, ich lag und lauschte, aber es fiel kein Schuss, sie ließen unsere Tiere in Frieden. Und dann hörte ich sie nahe in Väterchens Wagen lärmen, ich hörte, dass sie seinen Wodka tranken und ihm nach geraumer Zeit den ungeratenen, entsprungenen Sohn verziehen.
Und ich lag und merkte, dass ich mir die Hand zerbissen hatte in ohnmächtiger Wut und vielleicht auch in der Hilflosigkeit meiner Furcht. Ich hatte einen Lumpen geschlagen, einen Fremden, der wie ein Mörder hauste in meinem Land, weniger wert als ein hungertoller Hund, und nun war ich ein Abrek, wie man im Kaukasus die Männer nennt, die sich gegen die nicht von Gott gewollte Obrigkeit erhoben haben und in die Berge, die Wälder, in das Gesetzlose flüchten müssen. Fremde Uniformen in unserem Land, und ich war für sie ein Verbrecher, den sie suchten, um ihn an die Wand zu stellen. Dann weinte ich in meiner Verzweiflung, und es waren echte Tränen, die ich weinte, während Warja über mir stöhnte und ächzte wie eine Bäuerin beim Zahnarzt, und ich nahebei die trinkenden Männer lärmen hörte in ihrer harten Sprache und Väterchen, der ihnen versicherte, dass er schon immer auf sie und ihren Sieg gewartet habe, und der die goldenen Zeiten pries, die nun für alle Russen unter diesem Regime anbrechen mussten. Immer schon war er für sie gewesen und nur für sie und hatte heimlich geworben für das von ihnen aufzurichtende Regime, tschort wosomir, hol das der Teufel, und wenn sie seine gute Gesinnung nicht aus seinem Wodka herausschmecken konnten, dann möge der Teufel ihre Großmütter und übers Kreuz dazu …
Und dann muss es wohl stärker gewesen sein als ich und mich übermannt haben. Als ich unter einem festen Griff, der meinen Arm packte und mich unter dem Bett hervorzog, erwachte, war es tiefe Nacht, unsere Menagerie lag im Schweigen, fern dröhnte die langgezogene Salve einer Hinrichtung, nah in der Stadt flackerten einzelne Schüsse. Mein Vater umschlang mich und presste mich an seine Brust, ach, war er stark, Medwjet, der Bär … Sein Bart umfloss mein Gesicht, seine Tränen rannen über meine Stirn. »Söhnchen!«, weinte er. »Söhnchen Wladimir, Bemitleidenswürdiger! Nun bist du ein Wornaki, ein Rostoiniki – hättest du doch nicht gleich mit dem Eisen geschlagen, Dummkopf, Lieber, hättest du doch zuerst dem Towarischtsch die Wodkaflasche unter die Nase gehalten! Söhnchen, armes, liebes, gutes, dummes!« Die alte Warja war verschwunden, wir hielten uns, wir weinten, mein gutes Väterchen und ich.
Dann stieß er mich von sich, holte aus seinen Taschen dicke Packen Banknoten und stopfte sie in meine Taschen. Drei Briefumschläge musste ich an meiner Brust bergen, sie trugen gedruckte Firmennamen, wenn ich das Ausland erreichte, sollte ich mich dort melden und sagen, wer ich war. Und dann riss er einen vollgepfropften und ganz neuen Seesack heran, alle meine Sachen, die er hatte erreichen können, waren darin – Hemden und Hosen, Strümpfe und Jacken, Stiefel und Socken, Taschentücher, Schals und Mützen, selbst die paar Händevoll Bücher, von denen er wusste, dass ich sie gernhatte. Ich musste mich mit dem Sack beladen, er nahm mich beim Arm, er führte mich fort, ich ging mit ihm wie ein Betäubter. Dunkle Straßen, einmal schrie nahe eine Frau, der man Gewalt antat, einmal fiel ein Schuss, einmal rutschte mein Schuh durch eine fette Lache, die auf dem Pflaster stand – und die Lache war Blut.
Und dann ein offener Blick, verhängter Himmel, das Plätschern von Wellen an steinerner Wand, ein paar Laternen, die in all der Finsternis brannten, ihr Licht spielte trübe und fett über das schwarze Wasser. Dunkle Schatten, ein Mann, dessen mächtiger Brustkasten in einem dicken blauen Troyer steckte, der uns entgegentrat und mir wortlos den Seesack abnahm. Väterchen schob mich ihm nach. Eine schwankende Laufplanke, ein dunkel kauerndes Schiff dahinter, als ich das Deck betrat, tauchten überall Männer auf, bewegten sich leise und schnell, die Planke wurde eingezogen, Taue losgeworfen, ich hörte das gedämpfte Tuckern eines Motors – ich erwachte, ich stürzte an die Reling zurück, da war schon ein breiter Wasserstreifen zwischen der Schiffswand und dem Ponton, wurde breiter und breiter mit jedem Herzschlag. Und drüben, auf dem Kai, unter einer Laterne, stand, merkwürdig in sich zusammengesackt, eine bärenhafte Gestalt und wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. Mein Vater – und wegen einem fremden Strolch musste ich ihn allein lassen und war nun selbst für alle Zeit allein.
Ich habe ihn niemals wiedergesehen, ihn nicht, nicht meine Tiere, nicht meine gute Jugend, die in jener Nacht mit den Lichtern am Kai im Schwarzen Meer versank. Viele Jahre später, es war in Hollywood, ich nahm an den Aufnahmen teil, weil ich einen Panther abgerichtet hatte, den die Diva, die eine indische Rebellenfürstin zu spielen hatte, an der Kette führte, trat in einer Pause zwischen den Aufnahmen ein als rotröckiger britischer General verkleideter Komparse an mich heran und nannte zögernd meinen Vatersnamen. Er hatte ihn auf irgendeiner Liste gelesen, und der Name hatte ihn an eine Begegnung erinnert, die er Jahre nach meiner Flucht in Krasnojarsk gehabt hatte. Eine Begegnung mit meinem Vater, der ihm, dem Flüchtigen, mit einer achtlos aus der Rocktasche hervorgehalten Handvoll Geldscheinen entscheidend geholfen hatte. Im Herzen von Sibirien hatte er Babuschka getroffen, vor seinen Wohnwagen waren Pferde gespannt, und in einem zweiten Wagen führte er drei Bären und vier Wölfe mit sich, kein Mensch war bei ihm gewesen. Und auf eine Frage nach dem Ziel seiner Reise hatte er nur vage in das Wilde und Weite gewiesen und nicht ein Wort dazu gesprochen.
Und seit jener Nacht zerfloss mir das Bild meines Vaters, wie er einsam unter der trüben Laterne steht und sich mit dem Rockärmel über die nassen Augen wischt – jetzt sehe ich ihn durch das Land Sibir ziehen, schwer stampft er neben seinen Pferden dahin, und von Zeit zu Zeit tröstet er seine Bären und Wölfe mit Zuckerstückchen und guten Worten, dass sie nun bald am Ziel seien.
So lebt er für mich noch heute, und so sehe ich ihn: Da schreitet er schwer durch das Land Sibir, eine Sintflut, die er nie begriff, hat ihm seine Arche Noah zerschlagen – da geht er mit ihrem kläglichen Rest und rettet ihn und sich vor den Menschen.
Manchmal denke ich, er lebt noch heute und lebt die Träume meiner Kindheit. Dann sehe ich ihn in einer winzig kleinen Hütte unter den Schneestürmen seines gelobten und geliebten Landes Sibir. Der Wind faucht um die Baumstämme, aus denen er sein letztes Obdach errichtet hat, im vereisten Wald schreien die Luchse, er aber sitzt am prasselnden Holzfeuer und nahe ihm ist das behagliche Blasen und Schnauben der Bären im trägen Winterschlaf. Und um die Hütte, Wachtposten gleich, Wachtposten der wilden Wälder, in die sich das beste Herz, das ich auf dieser Menschenerde weiß, geflüchtet, gerettet hat, um die Hütte streichen die Wölfe und schützen meinen Vater vor allen Menschen, mein gutes Väterchen, Babuschka Medwjet.
MAITRE LABORDE, BELLUAIRE
- 2 -
Fragen Sie mich, bitte, nicht nach dem Jahr, das nun folgte, Herr, es war die bitterste, die grausamste Zeit meines Lebens. Ich verließ in Trapezunt das Schiff, heimlich bei Nacht, wie ich an Bord gekommen war, ich lernte am ersten Tage, dass ich die vielen Banknoten mit den hohen Ziffern, die mein Vater mir in die Taschen gestopft hatte, auf die Straße werfen konnte, sie waren nichts wert. Ein paar Goldstücke nur, die in einer kleinen Pfeffertüte zwischen den großen Scheinen gelegen hatten, halfen mir etwas weiter. Nicht viel, wirklich nicht sonderlich viel – nach einigen Tagen nutzloser Bemühungen schulterte ich meinen Seesack und machte mich zu Fuß auf den Weg nach Süden. Natürlich bin ich dann doch nicht den ganzen Weg zu Fuß gegangen, es gab mal eine Gelegenheit, ein gutes Stück mit einem Lastwagen zu fahren, hundert Meilen bin ich mit einer Kamelkarawane gewandert, eine andere große Strecke mit Pferdehändlern – ach, hatten die Leute prachtvolle Tiere, Araber und Berber und persische Polo-Ponys! – so kam ich schließlich nach Alexandrette. Mein Seesack war recht leicht geworden auf dieser Reise, was man mir abgenommen hatte, hatte ich gegen Essen und Trinken getauscht. Ich lungerte einige Tage im Hafen herum, dann heuerte mich, einen Mann ohne Papiere, ein kleiner, verwahrloster Trampfrachter an, als Heizer. Es war die nackte Hölle, Eisen und Stahl und die Kohle fressenden Feuer, und Gefährten in diesem Inferno, die nichts als Verbrecher waren, Diebe und Mörder und Knabenschänder – aber ich kam bis Alexandria. Und von dort mit einem Schiff, das um nichts besser war als die schwimmende Hölle, die ich verlassen hatte, bis Tripolis. Und von dort gelang mir, wiederum als Heizer vor den Feuern, der große Sprung nach Alicante. Und dort, niemals werde ich erzählen, wie mir das gelungen ist, kam ich in den Besitz eines Seefahrtsbuches, eines goldrichtigen Dokumentes, auf meinen Namen ausgestellt und mit meiner Photographie geschmückt. Nur einen Schönheitsfehler hatte es, es gab auch meine Staatszugehörigkeit richtig an, ich war und blieb ein Russe. Trotzdem erleichterte es mir vieles, ich kam, immer als Heizer, ich war verdammt dazu, mir vor den Kesseln das Mark aus den Knochen zu schinden und zu schwitzen, ich kam nach Lissabon– ich kam, nun begann hier schon der neue Winter, nach Saint Nazaire, das war mein Ziel gewesen von Anfang an, dafür hatte ich alle Höllen in Kauf genommen, dafür auch hatte ich auf meiner langen Fahrt so viel von der französischen Sprache gelernt, wie mir nur möglich war.
Als ich dann in Saint Nazaire an Land ging, sprach ich das Französische schon halbwegs ausreichend, aber mein Seesack war fast leer, und ich war nicht mehr als ein sehr heruntergekommener Beachcomber. Jedoch hatte ich etwas Geld in der Tasche, denn, seitdem ich ein Seefahrtsbuch hatte, war mir meine Heuer richtig ausgezahlt worden, was dem namenlosen, ausweislosen Tramp keineswegs widerfahren war. Also kleidete ich mich neu ein, sehr billig und sehr gut, denn in Saint Nazaire wurden große Bestände amerikanischen Heereseigentums veräußert, verschleudert, verschenkt, was weiß ich, die Franzosen wollten nichts davon, nichts, was nach Uniform roch. Ich aber kroch zum ersten Male in meinem Leben in westliche Kleider: Khakihemden, Flanellhemden, Gabardinehosen– ach, ich weiß noch, als ich in den guten amerikanischen Offiziers-Trenchcoat schlüpfte. Gabardine, Plaidfutter und dazwischen eine eingearbeitete Ölhaut, da zog ich wirklich einen neuen Menschen an. Auch mein Seesack füllte sich wieder etwas auf, und dann blieb mir noch, nach einem ausschweifenden Bad und nach einer langen Sitzung bei einem bestürzend schnell und gut arbeitenden Friseur, Geld genug, zum Bahnhof zu gehen, eine Fahrkarte zu lösen, über Nantes, Angers und Tours nach Blois zu fahren.
In der Brusttasche meines neuen Flanellhemdes knisterten die drei Briefumschläge, die mir mein Vater anvertraut hatte. Der Firmenaufdruck des einen nannte eine Adresse in Blois. Ohne viel fragen zu müssen, fand ich die Straße, fand ich das Haus und las auf dem glänzend geputzten Schild der Haustür den gesuchten Namen: »Pierre Laborde, Belluair.«
Das Haus stand ziemlich frei in einer noch nicht recht ausgebauten Straße, links und rechts zog sich, wohl je an hundert Meter lang und gute drei Meter hoch, eine weißgetünchte Mauer. Es gab auch ein großes Tor, das in den solcherart gesicherten Hof führte, aber es war fest verschlossen, und mein Klopfen und Hämmern und Rufen blieb unbeantwortet. Aber während ich noch unschlüssig stand, denn es schien mir besser, durch dieses Tor einzutreten, wer war ich, dass sich mir die Tür eines Hauses öffnen sollte, da hörte ich eine Antwort, und es waren die Stimmen wilder Tiere: ein wölfisches Jaulen, Bären brummten, Affen kreischten, dunkel donnerte ein unzufriedener Löwe. Und da fiel das Jahr der Wanderung von mir ab, Fremde und Ferne, die Hölle hinter den Heizkesseln und die andere Hölle, das Logis im Schiff mit den rohen und gemeinen Männern von den Trampschiffen der Levantelinien – ich eilte zu der Haustür und drückte eilig und furchtlos auf den weißen Knopf über dem blanken Schild: Hier war ich doch zu Haus, endlich wieder zu Haus.
Die Tür wurde geöffnet, ein junges Mädchen, schwarzes Kleid, weißes Schürzchen, ließ mich ein und führte mich in ein Zimmer, das für mich ein Salon war. Nach kurzer Zeit trat eine Dame ein, etwas klein, etwas füllig, sie schien mir sehr gepflegt und überaus elegant, duftend und onduliert, ich glaubte, ganz leidlich französisch sprechen zu können, aber dann kapitulierte ich doch rasch vor ihren schnellen Worten und streckte ihr schließlich nur erschöpft den Briefumschlag hin, der an meinen Vater adressiert war und den Firmenaufdruck ihres Mannes trug. Sie fragte noch mancherlei, ich merkte die wachsende, echte menschliche Anteilnahme heraus, aber nun konnte ich nur noch mit »Mais non, madame!« oder mit »Oui, oui!« antworten – da lud sie mich zum Sitzen ein und verließ mich.
Ich setzte mich nicht. In der Stube war ein großer Spiegel, in dem ich mich in meiner ganzen Größe sehen konnte. Ein junger Mann im guten Trenchcoat, Gabardinehosen, Flanellhemd, einfarbiger Binder und bunter Schal. Verstört nahm ich die baskische Mütze vom frisch geschnittenen Haar, das aufdringlich nach Friseur roch, das hätte ich schon früher tun müssen, fiel mir ein, aber sie war so leicht, diese Mütze, dass ich sie ganz vergessen hatte. Neben mir stand der Seesack, er war blitzneu gewesen, als mein Vater ihn mir geschenkt hatte, er sah noch immer blank und sauber aus, und sein Inhalt war nicht allzu ärmlich. Ich stand und sah mich an, ich wusste gut, dass das alte Leben neben Babuschka zu Ende war für alle Zeit, ich wusste, dass mir die Flucht gelungen war, weil ich alle Höllen durchgestanden und nicht kapituliert hatte. Aber noch wusste ich nicht, was jetzt kommen, was mit diesem Tage nun für mich beginnen würde. Vielleicht stand ich in zehn Minuten wieder auf der Straße, fremd im Land, meinen Seesack am Arm und nicht mehr das Geld für ein Abendessen, für ein Nachtlager in der Tasche. Doch dann lächelte ich mir selbst im Spiegel Mut zu. Hatte ich nicht da draußen die Wölfe gehört, die Bären, den übellaunigen Löwen – wer wohl konnte mich in diesem friedlichen Land von den wilden Tieren reißen, wie mir das in Russland geschehen war? Ich war doch am Ziel, ich gehörte doch hierher, hierher zu den wilden Tieren – der Fehler war nur, dass man mich nicht durch das Stalltor eingelassen hatte. Aber da wurde schon die Tür aufgestoßen, und Monsieur Laborde, gefolgt von seiner Frau, trat, nein, sprang in das Zimmer.
Monsieur Laborde war wesentlich kleiner und schmaler als ich, er trug im blankschwarzen Haar den schärfsten Scheitel, den ich jemals gesehen hatte, große, schwarze, nüchtern-kluge Augen, Hakennase, ein sehr gepflegter Henriquatre über Lippen und Kinn. Er stak in einem rot und grün karierten Hemd, Breeches und hohen Stiefeln mit Gummisohlen, vom rechten Handgelenk hing ihm am Riemen die kurze Dressurpeitsche herab, er war, von seiner Frau gerufen, geradenwegs aus dem Dressurkäfig herausgelaufen, er kam direkt von den Tieren, von den Tieren zu mir. Um ihn war der Ruch, den ich kannte, allzu gut kannte, in dem ich aufgewachsen war, der Ruch nach den Tieren, nach der Menagerie – am liebsten hätte ich diesen fremden Mann umarmt, meinen Kopf an seine Brust gelegt und geweint. Mich würgte es in der Kehle, mir war so schwach in den Knien, dass ich zitterte.
Aber natürlich umarmte ich Monsieur Laborde nicht – er sah mich nur einmal an, er sah wohl mit diesem einen Blick, wie es um mich stand, dann machte er zwei schnelle Schritte auf mich zu und schloss mich in seine Arme. »Pauvre garon!«, sagte er nur, er wusste schon alles von mir, und nun weinte ich doch.