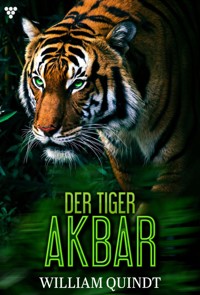30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Götter und Gaukler
- Sprache: Deutsch
Zauber der Fabulierkunst, die immer am Leben orientiert bleibt! Ein lebensbejahender Roman, voller Spannung und Abenteuer. Dramatische Geschehnisse im indischen Dschungelbereich, im Bungalow des deutschen Tierparkdirektors und Forstmeisters, der im Dienst eines indischen Fürsten steht, wechseln mit meditativer Weisheit. Der Autor vom »Tiger Akbar« setzt in diesem schicksalsträchtigen Roman den Lebenslauf der Menschen fort, die darin Hauptrollen spielen, und neue Menschen erweitern den Kreis. Immer sind es Vollblutmenschen, im Mittelpunkt die eigenwillige Diana, Tiere, leidende und raublüsterne Mitgeschöpfe, manchmal wehrhafte Jagdbeute der Menschen, manchmal kluge und hilfreiche Gefährten. Sie alle gehören zum farbglühenden Setting dieses Romans, dessen Handlung schließlich zurückschwingt zum ruhenden Pol in norddeutscher Heide. Zwei Menschen, ruhelos und enttäuscht – eine Schriftsteller-Journalistin und ein Maler – flüchten aus der lauten Welt in die Stille, suchen eine Heimat, bauen an einem neuen Zuhause. Die Geschichte des Knaben Peter Petersen hob einstmals an im Duft der Syringen, hob an im leidenschaftlichen Aufruhr gegen die kleinbürgerlich strengen Gesetze, die sein Leben bestimmten und seine Sehnsüchte fruchtlos verdorren ließen. Die Geschichte des Knaben begann mit der Empörung seines hungernden Herzens, das ihn davontrieb aus den abgesteckten und quälend eingeengten Bezirken seiner Bestimmung, das ihn trieb, den dunklen Melodien seines Blutes zu lauschen und ihnen nachzuziehen bis hinter die fern verblauenden Horizonte. Es ist ein leichtes und verführerisches Ding, zu berichten von Sehnsucht und Unruhe der Jugend, von ihrem Suchen und Finden, von Glück und – Irregang, von ihrer wild blühenden Lust und auch von der Tragik, die ihre heißen Herzen mit brennenden Wunden zeichnet – es ist ein ander Ding, auszusagen von der Seele des Mannes. Von der Seele eines Mannes, der seinen eigenen Weg geht durch diese bunte und vielfach fordernde Welt, der den Mut zu sich selbst hat und zu einem Leben unter eigenem Gesetz. Peter Petersen hat die große Freiheit gefunden, die nicht äußerlich klebt an einem Menschen wie ein gefälliges, farbig lockendes Kleid, sondern die in seiner Brust erwächst und ihn sich abkehren lässt von allen Dingen, die dem Bürger wert und teuer sind. Peter Petersen ist verfallen dem unsagbaren Zauber der wilden Welt, ist verfallen der Schönheit und dem Adel der freien, starken, räuberischen Tiere – und Peter Petersen ist ein Mann geworden, denn sein Herz trägt die schwere, niemals sich schließende Wunde, den Schmerz um Daphne Dennys, das Wälderkind, die ihn einst tief hinein in das Herz der Wildnis führte, und die an ihm starb und daran, dass sie einmal von den Gesetzen ihres abseitigen Pfades wich. Peter Petersen ist ein Mann geworden, er ist still und verschlossen, er ist hart und herrisch nach außen, aber immer noch wohnen in seinem Herzen die Sehnsüchte der Jugend, und sein Herz fühlt bisweilen die große Leere und horcht in sich selbst hinein und fragt verzweifelt: »Warum – warum?« Er ist ein Mann, und bei aller äußerlichen Fülle ist sein Leben leer geworden, er hat sich mit Arbeit und Madame Fernande beschieden, weil der tiefste Traum seines Lebens sich nicht erfüllte: Daphne Dennys starb, und der Tiger Akbar zieht ferne, fremde Pfade.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Inhalt
Das Kind - Welkender Jasmin
Der Einsame
Märchen und Sterne
Menschen und Tiere
Die Elefanten
Der wilde Wald
Haus im Regen
Die fremden Gesetze
Melodien der Nächte
Ein Mann stirbt
Das Mädchen - Der flügellahme Falke
Daphnes Wiederkehr
Der Weg nach unten
Ein Mädchen allein
Mauern der Städte
Daheim am Dschungel
Die grosse Jagd
Schrei aus dem Walde
Schiff auf dem Meer
Die Frau - Die weißen Länder
Die Wege der Mutter
Das rollende Rad
Der Sturmwind
Die Wunde am Menschen
Das müde Herz
Der Wind und die Wälder
Treibholz
Bote des Ewigen
Götter und Gaukler – 1 –
Eine dramatische Geschichte im indischen Dschungel
William Quindt
Inhalt
- 1 -
Zauber der Fabulierkunst, die immer am Leben orientiert bleibt! Ein lebensbejahender Roman, voller Spannung und Abenteuer. Dramatische Geschehnisse im indischen Dschungelbereich, im Bungalow des deutschen Tierparkdirektors und Forstmeisters, der im Dienst eines indischen Fürsten steht, wechseln mit meditativer Weisheit. Der Autor vom »Tiger Akbar« setzt in diesem schicksalsträchtigen Roman den Lebenslauf der Menschen fort, die darin Hauptrollen spielen, und neue Menschen erweitern den Kreis. Immer sind es Vollblutmenschen, im Mittelpunkt die eigenwillige Diana, Tiere, leidende und raublüsterne Mitgeschöpfe, manchmal wehrhafte Jagdbeute der Menschen, manchmal kluge und hilfreiche Gefährten. Sie alle gehören zum farbglühenden Setting dieses Romans, dessen Handlung schließlich zurückschwingt zum ruhenden Pol in norddeutscher Heide. Zwei Menschen, ruhelos und enttäuscht – eine Schriftsteller-Journalistin und ein Maler – flüchten aus der lauten Welt in die Stille, suchen eine Heimat, bauen an einem neuen Zuhause.
William Quindt hat mit diesem Roman sein größtes, sein reichstes und reifstes Werk geschaffen. Auch von ihm gilt, was von seinem Vorläufer, dem Roman zwischen Mensch und Tier »Der Tiger Akbar« gesagt worden ist: »Ein Tierbuch, das Menschen und Tier in sonst kaum je gesehenen Relationen zeigt. Ein glitzernd buntes Reisebuch, ein spannender Gesellschaftsroman – es ist schon eine große, vielseitige, bewundernswerte Kunst, die in diesen Seiten steckt.«
Das Kind - Welkender Jasmin
- 2 -
Die Geschichte des Knaben Peter Petersen hob einstmals an im Duft der Syringen, hob an im leidenschaftlichen Aufruhr gegen die kleinbürgerlich strengen Gesetze, die sein Leben bestimmten und seine Sehnsüchte fruchtlos verdorren ließen. Die Geschichte des Knaben begann mit der Empörung seines hungernden Herzens, das ihn davontrieb aus den abgesteckten und quälend eingeengten Bezirken seiner Bestimmung, das ihn trieb, den dunklen Melodien seines Blutes zu lauschen und ihnen nachzuziehen bis hinter die fern verblauenden Horizonte.
Es ist ein leichtes und verführerisches Ding, zu berichten von Sehnsucht und Unruhe der Jugend, von ihrem Suchen und Finden, von Glück und – Irregang, von ihrer wild blühenden Lust und auch von der Tragik, die ihre heißen Herzen mit brennenden Wunden zeichnet – es ist ein ander Ding, auszusagen von der Seele des Mannes.
Von der Seele eines Mannes, der seinen eigenen Weg geht durch diese bunte und vielfach fordernde Welt, der den Mut zu sich selbst hat und zu einem Leben unter eigenem Gesetz. Peter Petersen hat die große Freiheit gefunden, die nicht äußerlich klebt an einem Menschen wie ein gefälliges, farbig lockendes Kleid, sondern die in seiner Brust erwächst und ihn sich abkehren lässt von allen Dingen, die dem Bürger wert und teuer sind. Peter Petersen ist verfallen dem unsagbaren Zauber der wilden Welt, ist verfallen der Schönheit und dem Adel der freien, starken, räuberischen Tiere – und Peter Petersen ist ein Mann geworden, denn sein Herz trägt die schwere, niemals sich schließende Wunde, den Schmerz um Daphne Dennys, das Wälderkind, die ihn einst tief hinein in das Herz der Wildnis führte, und die an ihm starb und daran, dass sie einmal von den Gesetzen ihres abseitigen Pfades wich.
Peter Petersen ist ein Mann geworden, er ist still und verschlossen, er ist hart und herrisch nach außen, aber immer noch wohnen in seinem Herzen die Sehnsüchte der Jugend, und sein Herz fühlt bisweilen die große Leere und horcht in sich selbst hinein und fragt verzweifelt: »Warum – warum?« Er ist ein Mann, und bei aller äußerlichen Fülle ist sein Leben leer geworden, er hat sich mit Arbeit und Madame Fernande beschieden, weil der tiefste Traum seines Lebens sich nicht erfüllte: Daphne Dennys starb, und der Tiger Akbar zieht ferne, fremde Pfade.
Und so blüht in dieser Nacht an der Schwelle seines zweiten Lebens ihm nicht der sommerliche Flieder seiner fernen Heimat – die dunkle Nacht schwimmt im Duft, aber es ist der strenge, der bittere und traurige Duft des welkenden Jasmins.
Samtschwarz, samtweich liegt die Nacht über der Welt, über dem Lande zu Füßen der Götterberge, des Himalaja. Kein Mond mit sanftem Silberlicht, kein sprühender Sternenreigen, kein Wind auch, der durch die Bäume singt gleich einem zärtlichen Kind, das sich selbst in den Schlaf summt.
Wohl ist ein dünnes Surren in der toten, schwülen Träge der Tropennacht, aber das ist fremd und neu in diesem Lande, das hart am Rande der wilden Wälder liegt, es kommt aus der kleinen Kraftstation, die mit elektrischem Strom die Palaststadt des Radschas von Masherbara speist. Aus der Mitte des Parkes sprüht das solcherart gewonnene Licht in hellen, bunten Garben – wer wird sich wohl mit Innenbeleuchtung, mit Lampen, welche die Parkwege erleuchten, bescheiden, wenn es hundert lustige Möglichkeiten gibt, mit diesem Zauberlicht zu spielen und sich an ihm zu erfreuen? Und so schwimmt der nüchtern gelbe Sandsteinbau, den sich der Radscha bauen ließ, weil Nelly Sunday, die Amerikanerin, seine erste Frau, die vor Jahresfrist starb, es so wünschte, in dem grellen, flirrenden, huschenden und laufenden Licht eines europäischen Vergnügungslokals, einer Zirkusfassade, die nackte, stilisierte Nymphe auf dem Sims hält eine rote Fackel in der Hand und wölbt Leib und Brust wie in räkelnder Lust in das schwüle Licht. Der verdeckte Gang aber, der von der Rückwand des Schlosses zum zweiten, zum größeren Palast führt, zur Zenana, zum Frauenhaus, dieser Gang liegt im Dunkel, wie der Damenpalast selbst, der mit Erkern und Loggien bunt verschnörkelte Riesenkasten. Nelly Sunday starb, der Radscha hat sich von den merkwürdigen und oftmals schlechthin unbegreiflichen Bräuchen des Abendlandes rasch gelöst. Zwar hat er sich bis heute noch nicht wieder verheiratet, aber viel fröhliches Leben ist in der Zenana. Was sich jedoch hinter den vielen Fenstern mit den farbenfrohen Markisen verbirgt, das mögen nur die vielen alten Frauen wissen, die man dort ein- und ausgehen sieht. Sie aber schweigen mit ihrem stillen Lächeln, mit dem gleichen stillen Lächeln, das der Fürst jenen groben Europäern in die Augen lächelt, die ungezogen und tölpelhaft genug sind, ihn nach Frau und Kindern zu fragen.
Auch die Tempel schwimmen im Licht, das ihre wilden, zerrissenen Fassaden ausleuchtet bis in die geheimsten Falten, die nahen Elefantenhäuser jedoch liegen in sanfter Dunkelheit, und auch auf den Wegen des angrenzenden Tierparks, den sich der Fürst zu seiner Belustigung hält, brennen nur die notwendigen Lampen. Es ist recht spaßhaft, wie man sich mit diesem Licht die Nacht zum Tage machen kann, ja, der Mensch ist groß und gibt sich seine eigenen Gesetze, aber das Tier, Bruder Tier, untersteht dem alten, dem heiligen Gesetz der ewigen Gottheit – für das Tier soll Nacht sein, wenn die Götter es so wollen.
Sonst aber leuchtet das kaltglühende Licht in jedem der hundert Häuser im weiten Park, in den Wohnungen der würdigen Hofbeamten ebenso wie in den Hütten der Mahouts und der Shikaris und auch in den stark duftenden, teppichgepolsterten Kammern der Tempelmädchen.
Von der Veranda eines für europäische Bedürfnisse erbauten Bungalows springt das Licht starker Wandlampen gegen die samtene Schwärze der Nacht und lässt die Stämme der Tamarindenbäume silbern aufleuchten.
Ein Mann liegt im Langstuhl unter der Lampe, gegen die mit süchtig dünnem, bösem Surren eine Traube von Moskitos ankämpft. Neben ihm steht ein fahrbares Tischchen mit Whiskyflaschen und Sodasiphons, mit Zigarrenkisten und Zigarettendosen. Zwei Gläser warten gefüllt – vier Fünftel Whisky, ein Fünftel Soda, wie man das so trinkt in den Tropen als weißer Mann –, aber niemand trinkt aus ihnen. Der kleine, alte, vertrocknete Mann mit dem grauen starken, hängenden Husarenschnauzbart sieht still und ernst zu der schlanken, gespannten Figur des zweiten Mannes hinüber, der an der Verandabrüstung lehnt und gegen die verhängten Fenster eines nahen Bungalows starrt, hinter deren leuchtendem Weiß schwarze Schatten unruhig hin und her gleiten.
»Komm her, Peter!«, sagt der Alte endlich und streicht rechts und links über seinen dicken Schnurrbart. »Komm her, das ganze Gezappel hat doch keinen Sinn, trink lieber!«
Peter Petersen wendet sich nicht, er steht und starrt gegen die verhängten, leuchtenden Fenster. Dieser schmale Schatten eben – war es der Doktor, dieser lasche, phlegmatische Monsieur Beauville, dem er zutiefst misstraut, weil der von den Tropen zerbrochene Mann ihm verächtlich und widerlich ist, war es Missis Williamson, die dicke, rundliche Amerikanerin, deren endlosem und heftigem Redestrom er niemals gewachsen gewesen und immer entsprungen ist, war es die verlumpte, knochendürre Witwe des Shikaris, deren glatt geschorener Schädel über dem verfälteten geierscharfen Gesicht ihm ebenso lächerlich dünkt, wie ihm das ganze verschrumpelte Weiblein unheimlich ist? Wer war es – wer kann es gewesen sein? Ach, Fernande war es gewiss nicht. Arme Fernande, sie liegt im Bett, und keiner von den dreien dort kann ihr helfen, hilft ihr. Und auch er kann ihr nicht helfen, auch er nicht, Peter Petersen. Er ist nur schuld daran, dass sie sich jetzt so quälen muss, so entsetzlich leiden … Sie ist kein Mädchen mehr, sie ist eine reife Frau, sie verträgt die Tropen nicht sonderlich, er hat gewollt, dass sie nach Europa fahren sollte, aber sie weigerte sich, aus Bequemlichkeit, aus Gedankenlosigkeit hat er sie gewähren lassen – was aber geschieht jetzt mit ihr da drüben? Wie nur kann eine Frau das aushalten, wie nur in aller Welt? Und dieses Furchtbare, dieses Unfassliche, mit dem die Natur die süßen Verwirrungen der Liebe beantwortet, dieses Schaurige geschieht seit Jahrtausenden in der Welt stündlich, minütlich, bei Tag und bei Nacht … Ist diese Qual der Sinn der Liebe – oder ist die Liebe nichts als ein Lockmittelchen, ein Köder der großen Verführerin Natur, damit sie die Fruchtbarkeit erreicht, die sie braucht und will, die große Verschwenderin allen Lebens? Ja, so wird es sein – sie will das Leben, immer neues, drängendes, zeugendes, gebärendes Leben, wir Menschen mit all unseren großen Sehnsüchten und Einbildungen, wir sind nur tanzende Marionetten in ihrer Hand …
Er wendet sich nicht, er krampft beide Hände um das Holz der Verandaverkleidung, er sieht gegen den Schatten, der jetzt still hinter dem Fenster steht, es ist Beauville, monsieur le docteur, warum in aller Welt steht er so still und so gekrümmt? Peter Petersen stöhnt: »Lass mich, Charly, ich mag nicht, ich kann nicht, ich will nichts hören, ich will nichts sehen, ich fürchte, ich werde verrückt! So etwas überlebt kein Mensch, so etwas kann kein Mensch aushalten!«
»Ne ganze Menge haben es ausgehalten, ne ganze Menge werden es noch aushalten!«, sagt der alte Zigeuner mit stillem Lächeln. »Nicht nur einmal – zehnmal, und hinterher sind sie immer mächtig stolz auf ihre Leistung!«
Jetzt fährt Peter Petersen herum und schreit seinen Freund an mit verzerrtem Gesicht: »Stolz – stolz auf dieses, auf das da? Ein Mann – wir Männer? Ein lächerlicher Hanswurst, der sich bei diesem etwas auf seine Person einbildet! Charly, gestern Abend hat es angefangen mit Fernande, die Nacht hindurch ist es gegangen, den Tag, und nun ist es schon wieder spät in der Nacht. Und ich bin bei ihr gesessen, bis jetzt, bis vor einer Stunde, da habe ich es nicht mehr ausgehalten, bin davongelaufen, zu dir, Charly! – Wie sie sich quält, wie sie geworfen wird von den Wehen, wie sie schreit, Charly! Und dieses Vieh, dieser Beauville, der weiß nichts anderes zu sagen als: ›Madame war Artistin, wir werden schneiden müssen, das kommt oft vor, Verlagerungen, Sie verstehen, Monsieur, der Beruf! Aber Missis Petersen ist gesund und stark, es wird bestimmt alles gut gehen!‹ Keine Ahnung hat sie natürlich, nur den typischen Optimismus aller Säufer, den hat sie! Und das Hinduweib hockt in einer Ecke, starrt mich an wie die Katze ihr Karnickel und lässt sich die stärkste Lampe auf den geschorenen Schädel scheinen, dass der leuchtet wie ein auf Hochglanz poliertes Straußenei – und Fernande liegt da und schreit und schreit … Und wenn sie einmal für zwei Minuten Ruhe hat, dann lächelt sie, dann drückt sie meine Hand, dann sagt sie: ›Unser Kind, Peter!‹ – und dann packt die grauenhafte Faust wieder zu und beutelt sie wie ein Terrier seine Ratte. Und darauf soll ich stolz sein, ich? Schämen müsste ich mich! Was wissen wir Männer denn schon von den Frauen? Nichts wissen wir, und wenn wir was wissen, dann ist es das Lachhafte, das Süße, das Falsche, das ganz und gar Unwesentliche! Keine Ahnung haben wir von ihnen, wie rau springen wir mit ihnen um, was tun wir ihnen alles an, aus Leichtsinn, aus Gedankenlosigkeit, aus Niedertracht und Übermut!«
Peter Petersen kommt an den Tisch heran, nimmt das Glas auf, leert es und lässt sich danach schwer in den Longchair fallen, beugt sich vor, wühlt die Stirn in beide Hände, stöhnt mehr, als dass er spricht: »Ich bin fertig, ich kann nicht mehr! Und dieser Idiot von einem Arzt, der ist doch nur nach Indien gekommen, weil er für Europa zu dämlich gewesen ist! Und diese dicke Hebamme aus dem Wilden Westen und das schmutzige Stück von Shikari-Witwe …«
»Du sollst mir die alte Zuma in Ruhe lassen!«, unterbricht ihn Franzek, der die Gläser wieder gefüllt hat und nun einen Schuss Soda in den Whisky spritzt. »Und Beauville ist nicht halb so untüchtig wie er aussieht, wenn es darauf ankommt, kann der Junge ganz gelenkig sein. Und die alte Williamson ist sogar sehr tüchtig, verlass dich darauf, die hat hier in Masherbara mehr Kinder an die Sonne geholt, als du dir auch in deinen kühnsten Träumen einfallen lässt, mein guter Peter. Aber wenn wirklich einer von diesen beiden irgendwelchen Unsinn machen würde, Peter, Zuma, die alte Hexe, die wird deine Fernande noch dem Tod und allen Teufeln aus den Klauen reißen. Ich kenn sie, Zuma kann mehr als Brot backen, in Europa würde man sie einlochen oder zum Ehrenprofessor machen, bei der alten Zuma ist Fernande aufgehoben wie in Gottes Schoß. – Da, trink noch einen, Peter, dass du mir nicht aus den Stiefeln kippst. Und steck dir ’ne Zigarette an …«
Wie willenlos kommt der Jüngere den Aufforderungen nach. »Ich weiß, Charly, ich benehme mich wie ein Idiot. Dieses Land, dieses Klima – manchmal denke ich, ich halte es nicht mehr aus, es zermürbt mich, es nimmt mich zwischen zwei Mühlsteine und mahlt mich kurz und klein, Hitze und Schwüle … Ich hätte niemals nach Indien kommen sollen, das ist kein Weg für mich, keine Möglichkeit. Ich gehöre nach Europa, ich gehöre nach Deutschland, und in Deutschland gehöre ich an die Wasserkante, nach Hamburg gehöre ich, wenn du es genau wissen willst. Da ist jetzt April, und die großen Winde wehen aus der See in das Land … Weißt du, was ich möchte, Charly? Jetzt auf einer kleinen Segeljacht bei gutem Wellengang und Windstärke sechs an Cuxhaven vorbei nach Helgoland seilen. Ach, Charly, das wäre was … Und dann abends auf Helgoland die roten Vögel und richtigen Grog – Charly, ich habe mein Glück mit Füßen getreten, ich habe alles verkehrt gemacht in meinem Leben!«
»Dein Glück mit Füßen getreten hast du?«, poltert der Zigeuner jetzt los in ehrlichem Zorn. »Dein Glück gemacht hast du in Indien, das weißt du genauso gut, das weißt du sogar noch besser als ich, du Hansnarr! Was wärest du denn, wenn du in Europa geblieben wärest? Bestenfalls ein Dompteur, und das auch noch nicht einmal aus eigener Kraft. Dazu hätte dir die Fernande geholfen, weil du einmal ihren Mann betrogen hast mir ihr, du Lümmel! Das wäre ’ne schöne Existenz, muss ich schon sagen! Dabei könntest du dich gerade als Herrensegler auf der Elbe herumdrücken! Und was bist du hier? Ein König bist du hier! Oberforstmeister des Radschas von Masherbara und erster Direktor des fürstlichen Tierparks. Und die Wälder sind kaum kleiner als ganz Bayern, und im Tierpark sind so viele Tiere, dass der aufgeblasenste europäische Zoodirektor vor dir verlegen stottern und tief den Hut ziehen würde. Tun und lassen kannst du, was du willst, gewiss, ich stehe dir noch zur Seite, aber ich kratz ja nun doch bald ab, manchmal spür ich’s schon verdammt in den Knochen. Und das dicke Geld, das du verdienst, kannst du mit dem besten Willen nicht ausgeben, lässt es auf der Bank Zinsen hecken, kümmerst dich nicht drum, hast ja alles und noch mehr, was du zum Leben brauchst! Dein Glück mit Füßen getreten – weißt du Strolch noch, dass du mal Tierwärter gewesen bist, simpler Zirkuskutscher, dass du arbeitslos in Berlin herumgelaufen bist wie ein verprügelter Hund? Zu gut geht es dir, das ist dein ganzes Elend! Da, trink!«
Peter Petersen leert das frische Glas und zündet sich eine neue Zigarette an. »Wie ich damals nach Indien gekommen bin«, sagt er still, »Charly, du weißt, da hatte ich andere Pläne, ehrliche, handfeste Pläne und Vorsätze. Bauer wollte ich werden, die Wildnis wollte ich roden, Neuland wollte ich schaffen!«
»Papperlapapp!«, schneidet ihm Franzek mit heftiger Handbewegung brüsk die Rede ab. »Wildnis roden, Neuland schaffen – hunderttausend Idioten brennen und roden in diesem Lande herum, dass es zum Himmel stinkt. Neuland – mühsam bewässerte Felder, Plantagen, Autostraßen, Frucht- und Genussmittelindustrie, nicht wahr? Wo bleibt der Wald, wo bleibt der Dschungel, wo bleiben die Tiere, Peter Petersen? In eurem Neuland ist kein Platz dafür – aber wenn tausend Menschen roden und ackern und brennen und planieren, verdammt noch mal, du Dummkopf, dann muss doch wenigstens ein vernünftiger Mensch da sein, der sich um den Wald kümmert, der ihn und seine Tiere schützt vor dem blöden Ameiseneifer der Menschen. Und dazu, Peter, dazu taugst du doch weit besser als hinter den Pflug, das weißt du selbst gut genug – du hast doch gleich mit beiden Händen zugegriffen, als wir dir bei deiner Ankunft unseren Plan vorlegten. Damals wusstest du sehr gut, was zu dir passt!«
»Damals habe ich es gewusst, und schließlich weiß ich es auch heute noch!« Peter hebt den Kopf und sieht sinnend in den dunklen Park hinaus gegen die grausilber leuchtenden Stämme der Tamarinden. »Du hast recht, Charly – und doch – und doch – etwas fehlt mir, etwas Entscheidendes, mich restlos Ausfüllendes.«
Charly Franzek, der alte Waldläufer, beugt sich vor und legt leise die Hand auf das Knie seines Freundes. »Ich will dir sagen, was dir fehlt, Peter. Du bist ja gar nicht nach Indien gekommen, um hier etwas Neues anzufangen, du bist nach Indien gekommen, um etwas Verlorenes zu suchen, weil du hofftest, es hier wiederzufinden!«
Schweigend sehen sich die beiden Männer, der Junge und der Alte, in die Augen. Und dann spricht Franzek leise und traurig zwei Worte: »Daphne Dennys!«
Peter Petersen durchläuft es kurz und zitternd wie ein elektrischer Schlag, und dann reißt er seine Augen von Franzeks Gesicht und starrt wieder in die Nacht hinaus. Der alte Zigeuner lehnt sich stumm in seinem Sessel zurück, da spricht Peter, langsam, schwer und verträumt: »Daphne – ach, Daphne! Du hast recht, Charly, recht, wie du immer hast. Und doch auch nicht! Daphne – sie war nicht von dieser Welt, sie war ein Märchen, sie war ein schöner, wilder Traum. Weißt du noch, Charly, wie sie den Elefanten ritt? Wie die Geparden sich von ihr hetzen ließen, wie die Falken kreisten über ihrer Faust? Weißt du noch, wie der Tiger Akbar ihr Sklave wurde, wie sie tanzte mit ihm? Aber nein, das weißt du nicht, du hast ja niemals ihren Tanz gesehen, du Armer! Ihre dunklen Augen, ihre weiche Stimme, ihre goldene Haut, die weiße Seide, die um ihre hohen, schmalen Beine wehte – ach, Charly! Und in dieser Frau, in diesem schmalen Mädchen ein Herz, eine Seele! Charly, heute weiß ich, dass ich maßlos glücklich gewesen bin damals, als ich glaubte, an ihrer Seite verschmachten zu müssen. Einmal in unserem Leben kommt ein Mensch und formt unser Herz – und alles ist Spreu nur, was später kommt und diese Form nicht zu füllen vermag … Ja, Charly, ich weiß, warum ich mich oft so leer fühle, so tot und ausgebrannt, Daphne, das Wälderkind, Daphne, die mit dem Tiger Akbar tanzte, der sie liebte, Daphne hat mein Herz so ausgeweitet, dass jede andere Frau nur geringsten Platz in ihm einnimmt, dass ich nicht eine mehr fühle, dass sie mir alle gleichgültig sind, langweilig und oft genug nur lächerlich.«
Er sitzt vorgebeugt, die Zigarette verkohlt zwischen seinen Fingern. Charly Franzek sieht ihn stumm von der Seite an. ›Fünf Jahre ist es her, dass das Mädchen starb!‹ denkt er. ›Und der Peter ist nun bald an die Vierzig. Und eine einzige Nacht hat er sie gehabt … Gewiss, Daphne Dennys ist mit keinem Maß zu messen, und er lebte Jahre mit ihr, und er liebt sie heute mehr denn je. Armer Junge! Er versteht was vom Wald, er versteht viel von den Tieren, aber noch ist er nicht in dem Alter, dass Arbeit allein ihn ausfüllen könnte, noch immer ist er jung, noch immer nicht hat er gelernt, sich zu bescheiden. Er fühlt sich leer, denn er träumt immer noch den alten Traum, der einst unter Tigerpranken gestorben ist. Leer …! Und dann denkt er zwei Worte, sie drängen sich ihm schon auf die Zunge, aber er beißt die Zähne übereinander: Nur diesen Namen nicht nennen, sie liegt drüben, geknechtet von den Wehen, sie bekommt ein Kind von diesem Mann, der sagt, dass er sich leer fühlt, dass alle Frauen ihm gleichgültig sind, langweilig oder lächerlich – und der vor zehn Minuten noch wie ein Irrer tobte, weil er sie nicht von ihren Schmerzen befreien konnte …
Aber da spricht Peter Petersen, dessen Augen nun wieder erloschen sind und müde in die Nacht hinaus sehen, diesen Namen schon selber aus: »Und Fernande? Charly, man kann so leer, so müde, so verzweifelt sein, dass man sich aus dieser Verzweiflung heraus in die Geste der Liebe flüchtet. Man wird bescheiden, man wird ja so sehr bescheiden. Man kann nicht allein leben, man kann nicht einsam sein, man sucht andere Menschen, man drängt sich aneinander, wie Schafe im Sturm sich aneinander drängen, um einer des anderen Wärme zu spüren. Und so lebt man, so liebt man – es ist traurig um die Menschen bestellt, Charly.«
Der alte Zigeuner schweigt, er weiß nichts zu sagen. Er hat Daphne Dennys gekannt, er hat sie geliebt, ja, er hat sie vergöttert, vielleicht auch hat er sich damals bisweilen heimlich und erbittert gegen sein Schicksal aufgelehnt, als alter Mann mit dem Mädchen zusammentreffen zu müssen, von dem die Sehnsüchte seiner Jugend geträumt hatten. Aber ist es nicht immer so im Leben, dass das Glück zu spät kommt und an uns vorüberweht, weil wir es nicht mehr halten können oder auch nicht mehr halten wollen, oder weil es uns nicht sieht, die wir alt und gebeugt und müde am Rande der Straße sitzen, auf der es vorüberfliegt? Und er hat Peter Petersen, den Jungen, immer etwas beneidet, und er hat ihn, seinen guten, seinen einzigen Freund, auch wohl immer etwas gehasst, denn welcher Mann glaubt wohl, dass ein anderer Mann das Mädchen seiner Liebe so gut versteht wie er selbst, so glücklich macht, wie er selbst es glücklich machen würde, und welcher Mann hält wohl den anderen Mann für wert und würdig, die Liebe zu empfangen, von der er selbst entsagend geträumt hat? Aber dann ist damals das Unglück geschehen, und Peter Petersen zerbrach fast daran, wenn einer verstehen konnte, was ihm mit Daphne Dennys gestorben war, so ist er es gewesen, er, Charles Franzek. Nun war Peter nichts mehr für ihn als der gute, der beste Freund, er hat alles getan, um ihn, der sich wund und menschenscheu im einsamen Heidehaus verkrochen hatte, heraus und nach Indien zu locken. Es ist gelungen, aber dann kam Peter nicht allein, er kam mit Madame Fernande, die er auf dem Schiff, im arabischen Meer, geheiratet hatte. Der Alte kennt die Vorgeschichte dieser Liebe gut genug, sie lief damals, verbreitet von tausend eifrigen Zungen, durch die Welt: Die beiden Dompteure, die mit dem bösesten Tiger ihrer Gruppe um eine Frau kämpften, ohne Stachel, ohne Peitsche, um eine Frau, die dem einen gehörte und die den anderen liebte. Dieser gewann den schauerlichen Kampf – aber dann verzichtete er auf den Sieg und entfloh der Frau. Nach Jahren fand der andere seinen Tod, da ging die Witwe zu dem immer noch Geliebten zurück, sie fand ihn allein, denn Daphne Dennys war wenige Monate vorher gestorben.
Jetzt denkt er: ›Zier dich nur, mein Junge. Tod ist Tod, aber Leben ist Leben. Und das Leben ist immer stärker als der Tod. Drüben liegt Fernande und schenkt dir ein Kind. Und das wird dir über die Schwelle helfen. Zwei Jungen wünsche ich dir, damit Bewegung in dein Haus kommt. Oder einen Jungen und ein Mädchen, Peter, das wäre doch was! Dann machen wir aus dem Jungen einen großen Jäger, und das Mädchen – Peter, bei dem Mädchen wollen wir uns Mühe geben, dass wir mit ihr vor Daphne Dennys bestehen können!‹
Peter Petersen lässt den Zigarettenstummel fallen und tritt ihn aus. Er ist aufgestanden, hat sich seinem Freunde zugewandt, die Hände in den Taschen der langen weißen Leinenhosen, wippt er auf den dünnen Sohlen seiner Segelschuhe auf und ab – aber ein leises Geräusch in seinem Rücken lässt ihn herumfahren. Und dann schreit er schon los mit der wilden Zügellosigkeit des Mannes, den die Tropen hart gepackt haben und der ihre ersten Peitschenschläge noch nicht verwunden hat: »Was willst du hier? Kannst du schleichendes Scheusal dich nicht anständig bemerkbar machen?«
Auf der obersten Treppenstufe steht, klapperdürr, in schmutzige Tücher gewickelt und mit dem glattgeschorenen Kopf der Witwe über dem hässlich zerknitterten Hexengesicht, ein altes Weib. Es neigt sich viele Male, dann sieht es stracks in die zornig funkelnden blauen Augen, sie lächelt leise und böse, dieser Mann ist nie gut gewesen zu ihr, es macht ihr Freude, ihm wehzutun, sie spricht: »Sahib Petersen, wir wollen alle mit dir trauern, alle wir Männer und Frauen aus Masherbara. Wohl ist dir ein Kind geboren, aber, Sahib Petersen, es ist nur ein Mädchen – und die Mutter ist schon tot!«
Charly Franzek schnellt in die Höhe, klirrend stiebt das Tischchen, an das sein Ellenbogen stieß, davon. Er sieht nur den Rücken seines Freundes, der steht starr und regungslos, aber langsam, unmerklich fast, krümmt er sich, verfällt, sinkt der Kopf herab.
Dann ist ein schneller Schritt auf der Treppe, das bleiche, verstörte Gesicht des Monsieur Beauville taucht auf, die Gläser der Hornbrille glitzern im Licht, verstrubbeltes Haar fällt in die schweißnasse Stirn, er ringt die Hände: »Monsieur – monsieur – ich hatte das Kind, ich hatte die Frau über den Berg – die Tropen, Monsieur, Herzlähmung, sie war schon viel zu sehr von dem Klima geschwächt, um Mutter werden zu dürfen!«
Der Einsame
- 3 -
Er nannte sich Gurg und kam aus den wilden Wäldern. Das Haar, von keinem Turban geschützt, von keinem Knoten gebändigt, fiel ihm lang und schwarz auf die Schultern, er roch nach Moos, nach Büffeldung und nach welkendem Laub. Sein Leib federte schmal und sehnig, seine Haut glich weichem braunem Leder, und seine nackten Füße setzten sich lautlos wie auf Gummisohlen. Nur ein schmales Tuch umgürtete seine Hüften, sein Gesicht war seltsam starr und unbewegt, einzig die großen, brennenden Augen lebten und bewegten sich immerfort ohne Ruhe. Er war ein Ärgernis in der reichen Palaststadt des Radschas von Masherbara, und allen Mahouts, die ihr gutes, festes Gehalt bezogen, pensionsberechtigt waren und in weiß getünchten Häusern mit elektrischem Licht und Ventilatoren lebten, allen standesbewussten Mahouts war er vom ersten Augenblick seines Erscheinens an ein Gräuel.
Eines Tages, zur Mittagszeit und in der stärksten Sonnenglut, stand er plötzlich auf dem Elefantenhof. Jedermann ruhte und suchte Kühle zu dieser Stunde, er aber schwamm durch die staubige Hitze wie ein Fisch durch kühles Wasser. Sicherlich hatten auch die Torwärter geschlafen, wie anders konnte es dem wilden Fremdling gelungen sein, in die Palaststadt einzudringen und die guten Leute in ihrem Schlummer zu stören und in ihrer wohlverdienten Ruhe?
Mitten auf dem Elefantenhof also stand er und sah zu den hundert Elefanten hinüber, die unter den Schattendächern leise mit ihren Ketten klirrten und an ihren Bananenzweigen kauten, stand lange und unbeweglich und gab nicht den kleinsten Laut von sich, aber die Männer bemerkten seine Anwesenheit doch, allein seine Gegenwart erweckte sie, sie fühlten im Schlummer, dass ein gefährlich Fremdes unter ihnen weilte und ihre Ruhe bedrohte. Sie lagen auf ihren Matten, sie sahen misstrauisch, ablehnend und wohl auch mit einer unbestimmten Furcht auf den fremden Eindringling, sie griffen stumm nach ihren Stachelhaken, wie wenn in ihren Hof ein feindlicher Haufe eingedrungen sei, dessen Angriff mit den Waffen abgewehrt werden musste.
Dann breitete der Fremdling plötzlich beide Arme nach den Seiten aus, dann schrie er, eine wilde, unartikulierte Tonfolge, die niemand verstand, und die wohl auch nicht zu verstehen war – aber die Elefanten antworteten darauf wie auf ein Signal. Sie kümmerten sich nicht mehr um ihr Futter, sie warfen ihre Rüssel hoch, sie saugten schnaubend den Ruch ein, der von dem Fremden kam, sie begrüßten ihn mit dem großen Ruf, den sie nur dann anstimmen, wenn etwas Gewaltiges ihr Herz bewegt.
Und der nackte Wilde rannte mit immer noch ausgebreiteten Armen auf sie zu, wie wenn er die langen Reihen der Elefanten, die Reihe vor ihm, die Reihe rechts, die Reihe links – wie wenn er sie alle zusammen umarmen und an sich reißen, an sein Herz drücken wollte. Aber er erreichte ihre Reihen nicht, Guru, der Mann aus dem Pandschab, warf im Liegen seinen Ankus nach ihm, der Stachelstab flog dicht über die Erde gegen den Laufenden, schlug gegen seine Beine und brachte ihn zu Fall. Und als er sich wieder aufrappelte, verstört und wie von einer großen Ernüchterung befallen, da sah er sich eng umdrängt von vielen Gestalten, die ihm wilde Worte in die Ohren schrien, die Fäuste und Stachelhaken vor seinem Gesicht schwenkten, da fühlte er Hände, die in sein Haar griffen und daran rissen, Fäuste, die ihn packten und schüttelten und stießen. Und er hörte schmutzige Worte über seine Eltern und Ahnen, über sein eigenes unangenehmes, Ekel erregendes Äußere, er hörte sich beschimpft und hörte, wie ihm viele Prügel verheißen wurden, ihm, dem schmutzigen, verlausten Paria, der es gewagt hatte, in die Palaststadt des Radschas von Masherbara einzudringen und den fest angestellten Mahouts den schwer verdienten Schlummer zur Mittagszeit zu stören.
Einen Augenblick lag es wie ein Lächeln über dem hageren Gesicht, schien es, als wolle er die schreienden Männer belustigt fragen, warum eigentlich sie ihn so hässlich verdächtigten, es könne doch wohl kaum ein nackter Mann eine ganze Elefantenherde stehlen – da aber stieß ihm einer der Männer, Dschumba war es, der Kashmire, den Ankus von hinten in die Knie, und der Schmerz sprang durch ihn wie ein Brand, er fühlte sein Blut sickern aus der gerissenen Haut. Tobend und furchtlos sprang er gegen die vielen Männer an. Die wichen zurück, die spritzen auseinander, es war, als hätte man einen Tiger in einen Kreis von Hunden geworfen. Und kein menschlicher Schrei war es, der aus der Kehle des Bedrängten sprang, er war wie das Fauchen einer gereizten Katze, und auch sein Angriff war nicht der eines erregten Mannes, der mit Fäusten schlägt und mit Füßen stößt – er war wie der wilde Wirbel eines Panthers im dicht sich drängenden Rudel der Rinder.
Nun umringten sie ihn im weiten Kreis, in ihrer Mitte stand er, jede seiner Hände hielt einen Ankus, den er seinen Gegnern entrissen hatte, und der Boden um ihn war bedeckt mit vielen Stachelhaken, die er seinen Feinden aus den Händen geschlagen. Vorgebeugt stand er, die Arme wie zum Schlag an sich gezogen, die schweren Bronzehaken in seinen Händen glichen Krallen, fest mit seinem Körper verwachsen, langsam drehte er sich im Kreis. Sie sahen in seine Augen, in diese stechenden, dunkel schwelenden Augen, da wussten sie alles von ihm, und die Furcht kroch in ihre Herzen.
Der Mann dort ist ein Wilder, sie sehen es gut, sie aber sind ehrsame Mahouts, zwar fürchten sie sich nicht wenig vor diesem gefährlichen Eindringling, nun aber steigt auch der gerechte Zorn in ihnen auf: Wie können sie dergleichen in ihrer Mitte dulden? Sie können das nicht, der Mann ist fremd, er ist unheimlich, er ist nicht von ihrem Blut, es taugt nicht, dass etwas lebt auf dieser Welt, das anders ist als sie selbst, es muss vernichtet, ausgelöscht muss es werden, das muss ihnen gelingen, denn sie sind ja viele Dutzend Männer, und er ist allein, und sie hassen ihn, weil er nicht in ihre Ordnung taugt.
Und so fassen sie ihre Stachelhaken fester und schließen neu ihren Kreis, aber ehe sie daran gehen, ihm den Garaus zu machen, stärken sie ihren Mut mit ermunternden Zurufen.
»Ein Paria, ein Holzträger, ein Leichenverbrenner!«, schreit Sipir, der Mahout aus Radjputana. »Er befleckt uns mit seiner Gegenwart, er raubt uns die Kaste!«
»Ein Ghond ist er, ein Rodiya, ein Strolch und Herumtreiber und Dieb!«, brüllt Sadullah, der dickste aller Mahouts. »Wir wollen ihn verprügeln, dass er niemals mehr ehrlichen Männern die Ruhe rauben kann!«
»Kein Ghond – ein Zigeuner ist er!«, schreit der kleine Kuri aus dem Deckan. »Ein Zigeuner aus Ceylon, wisst ihr nicht, dass sie dort unten eine eigene Sprache haben, die nur sie und ihre Elefanten verstehen? Aufruhr will er bringen, unsere Elefanten sollen sich empören gegen unsere Güte und Weisheit, das will er, dieser Zigeuner, erschlagt ihn, meine Brüder!«
Sie schwenken ihre Stachelhaken, sie stehen und warten auf einen Ruf, der sie vereint gegen den unheimlichen Fremdling wirft, der sich noch immer geduckt in ihrem Kreise dreht wie ein gestellter Leopard. Aber dann stehen sie stumm und lauschen verstört: Ihre Elefanten brüllen! Alle hundert Tiere reißen an ihren Ketten, alle hundert haben ihre Rüssel weit vorgestreckt, sie streben unter den Schattendächern hervor, sie streben hin zu dem Kreis der Männer – und keiner der Mahouts zweifelt in dieser Minute daran, dass die Elefanten den Fremdling befreien wollen aus ihrer Bedrohung, dass die Elefanten sie, ihre Pfleger und Führer, vernichten wollen. Denn dieses Gebrüll – oh, dieses Gebrüll ist der große Streit- und Kampfruf, der sich nur dann erhebt, wenn ein Bruder in großer Gefahr ist, wenn es gilt, ihn zu retten.
Und da wirft der kleine, schlitzäugige Ali, der Malaie von den Sunda-Inseln, seinen Ankus von sich, streckt abwehrend beide Hände gegen den Fremden, damit dessen Blick nicht auf ihn fällt, da kreischt er mit sich überschlagender Stimme: »Kein Gond, kein Zigeuner – ein Tigermann ist er! Seht genau hin, Brüder! Seht seine Augen, seht die Narbe auf seiner Oberlippe! Nicht trägt er die Hasenscharte, er hat sie verwischt durch einen fremden Zauber, aber die Narbe ist geblieben, erkennt ihn daran! Stehet mir bei, beschützt mich, Freunde, ich habe ihm sein Geheimnis in das Gesicht gerufen, gleich wird er sich verwandeln in seine ursprüngliche Gestalt, Freunde, in einen Tiger, stehet mir bei, ohne eure Hilfe bin ich verloren!«
Und damit wirft der kleine Ali sich herum und läuft davon, dass seine schmächtigen kurzen Beine wirbeln wie Trommelschlegel. Keiner sieht ihm nach, wenn auch viele sind, die ihn beneiden um den Mut seiner Flucht, sie alle starren mit wachsender Furcht, mit steigendem Grauen den Wildling an, der sich in ihrer Mitte dreht, einen Ankus in jeder Hand. Ein Tigermann … Gewiss, jeder kennt sie, diese bösen Söhne Parvatis, die bei Tage still in ihren Hütten leben, Schneider und Kupferschmiede, Töpfer und Teppichweber, und die zur Nachtzeit als Tiger durch die Dschungel streichen, die Männer tötend und die schönsten Frauen verschleppend in den undurchdringlichen Busch. Ein Tigermann, gewiss, und Ali hat es ausgesprochen: Wenn man einem Tigermann bei Tageslicht sein Geheimnis in die Augen sagt, dann muss er sogleich die Tigergestalt annehmen. Gleich also wird der Fremde sich verwandeln, und wird, ein Tiger dann, dem Flüchtenden nachsetzen, um ihn zu töten … Aber wenn er ein Tigermann ist, warum schreien dann die Elefanten so wild, als wäre einer ihrer Brüder in größter Gefahr? Feindschaft ist doch, ewige Feindschaft ist zwischen dem Elefanten, dem Weisen und Starken, und dem Tiger, dem verwegenen, furchtlosen Räuber. Wenn er wirklich ein Tigermann ist, warum verwandelt er sich dann immer noch nicht?
Sie stehen und warten, aber sie warten umsonst, und dann erhebt sich nahe ihrem Kreise eine Stimme, eine tiefe und kräftige, eine sehr gütige Stimme, sie gehört dem alten Sahabeth, dem Obersten der Mahouts, der ein starker Mann war in seiner Jugend und es auch heute noch ist, der aber weise und friedlich wurde in einem langen Leben mit den Elefanten, die sein Fürst ihm anvertraut hat, und die er liebt, und denen er dient, und von denen er gelernt hat, dass Kraft nichts ist ohne Güte, dass aber die Güte, die sich mit der Kraft vermählt, zur Weisheit führt.
»Oh, ihr unnützen Treiberburschen!«, so ruft der Alte. »Ihr Söhne der Unruhe und des Ungehorsams – welchen Unfug treibt ihr nun heute wieder? Müsst ihr das Antlitz der Götter beleidigen, dass ihr rauft in den Stunden, die der Sonne gehören? Büffelkälber seid ihr, stinkende Ziegenböcke, wie eine Horde Affen lärmt ihr nahe dem Schloss unseres Fürsten, was soll er denken von euch – und was denken von unseren Elefanten?«
Damit durchbricht der Alte den Kreis, und nun sieht auch er den Fremden. Er stockt nur für die Länge eines Herzschlages, dann geht er ernst und würdig auf den nackten Waldmann zu. Lang und weiß fließt das weiche Gewand an ihm herab, schneeweiß leuchtet der Turban auf seinem Haupt und ist doch keineswegs weißer als der Bart, der ihm von Mund und Kinn herab auf die Brust fließt. Der nackte, gekrümmte Kämpfer sieht ihm entgegen und richtet sich auf, achtlos lässt er die Ankusse zu Boden gleiten, und wie der Alte nun vor ihm stehen bleibt, legt er die Arme über die Brust und neigt sich vor der Würde des weißen Bartes. Sahabeth steht und sieht in das schmale Gesicht, in dem noch die Hitze des Kampfes pulst. Langsam nähern sich die Mahouts, schließt sich ihr Kreis wieder enger. Der Fremde kann kein Tigermann sein, längst schon hätte er sich dann verwandeln müssen – aber selbst wenn er ein solches Ungeheuer wäre, ihnen kann jetzt nichts Böses mehr widerfahren: Sahabeth ist ja bei ihnen, der Alte und Weise.
Der Obermahout sieht in die brennenden Augen, die furchtlos und ernst seinen Blick erwidern. Dann hebt er seine Stimme: »Du bist fremd hier, Knabe, fremd in der Palaststadt unseres Fürsten, fremd im Lande Masherbara. Was trieb dich zu dieser Stunde auf den Elefantenhof?«
»Ein Ruf und meine Sehnsucht!«, sagt der junge Mann leise und schüttelt sich die langen Haare aus dem Gesicht. »Ich ging durch die Stadt und fürchtete mich sehr, denn ich habe noch nie eine Stadt gesehen, musst du wissen, und ihre vielen und unerklärlichen Dinge verstörten mein Herz. Und als ich vor einem Wagen flüchtete, der ohne Pferde auf mich zugerast kam, ich weiß nicht, welche Teufel ihn hetzten – da hörte ich plötzlich einen Elefanten rufen.« Er schweigt und sieht mit krauser Stirn zu Boden: »Ein dummes Gebilde, dieser Wagen ohne Tiere! Er verfolgte mich, aber ich sprang um drei Häuserecken, da hatte er schon meine Spur verloren, ich stand hinter einem Pfeiler, und der Wagen lief auf der breiten Straße dahin, und er prustete, wie das Einhorn prustet, das Nashorn, weißt du. Und ich glaube, die Seele eines solchen Einhorns wohnte auch in ihm, diesem stinkenden Tier auf Rädern!«
Rings kichern die Mahouts: Das ist kein Tigermann, das ist ein dummer, ein einfältiger Dorfbauer, der noch keine Stadt gesehen hat und nicht weiß, was ein Auto ist. Aber ein schneller, strafender Blick ihres Herrn und Meisters stellt sofort wieder das Schweigen her.
Der Junge hebt wieder die Augen: »Ja – da also rief der Elefant, du mein Beschützer. Und mein Herz entbrannte in Sehnsucht. Denn siehe, ich habe immer unter Tieren gelebt, und ich machte mich auf, und ich kam in diesen Hof, und ich glaubte, mein Herz würde stillstehen vor Freude, als ich diese vielen Elefanten stehen und auf mich warten sah, und sie begrüßten mich, aber als ich ihren Gruß erwidern wollte, da haben deine Männer mich daran gehindert. Und weil ich mich nicht hindern lassen wollte, wäre es fast zu einem kleinen Kampf gekommen, durch meine Schuld, denn ich bin aus den wilden Wäldern, und vielleicht benehme ich mich töricht in eurer Stadt. Sei milde mit mir, du Oberster der Mahouts, o du erster Diener des Elefantenvolkes!«
Rings durch den Kreis läuft ein beifälliges Murmeln. Gut setzt der Junge seine Worte, ehrlich klingt, was er sagt, und er will keinen Streit, er sucht den Frieden, er spricht wie ein Bruder.
Sahabeth sieht auf den schmalen Mann herab, den er um Haupteslänge überragt. »Gut!«, nickt er mit befriedigtem Gesicht. »Nun aber sage uns, wo der Weg begann, auf dem du zu uns gekommen bist.«
Wieder hält der Junge den Blick mit ehrlichen Augen, aber nun sind seine Worte ganz andere als noch eben zuvor: »In den wilden Wäldern, Alter, Kluger, in den Dschungel. Es ist mein Weg gewesen, du Vater im Elefantenvolk, mein Weg allein, und ich will nicht darüber sprechen, heute nicht und niemals!«
Unwillig verziehen sich die Gesichter der lauschenden Mahouts. Nicht gut, gar nicht gut ist dieses! Wer denn ist dieser dreiste Knabe? Ein Ausgestoßener, ein Flüchtling, ein Schuldbeladener, ein Verbrecher? Eine solche Frage muss beantwortet werden, gründlich und eingehend, wie kann man einen Menschen um sich dulden, von dem man nicht weiß, welche Frau ihn geboren hat, welcher Mann sich seinen Vater nennt, aus welchem Reich er ist und warum er dieses verließ? Sahabeth muss noch einmal fragen, sogleich und ohne Nachsicht! Aber der Alte wiederholt die Frage nicht, er stellt eine neue: »Sage mir deinen Namen, du Verschweiger!«
»Man nennt mich Gurg!«, kommt schnell die Antwort.
Sahabeth hebt den Blick und lässt ihn rasch im Kreise wandern. Nein, da ist keiner unter den Mahouts, der dieses alte Wort einer fernen Sprache versteht. Er aber, er, Sahabeth, der Alte, er kennt dieses Wort, er weiß auch gut, was es bedeutet. Wolf bedeutet dieses Wort. Wieder sieht er den Jungen an, der weiße Bart versteckt sein stilles Schmunzeln: ›Wie er passt zu dir, dieser Name!‹ denkt der Alte. ›Keinen besseren wüsste ich für dich. Wie ein Wolf bist du, und meine klugen und fleißigen Mahouts sind gegen dich wie Hunde gegen den Wolf –‹ Er sieht plötzlich den Jungen scharf und forschend an. War es nicht einmal, viele Jahrzehnte sind es her, da gurrte ein Mädchen an seinem Hals, auf bunten Teppichen lagen sie, was war es doch, was die schmale Hindin gurrte? ›Wolf!‹ gurrte sie. ›Mein Wolf!‹ »Gurg«, hieß es in ihrer Sprache … Gurg – aber nein, wenn damals etwas geschehen ist nach seinem Abschied, dieser Bursche kann es nicht sein, er ist zu jung, er ist viel zu jung.
Und so sagt er jetzt gemächlich: »Gurg – das ist ein guter Name. Und nun beantworte mir noch eine Frage: Wohin soll dein Weg dich führen?«
Gurg sieht in das alte Gesicht, und jetzt ist es wie ein Flehen in seinen dunklen Augen: »Wenn du es willst, o du Oberster der Mahouts, wenn du es willst, endet mein Weg hier zu deinen Füßen!« Und dann sagt er rasch und mit heißer Bitte: »Lasst mich hierbleiben, Gütiger, hier bei den Elefanten!«
Der Alte lässt die Lider über seine Augen sinken, um seine Freude zu verbergen. Diesen jungen Wolf kann er wohl gebrauchen, er braucht seit Langem einen Menschen, auf den er sich ganz und gar verlassen kann, einen, der nicht nur seine Arbeit verrichtet, sondern sich auch um alles kümmert, dem das Wohl der Tiere am Herzen liegt, auch wenn es ihm nicht persönlich anvertraut ist. Gurg wird dieser Mann sein, er wird ihn sich erziehen, dieser Wildling mit dem kühnen und scheuen Tierblick taugt vielleicht sogar dazu, einmal sein Nachfolger zu werden, taugt dazu gewiss besser als einer von diesen behäbigen Familienvätern und Gehaltsempfängern.
Aber dann sagt er, um sich nicht zu verraten und auch um den Jungen auf die Probe zu stellen: »Bei den Elefanten? Gurg, mein Fürst hat noch viele andere Tiere.« Er deutet mit dem Arm auf das angrenzende Parkstück: »Tiger und Löwen, Leoparden und Hirsche, Büffel und Einhörner, Wölfe und Wildkatzen, Affen und Warane, Füchse, Schakale, Marder, Schlangen – tausend Tiere hält mein Fürst zu seiner Lust. Vielleicht wärest du lieber bei den wilden Brüdern, Knabe Gurg, als bei den Elefanten, die doch nur Arbeiter sind im Dienste unseres Herrn, des Fürsten von Masherbara?«
Nun arbeitet es in dem schmalen, verschlossenen Gesicht unter dem wirren Haarstrudel. Sahabeth sieht, wie bewegt der Junge von seinen Worten ist, sieht, wie es in ihm kämpft und wühlt, und Sahabeths Herz frohlockt und bettelt: ›Gurg, wilder Gurg, du gehörst zu den Tieren, ich sehe es dir an, du liebst sie alle, aber ich bitte dich, ich bitte dich sehr, komm zu mir, Gurg, bleib bei mir und bleibe bei den Elefanten!‹
Der nackte Fremdling sieht auf und blickt hinüber zu den Elefanten unter ihren Schattendächern. Die Tiere haben ihre wilden Rufe eingestellt, sobald Sahabeth auf dem Elefantenhof erschienen ist. Sie kennen ihn gut, den Alten, wo er ist, da ist Frieden und Gerechtigkeit. Aber noch immer setzen sie ihr Mahl nicht fort, sie stehen still, sie schlenkern die hängenden Rüssel, sie sehen auf die Gruppe der Männer und warten …
Und da lächelt Gurg dem alten Sahabeth in das gütige, weißbärtige Gesicht: »Ich möchte sie sehen, ja, Vater des Elefantenvolkes, ich möchte sie alle sehen, heute noch und jeden Tag. Aber bleiben, bleiben möchte ich bei den Elefanten, wenn du es erlaubst, Gütiger und Weiser.« Und damit kreuzt er die Arme über der Brust, er verneigt sich tief, und dann sagt er, schnell und leise, dass nur Sahabeth ihn verstehen kann: »Und bei dir!«
Der Alte verbirgt seine Freude immer noch. Er lässt seinen dunklen, klugen Blick über den Kreis der Mahouts schweifen. Aber rings in diesem Kreis sieht er nur mürrische Gesichter, sieht Ablehnung und Misstrauen, sieht Zorn auch und Hass und Furcht. Murren läuft durch die Reihe, und da ruft auch schon Sipir: »Er ist ein Fremder, er gehört nicht zu uns!«
Und Sadullah, der dickste aller Mahouts, schnauft vorwurfsvoll: »Wir alle stehen seit vielen Jahren im Dienste des Fürsten. Unser Beruf ist schwer, und wir haben ihn mühsam erlernen müssen. Soll ein fremder Knabe sich auf das Pferd setzen, das wir gesattelt haben – und nicht für ihn?«
Da aber ruft hinter dem Kreise eine dünne, spitze Stimme, und das ist Ali, der Mann von den Sunda-Inseln, der sich wieder herangeschlichen hat: »Lasst ihn doch – lasst ihn Rama reiten! Wenn er Rama reitet und führt, dann mag er bei uns bleiben!«
Und nun braust ein gewaltiges Gelächter durch den Kreis, die Männer wiehern vor Lachen, sie kreischen mit überschnappenden Stimmen, sie schlagen klatschend die Hände gegen die Schenkel. Und dann brüllen sie einstimmig: »Ja, er mag bleiben, aber erst soll er Rama reiten, erst soll er Rama führen!«
Rama aber ist der Dämon im großen Elefantenstall, ein Rogue, ein Tusker, verwegene Jäger haben ihn gefangen vor vielen Jahren, haben ihn im Triumph in die Palaststadt gebracht, aber dort steht er noch heute an seinem Platz, entfernt von den anderen, und man kann ihn nur dann von den Ketten lösen, wenn man ihn rechts und links vorn und hinten einmauert mit den stärksten und kampferprobtesten Elefanten – und acht von ihnen sind nötig, um ihn über den Hof und zurück an seinen Platz zu bringen. Einen Menschen aber hat er bis heute nicht auf Rüsselweite an sich herangelassen, einen Menschen hat er niemals auf seinem Rücken geduldet.
Sahabeth, der Alte, fühlt, wie sein Herz schwer und traurig wird. Seine stille Hoffnung wird sich nicht erfüllen, alle die Mahouts sind gegen den Fremden, sie werden ihn nicht in ihrem Kreise dulden. Gewiss könnte er jetzt ein Machtwort sprechen, nach dem die Männer aus den Elefantenstockaden Gurg dulden müssten in ihrer Mitte, aber es ist niemals gut, einen Wunsch gewaltsam zu verwirklichen, es würde nur ewige Unruhe geben, Hass und endlosen Streit, der Friede im Elefantenhof von Masherbara wäre für immer dahin. Aber die Probe – nein, diese Probe besteht Gurg nicht, sie ist nicht zu bestehen, Rama lässt sich nicht reiten, wenn der Fremde sich ihm nähert, bedeutet das seinen Tod. Und darum ist es des alten Sahabeths Pflicht, diese Probe zu verhindern und den Fremden aus der Palaststadt zu weisen.
Traurig sieht er auf den Jungen. Der hat sein Gesicht von ihm gewandt und sieht auf den Kreis lachender, wiehernder, kichernder Männer, aber wie nun seine Augen wieder denen des Obermahouts begegnen, da glänzen sie mutig und verlangend. Bittend legt er die Handflächen gegeneinander, leise neigt er sich, dann sagt er, rasch, hastig und mit brennendem Verlangen: »Ich habe gehört, ich habe verstanden. Ich bitte euch, Rama ansehen zu dürfen, er ist ein böser Elefant, errate ich es recht, mein gütiger Vater?«
Noch zögert Sahabeth, aber es ist nicht Furcht und Unentschlossenheit, die den Vielerfahrenen zaudern lässt, er sieht das ruhige Gesicht, er sieht die glänzenden Augen Gurgs: Dieser Junge fürchtet sich nicht, er ist sehr zuversichtlich, und er ist viel zu klug, um den Mut der Dummen zu haben, sollte er wirklich? Und darum sagt der Alte jetzt ruhig: »Es ist gerecht, dass eine Probe gefordert wird, und dass du dich ihr unterwirfst, Gurg. Denn du bist fremd und jung, wir wissen nichts von deinen Wegen, über die deine Füße gegangen sind, wir wissen nichts von den Gedanken hinter deiner Stirn, und wir wissen nichts von den Träumen deines Herzens. Aber das alles werden wir wissen, wenn du Rama gegenüberstehst, wenn du dich an ihm erprobst. Mögen die Götter mit dir sein, meide die Reichweite seines Rüssels – komm nun und folge mir!«
Der Ring der Mahouts öffnet sich, Sahabeth, der Alte, geht über den Hof, dem rechten Schattendach entgegen, Gurg hält sich bescheiden zwei Schritte hinter ihm, und das Rudel der Elefantenwärter folgt ihnen in johlender Begeisterung. Aber der Alte bleibt stehen und scheucht sie zurück. Sie sollen nicht die Elefanten verwirren mit ihrem Geschrei und mit ihrem Übermut. Gerechtigkeit soll sein, der Fremde soll sich allein dem bösen Rama nähern. Und sie gehorchen und lassen sich nieder unter der Sonne, vergnügt schwatzend, denn ein Fest wartet ihrer.
Und nun bleibt auch der Alte stehen. Verwundert sieht er auf die lange Reihe der Elefanten. Sie kümmern sich immer noch nicht um ihr Futter, sie hängen in ihren Ketten, ihre Rüssel sind dem Fremden zugewandt und saugen stark die Luft ein, die von ihm kommt, ihre breiten Fächerohren schlagen, ihre braunen Augen glitzern lustig und verschmitzt. Ein Rüssel aber streckt sich weiter und begehrlicher noch als alle anderen dem jungen Gurg entgegen, einem Maul entfährt ein spitzer, sehnsüchtiger Schrei, und dieser Schrei kommt von einem Elefanten, der vereinzelt unter dem Ende des Schattendaches steht und abgesondert von den anderen, damit er keinem etwas zuleide tun und versorgt werden kann, ohne dass seine Wärter in Gefahr kommen, von seinem Rüssel getroffen zu werden. Und dieser Elefant ist um einen guten Fuß höher als selbst die stärksten Kämpfer der großen Herde, seine Stirn ist ein breites, zerklüftetes Gefels, seine Brust gleicht einem Kampfwagen und seine starken Beine runden Säulen. Auch trägt er die stärksten Zähne von allen Elefanten, stark wie ein Männerschenkel, lang wie ein Frauenbein und gefährlich geschwungen wie die schmale Sichel des Mondes – und das ist nun Rama, der Böse, der Rogue …
Sahabeth, der Alte, hat es nicht nötig, ein Wort zu sprechen, auch nur mit der Hand zu deuten, der Junge an seiner Seite sagt leise: »Ich erkenne ihn, es ist der, der mich gerufen hat! Habt Dank, mein Vater!« Und dann geht er an dem Obermahout vorüber und geradewegs auf Rama zu. Der Alte sieht auf den schmalen, nackten Rücken. Wie die schlanken Glieder federn, wie die edlen Muskeln spielen unter der goldenen Haut, und ganz deutlich spürt er jetzt den Geruch, der von dem Fremden kommt – den Ruch von Moos und Büffeldung und welkendem Laub. Und da erfüllt ihn die Gewissheit, und er weiß: Er wird jetzt ein Wunder sehen! Gurg geht nahe an den großen Elefanten heran, aber um eine Schulterbreite vor dem Ende des gestreckten Rüssels bleibt er stehen, und dann kauert er sich still nieder nach Art der Waldleute: Die Füße stehen mit ganzer Sohle auf der Erde, und die Ellenbogen hängen über den Knien. So sitzt er lange Zeit und sieht zu dem Elefanten auf. Wie ein Gebirge ragt das gewaltige Tier über ihm auf, in seinen Fußketten hängend, drängt Rama Gurg entgegen. Gleich einer Linie der Sehnsucht streckt sich sein Rüssel nach dem Kauernden, nach dem Unerreichbaren aus. Weit abgespreizt breiten sich die runzligen Fächer der Ohren, die braunen feuchten Augen starren unverwandt. So hängt das Tier, einem Felsen gleich, über dem Hockenden, unbeweglich gleich grauem Stein, unbeweglich wie der Mann.
Jetzt hört der Alte, der Oberste der Mahouts, ein leises Summen, monoton und dunkel, es kommt aus Gurgs Mund, und Rama, der böse Elefant, lauscht darauf wie ein verliebtes Mädchen süßem Vogellied. Aber nur das Summen ist, die Unbeweglichkeit bleibt. Dann aber ist es, als wolle Rama, der Gewaltige, seine Ketten sprengen, so wirft er sich hinein, dem Mann entgegen, der vor ihm hockt. Aber diese Ketten sind stärker als selbst Ramas böse Kraft, er erreicht den Fremdling nicht. Gurg jedoch hebt langsam seine Hand, noch langsamer senkt er sie, und dann legt er sie wie eine Schale über den Rüsselmund, der auf seine Brust gerichtet ist. Die ganze schwere Masse des Rogue drängt sich jetzt gegen diese Handfläche, als wolle er sie einsaugen in seinen Riesenleib.
Und dann kommt der Schrei, der klagende, spitze, sehnsüchtige Schrei des einsamen Elefanten, der seine Einsamkeit nicht mehr ertragen kann, der sich nach seiner Herde sehnt und seine Gefährten ruft. Aufrecht auf seinen Füßen steht jetzt der schlanke Gurg. Aber er geht nicht auf den Elefanten zu, er weicht ihm aus, er gleitet um ihn herum, jetzt steht er neben seinem Hinterteil, und seine Hand streicht über die raue Borkenhaut. Das schwere Tier schiebt sich zurück, nun drängt es nach hinten, es zittert leise, still liegen die Ohren, und der lange Rüssel krümmt sich, dem Fremden, dem Ersehnten entgegen. Der aber eilt sich nicht, in großen, sanften Bogen streicht seine Hand über den gewaltigen Leib, um Fingerbreite nur schiebt er sich vor bei jedem Strich. Endlich dann, während seine Rechte hoch am Rücken Ramas haften bleibt und einen Flecken Haut dort knetet und drückt, kommt seine Linke und legt sich wieder über den Rüsselmund. Still und wie befriedigt steht Rama, Rama, der Böse und Gewalttätige, aber unaufhörlich läuft das Zittern durch ihn hin, nicht jenes Zittern der Haut, das die Fliegen vom Leib scheucht, nein, dieses Zittern kommt aus seinen tiefsten Tiefen und lässt alle seine Knochen leise erbeben.
Und dann fassen plötzlich beide Hände des Mannes in die Krümmung des Rüssels. Rama quiekt auf, zärtlich und beglückt, mit einem Ruck zieht er den Mann vor sich und heran, dicht heran an seine Brust. Unter den schweren Kiefern des mächtigen Elefantenhauptes nun steht der schlanke braune Gurg. Seine Hände hängen ihm still herab, er bewegt kein Glied, aber sein sonst so starres Gesicht ist weich, gelöst und tief beseeligt, seine Augen sprühen in einem fast irren Glanz. Der Mund des Elefantenrüssels gleitet über ihn dahin in schnellen und seltsamen Kurven, wie die tastende Hand eines Blinden sich einen fremden und doch sehnsüchtig erwarteten Menschen zu eigen macht, so fährt der Rüssel über seine Glieder, so macht das gewaltige Tier sich seinen Leib zu eigen. Und dann schlägt er seinen Rüssel in die Höhe, und dem geöffneten Spalt seines Maules entspringt die grelle Trompete der Freude …
Sahabeth, der Alte, der auf diese seltsame Handlung gestarrt hat wie auf ein Märchenspiel, das allem Wissen und aller Vernunft zum Trotz Wirklichkeit geworden ist vor seinen Augen, Sahabeth, der vieles gesehen hat in seinem Leben, das den Elefanten gewidmet gewesen ist, ihrer Jagd, ihrem Fang und ihrem Dienst, Sahabeth schrickt zusammen und sieht verstört um sich. Um ihn ist Wispern und Geflüster, gehässiges Zischeln und die dunklen Laute der maßlosen Verwunderung. Die Mahouts haben ihre Plätze verlassen, angezogen von dem Unbegreiflichen, das da vor ihren Augen geschah, sie drängen sich neben und hinter ihren Obersten, sie raunen und tuscheln, sie weisen mit zitternden Fingern auf das Wunder.
Jetzt aber schweigen sie und schauen erstarrt. Gurg hat sich umgewandt, beide Hände über seinen Kopf erhoben, streicht er die schweren Kiefern des Elefantenhauptes, unter dem er steht. Dann aber beugt er sich, schlingt beide Arme um den linken Fuß Ramas, des Bösen, zieht an – und es ist, als höbe er die Säule des Beines in die Höhe. Und schon steht er auf ihrer Beuge, schon tritt er in das Schultergelenk, greift in den Ohrrand nahe seiner Wurzel, ein Schwung noch – da, seht, seht: Schon sitzt er im Nacken des Elefanten, im Nacken Ramas, des Bösen, des Fürchterlichen, des Niegezähmten, im Nacken Ramas, der ein Sohn Parvatis ist und sein Leben dunklem blutigem Dienst geweiht hat, seht es an, das Wunder, seht nur, seht! Es ist geglückt, beide Hände hebt Gurg im stillen Jubel über seinen Kopf, aber dann beugt er sich wieder vor, legt sich über den gewaltigen Schädel und streicht Ramas Stirn und die breiten Flächen seiner Backen. Als er sich wieder aufrichtet, leuchten seine Augen, hell und gebieterisch schwingt sich seine Stimme: »Kettet ihn los, Männer von Masherbara, kettet ihn los, Rama, den Großen, Rama, den Einzigen, ich will ihn reiten, ich will ihn führen!«
Sie stehen wie versteinert – da springt schon der Hohn von seinen Lippen: »Fürchtet ihr euch, ihr mutigen Männer? Habt keine Angst, Rama beachtet euch nicht, klein und niedrig seid ihr vor seiner Größe. Ich aber bin sein Freund, ich darf ihm dienen, und er geruht, auf meine Worte zu hören. Für euer Leben bürge ich, kühne Männer des großen Radscha – kettet ihn los!«
Da sind Guru und Ali schon von hinten herangesprungen, drehen mit fliegenden Fingern die Muttern von den starken Schrauben, mit denen die Ketten zusammengehalten werden, klirrend schlagen sie auseinander, und Rama ist frei. Langsam und schwer tritt er unter dem Schattendach hervor und auf den Hof hinaus.
Sahabeth, der Alte, fährt auf wie aus tiefem Schlaf. Er hat ein Märchen gesehen, er hat gesehen, was nicht wirklich sein kann, er hat gesehen, wie der Traum eines heißen, jungen Herzens Leben und Wahrheit wurde – gesegnet immerdar seien seine Augen! Und er glaubt auch jetzt noch nicht, was er sieht: Rama, der Böse, der langsam über den Hof zieht, den schlanken goldbraunen Gurg in seinem Nacken.
Aber dann erwacht er, denn er hört nahe neben sich leise und verzweifelt den dicken Sadullah raunen: »Bei Wischnu, dem Erhalter, das Tor – das Tor steht geöffnet!«
Das große Tor zum Elefantenhof – und Rama ist frei! Da verlässt den Alten die Ruhe des Erfahrenen und die Würde seiner Jahre, Erregung und Zorn brennen auf in ihm in jacher, steiler Flamme, er trägt die Verantwortung für alles, was geschieht mit den Elefanten und auch für das, was sie anrichten mit ihrer großen Kraft. Das Blut schießt ihm in das Gesicht, und mit vollen Lungen schreit er die Umstehenden an: »Schließt das Tor, ihr Söhne törichter Hündinnen, schließt das Tor, ihr Tagediebe und Nichtsnutze!«
Und im Augenblick rennen vier, fünf Männer über den in der Sonne flirrenden weiten Sandplatz, was ihre Beine nur hergeben wollen, das große Eisentor zu sperren und zu sichern – und da geschieht es …