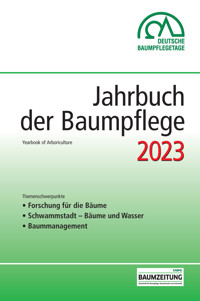
Jahrbuch der Baumpflege 2023 E-Book
35,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymarket Media
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Jahrbuch der Baumpflege
- Sprache: Deutsch
Das „Jahrbuch der Baumpflege 2023“ enthält die Fachvorträge, die auf den Deutschen Baumpflegetagen 2023 in Augsburg gehalten werden. In dieser Ausgabe sind 24 Fachartikel zu den folgenden Themenschwerpunkten enthalten: - Forschung für die Bäume - Schwammstadt – Bäume und Wasser - Baummanagement Außerdem im Jahrbuch der Baumpflege 2023 zu finden sind: - Adressen von Verbänden und Forschungseinrichtungen - Adressverzeichnis Baumpflege - Gesamtregister 1997 bis 2023 mit Autoren- und Stichwortverzeichnis umfasst über 800 Fachartikel Das Jahrbuch der Baumpflege ist Nachschlagewerk und Fachbuch in einem. Hier findet der Leser aktuelles Fachwissen zum Thema Baumpflege – wissenschaftlich korrekt und zugleich verständlich und plausibel aufbereitet. Das Buch wird von erfahrenen Praktikern, Arboristen, Sachverständigen und Wissenschaftlern gleichermaßen als Informationsquelle genutzt. Das Jahrbuch der Baumpflege erscheint 2023 in der 27. Ausgabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Herausgeber:
Prof. Dr. Dirk Dujesiefken, Dipl.-Ing. Thomas Amtage, Veranstalter der Deutschen Baumpflegetage,
Dr. Markus Streckenbach, Sachverständigenbüro für urbane Vegetation, Bochum
Redaktionelle Betreuung: Dipl.-Ing. Agrar Martina Borowski, Braunschweig
Herausgeber-Beirat 2023:
Dipl.-Ing. Tanja Büttner, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL), Bonn
Dipl.-Ing. Andreas Detter, Brudi & Partner TreeConsult, Gauting
Dipl.-Biol. Gerhard Doobe, Redaktion der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz, Hamburg
B. Sc. Stefan Düsterdiek, Institut für Baumpflege, Hamburg
Prof. Dr. Thorsten Gaertig, HAWK Göttingen, Studiengang Arboristik
Prof. Dr. Rolf Kehr, HAWK Göttingen, Studiengang Arboristik
Prof. Rudolf Klingshirn, Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V., München
Dipl.-Ing. Gudrun Kloos, Baureferat Gartenbau der Landeshauptstadt München
Dipl.-Biol. Thomas Kowol, Institut für Baumpflege, Hamburg
M. Eng. Michael Müller-Inkmann, Sachverständigenbüro Baum und Boden, Möhnesee
Prof. Dr. Klaus Richter, Dr. Michael Risse, Holzforschung München, TU München
Dr. Axel Schneidewind, Hamersleben
Dr. Thomas Schröder, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Bonn
Dipl.-Biol. Anette Vedder, Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen, Stadt Augsburg
Dr. Cedric Vornholt, Rechtsanwalt bei FPS Partnerschaftsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Katharina Weltecke, Boden & Baum, Bad Arolsen
Die Deutsche Bibliothek – CIP Einheitsaufnahme
Jahrbuch der Baumpflege … :
Yearbook of Arboriculture
Braunschweig: Haymarket Media
Erscheint jährlich – Aufnahme nach 1997
ISSN 1432–5020
ISBN 978–3–87815–283–5
Haymarket Media GmbH
Postfach 83 64, 38133 Braunschweig
Telefon: +49 531 38 00 4–0, Fax: –25
www.baumzeitung.de
Satz und Umbruch: Sigert GmbH, Braunschweig Druck: Kunst- und Werbedruck GmbH & Co KG, Bad Oeynhausen
Die Veröffentlichungen erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Für Fehler und Unrichtigkeiten kann Schadenersatz nicht geleistet werden. Alle Rechte vorbehalten. Für die namentlich gekennzeichneten Beiträge zeichnen die jeweiligen Autoren verantwortlich.
Redaktionsschluss: März 2023
© 2023 Haymarket Media GmbH, Braunschweig
27. Jahrgang
Das „Jahrbuch der Baumpflege 2023“ ist auch als E-Book erhältlich:
ISBN 978-3-87815-284-2 im PDF-Format
ISBN 978-3-87815-285-9 im ePub-Format
Auf www.united-kiosk.de/kiosk-haymarket/ steht das „Jahrbuch der Baumpflege 2023“ ebenfalls zum Download bereit und kann hier erworben werden.
Das Buch und alle in ihm enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine anderweitige Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit der vorliegenden Ausgabe halten Sie das 27. Jahrbuch der Baumpflege in den Händen. Es erscheint zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Baumpflegetage.
Neu ab diesem Jahr ist, dass die Herausgeberschaft dieser Buchreihe fortan von drei Personen getragen wird: Dirk Dujesiefken, Thomas Amtage und Markus Streckenbach. Seit Jahren arbeiten wir in vielfältiger Weise vertrauensvoll zusammen und sind seit dem letzten Herbst als Team für dieses Fachbuch und Nachschlagewerk tätig. Gemeinsam wollen wir mit dem Jahrbuch die Inhalte der Deutschen Baumpflegetage der Praxis zur Verfügung stellen. Wir freuen uns auf diese gemeinsame Arbeit für die Baumpflege.
Wie gewohnt ist dieses Jahrbuch der Baumpflege in vier Kapitel gegliedert. Es enthält die Inhalte der Fachvorträge zu den Deutschen Baumpflegetagen 2023. Die Themen dieser drei Veranstaltungstage finden sich jeweils in den Kapiteln 1, 2 und 3. Das Kapitel 4 enthält die Inhalte der wissenschaftlichen Kurzvorträge, die über die drei Veranstaltungstage verteilt stattfinden. Diese Kurzvorträge sind im Tagungsprogramm entsprechend gekennzeichnet.
Wir danken allen Autorinnen und Autoren für die qualitativ hochwertigen Beiträge und für die gewissenhafte Prüfung der Manuskripte dem Herausgeber-Beirat (s. S. 2). Weiterhin danken wir Martina Borowski für die sorgfältige redaktionelle Betreuung dieses Werkes. Dem Verlag Haymarket Media danken wir für die hervorragende Ausstattung dieses Buches und die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Hamburg, im März 2023
DIRK DUJESIEFKEN, THOMAS AMTAGE, MARKUS STRECKENBACH
Dear reader,
With this 2023 issue, you are holding the 27th Yearbook of Arboriculture in your hands. It is published on the occasion of the 30th anniversary of the German Tree Care Conference. New, as of this year, is that the ongoing editorship of this book series will be shared by three people: Dirk Dujesiefken, Thomas Amtage and Markus Streckenbach. For many years we have been working together in a spirit of trust in a variety of ways, and since last fall have been engaged as a team producing this technical book and work of reference. Together, we want to use the yearbook to make the contents of the German Tree Care Conference available to practitioners. We are looking forward to this collaboration for arboriculture.
As usual, this Yearbook of Arboriculture is divided into four chapters. It contains the contents of the lectures on the German Tree Care Conference 2023. The topics of the three days of events can be found in Chapters 1, 2 and 3 respectively. Chapter 4 contains the contents of the short scientific lectures that will be held over the three days of events. We would like to thank all of authors for their high-quality contributions and the Editorial Advisory Board for its thorough review of the manuscripts (see page 2). We would especially like to thank Martina Borowski for her careful editorial supervision of this work and would also like to thank the publisher Haymarket Media for the excellent layout of this book and the many years of trusting cooperation.
Hamburg, March 2023
DIRK DUJESIEFKEN, THOMAS AMTAGE, MARKUS STRECKENBACH
Für Ihren Terminkalender:
Die nächsten Deutschen Baumpflegetage finden statt vom 23.–25. April 2024.
Kontaktanschrift: Forum Baumpflege GmbH & Co. KG, Geschäftsstelle: Brookkehre 60, 21029 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 55 26 07 07, Fax: +49 (0)40 55 26 07 28, www.Deutsche-Baumpflegetage.de
Redaktionsschluss für das Jahrbuch der Baumpflege 2024 ist der 1. Dezember 2023.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Trauer um PROFESSOR DR. WALTER LIESE
D. DUJESIEFKEN
Baum des Jahres 2023: die Moor-Birke (Betula pubescens) – ihre Eigenschaften und Besonderheiten
A. ROLOFF
1Forschung für die Bäume
Baumpflege: Die Entwicklung einer komplexen Aufgabe im Stadtgrün – 30 Jahre Deutsche Baumpflegetage
H. BAUMGARTEN
Daten lügen nicht, wenn man sie lesen kann – Warum Statistik für die Baumpflege wichtig ist
H. MERKEL
Sagt die Form einer Vergabelung etwas über deren Bruchsicherheit?
S. RUST
Einsatz von Druckluftlanzen im Boden – Quantifizierung des Sanierungserfolges mit Laserscanaufnahmen der Bodenoberfläche
O. LÖWE, D. SEIDEL, K. WELTECKE, T. GAERTIG
2Schwammstadt – Bäume und Wasser
Bäume unter Wasser – Ein kritischer Blick auf Baumstandorte mit Rigolenfunktion
G. DOOBE, M. STRECKENBACH
Urbane Böden: Leistungen und zukünftige Herausforderungen für Stadtbäume
A. ESCHENBACH, A. SCHÜTT, J. N. BECKER
Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung an Baumstandorten
M. RICHTER, W. DICKHAUT
Bäume und Regenwasser-Management – 20 Jahre Erfahrung mit dem Stockholmer Modell
B.-M. ALVEM, J. JOSEFSSON, N. ROSS
Das Stockholmer Pflanzsystem in der Stadt Graz – vom Pilotprojekt zur bewährten Standardbauweise
T. STOISSER
3Baummanagement
Zur Effektivität von Baumschutzsatzungen anhand von Beispielen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen
D. MÜHLLEITNER, C. BUSCH, P. FEHRMANN, K. FROBEL
i-Tree: ein leistungsfähiges Instrument zur Schaffung von gesundem Stadtgrün mit Schwerpunkt auf Ökosystemdienstleistungen
M. ROTTEVEEL
Widerstandsfähigkeit und Kronenrückzug bei Baumveteranen: Wie sind die Symptome zu deuten?
T. JOYE
Nachvollziehbar und nachprüfbar: Die Anforderungen an ein schriftliches Gehölzgutachten
D. DUJESIEFKEN
Die „Essbare Stadt“ – geeignete Obstsorten für den urbanen Raum
S. TATSCHL
Baumveteranen und Nationalerbe-Bäume – Faszination, Besonderheiten, Risiken und Chancen
A. ROLOFF
4Wissenschaftliche Kurzberichte
Von der Baumrigole zum Boden-Rohr-System – Erweiterung des Speicher- und Wurzelraums durch Nutzung des Leitungsgrabens
C. BENNERSCHEIDT
Auswirkung einer pneumatischen Bodensanierung auf Stiel-Eichen: Ergebnisse eines dreijährigen Feldversuchs
F. FUNKE, S. RUST, M. MÜLLER-INKMANN
Identifikation von Belüftungsstörungen im Boden mit einem praxistauglichen mobilen CO2-Messgerät
T. GAERTIG, O. LÖWE, E. W. KURTH, O. THIERS, K. WELTECKE
Bewertung von Stadtbaumökosystemleistungen in deutschen Kommunen
H. A. PILLSTICKER, S. RUST
Erzielen Schalltomografie und Zugversuch vergleichbare Ergebnisse?
S. RUST, A. DETTER
Stammschäden an jungen Straßenbäumen: Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung
S. RUST, D. SCHNEIDER-BLANK, R. KEHR
Sanierung von Bodenschadverdichtung mit Pflanzen
K. WELTECKE, O. LÖWE, T. GAERTIG
5Verbände und Forschungseinrichtungen
Institute, Forschung und Lehre
Verbände
Weitere Organisationen und Vereine
Pflanzenschutzdienste
6Adressverzeichnis Baumpflege
Hinweise zur Benutzung
6.1 Baumpflegefirmen
6.2 Sachverständige
6.3 Produkte und Dienstleistungen
Inserenten-Verzeichnis
7Gesamtregister 1997-2023
Hinweise zur Benutzung
Autorenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Content
Mourning PROFESSOR DR. WALTER LIESE
D. DUJESIEFKEN
Tree of the year 2023: Downy Birch (Betula pubescens) – Features and Characteristics
A. ROLOFF
1Research for trees
Tree Care: The Development of a Complex Task in Urban Green Space – 30 years German Tree Care Conference
H. BAUMGARTEN
Data Don’t Lie if You Can Read Them – Why Statistics Are Important for Tree Care
H. MERKEL
Does a fork’s shape indicate its resistance to fracture?
S. RUST
Use of compressed air lances in the soil – quantification of the remediation success based on laser scanning images of the ground surface
O. LÖWE, D. SEIDEL, K. WELTECKE, T. GAERTIG
2Sponge city – Trees and water
Submerged Trees – a Critical Appraisal on Tree Pits with High Infiltration Capacity
G. DOOBE, M. STRECKENBACH
Urban Soils: Achievements and Future Challenges for Urban Trees
A. ESCHENBACH, A. SCHÜTT, J. N. BECKER
Decentralized Stormwater Management at Tree Sites
M. RICHTER, W. DICKHAUT
Trees and Storm water Management – 20 years of experience with the Stockholm model
B.-M. ALVEM, J. JOSEFSSON, N. ROSS
The Stockholm Planting Beds in the City of Graz – from a Pilot Project to the Proven Standard
T. STOISSER
3Tree management
The Effectivity of Tree Protection Regulations using the Examples of Bavaria and North Rhine-Westfalia
D. MÜHLLEITNER, C. BUSCH, P. FEHRMANN, K. FROBEL
i-Tree: a powerful tool for creating healthy urban forests with a focus on ecosystem services
M. ROTTEVEEL
Resilience and crown retrenchment in veteran trees: how to interpret the signs?
T. JOYE
Understandable and testable: The requirements for a written expertise on trees
D. DUJESIEFKEN
The „Edible City“ – Suitable Fruit Tree Species for Urban Areas
S. TATSCHL
Ancient and National Heritage Trees – Fascination, Characteristics, Risks and Prospects
A. ROLOFF
4Short scientific communications
From Tree Infiltration Ditches to Soil-Pipe-System – Expanding Water Storage and Root Space by Using Pipe Trenches
C. BENNERSCHEIDT
Effects of Pneumatic Soil Remediation on Common Oak: Results of a Three-year Field Experiment
F. FUNKE, S. RUST, M. MÜLLER-INKMANN
Identification of soil aeration deficiencies with a practical mobile CO2 measuring device
T. GAERTIG, O. LÖWE, E. W. KURTH, O. THIERS, K. WELTECKE
Valuation of Urban Tree Ecosystem Services in German Municipalities
H. A. PILLSTICKER, S. RUST
Do sonic tomography and static load tests achieve comparable results?
S. RUST, A. DETTER
Trunk Damage on Young Street Trees: Results of a Nationwide Survey
S. RUST, D. SCHNEIDER-BLANK, R. KEHR
Remediation of harmful soil compaction with plants
K. WELTECKE, O. LÖWE, T. GAERTIG
5Associations and Research Institutes
Institutes, research and teaching
Professional associations
Other organisations and associations
Plant protection services
6Address register for tree care
Reference for use
6.1 Tree care companies
6.2 Experts
6.3 Products and services
Index of advertisers
7Overall Index 1997–2023
Reference for use
Register of authors
Register of catchwords
Trauer um Professor Dr. Walter Liese
Mourning Professor Dr. Walter Liese
von Dirk Dujesiefken
Am 24. Februar 2023 ist PROF. DR. DR. H.C. MULT. WALTER LIESE im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Reinbek bei Hamburg nach kurzer Krankheit gestorben. Der Forstwissenschaftler war der Wegbereiter für eine baumbiologisch orientierte Baumpflege in Deutschland. Er setzte sich bis ins hohe Alter für einen fachlichen Austausch unter Kollegen ein. Durch seinen Tod hat die Forschung einen herausragenden, weltweit anerkannten Wissenschaftler und Kollegen verloren.
On February 24, 2023, PROF. DR. DR. H.C. MULT. WALTER LIESE died at the age of 97 at his home in Reinbek near Hamburg following a short illness. As forest scientist he pioneered tree biology-oriented tree care in Germany and was committed to professional exchange among colleagues right up into his old age. Through his death, research has lost an outstanding, globally respected scientist and colleague.
Leben
Verstorben mit 96 Jahren: PROF. DR. WALTER LIESE
WALTER LIESE wurde am 31. Januar 1926 in Berlin geboren und wuchs im nahe gelegenen Eberswalde auf, wo sein Vater JOHANNES LIESE an der Forstlichen Hochschule tätig war. Nach Arbeits- und Kriegsdienst im Zweiten Weltkrieg studierte er Forstwirtschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Georg-August-Universität Göttingen in Hannoversch Münden. Bereits 1951 promovierte er dort im Alter von 25 Jahren.
Zwischen 1951 und 1963 war WALTER LIESE zunächst wissenschaftlicher Assistent an der Forstlichen Versuchsanstalt Nordrhein-Westfalen, arbeitete ein Jahr in der Holzschutzindustrie und ging 1953 als wissenschaftlicher Assistent an das Forstbotanische Institut der Universität Freiburg. Hier habilitierte er 1957.
1959 wurde WALTER LIESE außerplanmäßiger Professor am Forstbotanischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Von 1963 bis zu seiner Emeritierung 1991 war WALTER LIESE ordentlicher Professor für Holzbiologie an der Universität Hamburg und Direktor des Instituts für Holzbiologie und Holzschutz der Bundesforschungsanstalt für Forst und Holzwirtschaft (BFH) in Hamburg. Er war zugleich in mehreren internationalen Organisationen tätig. Hervorzuheben ist seine Präsidentschaft beim Internationalen Verband der Forstlichen Versuchsanstalten (IUFRO) von 1977 bis 1981.
In seiner Zeit in Hamburg hat WALTER LIESE mehr als 40 Doktor arbeiten und 75 Diplomarbeiten betreut. Er war zudem Mitherausgeber von fünf wissenschaftlichen Zeitschriften. Weiterhin war er als Gastwissenschaftler sowie als Technischer Berater mit über 100 Einsätzen in 30 Ländern weltweit tätig.
Außer den Bäumen in der Stadt gehörte auch der Bambus zu den Forschungsgebieten von PROFESSOR LIESE.
Wissenschaftliche Arbeiten
PROFESSOR LIESE war ein besonders vielseitiger Wissenschaftler, der zahlreiche Fachgebiete entscheidend mitgestaltet hat. Dazu zählen die Holzanatomie, speziell die submikroskopische Struktur der Zellwand und der Tüpfel, die Dendrochronologie, die Physiologie holzzerstörender Pilze sowie der Holzabbau und der Holzschutz. Zudem galt sein besonderes Interesse dem Bambus. Er galt weltweit als der Bambus-Experte und hielt viele Vorträge über die Biologie, Eigenschaften sowie Verwendungsmöglichkeiten von Bambus.
In den 1950er Jahren hatte WALTER LIESE auch Kontakte zu den Brüdern RUSKA, beide Professoren in Berlin. ERNST RUSKA erhielt 1986 als Miterfinder des Elektronenmikroskops den Nobelpreis für Physik. Diese für seine wissenschaftliche Laufbahn richtungsweise Zusammenarbeit ermöglichte ihm die ersten Untersuchungen am Holz mit Hilfe der Elektronenmikroskopie. Bereits in seiner Dissertation befand sich das weltweit erste elektronenmikroskopische Bild einer Holzmikrostruktur.
Stadtbäume, deren Wundreaktionen sowie die Fragen der Baumpflegepraxis waren in den letzten 40 Jahren ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld von WALTER LIESE. Durch seine vielfältigen Kontakte war er auch mit den Arbeiten des amerikanischen Forstwissenschaftlers DR. ALEX SHIGO vertraut, der 1984 durch seine Vorträge in Deutschland für Verunsicherung sorgte. Nachfolgend hat PROFESSOR LIESE die zum Teil sehr emotionalen Diskussionen wieder versachlicht und konnte in dem damaligen Meinungsstreit die Wogen glätten. Hierbei hat er seine holzbiologischen Erfahrungen eingebracht und mehrere Forschungsprojekte initiiert.
Die Ergebnisse aus den verschiedenen, häufig gemeinsamen, Projekten der Universität Hamburg, der BFH sowie dem Institut für Baumpflege sind heute wesentlicher Bestandteil des Wissens in der Baumpflege. Die Befunde helfen, die Wundreaktionen von Bäumen zu verstehen und zeigen die Möglichkeiten und Grenzen baumpflegerischer Maßnahmen. PROFESSOR LIESE hat daher entscheidend dazu beigetragen, dass in Deutschland aus der althergebrachten Baumchirurgie eine baumbiologisch orientierte Baumpflege geworden ist.
Aus den vielen Projekten von PROFESSOR LIESE sind über 500 wissenschaftliche Publikationen und diverse Bücher entstanden. Das letzte Werk ist erst im letzten Jahr erschienen: Das CODIT-Prinzip – Baumbiologie und Baumpflege (Autoren: DIRK DUJESIEFKEN und WALTER LIESE), Haymarket Media, Braunschweig, 2022.
Ehrungen
WALTER LIESE erhielt insgesamt fünf Ehrendoktortitel, und zwar in Sopron/Ungarn (1986), Zvolen in der damaligen Tschechoslowakei (1987), Istanbul/Türkei (1987), Poznań/Polen (1991) und Ljubljana/Slowenien (1994). Er war Professor der Universität Nanjing/ China und Ehrenmitglied wissenschaftlicher Akademien in Frankreich, Indien, Italien sowie Polen. PROF. DR. DR. H.C. MULT. WALTER LIESE erhielt außerdem wissenschaftliche Ehrungen in folgenden Ländern: China, DDR, Deutschland, Finnland, Frankreich, Ghana, Großbritannien, Indien, Malaysia, Philippinen, Polen, Slowakei, Ungarn, Taiwan, Tschechoslowakei und in den USA.
Der Brückenbauer
WALTER LIESE hatte Kontakte in der ganzen Welt. Er war ein Netzwerker und in vielfältiger Weise auch Brückenbauer. Besonders lag ihm die Förderung und Einbindung von Kollegen aus Entwicklungsländern am Herzen. Auf diplomatischer Ebene war einer seiner erwähnenswerten Erfolge, dass es ihm gelang, für den IUFRO-Weltkongress in Kyoto 1981 Wissenschaftler aus der Volksrepublik China und Taiwan zusammenzubringen. Auch in Europa war WALTER LIESE in diplomatischer Mission unterwegs. In Zeiten des Kalten Krieges bemühte er sich über Jahrzehnte um Kontakte zwischen Ost und West und lud Kollegen aus dem Ostblock zu internationalen Tagungen und nach Hamburg ein. Bei Besuchen in Osteuropa war er meist schwer beladen und hatte Bücher, Gerät und manchmal sogar dringend benötigte Medikamente für die Kollegen in seinem Gepäck.
Durch den Tod von WALTER LIESE haben wir einen engagierten Wissenschaftler, langjährigen Kollegen und Freund verloren.
Literatur
DUJESIEFKEN, D.; GROSSER, D.; KOWOL, T.; WEGENER, G., 2006: PROFESSOR DR. WALTER LIESE – Der Wegbereiter für eine baumbiologisch orientierte Baumpflege in Deutschland. In: DUJESIEFKEN, D.; KOCKERBECK, P. (Hrsg.): Jahrbuch der Baumpflege. Haymarket Media, Braunschweig, 9–10.
Forest Research Institute Malaysia (FRIM), 2016: A Tribute to WALTER LIESE. FRIM, 37 S.
Thünen-Institut für Holzforschung, Zentrum Holzwirtschaft, Gesellschaft der Förderer und Freunde des Zentrums Holzwirtschaft, Bund Deutscher Holzwirte (Hrsg.) 2016: Festschrift zum 90. Geburtstag von PROF. DR. DR. H.C. MULT. WALTER LIESE. Vorträge und Erinnerungen anlässlich des Kolloquiums am 11. November 2016 im Schloss Reinbek. 94 S.
Autor
Prof. Dr. Dirk Dujesiefken
Institut für Baumpflege
Brookkehre 60
212029 Hamburg
Tel. (040) 7241310
Baum des Jahres 2023
Baum des Jahres 2023: die Moor-Birke (Betula pubescens) – ihre Eigenschaften und Besonderheiten
Tree of the Year 2023: Downy Birch (Betula pubescens) – Features and Characteristics
von Andreas Roloff
Zusammenfassung
Anlass für die Wahl der Moor-Birke als Baum des Jahres 2023 ist die sehr kritische Situation vieler (ehemaliger) Moorstandorte: Sie sind großflächig entwässert und anderen Nutzungsformen zugeführt worden, womit auch die Moor-Birke auf den allermeisten ihrer Naturstandorte verschwunden ist. Aufgrund der zahlreichen Gemeinsamkeiten und fließenden Übergänge der Artmerkmale zwischen Moor- und Sand-Birke (Betula pendula) infolge ihrer Hybridisierung werden sie hier beide vergleichend vorgestellt. Birken sorgen – auch im Winter – durch ihre weiße Rinde für Abwechslung und Heiterkeit in Stadt, Landschaft und Wäldern und sind mit frischen grünen Blättern der Inbegriff des Frühlings. Ihre lichten Kronen lassen viel Licht durch, zudem haben sie eine schöne goldgelbe Herbstfärbung.
Summary
The reason for choosing Downy Birch as ‚Tree of the year‘ 2023 in Germany is the critical situation of many (former) bog sites: they have been drained on larger areas and transformed into other types of use (mainly farmland). Therefore most of the natural habitats of Downy Birch have been eliminated, and with them this species. Downy and White Birch (Betula pendula) are presented here both in comparison because of their numerous similarities, fluent transitions of the typical features and their hybridization. As a consequence of their white bark, birch trees create variety and cheerfulness in cities, landscapes and forests, even during winter. With their fresh light-green leaves in April they are an epitome of spring. Their transparent crowns let much light pass through, and they exhibit a wonderful golden yellow autumn colouring.
1Einleitung
Anlass der Ausrufung der Moor-Birke als Baum des Jahres 2023 ist die dramatische Situation von ehemaligen Moorstandorten in Deutschland: Sie wurden zu über 90 % seit mehr als 200 Jahren entwässert, vor allem für landwirtschaftliche Nutzung. Auch die noch nicht von dieser direkten lokalen anthropogenen Trockenlegung betroffenen verbliebenen anmoorigen und Moor-Standorte verändern sich in jüngerer Zeit durch den Klimawandel infolge Erwärmung und Häufung von extremeren Trockenperioden, aber auch durch die schon länger erhöhten Stickstoffeinträge.
Die Zersetzung von Torfschichten ehemaliger Moore trägt zudem maßgeblich zur Treibhausgas-Emission bei (es sollen über 7 % sein, www.umweltbundesamt.de). Daher wird nun mit der im November 2022 von der Bundesregierung verabschiedeten „Nationalen Moorschutzstrategie“ eine Reduktion der Treibhausgase aus Moorgebieten und die moorspezifische Biodiversität gefördert. Die Moor-Birke soll und kann insofern als Weiserbaumart für intakte nährstoffarme Moore auf diese Situation und Strategie hinweisen.
2Charakteristika und Erkennungsmerkmale
Das Auffälligste an den Birken ist wohl ihre Rinde, woran sie selbst Kinder und Baumlaien erkennen: Sie erstrahlt in der Jugend und in mittlerem Alter auch in der dunkleren Jahreszeit in hellem Weiß (Abbildung 1). Durch ihre helle Rindenfarbe kann die Birke als Baum der Freiflächen die Oberflächentemperatur ihrer Rinde deutlich verringern, da Weiß die auftreffende Strahlung zu einem erheblichen Anteil reflektiert und so eine Überhitzung des sehr empfindlichen Zellteilungsgewebes Kambium direkt unter der Rindenoberfläche verhindert wird. Dies ist wegen der sehr dünnen Rinde bedeutsam.
Abbildung 1: Typischer Habitus der Moor-Birke ohne lang herabhängende Zweige (Usedom am Achterwasser)
Die weiße Rindenfarbe kommt durch den Farbstoff Betulin zustande, der ständig an die Oberfläche gelangt und die Rinde wasserundurchlässig macht. Ältere Rindenschichten, die sich außen befinden, lösen sich regelmäßig und für die Birke charakteristisch vom Stamm ab, indem sich größere Streifen waagerecht einrollen und dann abringeln. Darunter kommen immer wieder neue weiße bzw. helle Rindenschichten zum Vorschein (Typ Ringelrinde). Die Rinde der Sand-Birke ist heller und glänzender als die der Moor-Birke – bei Moor-Birken ist sie matter, aber auch bei Sand-Birken wird sie durch Algenbeläge oft matt. Im Alter kann sich am Stammfuß von Sand-Birken eine dicke, dunkle Schuppenborke bilden, was bei der Moor-Birke nicht auftritt. D. h. wenn alte Birken am Stammfuß Schuppenborke aufweisen, müssen es Sand-Birken sein. Leider gilt das aber zur Unterscheidung nicht umgekehrt: Birken ohne Schuppenborke können beide Arten sein, und 90 % der Sand-Birken haben am Stammfuß ebenfalls keine Schuppenborke, da die sich erst im Alter und bei etlichen Sand-Birken gar nicht bildet. Die dünne und helle Rinde führt dazu, dass man Birkenstämmen ihre genaue Lebensgeschichte sehr gut ansehen kann: Jeder früher vorhanden gewesene Ast ist für lange Zeit in seiner Lebensdauer, ehemaligen Stärke und seinem Abgangswinkel eindeutig dokumentiert und rekonstruierbar durch die Narben und deren sog. „Chinesenbärte“ (seitliche Winkelnarben) auf der Rindenoberfläche. Zudem bilden die Rindenporen (Lentizellen) markante waagerechte schwarze Striche auf der Rinde – je älter die Lentizellen sind, desto länger der Strich (Abbildung 2).
Abbildung 2: Dünne glatte Rinde mit strichförmigen Lentizellen, Astnarben und „Chinesenbärten“
Am Habitus fällt auf, dass die Zweige der Sand-Birke steiler stehen als die der Moor-Birke und an den Spitzen mähnenartig überhängen, was ihr auch den Namen Hänge-Birke eingebracht hat. Bei Moor-Birken dürfen sie nicht deutlich lang herabhängen (Abbildung 1). Birken können 20-30 m hoch werden und einen Stammumfang von 2,50 m (selten 3 m) erreichen. Ihr Höchstalter beträgt 80 (selten bis oder über 100) Jahre. Die Moor-Birke erreicht dabei nicht ganz die Dimensionen und das Alter von Sand-Birken.
Zu verwechseln ist die Moor-Birke bei uns nur mit der Sand-Birke. Wie die Namen bereits andeuten, sollten sie dementsprechend eigentlich auf deutlich unterschiedlichen Standorten vorkommen. Allerdings kann man sich darin nicht sicher sein, da es mehr Ausnahmen davon gibt als dass dies zutrifft (s. im folgenden Kapitel unter Ökologie).
Ein Blick auf die Blätter und jungen Zweige schafft in der Regel Klarheit bei der Unterscheidung beider Arten: Die einjährigen Triebe der Sand-Birke sind kahl, durch kleine Harzdrüsen sehr rau und etwas klebrig (weshalb sie oft auch Warzen-Birke genannt wird). Die Triebe der Moor-Birke sind dagegen fühlbar behaart (im engl. Downy Birch: Flaum-Birke) und ohne Harzdrüsen (Abbildung 3).
Abbildung 3: Die entscheidenden Unterschiede zwischen beiden Birkenarten (aus ROLOFF & BÄRTELS 2018, T: Trieb, OS: Oberseite, US: Unterseite; Erläuterung im Text)
Die Blätter der Moor-Birke sind unregelmäßig gesägt und unterseits zumindest in den Nervenwinkeln mit sog. Achselbärten behaart, die der Sand-Birke dagegen doppelt gesägt (d. h. die groben Blattrandzähne sind in sich nochmals gesägt) und unterseits kahl (Abbildung 3). Die Hauptnerven der Moor-Birkenblätter sind blattunterseits deutlich fühlbar, die der Sand-Birke dagegen kaum. Zwar gibt es auch (selten bzw. unklar wie häufig) Hybride zwischen beiden Arten, diese sind aber aufgrund der unterschiedlichen Chromosomenzahlen beider Arten steril und können daher keine Nachkommen erzeugen.
Die Herbstfärbung beider Birken ist oft rein goldgelb und hält meist bis in den November an, was sehr zum Farbwechsel in der Landschaft und in Wäldern beiträgt.
Die Blüten stehen in Kätzchen, männliche und weibliche getrennt. Dabei überwintern die männlichen ungeschützt (sie sind daher schon im Juli des Vorjahres zu sehen), die weiblichen hingegen erscheinen erst beim Austrieb im Frühjahr aus den Knospen. Die Blüte findet infolge des frühen Austreibens der Birke trotzdem meist schon Ende März statt (Abbildung 4), früher als bei vielen anderen Baumarten. Auf Schauapparate zum Anlocken von Insekten kann die Birke ganz verzichten, da sie vom Wind bestäubt wird und der Pollen – sehr zum Verdruss der Heuschnupfen-Empfindlichen – weithin durch die Luft verfrachtet wird. Daher wissen Allergiker den Blütezeitraum der Birken jedes Jahr genau (und fürchten ihn).
Abbildung 4: Baum in voller Blüte, für Birkenpollen-Allergiker eher unerfreulicher Anblick
Die Früchte sind winzige Nüsse mit zwei Flügeln, sog. Flügelnüsschen. Sie segeln ab August bis zum Herbst in großen Mengen aus Birkenkronen herunter. Diese große Zahl ist für eine Pionierbaumart wie die Birke überlebensnotwendig. Sie bringt es aber mit sich, dass Birken in der Stadt zur häufigsten Streit-Baumart zwischen Nachbarn geworden sind. Birkenfrüchte können bei Wind bis zu mehrere hundert Meter weit fliegen. Keimlinge, die noch im Spätsommer mit der Entwicklung beginnen, werden meist vom Frost zunichte gemacht, die Überzahl keimt jedoch erst im Frühjahr und umgeht damit dieses Problem.
Birken entwickeln ein herzförmiges Wurzelsystem und im Oberboden ein sehr dichtes Feinwurzelgeflecht. Sie können viel Wasser verdunsten. Auf Nass- und Moorstandorten wurzeln sie extrem flach und bilden Wurzelteller aus (Abbildung 5), da sie mit ihren Wurzeln nicht in länger nasse Bereiche hineinwachsen.
Sie gehören wegen ihrer Kätzchen und Nussfrüchte gemeinsam mit Haselnuss, Erlen und Hainbuchen zur Familie der Birkengewächse.
Abbildung 5: Extrem flacher Wurzelteller im Moor
3Vorkommen und Ökologie
Die Verbreitungsgebiete von Sand- und Moor-Birke erstrecken sich sehr ähnlich fast über ganz Europa, bis auf den südlichsten Bereich am Mittelmeer und Teile Südosteuropas. Dabei kommt die Moor-Birke weiter nach Nordwesten (bis nach Island und Süd-Grönland) und Nordosten vor (bis weit nach Sibirien) und steigt im Gebirge höher (bis über 2.000 m) als die Sand-Birke. Deren Areal reicht südlich weiter in den europäischen Mittelmeerraum.
Sand- und Moor-Birke sind Baumarten, die es aufgrund ihres sehr hohen Lichtbedarfs im natürlichen Konkurrenzgeschehen gegen andere Baumarten schwer haben. Sie sind der Inbegriff von Pionierbaumarten (Abbildung 6) mit fast allen dafür charakteristischen Eigenschaften:
• Blüte schon im Alter von wenigen Jahren,
• jährlich reichliche Samenproduktion,
• weit fliegende Samen,
• extreme Anspruchslosigkeit hinsichtlich Nährstoffbedarf und Wasserversorgung,
• schraubige Blattstellung und allseitige Zweigausrichtung,
• herabhängende Blätter und dadurch Lichtdurchlässigkeit der Krone,
• mehrschichtige Blattanordnung,
• schnelles Wachstum,
• geringes Höchstalter (max. etwa 100 Jahre).
Abbildung 6: Pionierbaumart Moor-Birke in ihrer optimalen Standortnische
Ihre Chance besteht in ihrer frühen Fruktifikation, der großen Fruchtanzahl und der Ausbreitung durch Wind um mehrere hundert Meter. Und die Moor-Birke findet damit ihre Nische auf nassen und zugleich kalten Standorten.
Ihr Lichtbedarf ist allerdings so hoch, dass Birken sogar Schwierigkeiten haben, unter sich selbst aufzuwachsen, obwohl sie mit die lichtesten Kronen unter den einheimischen Baumarten haben.
Die Birken gehören zu den schnelllebigen Baumarten, d. h. sie erreichen i. d. R. nur ein maximales Alter von etwa 100 Jahren (ausnahmsweise bis 150 Jahre), meist nur 60-80 Jahre. Dies hört sich vielleicht kritisch an, ist aber Teil ihrer Strategie: schnell zur Stelle zu sein, wo es neue Flächen zu besiedeln gibt, dort sofort einen (Rein-)Bestand zu etablieren und sich schnell an die neue Situation anzupassen. Insbesondere zuletzt genannter Aspekt wird derzeit immer wichtiger, da sich verschiedene Umweltbedingungen schneller ändern: z. B. das Klima und im besiedelten Raum menschenverursachte Standorteinflüsse, für die Moor-Birke vor allem den Standort-Wasserhaushalt betreffend. Damit können Pionierbaumarten meist besser umgehen und durch kurze Generationszyklen schnell(er) auf solche Veränderungen reagieren.
Moor-Birken sind an ihren meist feuchten bis nassen Standort gut angepasst, nehmen aber Veränderungen des Wasserspiegels sehr übel: Sinkt oder steigt dieser in einem Birkenbruch um einige Zentimeter, sterben alle Moor-Birken ab (Abbildung 7), da sie ihre Wurzeln nicht unter die Grundwasserlinie entwickeln und flache Wurzelteller ausbilden (Abbildung 5). Sie können aber auch auf sehr trockenen Standorten, selbst in der Stadt und sogar als Alleebaum vorkommen.
Abbildung 7: Nach Absenken des Wasserspiegels in einem Moor sind alle Moor-Birken abgestorben.
Die hohe Trockentoleranz von Sand-Birken hingegen führt dazu, dass man sie an sanierungsbedürftigen Gebäuden fast regelmäßig in der Hauswand sehen kann, wobei sie den grauen abblätternden Putz etwas hinter ihrem frischen Grün verschwinden lassen. Sand-Birken wachsen auch häufig in Dachrinnen und auf Felskuppen. Zu den Ansprüchen an die Wasserversorgung ist allerdings unbedingt hinzuzufügen, dass der Einzelbaum an die Verhältnisse von Beginn an angepasst sein muss. Plötzliche Verschlechterungen des Wasserhaushaltes hingegen (z. B. durch Baumaßnahmen in der Stadt oder Extremsommer) vertragen Birken sehr schlecht, was dann sogar zum Absterben führen kann. In sehr trockenen Sommern werfen sie mit als erste Baumart einen Teil ihrer Blätter gelb verfärbt vorzeitig ab, um als Schutzmechanismus die Verdunstungsfläche zu reduzieren. Das muss noch nicht das Lebensende bedeuten.
Wenn genügend Wasser da ist, gehören die Birken allerdings zu den „Säufern“, zu den Baumarten mit dem höchsten Wasserverbrauch und mit einem besonders intensiven Wurzelsystem. Das macht man sich im Landschaftsbau teilweise zunutze, indem man sie als „Wasserpumpe“ zur Drainage von feuchten Standorten einsetzen kann. So können von einem älteren Baum bis zu 300 Liter/Tag verdunstet werden.
Eine eigene sehr umfangreiche Kontrolle an fast 2.000 Birken in Mooren Sachsens und anderer Bundesländer ergab, dass die allermeisten „Moor-Birken“ dort Sand-Birken sind, nämlich 97 % (ganz genau 1927 von 1987). Dieses Ergebnis ist – dezent ausgedrückt – ziemlich irritierend. Denn das bedeutet wohl erstens, dass die Standortsamplitude der Sand-Birke viel weiter ins Nasse (in die Moore) reicht als allgemein angenommen. Zweitens heißt dies, dass die Sand-Birke die Moor-Birke selbst von deren Moorstandorten verdrängt, insbesondere wenn diese Moore nun nicht mehr ganzjährig nass sind, was durch den Klimawandel sogar auch die wenigen noch intakten Moore betrifft. Hierzu besteht dann noch erheblicher Forschungs- bzw. Klärungsbedarf.
Selbst in einem deutschlandweit bekannten Hochmoor ist die am Holzbohlen-Moorpfad als Moor-Birke ausgeschilderte Birke eine Sand-Birke. Zudem ist die Moor-Birke auf nährstoffarme Moore mit niedrigem pH-Wert angewiesen, was sich durch die hohen Stickstoffeinträge der letzten Jahrzehnte ebenfalls erheblich verändert hat.
Es ist also nicht ausgeschlossen (so hierzu die Hypothese), dass sich die Moor-Birke großflächig fast unbemerkt auf dem Rückzug befindet, bis zum völligen Verschwinden von vielen Moor- und nassen Standorten. Es wird daher vom Autor um Meldungen von sicheren, aktuell kontrollierten Moor-Birken-Vorkommen gebeten.
Die Birken sind besonders unempfindlich gegen Frost und Klimaextreme, was auch ihr Vorkommen in ganz Europa, im hohen Norden sowie in den Hochlagen vieler Gebirge erklärt und im Waldbau ausgenutzt wird (s. u.). Temperaturen auch unter -40 °C vertragen sie problemlos (Abbildung 8), da sie dann in ihren Zweigen Stärke in Öl umwandeln und so einen Wärmespeicher entwickeln, der beim Gefrieren Wärme freisetzt. Die Pioniereigenschaften führen dazu, dass sie auf großen Flächen als erste Baumart Birkenreinbestände bilden können, dies mit Sand-Birken besonders auf sandigen Standorten oder nach Waldbränden, auf Nassstandorten auch mit Moor-Birken. Birken sind daher von Natur aus wichtige Baumarten, die eine natürliche Bewaldung einleiten können. Dies haben sie auch nach den Eiszeiten, gemeinsam mit den Kiefern, getan und damals die Wiederbewaldung begonnen (nach Strauch-Weiden und -Birken). Anschließend werden sie rasch von anderen Baumarten verdrängt, was diesen aufgrund des hohen Lichtbedarfs der Birke leicht gelingt. Moor-Birken können (oder wohl eher: konnten bisher) auf nassen, kalten und nährstoffarmen Standorten dauerhaft Reinbestände bilden.
Abbildung 8: Moor-Birkenpaar in den Kammlagen des Erzgebirges bei Moldava in 900 m Höhe
In der Forstwirtschaft galten Birken lange Zeit als Unkraut und als Zeichen für faule Förster. Dazu mag beigetragen haben, dass junge Sand-Birken mit ihren besonders elastischen Zweigen und dem dadurch möglichen Peitschen bei Wind und Sturm benachbarte Fichten und Kiefern so stark beschädigen können, dass deren Wipfeltrieb abstirbt. Heute, in der überall verbreiteten naturnahen Waldwirtschaft, wird dies aber anders gesehen: Man lässt inzwischen eine gewisse Anzahl Birken in Mischbeständen absichtlich stehen oder fördert sie sogar gezielt wegen ihrer ökologischen Vorteile. Denn ihre Blattstreu ist gut zersetzlich, die lichten Kronen schaffen einen für viele andere Baum-, Strauch- und Krautarten günstigen Halbschatten, einen vorteilhaften Schutz gegen Spätfröste und einen wertvollen Lebensraum.
Das Stamminnere von Birken wird in höherem Alter schnell faul, was aber z. B. für den Birkenporling ein wichtiger Lebensraum ist. Pilzsammler wissen zudem, dass Birken oft mit Fliegenpilzen, Birkenröhrlingen und Birkenpilzen vergesellschaftet sind, wichtigen Mykorrhiza-Lebenspartnern, die auf armen Standorten die Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln der Birke verbessern.
Auf Birken leben viele Schmetterlingsraupen (z. B. vom Trauermantel) oder sind auf diese Baumart sogar angewiesen, ebenso Blattwespenlarven und Blattkäferarten. Man hat über 200 Insektenarten auf der Birke gefunden. Eine Vorliebe für Birken haben der Birken-Zeisig und das sehr seltene Birkwild. Birken werden zudem häufiger von Misteln besiedelt, wenn Vögel deren Samen gefressen haben und sich anschließend in Birkenkronen aufhalten.
Etwas sehr Schönes und ökologisch besonders wertvoll sind die selten gewordenen Eichen-/Birkenwälder (nur mit Sand-Birken auf trockeneren Standorten). Sie haben einen ganz besonderen Lichthaushalt und daher eine spezielle Krautschichtflora vieler lichtbedürftiger und seltener/geschützter Arten, eigene Tiergemeinschaften und weisen eine besonders hohe Artenvielfalt auf.
4Nutzung, Verwendung, Heilkunde, Mythologie
Das Holz der Birke ist sehr hell, elastisch und mittelschwer. Durch diese Eigenschaften ist es für bestimmte Verwendungen beliebt: zur Herstellung von Schlittenkufen, Felgen, Deichseln, Propellern, Holzschuhen, Trögen, Tassen, Löffeln u. a. sowie als Furnier für Küchen- oder Schlafzimmermöbel und Vertäfelungen. Sand- und Moor-Birkenholz ist nicht zu unterscheiden, letzteres kommt aufgrund seiner Seltenheit hier auch kaum in die Nutzung (häufiger nur in Skandinavien und Sibirien). Besondere Bedeutung hat Birken-Furniersperrholz und kommt aus Skandinavien, Russland und Nordamerika bei uns oft als Multiplex in den Handel.
Mit Birkenmaserholz (aus Maserknollen am Stamm) lassen sich traumhafte Gebrauchsgegenstände (Abbildung 9) und Schmuck herstellen. Auch Postkarten aus Birkenfurnier und Trinkbecher aus Birkenholz (Kuksas) sind in Gebrauch. Wer einen Kamin hat weiß, dass es kein besseres Kaminholz (mit Rinde) gibt als das der Birke, vor allem zum Anmachen des Feuers. Dies fördert in einigen Regionen, z. B. in stadtnahen Wäldern, bis heute die Verwendung dieser Baumart und treibt die Preise dafür in die Höhe. Zudem sieht es dabei wegen der weißen Rinde dreimal schön aus: als Brennholzstapel im Wald, als Feuerholz neben dem Ofen und beim Brennen.
Abbildung 9: Wunderschönes Schälchen aus der Maserknolle eines Birkenstammes
Birken gehör(t)en waldbaulich zu den sog. Weichlaubhölzern: Als solche werden von selbst ankommende Pionierbaumarten wie auch Weiden und Ebereschen mit schnellem Wuchs und weichem Holz bezeichnet. Allerdings hat die Birke gerade kein weiches Holz, sondern es gehört zu den Harthölzern mit einer Rohdichte von 0,5-0,8 g/cm3.
Einer der ersten Belege für die Nutzung von Birken in Europa durch den Menschen geht bis in die Mittelsteinzeit zurück (ca. 7500 v. Chr.). Seither haben Birkenbestände zumeist als Waldweide oder/und Vorwald gedient. Das Holz ist schon vor langer Zeit für Kleinmöbel und Gebrauchsgegenstände oder zur Herstellung von Holzkohle genutzt worden. Die Zweige wurden oft für rituelle Zwecke verwendet.
Einträglicher als die Holznutzung war in manchen Ländern bis vor gar nicht so langer Zeit die Erzeugung von Birkensaft. In einzelnen Forstbetrieben der DDR z. B. wurden bis zur Wiedervereinigung (und werden heute noch in Osteuropa) in jedem Frühjahr Tausende von Birken ‚gemolken‘ und Zehntausende von Litern Birkensaft gewonnen. Wenn man eine Birke im zeitigen Frühjahr 2 bis 4 cm tief anbohrt (oder sie ungewollt verletzt wird), tropft aus der Öffnung wochenlang eine klare Flüssigkeit heraus, der sog. Blutungssaft (Abbildung 10). Er enthält Mineralien und Zucker als Reservestoffe des Baumes und tritt aufgrund eines um diese Jahreszeit entwickelten osmotischen Überdruckes im Stamm ohne weitere Hilfsmittel aus dem Stamm aus. Auf diese Weise kann man in jedem Frühjahr bis zu 50 Liter Flüssigkeit pro Baum ernten. Da der Überdruck im Stamm schlagartig mit dem Austreiben der Blätter aufhört, ist die Produktion dann mit dem Erscheinen der Blätter schlagartig beendet. Der Birkensaft kann nach verschiedenen Rezepten weiterverarbeitet werden zu Wein, Limonade oder Haarwasser.
Abbildung 10: Frühjahrssaft läuft aus einer Birke nach Absägen des 2. Stämmlings im März, hier schon aufgrund des Zuckergehaltes von Bakterien besiedelt, daher die Gelbfärbung.
Beliebt sind die Birken (beide Arten) als Straßenbaum vor allem in Norddeutschland, besonders im Raum nördlich Bremen, wo es viele (ehemalige) Moore gibt: Hier sind sie mit Abstand die häufigsten Straßenbäume innerorts und an Überlandstraßen. Damit entsteht eine bemerkenswert offene, lichte und freundliche Stimmung in der Landschaft.
Die weiße Rinde haben unsere Vorfahren als Papierersatz verwendet, indem man die äußersten Rindenpartien vom Baum abzieht. Da der Inhaltsstoff Betulin die Rinde witterungsfest macht, findet man im Wald Jahrzehnte alte Birkenrindenhüllen, deren Stamm längst verfault und verschwunden ist (Abbildung 11). In Skandinavien gibt es Häuser, deren Dächer mit Birkenrinde gedeckt sind. Die Lappen machen daraus Umhänge und Schuhe, verwenden sie für Kanus, und in Notzeiten kann man Mehl daraus herstellen und Pfannkuchen backen.
Abbildung 11: Die sehr dauerhafte Rinde bleibt Jahrzehnte erhalten, während das Holz längst weggefault ist.
In der Heilkunde sind Birkenblätter nach dem deutschen Arzneimittelbuch ein anerkanntes Heilmittel. Sie können als Teeaufguss genossen werden, junge Birkenblätter auch sehr gut in Wildsalate gemischt oder in Quarkspeisen und Frühlingssuppen verwendet werden.
Was anderen Ländern Eiche oder Linde bedeuten, ist den Finnen und Russen die Birke. Das versteht man sofort, wenn man durch diese Länder reist: überall Birken, Birken, Birken. Auch bei uns haben sie als beliebter Zierbaum im Siedlungsbereich große Bedeutung (außer bei Pollenallergikern), allerdings nicht die Moor-Birke. Geschlossene, ausgedehnte Wälder bildet die Moor-Birke im nördlichen Russland sowie in Schottland und Skandinavien. In den nördlichsten und in Gebirgen höchsten Arealteilen wächst sie meist nur strauchförmig.
5Sonstiges Interessantes
Die Sand-Birke ist im Jahr 2000 zum Baum des Jahres ernannt worden.
Frühling, Frohsinn, Gesang und Birken – kurz: Mai, der Birkenmonat. So ist auch der Maibaum oft eine Birke. Die Beliebtheit und Häufigkeit der Birken in nordischen Ländern führt dazu, dass man aus diesen Ländern am besten einfach eine Urlaubskarte mit Birkenmotiven verschickt (Abbildung 12).
Abbildung 12: Die „3 Schwestern“ – Reiterationen einer im Moor umgekippten Moor-Birke
Die Birke ist in der Mythologie Inbegriff des Weiblichen, was sogar zu ihrem fünften deutschen Namen Frauen-Birke geführt hat. Eine schlüssige Erklärung dafür fällt allerdings schwer. Aufgehängte Zweige am oder im Haus sollen vor Blitzeinschlag schützen. Die Birke ist wohl eine der wenigen Baumarten, die in der Jugend schöner sind als im Alter.
Birkengrün empfängt das Brautpaar an der Kirchenpforte und daheim an der Haustür (unbedingt beachten, sonst soll es böse Folgen haben). Und Heiratsanträge machen Kenner auch heute noch, indem sie der Angebeteten eine Birke vor‘s Haus oder Fenster stellen. (Ob sie allerdings versteht, was das bedeutet?) Festumzüge werden von Birkengrün gesäumt, Birken sind auch die beliebtesten Richtfestbäume.
Hexenbesen dienen nicht der Abwehr von Hexen, sondern sind eine seltene, durch Pilze oder Mutationen hervorgerufene Erscheinung in der Krone von Birken, bei der einzelne kleinbleibende Zweige sich vielfach verzweigen und dadurch in der Krone wie Hexenbesen aussehen.
Die schönsten Bilder mit Birken hat wohl der Worpsweder Jugendstilkünstler HEINRICH VOGELER gemalt, da Birken der Lieblingsbaum dieser Kunstepoche waren und Haupt-Charakteristikum der dortigen Landschaft sind (Abbildung 13). In der Literatur kommt die Baumart regelmäßig bei Heidedichtern vor, z. B. bei HERMANN LÖNS. Dies werden dort auch oft Moor-Birken (gewesen) sein.
Abbildung 13: Moorlandschaft mit Moor-Birken im Teufelsmoor bei Bremen
Familiennamen wie PIRCHNER und BIRKHEIMER gehen auf die Birke zurück, ebenso Ortsnamen wie Birkigt, Pirken, Birchau u. a.
Literatur
ATKINSON, M. D., 1986: A reliable method for distinguishing between Betula pendula and Betula pubescens. Watsonia 16, 75–76.
ATKINSON, M. D., 1992: Betula pendula and Betula pubescens. Biol. Flora British Isles 80, 837–870.
BACKES, K., 1996: Der Wasserhaushalt vier verschiedener Baumarten der Heide-Wald-Sukzession. Cuvillier Verlag, Göttingen.
BARTELS, H., 1993: Gehölzkunde. Verlag E. Ulmer, Stuttgart.
Bayerischer Forstverein (Hrsg.) 1997: Bäume und Wälder in Bayern. Ecomed Verlag, Landsberg.
EIFLER, I., 1958: Kreuzungen zwischen Betula verrucosa und Betula pubescens. Der Züchter 28, 331–336.
EIFLER, I., 1960: Untersuchungen zur individuellen Bedingtheit des Kreuzungserfolges zwischen Betula pendula und Betula pubescens. Silvae Genetica 9, 159–165.
ELLENBERG, H.; LEUSCHNER, C., 2010: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 6. Aufl., Verlag E. Ulmer, Stuttgart.
FENNER, R., 2022: Die Moor-Birke – Baum des Jahres 2023. Flyer der Dr. Silvius Wodarz-Stiftung.
FIEDLER, F., 1963: Das Jugendwachstum der Birke in Vorwaldbestockungen. Diss. TU Dresden/Tharandt.
FISCHER-RIZZI, S., 2007: Blätter von Bäumen – Heilkraft und Mythos einheimischer Bäume. 4. Aufl., AT-Verlag, Baden/München.
GARDINER, A. S., 1958: Variation in bark characteristics in birch. Scottish Forestry 12, 191–195.
GRUBER, H.; MIERSCH, K., 1994: Gewinnung von Birkensaft. Allg. Forstztschr. 49, 1252–1254.
HEGI, G., 1981: Betula pubescens. Illustrierte Flora von Mitteleuropa III 1. Parey Verlag, Berlin/Hamburg.
HIBSCH-JETTER, C., 1994: Birken in den Alpen. Ecomed Verlag, Landsberg.
HIBSCH-JETTER, C., 1997: Betula pubescens Ehrhardt. Enzyklopädie der Holzgewächse 8, 1–16.
JONES, M.; HARPER, J. L., 1987: The influence of neighbours on the growth of trees in Betula pendula. Proc. Royal Soc. London B232, 1–33.
KÖSTLER, J. N.; BRÜCKNER, E.; BIBELRIETHER, H., 1968: Die Wurzeln der Waldbäume. Verlag P. Parey, Hamburg.
KRÜSSMANN, G., 1983: Handbuch der Laubgehölze. Verlag P. Parey, Berlin/Hamburg.
KUTSCHERA, L.; LICHTENEGGER, E., 2013: Wurzelatlas mitteleuropäischer Waldbäume und Sträucher. 2. Aufl., Stocker Verlag, Graz.
LEDER, B., 1992: Weichlaubhölzer – Verjüngungsökologie, Jugendwachstum und Bedeutung in Jungbeständen der Hauptbaumarten Buche und Eiche. LAFO (Landesanstalt für Forstwirtschaft NRW), Arnsberg.
LYR, H.; FIEDLER, H.-J.; TRANQUILLINI, W. (Hrsg.), 1992: Physiologie und Ökologie der Gehölze. Fischer Verlag, Jena.
MYKING, T., 1999: Winter Dormancy Release and Budburst in Betula pendula and Betula pubescens Ehrh. Ecotypes. Phyton 39, 139–146.
NATHO, G., 1959: Variationsbreite und Bastardbildung bei mitteleuropäischen Birkensippen. Fedd. Repert. 61, 211–273.
NOVITSKAYA, L. L., 1998: Regeneration of bark and formation of abnormal birch wood. Trees 13, 74–79.
NÜSSLEIN, S., 1999: Birken wirken wuchsfördernd. Allg. Forstztschr. 54, 615.
ORTNER, H. A., 2015: Die Birke – Ihre Bedeutung aus interdisziplinärer Sicht. HEP Verlag, Bern.
ROLOFF, A., 2010: Bäume – Lexikon der praktischen Baumbiologie. Verlag Wiley-VCH, Weinheim.
ROLOFF, A., 2013: Bäume in der Stadt – Besonderheiten, Funktion, Nutzen, Arten, Risiken. Verlag E. Ulmer, Stuttgart.
ROLOFF, A., 2017: Der Charakter unserer Bäume – Ihre Eigenschaften und Besonderheiten. Verlag E. Ulmer, Stuttgart-.
ROLOFF, A.; BÄRTELS, A., 2018: Flora der Gehölze – Bestimmung, Eigenschaften, Verwendung. 5. Aufl., Verlag E. Ulmer, Stuttgart.
SCHMIDT, P. A.; SCHMIEDER, B., 1997: Zur Unterscheidung von Hänge-Birke (Betula pendula Roth.) und Moor-Birke (Betula pubescens Ehrh.). Sächs. Flor. Mitt. 4, 148–160.
SCHMIEDER, B., 1996: Untersuchungen zur Variation von Birkenpopulationen (Betula pubescens Ehrh., Betula pendula Roth) im Elbsandsteingebirge. Dipl.arb. Fakultät Forst-, Geo- u. Hydrowissenschaften der TU Dresden.
SCHNEIDER, H., 1994: Sproßorganisation und Blattarchitektur bei Betulaceae und extratropischen Fagaceae. Diss. Botanicae 219, 1–229.
STRASSMANN, R., 2014: Baumheilkunde. Freya Verlag, Linz.
WAGENFÜHR, R., 2007: Holzatlas. 6. Aufl., Hanser Verlag, München.
www.bundesregierung.de/breg-de/suche/nationale-moorschutzstrategie-2141802 [Zugriff 22.11.2022].
Autor
Prof. Dr. Andreas Roloff ist Inhaber der Seniorprofessur für Forschung und Wissenstransfer zur Baumbiologie am Institut für Forstbotanik und Forstzoologie der TU Dresden in Tharandt. Er beschäftigt sich seit über 35 Jahren mit Fragen der Baumbiologie, Gehölzverwendung und Baumpflege. Er ist Fachreferent für Parks, Gärten und städtisches Grün im Rat der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft und Leiter des Kuratoriums Nationalerbe-Bäume.
Prof. Dr. Andreas Roloff Institut für Forstbotanik und Forstzoologie
Pienner Str. 7
01737 Tharandt
Tel. (0351) 463 31202
1 Forschung für die Bäume
Baumpflege: Die Entwicklung einer komplexen Aufgabe im Stadtgrün – 30 Jahre Deutsche Baumpflegetage
Tree Care: The Development of a Complex Task in Urban Green Space – 30 years German Tree Care Conference
von Heiner Baumgarten
Zusammenfassung
Die Lebensbedingungen für Stadtbäume wurden seit den 1970er Jahren durch Umweltbelastungen immer kritischer. Um Lösungen für den Erhalt der Stadtbäume zu entwickeln, entstanden seit Anfang der 1980er Jahre in Deutschland mehrere Baumpflege-Tagungen. Die größte und bedeutendste entstand 1993 in Augsburg. Neben einem intensiven Austausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis bot die begleitende Messe Informationen über neue Techniken und Methoden der Baumpflege. Durch die Begegnung unterschiedlicher Fachleute entstanden Impulse für innovative Baumschnitt-Methoden, neue Regelungen für die Baumkontrolle zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit oder auch die Initiative zur Gründung eines eigenständigen Studiengangs Arboristik. Heute zählen die Deutschen Baumpflegetage zu den international größten und bedeutendsten Baum-Fachtagungen.
Summary
Since the 1970s living conditions of urban trees have become more critical in face of environmental stress. To develop solutions for preserving urban trees, in Germany several Conferences on Tree Care were founded since 1980. The largest and most important of these was founded in 1993 in Augsburg. Along with an intensive dialogue between experts of science and practice and accompanied by a trade fair, the conference informed about new techniques and methods of arboriculture. The ensuing meeting and communication among many different experts provided input for the development of innovative pruning-methods, new rules of tree care measures to ensure that trees are safe or the initiative to install a new course of studies for arboriculture. Today the German Conference on Tree Care (Deutsche Baumpflegetage Augsburg) ranks as one of the most important international tree-conferences.
1Einleitung
Baumpflege ist eine der zentralen Aufgaben und Tätigkeiten der grünen Berufe, eine Selbstverständlichkeit für alle kommunalen und privaten Betriebe im innerstädtischen oder landschaftlichen Bereich. Und das war – gefühlt – schon immer so und ist nicht neu oder erst seit Gründung der verschiedenen Baumpflegetage in Deutschland oder international so. Baumpflege war in der Fachwelt schon immer eine Selbstverständlichkeit, weil Bäume im innerstädtischen Bereich wie in der freien Landschaft den gestalterischen und ästhetischen Vorstellungen der jeweiligen Zeit entsprechen mussten. Arten oder Wuchsformen wurden gewählt, um der Stadt oder der Landschaft ein bestimmtes Bild zu geben oder gestalterisch unbefriedigende räumliche Situationen zu verdecken. Bäume brauchten dafür Pflege wie Bewässerung, Düngung oder Schnitt.
2Städtebauliche Dichte
Mit beginnender Industrialisierung und Verdichtung der Städte wurden der Lebensraum und die Umweltbedingungen für Bäume immer ungünstiger und forderten für den Erhalt des Baumbestandes immer aufwendigere Pflegemaßnahmen. Anders als in der natürlichen Umgebung eines Baumes – Wald oder Solitärstand in offener Landschaft – wurden die Bäume in den Städten zunehmend von Gebäuden und Straßen bedrängt. Die Luftfeuchtigkeit sank, die Staub- und Schadstoffbelastung sowie die durchschnittliche Lufttemperatur stieg. Hinzu kamen Bodenverdichtung, Wurzelraumeinengung, mechanische Beschädigungen an Stamm und Krone sowie Schädigungen durch Streusalzeinsatz.
Dennoch wurden nach dem 2. Weltkrieg im Zuge des Wiederaufbaus der Städte verstärkt Straßenbäume gepflanzt, sodass die absolute Zahl der Bäume in den Städten kontinuierlich stieg. Bereits in den 1960er Jahren gab es Hinweise von Fachleuten aus den Grünflächenämtern zu den Problemen von Straßenbäumen, die durch äußere Einflüsse entstanden.1 Diese Erkenntnisse führten aber nicht zu Forderungen, die Baumstandorte an den Straßen den Anforderungen des Baumes an seinen Standort anzupassen, sondern man suchte in der Baumpflege nach Möglichkeiten, wie man dennoch ein gutes und gesundes Wachstum ermöglichen könnte.
3Die grünen Fachleute (re)agieren
Dieses Thema wurde auch in der 1958 gegründeten Ständigen Konferenz der Deutschen Gartenamtsleiter beim Deutschen Städtetag (GALK) diskutiert2 und führte 1975 zur Gründung des Arbeitskreises Stadtbäume. Seine Aufgabe und sein Auftrag war es, eine Liste mit geeigneten „Baumarten für die Bepflanzung von Straßen und Plätzen im städtischen Bereich“ zusammenzustellen. Eine erste Liste wurde bereits 1976 vorgelegt und in der Folge ständig fortgeschrieben. Aber auch sie war eine Reaktion auf bestehende Probleme und Entwicklungen ohne Forderungen nach einer grundsätzlichen Verbesserung der Lebensbedingungen für Bäume in der Stadt.
Die Notwendigkeit einer intensiven Baumpflege für den Erhalt und die Entwicklung gesunder Bäume in der Stadt wurde damit immer wichtiger. Mit der Gründung der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) 1975 durch die grünen Fachverbände entstand ein Netzwerk aus allen Ebenen der wissenschaftlichen bis praktischen Kompetenzen (nicht nur) in der Baumpflege. Die FLL übernahm z. B. die Fortschreibung der 1981 zunächst unter Federführung der Oberfinanzdirektion Stuttgart erarbeitete ZTV Baum im Jahr 1987, die seitdem als „ZTV-Baumpflege“ (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen) regelmäßig fortgeschrieben wird. Zum ersten Mal wurden darin Fachbegriffe definiert und damit für klare Leistungsbeschreibungen in der Baumpflege nutzbar.3
Nach Gründung des GALK-Arbeitskreises Stadtbäume und der Arbeit in der FLL zur ZTV Baumpflege wurde deutlich, dass es eine offene Plattform für den Informationsaustausch zwischen den Fachleuten geben musste, was mit der Gründung der Osnabrücker Baumpflegetage als erster Fortbildungsveranstaltung in der Deutschen Baumpflege auf Initiative von KLAUS SCHRÖDER und Prof. HORST EHSEN 1982 an der Hochschule Osnabrück auch erfolgte.4
1984 berichtete ALEX SHIGO in Heidelberg5 von seinen 1977 veröffentlichten Forschungsergebnissen zur Fäulnisbildung in Bäumen nach Verletzungen, wie z. B. auch nach Pflegeschnitten. Seine Erkenntnisse stellten die bis dahin übliche Praxis der „Baumchirurgie“ in Deutschland infrage und führten zu der Überzeugung, dass ein fachlicher Austausch zur Baumpflege nicht nur national von Bedeutung ist, sondern international aufgestellt werden muss.6
Die in den USA von SHIGO erarbeiteten Erkenntnisse zur Baumpflege animierten Forscher und Fachleute, auch in Europa das von ihm entwickelte CODIT-Modell (Compartmentalization of decay in trees) zu überprüfen und auf einheimische Baumarten zu übertragen7. In dieser Zeit begann auch die intensive Diskussion über die bessere Verträglichkeit eines Sommerschnitts an Bäumen, was innerhalb der Fachkreise und insbesondere mit Vertretern des Naturschutzes zu Kontroversen führte. Damit wurden die Fragestellungen zur Baumpflege neben den bereits bestehenden zu den Streusalzauswirkungen oder der Auswirkung von Luftschadstoffen auf Stadtbäume immer komplexer. Insbesondere die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse erforderten eine Intensivierung des fachlichen Austauschs, der alle Aufgabenbereiche und -ebenen der Baumpflege erreicht.
430 Jahre Deutsche Baumpflegetage in Augsburg
Anfang der 1990er Jahre suchte deshalb DR. STEFFEN WIEBE nach einem geeigneten Ort im süddeutschen Raum für neue Baumpflegetage und fand diesen in Augsburgs Kongresshalle.8 Mit Unterstützung des Augsburger Amtes für Grünordnung und Naturschutz sowie des Instituts für Holzforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München bereitete die „Arbeitsgemeinschaft Augsburger Baumpflegetage“ die erste Veranstaltung für 1993 vor. Wie schon in Osnabrück war die Kooperation mit dem örtlichen Grünflächenamt eine gute und richtige Entscheidung, auch die Einbeziehung der FLL war für die weitere Entwicklung der Deutschen Baumpflegetage strategisch wichtig. So war nicht nur gesichert, dass die Veranstaltungen ein breites Spektrum der Fachexperten und Fachverbände erreichten, sondern auch für die inhaltliche Ausrichtung der Baumpflegetage Impulse gesetzt wurden. Nicht zuletzt entstanden darüber wichtige Verbindungen und ein Austausch zwischen Wissenschaftlern, Verwaltungen und Baumpflegebetrieben. Fachexpertise wurde nicht nur im theoretischen Dialog über Vorträge und Diskussionen ausgetauscht, sondern Technik und Praxisvorführungen fanden ergänzend Eingang in die Baumpflegetage.
Unter anderem ausgelöst durch die Forschungsergebnisse von ALEX SHIGO in den USA entwickelten die Deutschen Baumpflegetage zahlreiche Kontakte ins europäische Ausland und darüber hinaus. Heute sind Beiträge aus der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Italien, Frankreich, Skandinavien und zunehmend aus den osteuropäischen Nachbarländern obligatorisch. Ein Austausch über die ISA (International Society of Arboriculture) führte zu wechselseitigen Besuchen der jeweiligen Kongresse und damit zu einem intensiven Erfahrungsaustausch über internationale Forschungsergebnisse.
Die kontinuierliche Entwicklung und Pflege der internationalen Kontakte bewirkte, dass die Deutschen Baumpflegetage heute sehr aktuell über neue Erkenntnisse und Entwicklungen berichten und diskutieren können. Letztlich ist dies auch ein wesentlicher Grund für den Erfolg der Deutschen Baumpflegetage mit Blick auf die kontinuierlich steigende Anzahl der teilnehmenden Aussteller*innen und Kongressteilnehmer*innen von anfangs wenigen Hundert bis heute auf rund 1.500 und zusätzlichen über 100 Austellern – Tendenz weiter steigend. Heute gehören die Deutschen Baumpflegetage zu den größten und bedeutendsten Baumpflegetagen weltweit.
Eine wesentliche Basis des Erfolgs ist sicher die frühzeitige Bildung von Fachbeiräten für Fachvorträge und das Kletterforum. Die Einbeziehung von Fachexpert*innen aus Wissenschaft, Verwaltung und Fachverbänden wirkt einerseits als Sensor für neue Fragestellungen und Themen in der Baumpflege und andererseits zur Qualitätssicherung für die Inhalte der Baumpflegetage, die im „Jahrbuch der Baumpflege“ veröffentlicht werden. Damit ist das „Jahrbuch der Baumpflege“ nicht nur Dokumentation, sondern auch ein Nachschlagewerk für alle in der Baumpflege Tätigen, Lehrenden und Forschenden. Und diese Bedeutung wird wiederum abgesichert durch einen Herausgeberbeirat. Diese Struktur unterstützt die Intention von STEFFEN WIEBE, der seitens des Veranstalters Wert auf Sachlichkeit legte und auch strittige Themen neutral und emotionslos in den Baumpflegetagen behandeln wollte.8
4.1Meilensteine und wichtige Impulse der Deutschen Baumpflegetage
Die Gründung der Deutschen Baumpflegetage fand zu einem Zeitpunkt statt, als die Probleme mit der Erhaltung und Pflege von Bäumen in der Stadt einen immer größeren Umfang einnahmen. Verkehrssicherungspflicht und Baumkontrolle, Sanierung von Altbäumen und Baumchirurgie, Kronensicherung und Baumstatik waren zum Teil hochstrittige Themen zwischen Fachleuten und mit Juristen und spiegelten sich in Beiträgen der Fachzeitschriften wider. Nicht immer waren es die Baumpflegetage selbst, die konkurrierende Positionen einten, aber durch Vorträge, Diskussionen und Dialog wurden Wege zu Lösungen oder Gemeinsamkeiten aufgezeigt und gefunden.
Kooperation DBT und FLL
Einen entscheidenden Anteil an diesem Prozess hatte die gute Kooperation der Deutschen Baumpflegetage mit der FLL. Erkannte Defizite bei fachlichen Themen wurden von der FLL aufgegriffen und in Arbeitskreisen oder Regelwerksausschüssen zu konsensualen Ergebnissen geführt und als Fachbericht oder Richtlinie zur Berücksichtigung oder Anwendung in der Praxis als Stand der Technik veröffentlicht. Wichtigste Richtlinien und Regelwerke, die teilweise bereits mehrfach überarbeitet und aktualisiert wurden, sind:
• Empfehlungen für Baumpflanzungen (2015), Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege
• Empfehlungen für Baumpflanzungen (2010), Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate
• ZTV-Baumpflege (2017), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege
• Baumkontrollrichtlinien (2020), Richtlinien für Baumkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit
• Baumuntersuchungsrichtlinien (2013), Richtlinien für eingehende Untersuchungen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen
• Fachbericht Artenschutz (2021), Artenschutz im Lebensraum Baum – Erhalten, Schützen, Pflegen
Zur Entstehung oder bei der Überarbeitung dieser Richtlinien oder Fachberichte fanden sehr oft grundlegend oder begleitend Fachvorträge bei den Deutschen Baumpflegetagen statt, wo durch den großen Teilnehmer*innenkreis viele Impulse in der Diskussion gegeben wurden oder Widersprüche früh erkannt und ggf. geklärt werden konnten. Die ZTV-Baumpflege 2017 wurde nach ihrer letzten Überarbeitung sehr ausführlich auf den Deutschen Baumpflegetagen in ihrer Bedeutung für die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der grünen Branche vorgestellt. So entsteht eine hohe Akzeptanz und Anwendungssicherheit auf allen Ebenen der Baumpflege.
CODIT-Prinzip und Hamburger Schnittmethode
Nachdem erstmals Ende der 1970er9 Jahre die komplexen Vorgänge nach Verletzungen an Bäumen zusammenfassend vorgestellt wurden und zu intensiven fachlichen Diskussionen führten und ALEX SHIGO 1984 mit seinem Vortrag in Heidelberg das CODIT-Modell (Compartmentalization of decay in trees) und die damit verbundenen Fragestellungen nach Deutschland brachte, nahmen die Deutschen Baumpflegetage dieses Thema in die regelmäßige Berichterstattung über neue Erkenntnisse auf.10 SHIGO hatte schon früh mit deutschen Wissenschaftlern wie PROF. DR. WALTER LIESE von der Universität Hamburg zusammengearbeitet, der die Erkenntnisse von SHIGO durch Untersuchungen an Hamburger Stadtbäumen weiterentwickelte. Die noch in den 1980er Jahren in Hamburg als Stand der Technik angesehene „Baumchirurgie“ als Mittel der Baumpflege wurde durch ihn maßgeblich in eine baumbiologisch orientierte Baumpflege verändert.
LIESE setzte seine Untersuchungen zum Wundverhalten von heimischen Bäumen insbesondere in der Zusammenarbeit mit DR. DIRK DUJESIEFKEN konsequent fort und stellte die unterschiedlichen Reaktionen als Basiswissen für die Baumpflege zur Verfügung. Schon in den 1980-er Jahren wurden praxisnah an städtischen Altbäumen vom damaligen Ordinariat für Holzbiologie der Universität Hamburg mit unterschiedlichen Schnittführungen und Schnittzeitpunkten vergleichende Methoden der Baumpflege durchgeführt. Es wurde in der über viele Monate angelegten Studie deutlich, dass neben der Schnittführung und Wundgröße der Schnittzeitpunkt erheblichen Einfluss auf die Wundreaktionen von Bäumen hat.11 Die sich aus diesen Erkenntnissen ergebenden Empfehlungen an die Praxis wurden als „Hamburger Schnittmethode“ bezeichnet und nach ausführlicher Praxiserfahrung bei den Deutschen Baumpflegetagen vorgestellt und diskutiert.12 Die Ergebnisse dieser Beratungen fanden Eingang in die jeweilige Überarbeitung und Aktualisierung der ZTV-Baumpflege der FLL und sind heute Stand der Technik in der Baumpflege.13
Mit den neuen und ergänzenden Erkenntnissen zu den grundlegenden Ausführungen von SHIGO spricht man heute vom CODIT-Prinzip und hat das Wort decay durch damage ersetzt, um auf die umfassenderen Einflussfaktoren hinzuweisen, und die Abwehr von Bäumen als Prozess bzw. eine Abfolge von Reaktionen zu verstehen, die je nach Verletzung oder Baumart sehr verschieden aussehen können.14 Die Deutschen Baumpflegetage waren für diesen Erkenntnisprozess das zentrale Forum aller in der Baumpflege Tätigen und hat dadurch aus meiner Sicht inzwischen weltweit eine führende Position in der modernen Baumpflege.
Baumkontrolle
Mit seiner Entscheidung vom 21. Januar 1965 hatte der Bundesgerichtshof festgelegt, dass „eine regelmäßige Überprüfung der Straßen notwendig (ist), um neu entstehende Schäden oder Gefahren zu erkennen“. In der Folge wurde in zahlreichen Verfahren vor den Oberverwaltungsgerichten diese Rechtsprechung in verhandelten Einzelfällen zu Straßenbäumen so interpretiert – und von zahlreichen Sachverständigen gestützt – dass jeder Baum zweimal im Jahr, jeweils einmal im belaubten und unbelaubten Zustand, zu überprüfen wäre.
Breite Kritik an dieser Auslegung hatte bis zum Ende der 1990er Jahre keinen Erfolg. Erst als sich auf Einladung der Umweltbehörde Hamburg Vertreter*innen aus allen betroffenen Disziplinen (Richter, Sachverständige, Vertreter von Kommunalversicherungen, Gartenamtsleiter, Wissenschaftler etc.) in einem Workshop trafen und festlegten, dass eine gemeinsame fachliche Auffassung erforderlich ist, um in der Rechtsprechung von der pauschalen zweimaligen jährlichen Kontrolle abzukommen, wurde auf der Basis der Erkenntnisse der jahrelangen Zusammenarbeit der Hamburger Umweltbehörde mit dem Institut für Baumpflege Hamburg in der FLL ein Regelwerksausschuss zur Erarbeitung von Baumkontrollrichtlinien gebildet. Die Baumkontrollrichtlinien erschienen erstmals 2004 und wurden 2010 und 2020 ergänzt und überarbeitet.
Im Rahmen der Deutschen Baumpflegetage wurde die Entstehung der Baumkontrollrichtlinien von Beginn an intensiv diskutiert und unterstützt. Ausgangspunkt dafür waren die Ergebnisse aus Hamburg bei der Erarbeitung des Straßenbaumkatasters15 sowie die Erfahrungen mit dem Hamburger Leitfaden für eine fachgerechte Baumkontrolle.16 Aus Beiträgen und Diskussionen während der Deutschen Baumpflegetage entstanden immer neue Impulse für Verbesserungen der Baumkontrollrichtlinien.
Studiengang Arboristik
Bei den Deutschen Baumpflegetagen fanden der fachliche Austausch und die Diskussionen nicht nur während der Veranstaltungszeit statt, sondern auch an den gemeinsamen Referentenabenden oder am Rande der begleitenden Messe. Angesichts ständig steigender Anforderungen an Sachverständige, Baumkontrolleure und Baumpfleger entstand der Gedanke, einen speziellen Studiengang an einer Deutschen Hochschule einzurichten. Konkret wurde die Idee in einer Diskussion von Professoren während der Deutschen Baumpflegetage 2001. Als geeigneter Studienort wurde die HAWK Göttingen angesehen und in einem interdisziplinär besetzten Gründungsteam wurde die Struktur des Studiengangs entwickelt. Die ersten Studierenden konnten 2003 ihr Studium aufnehmen.
Anfängliche Skepsis, ob denn die Studienabgänger in der Praxis gebraucht würden, ist schnell gewichen, da die Spezialisierung auf Baumpflege in vielen Ämtern und Firmen bis dahin kaum vorhanden war und die praxisorientierte Ausbildung diese Lücke schnell schließen konnte. Gerne wird heute das Studium auch als Weiterqualifizierung von Forstwirten oder Gärtnern im Garten- und Landschaftsbau angenommen. Zentrale Aufgaben der Arboristen sind z. B. Schutz und Pflege urbaner Gehölze und Bäume und Planung und Entwicklungen städtischer Grün- und Gehölzflächen. Tätigkeitsfelder finden sich in Kommunen, Sachverständigenbüros oder in Garten- und Landschaftsbaufirmen.
Die Deutschen Baumpflegetage haben damit einen Impuls für die Entstehung eines neuen Berufsbilds gegeben, das in der grünen Branche dringend benötigt wurde. Es ergänzt die Qualifikationen als Fachagrarwirt*in Baumpflege, Treeworker*in und Baumpfleger*in, die alle mit unterschiedlichen Aus- oder Fortbildungsmodulen Fachkräfte für die Baumpflege sind. Gleichgültig, welche Ausbildung Fachkolleg*innen haben, bei den Deutschen Baumpflegetagen finden sie qualifizierte Ansprechpartner*innen und wichtige Informationen für ihre berufliche Aufgabe.
Baumpflege und Artenschutz
Seit gut 15 Jahren – verstärkt nach Gründung des Studiengangs Arboristik – wurden in den Diskussionen bei den Deutschen Baumpflegetagen Fragen nach der Vereinbarkeit der Baumpflege, insbesondere in den Sommermonaten, mit dem Naturschutzrecht gestellt, da allgemein verbreitet war, dass zwischen dem 1. März und dem 1. Oktober Schnittmaßnahmen aus Artenschutzgründen verboten seien.





























