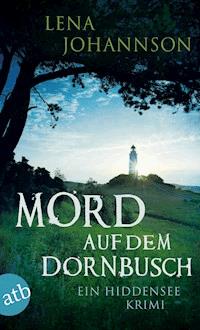9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Hamburg-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Jahre der Veränderung.
Hamburg, Ende der zwanziger Jahre. Frieda ist überglücklich, ihre Hochzeit steht kurz bevor, und die Schokoladenmanufaktur feiert immer größere Erfolge. Endlich scheint sie ihren Platz im Familien-Kontor gefunden zu haben. Als dann jedoch unerwartet ihre erste große Liebe auftaucht, stellt Frieda alles in Frage, woran sie bisher geglaubt hat. Doch die Suche nach ihrem persönlichen Glück rückt schnell in den Hintergrund, als die Nazis an die Macht kommen und mit einem Mal das Leben ihrer besten Freundin, der Jüdin Clara, in Gefahr ist.
Per hat sein Verlobungsgeschenk eingelöst und ein Haus an der Elbchaussee gekauft. Eigentlich wollten er und Frieda endlich den Hochzeitstermin festlegen – doch immer kommt etwas dazwischen. Und dann steht plötzlich Jason vor ihr, ihre große Jugendliebe. Seit er damals Hals über Kopf Hamburg verlassen hat, um in Übersee das Teekontor seiner Familie weiterzuführen, hat sie ihn nicht mehr gesehen. Mit einem Mal spürt sie, dass noch zu viel Unausgesprochenes zwischen ihnen liegt, als dass sie ihr neues Leben mit Per beginnen könnte. Aber wird ihr Verlobter dafür Verständnis haben?
Auch die sich langsam verändernde politische Stimmung belastet Frieda. Ist doch nicht nur ihre beste Freundin, sondern auch das uneheliche Kind ihres Bruders jüdischer Abstammung. Und dann wird ihre Hoffnung, dass Freunde und Familie in diesen schweren Zeiten noch enger zusammenhalten, jäh enttäuscht ...
Authentisch und berührend: Nach dem Vorbild eines Hamburger Kakao-Kontors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Sammlungen
Ähnliche
Über Lena Johannson
Lena Johannson, 1967 in Reinbek bei Hamburg geboren, war Buchhändlerin, bevor sie als Reisejournalistin ihre beiden Leidenschaften Schreiben und Reisen verbinden konnte. Seit ihrem ersten Roman »Das Marzipanmädchen«, der 2007 erschien, arbeitet sie als freie Autorin. Sie lebt an der Ostsee.
Bei Rütten & Loening und im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Dünenmond«, »Rügensommer«, »Himmel über der Hallig«, »Der Sommer auf Usedom«, »Die Inselbahn«, »Liebesquartett auf Usedom«, »Strandzauber«, »Die Bernsteinhexe«, »Sommernächte und Lavendelküsse«, »Die Villa an der Elbchaussee. Die Geschichte einer Schokoladendynastie«, »Die Malerin des Nordlichts« sowie die Kriminalromane »Große Fische« und »Mord auf dem Dornbusch« lieferbar.
Mehr Information zur Autorin unter www.lena-johannson.de.
Informationen zum Buch
Jahre der Veränderung.
Hamburg, Ende der zwanziger Jahre. Frieda ist überglücklich, ihre Hochzeit steht kurz bevor, und die Schokoladenmanufaktur feiert immer größere Erfolge. Endlich scheint sie ihren Platz im Familien-Kontor gefunden zu haben. Als dann jedoch unerwartet ihre erste große Liebe auftaucht, stellt Frieda alles in Frage, woran sie bisher geglaubt hat. Doch die Suche nach ihrem persönlichen Glück rückt schnell in den Hintergrund, als die Nazis an die Macht kommen und mit einem Mal das Leben ihrer besten Freundin, der Jüdin Clara, in Gefahr ist …
Per hat sein Verlobungsgeschenk eingelöst und ein Haus an der Elbchaussee gekauft. Eigentlich wollten er und Frieda endlich den Hochzeitstermin festlegen – doch immer kommt etwas dazwischen. Und dann steht plötzlich Jason vor ihr, ihre große Jugendliebe. Seit er damals Hals über Kopf Hamburg verlassen hat, um in Übersee das Teekontor seiner Familie weiterzuführen, hat sie ihn nicht mehr gesehen. Mit einem Mal spürt sie, dass noch zu viel Unausgesprochenes zwischen ihnen liegt, als dass sie ihr neues Leben mit Per beginnen könnte. Aber wird ihr Verlobter dafür Verständnis haben? Auch die sich langsam verändernde politische Stimmung belastet Frieda. Ist doch nicht nur ihre beste Freundin, sondern auch das uneheliche Kind ihres Bruders jüdischer Abstammung. Und dann wird ihre Hoffnung, dass Freunde und Familie in diesen schweren Zeiten noch enger zusammenhalten, jäh enttäuscht.
Authentisch und berührend: Nach dem Vorbild eines Hamburger Kakao-Kontors
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lena Johannson
Jahre an der Elbchaussee
Die Geschichte einer Schokoladen-Dynastie
Roman
Inhaltsübersicht
Über Lena Johannson
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil 2
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Teil 3
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Nachtrag zur historischen Richtigkeit und Dank
Impressum
Teil 1
Kapitel 1
Ende Mai1925
»Das ging nu aber auch so fix, da hätt ich nicht mal Labskaus sagen können.« Ernst strahlte.
»Mir scheint, man hätte sogar Labskaus mit Matjes und Rote Bete sagen können«, gab Albert Hannemann zurück. »Du hast lange genug für mich gearbeitet, es wurde Zeit, dass du endlich belohnt wirst.«
Frieda musste lächeln. Ihr Vater war bester Laune. Er hatte den Braten, den Henni aufgetragen hatte, ebenso gelobt wie das Gemüse. Er strahlte über das ganze Gesicht, und er hatte mehrfach betont, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, die Villa an der noch immer sehr beliebten Elbchaussee zu kaufen.
»Ein Ort zum Wohlfühlen«, hatte er zufrieden gesagt. »Dass wir ihn behalten konnten, verdanken wir auch dir, Ernst!«
Da hatte Vater recht. Und darum hatte Ernst seine neue Position mehr als verdient. Seit er mit zehn als Laufbursche bei Hannemann & Tietz angefangen hat, war klar, dass er mehr wollte. Nun hatte er es geschafft. Durch geschicktes Taktieren und mutiges Handeln war er zu Geld gekommen, als alle anderen unter der Inflation gestöhnt und Verluste gemacht hatten. Ohne ihn wäre ihre geliebte Schokoladenmanufaktur in größter Gefahr gewesen. Sie wusste nur zu gut, dass die Produktion von Zartbitter- und Vollmilchtafeln, von Pralinen mit Champagner- oder Fruchtfüllung für ihren Vater im besten Fall eine Liebhaberei war. Während der Wirtschaftskrise, als Vater an allen Ecken und Enden sparen musste, wäre die Manufaktur beinah auf der Strecke geblieben. Aber Ernst hatte erkannt, dass die Produktion von köstlichen Süßwaren sogar die Rettung sein konnte, wenn der Import nichts einbrachte. Deshalb hatte er sie unterstützt, wenn sie beharrlich immer wieder neue Rezepte entwickelt, stundenlang Schokoladenmasse gerührt, in Formen gegossen, Tafeln in Silberpapier gewickelt hatte. Bis sie so erfolgreich waren, dass ihr Vater ihr endlich höchst offiziell das Sagen über diesen kleinen Bereich seines Geschäfts erteilte. Mehr noch, Vater hatte ihr sogar in Aussicht gestellt, irgendwann seine Nachfolgerin im Familienunternehmen zu werden. Mit Per an ihrer Seite traute Vater ihr die Geschäftsleitung zu. Manchmal konnte sie es immer noch nicht fassen.
»Wirklich, Ernst«, hörte sie jetzt ihren Vater sagen. »Du hast es dir absolut verdient, mein Kompagnon zu sein. An Hannemann & Krüger muss ich mich zwar erst gewöhnen, aber das wird schon.«
»Sie können den Namen wirklich gern beibehalten. Hannemann & Tietz hat einen guten Klang, weit über Hamburgs Grenzen hinaus. Und Krüger is ja nicht so richtig ein Name, sondern eher ein Sammelbegriff.«
»Das kommt gar nicht infrage. Hättest du uns in den schweren Zeiten nach dem Krieg nicht Geld geliehen – ich darf gar nicht darüber nachdenken, was aus dem Unternehmen geworden wäre!«
»Sie hätten das schon irgendwie anders geschafft …«
»Indem ich womöglich die Gerätschaften der Manufaktur verkauft hätte?«
»Auf keinen Fall!« Allein die Vorstellung ließ Frieda aufschrecken. Hatte sie es doch geahnt, kaum tauchte ein Engpass am Horizont auf, stellte ihr Vater zuerst die Manufaktur infrage.
»Siehst du, Ernst, schon bei dem bloßen Gedanken steht meine liebe Tochter kurz vor einem Ohnmachtsanfall«, sagte ihr Vater lächelnd.
Ernst grinste nur, dann zwinkerte er seiner Mutter zu, die sich immer noch sichtlich unwohl fühlte. Kein Wunder, bis vor Kurzem war sie Angestellte im Hause Hannemann gewesen. Erst hatte sie Rosemarie das Mieder geschnürt, ihr die Schuhe geputzt und die Kleider gerichtet, später hatte sie sich um Frieda und Hans gekümmert, als wären es ihre eigenen Kinder. Bis letzte Woche hatte Gertrud das Küchenpersonal unter sich gehabt und würde jetzt vermutlich lieber selbst am Herd stehen oder zumindest den Leuten auf die Finger schauen. Doch das war nun vorbei.
»Die Mutter meines Geschäftspartners kann uns unmöglich weiter den Braten auf den Teller legen«, hatte Albert erklärt.
Rosemarie Hannemann fühlte sich genauso unwohl wie Gertrud. »Sie wird mit uns am Tisch sitzen?«, hatte sie verwirrt gefragt, als Albert ihr erklärte, es werde eine kleine Feier zu Ehren von Ernsts Einstand geben. »Worüber soll ich mich denn mit ihr nur unterhalten?« Rosemarie hatte vollkommen ratlos ausgesehen. Es wäre wirklich besser gewesen, in einem anständigen Restaurant zu feiern als zu Hause. Dort hätten sich die beiden ungleichen Frauen vermutlich schneller mit der ungewöhnlichen Situation arrangiert. Frieda lächelte stillvergnügt. Ach was, sie würden den Abend schon überstehen. Und tatsächlich war das Essen ohne größere Zwischenfälle vonstattengegangen. Dennoch war Frieda erleichtert, als Henni den Nachtisch servierte, rote Grütze mit Sahne. Oder Rødgrød med fløde, wie Per sagte. Immer wieder sagen musste, denn Frieda konnte sich nicht daran satthören, wenn er dänisch sprach. Besonders diese drei Wörter liebte sie.
Lächelnd schaute sie zu Per herüber – schon wieder wollte ihr ein Glücksgefühl das Herz fluten. Was war heute nur los mit ihr? So rührselig kannte Frieda sich selbst nicht. Im letzten Herbst hatten sie sich verlobt, da war sie gerade zweiundzwanzig gewesen. Ihr war es ein wenig früh vorgekommen, ihre Eltern dagegen hatten es kaum abwarten können. Nicht etwa, weil sie ihr Kind einfach gern unter der Haube gewusst hätten, sondern um durch eine einträgliche Heirat die finanzielle Lage des Handelsunternehmens zu stärken, so schlecht war es ihrem Vater damals gegangen. Mit siebzehn, so alt war sie, als ihre Eltern das erste Rendezvous einfädelten, war es ihr wie Verrat vorgekommen, als würden Vater und Mutter sie an einen Mann mit Geld verschachern. Und wirklich: Mit Per waren Vaters finanzielle Sorgen Geschichte. Doch zum Glück war er ein hochanständiger Mann. Mehr noch. Frieda empfand größte Zuneigung für ihn. Dass auch die Leidenschaft zwischen ihnen noch wachsen würde, daran hatte sie keinen Zweifel. Sie betrachtete ihn von der Seite. Seine blauen blitzenden Augen wurden von Lachfältchen eingerahmt, das blonde Haar war kurz und wie immer sehr ordentlich nach hinten gekämmt. Er bemerkte ihren Blick und sah sie fragend an. Frieda legte ihre Hand auf seine und lächelte ihn an. Die letzten Monate an seiner Seite waren schön gewesen. Sehr schön. Per freute sich darauf, in Hamburg sesshaft zu werden. Er hatte ein prachtvolles Haus am Rande der Elbchaussee gekauft. Bis zur Villa ihrer Eltern waren es nur wenige Schritte, und der Garten grenzte direkt an den Jenischpark. Frieda hatte sich auf den ersten Blick in das Anwesen verliebt. Nicht nur die Lage inmitten von Grün und oberhalb des kleinen Teufelsbrücker Hafens hatte sie sofort begeistert. Vor allem gefielen ihr die großen Fenster, die so viel Licht einließen. Die Zimmer in den beiden Stockwerken waren geräumig und freundlich. Da der Bau auf einem kleinen Hügel errichtet worden war, gab es statt eines Kellers ein Souterrain-Geschoss. Dort würde Selma Blumenstein wohnen, die im März das Kind von Friedas Bruder Hans zur Welt gebracht hatte. Es war Pers Vorschlag gewesen, sie mit ihrer Tochter zu sich zu nehmen. Ebenso gut hätte Selma in dem Anbau bleiben können, den Frieda bis zur Hochzeit noch bei ihren Eltern bewohnte, und wo die junge Frau aus Berlin seit ihrem Auftauchen während Friedas und Pers Verlobungsfeier Unterschlupf gefunden hatte. Doch Selma war Jüdin, und Rosemarie tat sich schwer mit diesem Umstand. Ein uneheliches Enkelkind war ohnehin schon mehr, als sie verkraften konnte. Per war sensibel genug, um zu begreifen, wie hilfreich ein wenig Abstand zwischen Rosemarie und Selma war. Frieda konnte den Umzug in ihr eigenes Reich kaum noch abwarten. Bald würden die Innenarbeiten – ein paar neue Tapeten, etwas Farbe – abgeschlossen sein. Dann mussten sie nur noch den Hochzeitstermin festlegen, ehe Frieda endlich ihren eigenen Haushalt haben würde.
»Ich fürchte, für mich wird es langsam Zeit.« Pers tiefe Stimme riss sie aus ihren Gedanken. »Mein Vater erwartet mich morgen schon sehr früh in unserem Stammhaus in Odense. Mir scheint, mein alter Herr hat einiges mit mir zu besprechen, da sollte ich ausgeschlafen sein. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich mich daher jetzt verabschiede.« Er erhob sich. Sofort standen Ernst und Albert auf, Gertrud schien zu überlegen. Sie war es einfach nicht gewöhnt, als Dame Platz zu behalten.
»Ich begleite dich zur Tür.« Frieda erhob sich.
»Unsere beiden Turteltauben«, sagte Rosemarie mit einem Seufzer.
»Wird wirklich Zeit, dass ihr endlich vor den Altar tretet. Zwar wird das Haus ohne dich sehr leer sein, Sternchen, aber eine Frau gehört nun mal zu ihrem Mann.« Ihr Vater sah sie an. In seinem Blick lag so viel Wärme. Frieda wusste, wie froh er war, dass der finanzkräftige Bräutigam nicht nur Friedas Verstand hatte überzeugen können, sondern dass sie ihn von Herzen gern hatte. Wenn Albert das Unternehmen, das sein Großvater gegründet hatte, auch über alles stellte, rangierte das Glück seiner Tochter doch direkt dahinter. Ernst starrte auf das weiße Damasttuch, auf dem noch die leeren Kristallschalen mit roten klebrigen Grützespuren standen. Den ganzen Abend war er – abgesehen von einem kurzen Moment – ausgelassen gewesen und hatte mit Albert geplaudert, als wären sie schon immer zwei Kaufmänner, die gemeinsam zur Börse gingen oder an der Alster ihren Cognac nahmen. Jetzt aber wirkte er seltsam verkniffen, und seine Mutter ließ ihn nicht aus den Augen. Was er wohl hatte? Wahrscheinlich war ihm klar, dass Turteltauben es nicht ganz traf. Ernst war ein hoffnungsloser Romantiker, bestimmt hätte er es lieber gesehen, wenn Frieda Per nicht nur sehr zugetan, sondern bis über beide Ohren in ihn verliebt gewesen wäre.
»Du lässt mich also wirklich allein? Ein schöner Bräutigam bist du«, sagte sie lachend, als sie vor dem Portal der Villa standen. Per kniff das linke Auge zu, wie immer, wenn er überrascht oder irritiert war.
»Warum kommst du nicht mit? Odense ist eine fortschrittliche Stadt. Wir haben sogar eine Bildungsministerin!« Typisch Per, er schwärmte ihr nicht von hübsch angelegten Parks oder interessanten Einkaufsmöglichkeiten vor.
»Ich fürchte, sie wird mich nicht empfangen.« Frieda lächelte. »Warum also sollte ich mit dir reisen?«
»Außerdem ist es die Geburtsstadt von Hans Christian Andersen«, sprach er unbeirrt weiter. »Als Kind habe ich seine Märchen geliebt. Wusstest du, dass man nach seinem Tod in einem Ledersäckchen, das er ständig bei sich trug, den Brief einer Frau gefunden hat?« Frieda sah ihn erstaunt an. »Nicht irgendeiner Frau, sondern seiner großen Liebe, die einem anderen versprochen war. Es war ihr Abschiedsbrief, den er sein ganzes Leben bei sich getragen hat. Ist das nicht romantisch?«
»Vor allem ist das schrecklich traurig.« Sie nahm seine Hände. »Du und Romantik.« Frieda schüttelte den Kopf.
»Ich dachte, damit überzeugt man Frauen. Etwa nicht?« Seine Lippen zuckten verräterisch.
»Eine sehr seltsame Logik, Per Møller. Selbst wenn Andersen noch so romantisch war, warum sollte mich das in seine Geburtsstadt locken? Er ist schon lange tot.« Sie legte den Kopf schief. »Außerdem liebte er Männer, heißt es.«
»Unfug. Lies etwas von ihm, dann weißt du, dass es nicht wahr ist.« Er zögerte kurz. »Oder noch besser: begleite mich! In der Stadt gibt es ein interessantes Museum über ihn.«
Sie seufzte. »Ich würde so gern. Nur ist in der Manufaktur gerade so viel zu tun.«
»Ist es jemals anders?«
»Bitte, Per, du weißt, dass ich im Moment besonders viel Arbeit habe. Für den Umzug muss so viel vorbereitet werden. Außerdem möchte ich für nichts auf der Welt auch nur einen Tag auf Sarah verzichten.«
»Selmas Tochter ist dir also wichtiger als ich.« Das war eine Feststellung, und Frieda ahnte, dass er es ein wenig ernst meinte.
»Du veränderst dich nicht mehr so schnell«, wich sie aus. »Aber ein Säugling von gerade einmal zwei Monaten …«
»In vier oder höchstens fünf Tagen verändert sich auch der nicht«, entgegnete er sachlich. Frieda gefiel es, wie er versuchte, sie doch noch zu überzeugen, obwohl er eigentlich längst gehen wollte. Sie hätte ihm auch zu gern das Gefühl gegeben, sehnsüchtig auf ihn zu warten, wie es für eine Verlobte normal wäre. Es würde Momente geben, in denen er ihr fehlte, denn sie war von Herzen gern mit ihm zusammen. Nur hatte sie eben auch ihr eigenes Leben, ihre Manufaktur, den Umzug. Die fünf Tage würden vergehen wie ein Wimpernschlag.
»Wenigstens fährst du nicht weit weg«, sagte sie nur.
»Noch nicht. Du weißt, dass mein Cousin unsere Niederlassung in New York betreibt. Früher oder später werde ich mich auch dort einmal sehen lassen müssen.«
»Kein Problem. Solange du damit wartest, bis wir verheiratet sind, und ich dich begleiten darf.« Frieda sah zu ihm auf.
»Einverstanden. Wann heiraten wir noch gleich?«
Sie spürte einen altbekannten Druck in der Kehle. »Lass mich nur den Umzug der Manufaktur ins Ballinhaus hinter mir haben. Dann gehört mein Kopf ganz den Vorbereitungen, die so ein Fest verdient hat.«
»Von dem Kakao-Dinner, das du auf die Beine gestellt hast, spricht heute noch ganz Hamburg. Also lohnt es sich wohl, wenn ich dir noch etwas Zeit gebe.«
Es war heiß am letzten Tag des Monats Mai. Zwar war es am frühen Morgen noch zu ertragen, doch strahlte die Sonne schon verheißungsvoll vom blauen Himmel, die Luft stand still, wie es in Hamburg höchst selten vorkam. Keine Brise, keine Erfrischung. Der arme Per, im Auto würde es stickig sein wie in der Hölle. Friedas Begeisterung für lange Fahrten in einem Automobil hielt sich in Grenzen. Es war eine holprige und laute Angelegenheit, fand sie. Öffnete man die Fenster, um nicht zu ersticken, wurde das Rauschen und Zischen geradezu unerträglich. Sie zog die Vorhänge gleich wieder zu, was nur mäßig nützen würde.
Als sie die Stube betrat, war Selma schon da. Sie saß in einem der kleinen Sessel und gab Sarah gerade die Brust.
»Verzeihung«, sagte Frieda und sah rasch zur Seite.
»Ich muss mich entschuldigen«, sagte Selma sofort und machte Anstalten aufzustehen, was mit einem hungrigen Säugling auf dem Arm nicht so einfach war. »Es ist ja schließlich dein Wohnzimmer.«
»Und der kühlste Raum, den ich dir bieten kann. Also bleib nur hier. Im Speisezimmer meiner Eltern ist es zwar sicher noch angenehmer, aber dort müsstest du Sarah das Fläschchen geben, wenn du einen Ohnmachtsanfall meiner Mutter vermeiden willst.«
Selma nickte betrübt. »Wer hat ihr nur den Floh ins Ohr gesetzt, dass es etwas Besseres geben kann als die natürlichste Nahrung, die eine Mutter in sich trägt? Man hört immer wieder, dass Neugeborene, die künstlich aufgefüttert wurden, sterben. Dünne Getreidesuppen und Kuhmilch mit Fencheltee!« Sie verzog angewidert das Gesicht. »Ich will nicht schlecht über deine Mutter reden, Frieda. Ich lebe unter ihrem Dach. Aber manchmal denke ich, sie hat mir diesen Apparat zum Erwärmen der künstlichen Nahrung nur geschenkt, weil sie hofft, Sarah könne daran zugrunde gehen.«
»Aber nein, Selma, so etwas darfst du nicht sagen. Sarah ist ihr Enkelkind, ihr erstes noch dazu.« Selma war offenbar fertig und versuchte, die Knöpfe ihrer Bluse zu schließen. »Ich nehme sie dir ab.« Frieda streckte die Arme nach der Kleinen aus.
»Danke!«
»Meine Mutter ist nicht besonders klug, schrecklich altmodisch und hin und wieder ungerecht, trotzdem hat sie ein gutes Herz. Glaube mir, sie kann diesem drolligen Geschöpf ebenso wenig widerstehen wie alle anderen.« Frieda stupste Sarahs winzige Nase. »Nicht? Du verzauberst jeden. Sogar ein Stein würde schmelzen, wenn er dich sehen könnte. Du bist so niedlich!« Vorsichtig strich sie mit dem Finger über die kleine rosige Wange. Wie zart die Haut war!
»Ich weiß nicht«, sagte Selma düster, »gestern hat sie mich schon wieder gefragt, wie lange ich denn noch mit der Taufe warten will. Als ob ich ihr nicht schon hundertmal erklärt hätte, dass jüdische Kinder nicht getauft werden. Das Kind einer Jüdin ist ein Jude, ob es deiner Mutter passt oder nicht. Ich habe nicht vor, meiner Tochter die Religion ihres Vaters vorzuschreiben, der nichts von ihr wissen will.« Ihre hohe Stirn legte sich in Falten, sie nahm Frieda das Kind wieder ab.
»Das ist ungerecht, Selma. Hans erkundigt sich immer nach ihr, jedes Mal, wenn ich ihn besuche.« Frieda errötete. Sie hatte das Gefühl, dass die Lüge allzu deutlich ihrem Gesicht abzulesen war. »Wenn auch nicht jedes Mal, so doch häufig.«
»Nach mir auch?«, fragte Selma scharf. »Vielleicht macht ihn das Gefängnis milde«, fügte sie sanfter hinzu. »Aber kannst du ihn dir als liebenden Familienvater vorstellen, wenn er da raus ist?«
Frieda dachte über die Frage nach. »Ja, das kann ich«, sagte sie schließlich. Die beiden sahen sich eine Weile an, dann schüttelte Selma unwillig den Kopf. »Mal sehen, ob Sarah jetzt ein bisschen schläft.« Sie lächelte müde. Ihre Haut wirkte noch blasser als sonst, um ihre Augen lagen dunkle Schatten. »Seit Tagen diese schwüle Luft. Wir hatten beide schon lange keine erholsame Nacht mehr.«
Auf dem Weg zum alten Unternehmenssitz in der Deichstraße, in dem noch immer ihre Schokoladen-Werkstatt lag, dachte Frieda darüber nach, wie wunderbar sich alles gefügt hatte. Sie war glücklich, ja das war sie wirklich. Mit dem Umzug ins Ballinhaus erfüllte sich für sie ein großer Traum. Endlich würde sie eine richtige Manufaktur haben, mit allem Drum und Dran. Zuerst hatte sie ihre Kreationen in einem feuchten, viel zu kleinen Abstellraum entwickelt und hergestellt. Dann hatte ihr Vater immerhin dafür gesorgt, dass sie etwas mehr Raum zur Verfügung hatte, doch auch der reichte längst nicht mehr aus. Bald würde sie eine großzügige helle Kakaoküche haben, wo die Conchiermaschine, verschiedene Walzen, Töpfe und allerlei Zutaten Platz fänden. Eine eigene Kammer mit Packtischen und Lagerplatz für Silberpapier und die verschiedenen Bögen, an denen jeder sofort die gute Hannemannsche Schokolade erkannte. Zartes Rot für die Sorte mit Rosenwasser, ein kräftiges Blaugrau für die scharfe Tafel für den Herrn mit Weinbrand, einem Hauch Chili und kandiertem Minzblatt. Mit Theodor Reichardt würde sie sich auch nach Bezug der neuen Räume nicht vergleichen können, das war ihr klar. Ein eigenes Schwimmbad nur für die Mitarbeiter, das stelle man sich nur einmal vor! Aber Reichardt war schließlich auch kein Importeur, der mit Kolonialwaren aller Art begonnen und sich irgendwann auf Kakaobohnen spezialisiert hatte, sein Geschäft war schon immer die Produktion von Kakaowaren gewesen. Sollte er in seiner Fabrik mit seinen fast viertausend Angestellten ruhig Trinkschokolade und Naschwerk für die Massen herstellen. Die Gute Hannemannsche war etwas Besonderes, das man sich nur hin und wieder gönnte, wie Champagner. Sie war zwar für die meisten erschwinglich, aber eben nicht unbedingt jeden Tag. Frieda war der Auffassung, dass dieses Geschäftsmodell gerade in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten das bessere war. Sie mochte sich nicht ausmalen, welche Kosten Reichardts Fabrik in Wandsbek Monat für Monat erzeugte. Wie sollte man die wieder hereinholen und obendrein Gewinn erwirtschaften, wenn der Absatz zurückging? Und damit war zu rechnen, davon war sie überzeugt. Denn mit der Bevölkerung Hamburgs und seiner Nachbarstädte verhielt es sich so wie mit ihrem Weg zum Kontor, den sie heute in einer offenen Pferdedroschke zurücklegte. Es gab riesige Unterschiede. Da waren die klassizistischen Villen und blendend weißen Bürgerhäuser von Blankenese, doch genauso gab es Backsteinkaten mit vermoosten Reetdächern in Altona und die windschiefen Fachwerkhäuser in der Neustadt, im Kornträgergang und Langergang etwa. Schmal wie Schluchten waren die Gassen dort, schlierig-schwarz vom Ruß und vollgestopft mit viel zu vielen Bewohnern, die sich winzige Kammern teilten. Auch in der Bevölkerung gab es die Reichen, die nach dem entsetzlichen Krieg süchtig nach Vergnügungen und Luxus waren, und sich das auch leisten konnten, und es gab die Armen, die eingepfercht in den letzten Gängevierteln der Stadt kaum wussten, wie sie die vielen Mäuler stopfen sollten. Frieda hatte mit den Erzeugnissen ihrer Manufaktur die erste Sorte im Auge. Reiche gab es immer. Für die andere Sorte zweigte sie immer mal ein paar Kartons einfacher Produkte ab und spendete diese.
Kurz hinter dem Hafentor war kein Durchkommen. Die Straßen waren immer häufiger verstopft von Droschken, Autos, Bussen und an einigen Stellen der Straßenbahn.
»Das letzte Stück kann ich laufen«, rief sie dem Kutscher zu und stieg aus. Am Binnen-Hafen schlug ihr fauliger Geruch entgegen. Wurde wirklich höchste Zeit, dass es regnete. Die Pegel der Elbe und in den Fleeten sanken bereits. Schon konnte man hier und da die mächtigen Eichenpfähle sehen, auf denen manches Haus im schlammigen Grund stand. Frieda trug eine luftige weiße Bluse und einen weiten hellblauen Rock, trotzdem lief ihr schon nach wenigen Schritten der Schweiß. Sie warf einen schnellen Blick nach rechts, ehe sie in die Deichstraße bog. Wie sehr sie Hamburgs gewaltige Speicher liebte! Als junges Mädchen hatte sie sich gewünscht, in den stolzen Backsteinbauten zu arbeiten, die Seite an Seite auf den Brook-Inseln in die Höhe ragten. Was dort nicht alles gelagert war! Kaffee- und Kakaobohnen in Säcken, Gewürze, Zucker, Tee in Holzkisten. Tee. Sie schob das flaue Gefühl, das sich mit einem Schlag in ihr ausbreiten wollte, beiseite. Statt auf einem Speicherboden würde sie demnächst in ihrem eigenen kleinen Kontor im Ballinhaus ihrer Arbeit nachgehen. Mit Blick auf das Chilehaus, dessen aufsehenerregende Form an den Bug eines Schiffes erinnerte, das mitten durch die Stadt pflügt. Dort würde sie Bestellungen und Rechnungen schreiben, sich neue Rezepte überlegen, die sie später in der Küche ausprobieren konnte, und Kontakt mit Lieferanten und Abnehmern halten. Und sie würde allmählich alles lernen, was ein Hamburger Kaufmann wissen musste, der mit dem Import sein Geld verdiente. Ihr Vater konnte sicher sein, dass Frieda mit Per einen erfahrenen Mann an ihrer Seite hatte, mit dem sie gemeinsam die Leitung des Unternehmens bewältigen konnte. Und dann war da ja auch noch Ernst, der bis dahin gewiss alle nötigen Fähigkeiten erworben haben und sie uneingeschränkt unterstützen würde. Genau davon hatte sie geträumt, nur war es ihr bis vor Kurzem unmöglich erschienen, dass dieser Traum je in Erfüllung gehen könnte. Sie seufzte zufrieden. Bis es soweit war, dauerte es natürlich noch, und das war auch gut so. Ihr Vater war noch nicht alt und würde die Zügel noch lange in der Hand behalten.
Vorerst lag es in ihrer Verantwortung, Hannemannsche Schokolade herzustellen und zu verkaufen. Frieda würde ihren Vater nicht enttäuschen, dachte sie, während sie das schlichte weiße Haus in der Deichstraße betrat. Und sie würde beweisen, dass eine Frau durchaus für die Geschäftsleitung taugte.
Auf der Treppe in den ersten Stock stieß sie beinahe mit Hein Spreckelsen zusammen.
»Moin, Mademoiselle!« Er strahlte sie an und riss sich seine Mütze vom Kopf.
»Moin, Spreckel.« Sie freute sich, den Quartiersmann zu sehen. Er verbreitete eigentlich immer gute Laune. Genau wie sein Freund Ernst. »Na, was führt Sie denn her?«
»Och, ich dachte, so’n Umzug ist man bannig viel Arbeit, ne? Vielleicht brauchen Sie noch ’n starken Kerl. Oder auch zwei oder drei.« Er knetete seine Mütze. In dem Augenblick kam Ernst von oben.
»Mensch, hab ich doch richtig gehört, der Spreckel.« Er setzte eine strenge Miene auf. »Willst wieder Schokolade abstauben, oder was?«
»Nee, nie nich! Also wirklich, Ernst, als ob ich … Nu bist du hier ’n halber Geschäftsführer, da denkst wohl, du bist was Besseres und kannst so mit mir rumspringen.«
»Um«, korrigierte Frieda automatisch. Er sah sie verwirrt an.
»Ja, denn eben um …« Schnell hatte er den Faden wiedergefunden. »Aber ich bin Quartiersmann. Und zwar ein ganzer«, erklärte er stolz.
»Von wegen ein ganzer.« Ernst schnaubte verächtlich, doch seine Miene verriet, dass er seinen guten Freund nur auf den Arm nahm. Frieda wusste, dass Ernst in Wirklichkeit höchsten Respekt vor dessen Wissen und Fleiß hatte. »Ihr seid doch sogar zu viert. Spreckelsen & Consorten. Schon vergessen?«
»Aber ich bin der Vormann!« Spreckel ließ sich doch tatsächlich ärgern. »Die Consorten sind man mehr so stille Teilhaber.«
Frieda verschränkte die Arme. »So, die Herren, ich habe noch einiges zu tun. Wollen wir jetzt noch über den Umzug sprechen? Sonst würde ich …« Sie deutete nach oben.
»Was hast du denn mit unserem Umzug zu tun?« Jetzt war Ernst wirklich überrascht.
»Is doch ’ne ziemliche Schlepperei, habe ich mir gedacht. Und ’n paar von meinen Leuten hätten bestimmt nix gegen ein paar Mark extra einzuwenden. Das geht nu zwar wieder richtig los mit der Warenbewegung im Hafen, aber in den letzten Monaten war doch meist Schmalhans Küchenmeister. Jeder ist noch froh, wenn er ’n büschen was verdienen kann, so nebenbei.«
»Wir können sicher Hilfe gebrauchen«, sagte Frieda.
»Jo. Bloß haben wir schon die Möbelpacker beauftragt. Und: Warum bist du nicht zu mir gekommen? Oder noch besser zu Herrn Hannemann?« Jetzt verschränkte auch Ernst die Arme vor der Brust.
»Wollte ich ja«, verteidigte sich Spreckel. »Nur is der Alte … Oh, Verzeihung!« Er kniff die Augen zu und kräuselte die Lippen, als habe er gerade in eine Zitrone gebissen. »Der Herr Hannemann ist noch nicht zugegen«, sagte er und betonte jeden Buchstaben. »Und du warst auch nirgends zu finden.«
»Vorschlag: Wir besprechen die Einzelheiten in der Manufaktur«, sagte Frieda. »Ich habe ein neues Rezept ausprobiert. Pralinen mit Erdbeerstückchen. Mich würde sehr interessieren, was ihr davon haltet.«
»Immer stets zu Diensten«, verkündete Spreckel sofort und machte einen Diener.
»Ja, wenn du uns brauchst«, stimmte Ernst mit breitem Grinsen zu, »dann kannst du natürlich auf uns zählen.«
Nachdem Spreckel gegangen und auch Ernst wieder überall und nirgends gleichzeitig unterwegs war, dachte Frieda über die Worte des Quartiermannes nach. Frieda hatte noch nie in ihrem Leben Hunger gelitten, gleichwohl war ihr bewusst, dass es in der Stadt den meisten nicht so gut ging wie ihr. Nach dem Krieg hatte es noch Jahre gedauert, doch nun kam die Wirtschaft endlich in Schwung. Nur hieß das leider nicht, dass der zunehmende Wohlstand schon bei jedem ankam. Ihr fiel ein, dass sie in letzter Zeit ihre Aktivitäten im Waisenhaus ziemlich vernachlässigt hatte. Ihr Urgroßvater Theodor Carl hatte das Heim 1842 beim Großen Brand, der Hamburg zu großen Teilen zerstört hatte, vor den Flammen gerettet. Erst vor wenigen Jahren hatte Frieda den Grund erfahren: Dort hatte sein Kind gelebt, das er mit einem Hausmädchen gezeugt hatte. Frieda war entsetzt und ärgerlich, dass die Familie dieses Kapitel beharrlich ignorierte. Rosemarie hatte gar verhindern wollen, dass Frieda überhaupt davon erfuhr. Ungeheuerlich, dass Großvater Carl einen Bruder oder eine Schwester hatte, sich jedoch nicht einen Deut darum kümmerte! Irgendwann musste dieses Kind das Waisenhaus verlassen haben. Wohin war es gegangen? Frieda hätte es zu gern gewusst, doch außer ihr schien sich niemand dafür zu interessieren, nicht einmal ihr Vater.
»Das sind alte Geschichten, Kind«, hatte er gesagt, wann immer sie ihn danach fragte. »Man sollte die Vergangenheit ruhen lassen.«
Frieda fand es traurig, dass niemand sich verpflichtet fühlte, Nachforschungen anzustellen, und dem Kind von einst zu helfen. Darum hatte sie begonnen, dem Heim Geld zu spenden, wann immer sie etwas entbehren konnte. Eigentlich war es vor allem Liz gewesen, die sie dazu gebracht hatte. Eliza Williamson war Krankenschwester auf der Uhlenhorst gewesen. Die Geschichten von ihren unterernährten Schützlingen, die Liz immer wieder erzählt hatte, hatten Frieda das Herz gebrochen. Sie seufzte. Sie wollte nicht an Eliza denken, denn dann dachte sie sofort an Jason, und das flaue Gefühl, das sie nur zu gut kannte, drohte sie zu ersticken. Besser, sie machte sich eine Notiz, dass sie sich wieder um das Waisenhaus kümmern wollte, sobald der Umzug geschafft war. Wie sagte Ernst immer? Das Ansehen eines Kaufmanns hängt nicht bloß vom Wohlstand ab. Sehr richtig! Gute hanseatische Kaufleute hinterließen auch Spuren im gesellschaftlichen Leben der Stadt, das war Tradition. Noch dazu eine, die Frieda von ganzem Herzen schätzte. Die vielen Arbeiter, wie etwa die im Hafen, waren sozusagen das Blut Hamburgs. Ohne sie konnte kein Organ funktionieren, konnte sich kein Körperteil der Hansestadt bewegen. Menschen wie Friedas Freundin Ulli, die auf Spreckels Speicherboden zusammen mit anderen Frauen Tag für Tag viele Stunden Kaffeebohnen sortierte, sorgten für den Herzschlag der reichen Kaufleute und lebten doch in einfachsten, oft sogar unwürdigen Verhältnissen. Neben den stolzen Neubauten, neben all der Pracht existierte in Hamburg auch Elend. Jede Menge davon. Frieda hatte es kennenlernen müssen, um zu begreifen, wie glücklich sie sich selbst wegen ihres Wohlstands schätzen konnte. Es war das Mindeste, anderen Menschen etwas davon abzugeben. Vor drei oder vier Jahren war sie noch ein junges Ding gewesen, das im Moment gelebt hatte und daran festhalten wollte. Kein Grund, sich zu schämen, es war völlig normal, dass sie nur ihre eigene Welt gekannt hatte. Nun war sie erwachsen, hatte viel gesehen und erlebt. Jetzt verstand sie, dass jeder seine eigene Biografie schrieb. Dabei kam es darauf an, nicht nur das eigene kleine Leben, sondern das Ganze zu sehen. Jetzt war der richtige Zeitpunkt, dafür zu sorgen, dass man sich später nicht nur an die Geschäftsfrau Frieda Hannemann erinnerte, sondern an eine Frau mit großem Herzen. Sie wollte eine würdige Nachfolgerin ihres Urgroßvaters Theodor Carl sein. Ihm zu Ehren hatte man eine Gedenktafel in der Admiralitätsstraße aufgestellt, weil er beim Großen Brand durch sein beherztes Eingreifen fast dreihundert Menschen das Leben gerettet hatte. Ob die Tafel dort auch stehen würde, wenn die feinen Hanseaten wüssten, aus welchem Grund er damals ausgerechnet das Waisenhaus vor den Flammen geschützt hatte?
Erst in den frühen Abendstunden kehrte Frieda nach Hause zurück. Normalerweise hätte sie Per noch einen Besuch abgestattet, oder er wäre zu ihr gekommen. Fast jeden Abend trafen sie sich, um einander zu erzählen, was sie getan und erlebt hatten. Frieda genoss diesen Austausch sehr. Zwei Tage waren seit Pers Abreise vergangen. Obwohl ihr die abendlichen Gespräche fehlten, fühlte es sich für Frieda an, als wären es nur zwei Stunden gewesen, so viel war zu tun. Sie hatte die Produktion von Pralinen, Tafeln und für Flocken, aus denen man Trinkschokolade machen konnte, eingestellt, damit sämtliche Gefäße und vor allem die Walzen vor dem Abtransport gründlich gereinigt werden konnten. Gewürze und andere feine Zutaten verpackte sie selbst. Die Kartons mit fertiger Ware, mit Verpackungspapier, unzähligen Rührlöffeln, Formen und Schüsseln überließ sie ihren Mitarbeitern. Ihr Vater und Ernst trafen letzte Absprachen mit Hermann Krosanke, der mit seinen Pferden und Möbelwagen eine Institution war. Er würde in wenigen Tagen alles von der Deichstraße zum Meßberg bringen, was Hannemann & Krüger ausmachte. Die Beteiligung von Spreckels Leuten wurde ebenso geklärt wie der Einsatz der Handlungsgehilfen. Buchhalter Meynecke hatte sich geradezu ausgebeten, dass er und niemand sonst die Kartons mit den Journalen, Kassenbüchern und dergleichen verladen und im Ballinhaus in Empfang nehmen würde. Aufregung und Vorfreude waren überall und bei jedem Einzelnen greifbar. Gerade überlegte Frieda, ob sie noch ein halbes Stündchen lesen sollte, oder ob ihr ohnehin die Augen zufallen würden, sie also auch gleich zu Bett gehen könnte, als ihr Telefonapparat klingelte. Sie hob den Hörer ab.
»Jetzt kommt ein Gespräch für Sie«, säuselte das Fräulein vom Amt. Bei jedem Anruf der immer gleiche Satz. Dann Pers Stimme, ein wenig knisternd und mit Rauschen im Hintergrund.
»Das ist aber nett! Ich hoffe, es gibt keinen Anlass, dass du anrufst. Ist alles in Ordnung bei dir?«
»Ich dachte, ich bräuchte keinen Anlass, um meine Verlobte anzurufen.«
»Natürlich nicht.« Sie lächelte. »Ich freue mich. Dann bist du also gut angekommen?« Per erzählte von seiner Reise und von der Arbeit, dann wollte er wissen, wie die Umzugsvorbereitungen vorangingen. »Zu schade, dass du nächste Woche nicht hier bist«, sagte Frieda lachend, nachdem sie ihm alle Einzelheiten berichtet hatte. »Wenn es wirklich so weit ist, übernimmt Krosanke das Ruder. Dann können Vater und Ernst nicht mehr viel tun. Es wäre gut, wenn du sie dann ablenken würdest. Ein ausgedehntes gemeinsames Mittagessen, oder du hättest sie auf eine Fähre locken und mit ihnen kreuz und quer durch den Hafen schippern können.«
»Eine brillante Idee.« Er atmete durch. »Glaube mir, ich lasse deinen Vater nur höchst ungern mit dem Umzug allein.« Nach einem Moment sagte er: »Eine Sekunde hatte ich doch tatsächlich gedacht, du freust dich einfach darauf, mich bald wiederzusehen, aber du denkst wirklich nur an das Geschäft, oder?«
Frieda wurde das Herz schwer. Sie hasste es, bei ihm diesen Eindruck zu hinterlassen. »Nicht nur. Ich …«
»Schon gut, Frieda.« Wieder entstand eine kurze Pause. »Jetzt muss ich Schluss machen. Es gibt Dorsch mit Kartoffeln und Senfsoße. Niemand kocht das besser als meine Mutter.«
»Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Grüße deine Eltern bitte von mir, und bitte deine Mutter, mir das Rezept aufzuschreiben, damit ich wenigstens versuchen kann, mit ihr mitzuhalten.«
»Warum solltest du kochen?«
»Weil ich eine moderne Frau bin. Ich brauche keine Bediensteten.« Frieda stutzte. »Was ist das überhaupt für eine Frage? Deine Mutter kocht doch auch selbst.«
»Sie ist aber auch nur die Ehefrau eines Reeders und hat mit seinen Geschäften nichts zu tun. Du kümmerst dich um die Manufaktur, wirst einmal Teil der Geschäftsleitung von Hannemann & Krüger sein, ein Kind großziehen oder mehrere …«
Frieda räusperte sich. »Na schön, eine Köchin und ein Kindermädchen vielleicht, aber mehr will ich auf keinen Fall im Haus haben.«
»Wir werden sehen.«
Nachdem sie sich verabschiedet hatten, blieb Frieda noch einen kurzen Moment sitzen. Es tat ihr leid, dass er wieder einmal vergeblich auf ihre Liebesbekundungen gewartet hatte.
»Ich habe mich in dich verliebt, darum bitte ich dich, meine Frau zu werden«, hatte er zu ihr gesagt. Sie hatte nicht erwidert, dass sie ihn ebenfalls liebte. Bis heute nicht. Weil es nicht der Wahrheit entsprach und sie diese Worte niemals aussprechen würde, wenn sie nicht geradewegs aus ihrem Herzen kamen. So gern sie ihn auch hatte, es war nicht das, was sie für Jason empfunden hatte. Noch nicht. Zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit musste Frieda an Jason denken. Jason Williamson, Sohn einer englischen Tee-Dynastie. Dieses Mal ließ sie den Gedanken zu, denn er bereitete ihr ein weit weniger mulmiges Gefühl als üblich, wie sie erstaunt feststellte. Jason war ihr im wahrsten Sinne des Wortes über den Weg gelaufen. Er war ihre große Liebe! Ein spöttisches Lächeln trat auf ihre Lippen. Zumindest das, was sie so für die große Liebe gehalten hatte! Verliebtheit traf es wohl eher. Durch Jason hatte sie Romantik und Leidenschaft kennengelernt. Na und? Solchen rosaroten Gefühlen wurde für ihren Geschmack zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Alle Welt sprach davon, aber was sollte das schon sein? Das Kribbeln und Flattern? Die körperlichen Genüsse? Alles vorüber, ehe man Labskaus sagen kann. Darauf konnte doch niemand ernsthaft sein Leben gründen. Auf eine verlässliche Person wie Per dagegen schon. Natürlich würde sie auch mit ihm schlafen, wenn sie verheiratet waren, vermutlich Kinder haben. Würde es ihr Spaß machen? Selten erlaubte sie sich derartige Gedanken, doch in diesem Moment fragte sie sich, wie es mit Per wohl sein würde. Bestimmt war er zärtlich und behutsam. Ob er sie auch in einen derartigen Zustand versetzen konnte, wie Jason es getan hatte? Sie sah Jason vor sich, sein rötlich-braunes Haar, die Sommersprossen auf seiner Nase, diesen verführerischen Blick. Seine Hände auf ihrem Körper, seine weichen Lippen auf ihrem Mund. Nicht nur auf ihrem Mund. Frieda schloss die Augen. Das wohlige Ziehen in ihrem Leib meldete sich zurück. Wie lange hatte sie es nicht mehr zugelassen? Sie musste schlucken, holte den Moment im Geist zurück, als sie ihn in seiner Wohnung besucht hatte, als seine Finger über ihre Oberschenkel geglitten waren, zum ersten Mal ihre Brüste berührt hatten. Sie war mehr als bereit gewesen, sich ihm hinzugeben. Ihr Seufzen brachte sie in die Gegenwart zurück. Dann hatte er ihr eröffnet, dass er nach Indien reisen musste.
»Vielleicht steht eure Verbindung unter keinem guten Stern«, hatte Ernst einmal gesagt. Womöglich hatte er recht. Erst war es ihr Vater, dann ihr Bruder gewesen, der versucht hatte zu verhindern, dass sie Jason nach Indien folgte. Und es war ihnen gelungen. Sie war in Hamburg geblieben, hatte ihm Briefe geschrieben. Seine letzte Nachricht war ein Abschied gewesen. Noch einmal seufzte Frieda, als sie an die Zeilen dachte, die sie bestimmt hundertmal gelesen hatte:
»Ich muss davon ausgehen, dass du nicht mehr an mich denkst. Wahrscheinlich hast du einen anderen getroffen.« Das war alles. Er hätte zurückkommen, einfach vor ihrer Tür stehen und sie fragen müssen, ob sie ihn wirklich vergessen hatte. Doch Jason war kein Kämpfer. Er hatte viel zu schnell aufgegeben. Als er diese Worte geschrieben hatte, hatte sie noch sehnsüchtig auf seine Rückkehr gehofft. Als sie sie – so viel später – endlich hatte lesen können, hatte sie wahrhaftig einen anderen getroffen. Per. Er würde Frieda nicht so schnell gehen lassen. Wieder atmete sie tief durch. Sie hatte Jason schreiben wollen, fand, dass er ein Recht auf die Wahrheit hatte. Doch dann hatte sie es sich anders überlegt. Was hätte es genutzt, wenn er erfahren hätte, dass sowohl ihre als auch seine Briefe abgefangen worden waren? Es hätte nichts an dem Umstand geändert, dass Jason nicht alle Hebel für ihre gemeinsame Zukunft in Bewegung gesetzt hatte. Er wusste nicht einmal von Pers Existenz, sondern ging nur davon aus, dass sie jemanden getroffen hatte. Genug für ihn, ihr Lebewohl zu sagen. Frieda war das längst nicht genug. Nur an Jasons Schwester Liz hatte Frieda ein paar Zeilen verfasst. Liz war ihr während Jasons Abwesenheit ein großer Halt gewesen. Dann hatte sie Hamburg über Nacht verlassen, weil ihre Mutter gestorben war, und sie zu ihrer Familie nach England wollte. Es wäre unanständig gewesen, ihr nicht wenigstens Worte des Beileids zu senden. Ein letzter Brief, danach hatte Frieda die Williamsons aus ihrem Leben gestrichen. Je mehr Zeit verging, desto mehr verblasste die Erinnerung an all das. Trotzdem, sie hätte zu gern gewusst, was aus Jason und Eliza geworden war. Nein, vorbei. Fang gar nicht erst wieder damit an, Frieda Hannemann! Auf ihr Kondolenzschreiben hatte sie nie eine Antwort erhalten, und das war gut so. Jetzt gab es nur noch Per Møller. Im Gegensatz zu Jason würde er um sie kämpfen, und er würde zu ihr zurückkommen. Auf ihn konnte sie sich verlassen.
Als Frieda am nächsten Morgen erwachte, hörte sie leises Trommeln am Fenster. Regen. Sie streckte sich. Wie schön, gewiss hatte es sich dann auch etwas abgekühlt. Sie sah auf die Uhr. Noch nicht einmal halb sieben. Trotzdem hörte sie aus Selmas Zimmer schon leises Summen. Vermutlich war Sarah schon wach, und Selma versuchte, ihr Kind wieder in den Schlaf zu singen. Frieda stand auf und klopfte an ihre Tür. Das Summen verstummte.
»Guten Morgen. Was hältst du davon, zusammen zu frühstücken?«
»Wenn du ausnahmsweise mal Zeit hast, gern«, kam es augenblicklich zurück. »Ich bereite alles vor, während du im Bad bist.«
»Das hatte ich gehofft.« Sie hörte Selma lachen.
Wenig später saßen die beiden Frauen am Frühstückstisch in Friedas kleinem Reich. Sarah lag in dem Körbchen, das Frieda vor der Geburt besorgt hatte. Es war einfach praktischer, den Weidenkorb vom Schlafzimmer in Friedas Wohnzimmer, dann wieder in Selmas Kammer oder auch mal ins Freie zu tragen, als ständig eine Wiege hin und her zu schleppen. Die Zeit würde ohnehin schnell vergehen, und dann würde die Kleine nur noch ein Kinderbettchen brauchen und ansonsten auf dem Fußboden oder dem Sofa herumkrabbeln.
Es klopfte, Henni brachte Kaffee und die Zeitung.
»Danke, Henni.« Frieda legte den Hamburger Anzeiger zur Seite. Sie hatte es sich zwar zur Angewohnheit gemacht, wie ihr Vater jeden Morgen aktuelle Nachrichten und Wirtschaftsmeldungen zu studieren, ehe sie das Haus verließ, doch sie wollte nicht unhöflich sein. Außerdem genoss sie es sehr, ein wenig mit Selma zu plaudern. Sie mochte die hübsche Frau, die mit einem Koffer, einem gewölbten Bauch und großer Verzweiflung in ihre Verlobungsfeier geplatzt war. Und Frieda liebte ihre Nichte Sarah. Das Kind hatte einen denkbar unglücklichen Start ins Leben. Die Mutter Jüdin, unverheiratet, der Vater, ein gebrochener Mann, dem der Krieg den Boden unter den Füßen weggezogen hatte, und der im Gefängnis saß. Den größten Teil seiner Strafe hatte Hans inzwischen abgesessen. Doch was sollte aus ihm werden, wenn er wieder frei war?
»Hans macht sich ziemlich gut in letzter Zeit«, sagte Frieda und war selbst ein wenig erschrocken, dass sie es laut ausgesprochen hatte. Selma hob nur kurz die perfekt geschwungenen Augenbrauen. Wie schön diese Frau war. Das dunkelbraune Haar fiel ihr in sanften Wellen weit über die Schulter, ihre braunen Augen konnten ebenso scheu wie energisch dreinblicken. Ihre etwas breiten Lippen waren von natürlichem Rot, die Nase vielleicht eine Spur zu lang, aber wohlgeformt und schmal. Selma war eine Erscheinung, groß und schlank, der Rücken auffallend gerade, die Schultern gestrafft. Hans war ebenfalls sehr stattlich, allerdings hatte er blaue Augen und blondes welliges Haar, das man ihm in der Haft kurz geschnitten hatte. Die wenigen Härchen, auch die Augenbrauen und Wimpern der kleinen Sarah waren dunkel, wie bei ihrer Mutter, dazu hatte sie die blauen Augen ihres Vaters. Sie würde einmal eine Schönheit werden. Wenigstens in diesem Punkt hatte sie Glück.
»Worüber lächelst du?« Selma beobachtete sie.
»Nichts Bestimmtes. Es ist nur …« Frieda dachte an ihren letzten Besuch in der Anstalt in Fuhlsbüttel. »Er verhält sich wieder ziemlich normal, seit er die Drogen überwunden hat. Allerdings scheint er mir noch immer labil zu sein und deprimiert. Ich weiß, dass du ihn nicht gerade mit offenen Armen empfangen wirst.« Selma holte Luft, doch Frieda sprach schnell weiter: »Das musst du auch nicht. Du brauchst dich Hans gegenüber in keiner Weise verpflichtet zu fühlen, nur weil du bei uns ein Zuhause gefunden hast. Das habe ich dir versprochen, und dabei bleibt es auch.« Sie trank einen Schluck Kaffee. »Er braucht aber nun mal etwas, wenn er draußen nicht gleich wieder in die falschen Kreise geraten soll. Hans braucht eine Aufgabe. Nur was? Darüber zermartere ich mir schon länger das Gehirn. Mein Vater will nichts davon hören, ihn in der Firma unterzubringen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde mich der Gedanke auch beunruhigen. Mein Bruder könnte innerhalb kürzester Zeit alles zerstören, was Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben. Er könnte Ernsts Existenz genauso gefährden wie meine Manufaktur.«
»Er war der verwöhnte Prinz, der nie etwas leisten musste. Bis er in den Krieg geraten ist und von früh bis spät bis an die Grenzen des Erträglichen gehen musste. Und weit darüber hinaus.« Selma lehnte sich zurück und legte die Stirn in Falten. »Ein jüdisches Sprichwort sagt: Die Soldaten kämpfen, aber die Könige sind die Helden. Wer war in diesem Krieg der Held?«
»Niemand.«
Selma schüttelte traurig den Kopf. »Da hast du recht. Es gibt noch ein Sprichwort. Es heißt: Menschenherz und Meeresboden sind unergründlich. Ich wusste nie, was in deinem Bruder vorgeht. Das hat mich an ihm so gereizt, als ich ihn kennenlernte, das Unergründliche.« Ihre Gesichtszüge entspannten sich ein wenig. »Es ist nicht allein seine Schuld, dass ich nun ein Kind von ihm habe. Er hat mich nicht gezwungen, mit ihm ins Bett zu gehen. Er war nicht der erste Mann und wäre wohl auch nicht der letzte geblieben. Wir haben beide nicht aufgepasst. Jetzt wünschte ich, er wäre leichter zu ergründen.« Leise sagte sie: »Dann hätte ich weniger Angst vor dem Moment, wenn er nach Hause kommt.«
Eine Weile aßen sie schweigend. Sarah quietschte vergnügt und brabbelte vor sich hin, als wolle sie bereits sprechen. Frieda fragte sich plötzlich, wie Pers und ihre Kinder wohl aussehen würden. Sie stellte fest, dass sie es gern herausfinden würde.
Kapitel 2
Der Tag des Umzugs war gekommen und die Wagen von Hermann Krosanke rumpelten unaufhörlich von der Deichstraße in Richtung Ballinhaus und zurück.
Ernst und ihr Vater brüllten abwechselnd Kommandos, bis es Krosanke zu viel wurde: »Jo, Herr Hannemann, nu gehn Sie man fein ’n Päuschen machen, ich stell schon keinen Murks nich an.«
»Ja, aber …«
»Nee, nix aber, ich kümmer mich da gut um.« Und leise murmelte er: »Goh mi blots af!«
Frieda verkniff sich das Lachen. Es war beileibe nicht Vaters erster Umzug, aber es war der erste, bei dem alles auf einen Schlag von einem Ort an den anderen gebracht werden musste. Und dann auch noch in das Ballinhaus! Der nagelneue Prachtbau am Meßberg lag mitten im Kontorhausviertel, das an die Stelle schäbiger Wohngänge getreten war. Zehn Geschosse, Eisenbeton mit rotem Backstein verkleidet, der teilweise in sanften Wellen verlief, wo man eigentlich Ecken und Kanten erwarten würde. Am besten gefielen Frieda die reliefartigen Figuren, Fischwesen, die die Eingänge bewachten.
Buchhalter Meynecke hatte ein wachsames Auge auf jeden Karton, der mit Ordnern und Kassenbüchern gefüllt das Haus in der Deichstraße verließ. Frieda zählte nicht mit, wie oft er sich eine Pfeife anstecken wollte, sie dann jedoch unverrichteter Dinge wieder in seiner Brusttasche verschwinden ließ, weil etwas oder jemand seine volle Aufmerksamkeit beanspruchte.
Rudolf, ein Kriegsinvalide, der seit einigen Jahren für sie arbeitete, war mit seinen Krücken erstaunlich flink unterwegs. Wurde trotzdem Zeit, dass er eine Prothese bekäme, die ihm den linken Unterschenkel ersetzte. Der Krieg hatte ihm das Körperteil genommen. War es nicht blanker Hohn, dass es auch der Krieg war, der die Entwicklung in diesem Bereich der Medizin so vorangetrieben hatte?
Schade, dass dieser Professor Sauerbruch, von dem man so viel Erstaunliches hörte, nur eine bewegliche Armprothese entwickelt hatte, wobei Rudolf sich von Sauerbruch sowieso keine Beinprothese hätte leisten können. Eine einfache würde ihm schon helfen. Könnte er auf Krücken verzichten, hätte er beide Hände frei und könnte eine vollwertige Stelle in der Manufaktur übernehmen. Frieda nahm sich vor, mit ihm darüber zu reden, sobald sie die neuen Räume bezogen hatten. Die Wirtschaft würde in den kommenden Jahren florieren, sie durfte sich auf mehr Arbeit einstellen. Mehr Arbeit bedeutete aber auch, dass sie mehr Angestellte brauchen würde.
»Vorsicht, gnädige Frau!« Ein Mann mit Oberarmen, die den Umfang von Friedas Schenkeln hatten, bahnte sich seinen Weg zu einem der Wagen. Auf dem Buckel trug er eine von Vaters kleineren Kommoden. Frieda sprang zur Seite. Viele der Handlungsgehilfen und Arbeiter, denen Albert größtenteils zwei Tage freigegeben hatte, waren dennoch gekommen. Sie wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen und zur Stelle sein, wenn Hilfe gebraucht würde. Auch von Spreckels Männern waren drei gekommen. Albert hatte mit Krosanke besprochen, dass das gesamte Unterfangen an zwei statt, wie Krosanke angekündigt hatte, an drei Tagen über die Bühne zu gehen habe. Mit Spreckels Männern sollte das möglich sein.
Schon wieder musste Frieda zur Seite gehen. Ausgerechnet jetzt wollte auch noch ein Kutscher mit recht breitem Gespann zum Steinkohlen-, Holz- und Torflager am Ende der Deichstraße, wie der aufgebrachte Mann lautstark verkündete. Die Gasse war sowieso recht schmal, und nun beanspruchten Krosankes Wagen auch noch mehr als eine Seite davon für sich. Frieda beobachtete, wie der Mann auf dem Bock, die Pausbacken schon dunkelrot vor Zorn, wild mit den Armen fuchtelte und seine Pferde auf den Gehsteig dirigierte. Krosanke stand mit in die Hüften gestemmten Fäusten da und passte auf wie ein Schießhund, dass nur keins seiner Fahrzeuge auch nur einen Kratzer abbekam. Seine Mitarbeiter mussten auf sich selbst achtgeben. Wie Zirkusakrobaten tänzelten sie mit ihrer schweren Fracht durch die winzigsten Zwischenräume und Schlupflöcher, um ihre Arbeit weiter zu verrichten. Denn ein Grund für eine Pause war das Gedränge nicht.
»Nich Maulaffen feilhalten, fix weitermachen!«, brüllte Krosanke, wenn einer auch nur für eine Sekunde stehen blieb.
»So mach ich das leiden!« Ernst stand auf einmal neben Frieda. Er griente fröhlich und rieb sich die Hände. »Is bannig was los, und gibt an allen Ecken und Enden was zu gucken.«
Er hatte den Satz noch nicht beendet, als einer von Spreckels Männern zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe vor dem Haus hinabhüpfte, mit der Ferse hängen blieb und mächtig ins Straucheln geriet.
»Oha!«, sagte Ernst. Es ging alles so schnell, dass Frieda und er nur zusehen konnten, wie dem armen Kerl der Karton Vollmilchschokolade, wie Frieda sofort an der Kennzeichnung erkannte, aus den Händen geschleudert wurde. Spreckels Arbeiter, ein schlaksiger dunkelhaariger junger Mann, ruderte mit den Armen, die Frieda ungewöhnlich lang erschienen. Er fing den Karton auf, knickte beim nächsten Schritt um, stolperte hilflos vorwärts und blieb am Bein einer Kommode hängen, die einer der Möbelpacker gerade auf dem Gehsteig abgestellt hatte. Der Karton mit der Schokolade entwischte ihm nun doch noch, schlitterte über die Kommode und fiel am anderen Ende auf den Boden. Der Deckel riss auf, und die hübsch verpackten Tafeln im schlichten hellblauen Papier rutschten heraus.
»Schiet aber auch!«, schimpfte Spreckels Mann und rieb sich abwechselnd den linken Knöchel und den rechten Ellenbogen.
Frieda wollte schon zu den auf dem Boden verstreuten Schokoladentafeln eilen, als Ernst sie zurückhielt und mit dem Kopf auf zwei Kinder deutete, die wie aus dem Nichts auf dem Gehsteig aufgetaucht waren. Sie hatten struppiges Haar und dreckige Finger, die sie jetzt vorsichtig nach den Tafeln ausstreckten. Ihre glänzenden Augen, weit aufgerissen, waren dabei auf den schlaksigen Arbeiter gerichtet, der den Karton hatte fallen lassen.
»Weg da! Los, macht, dass ihr wechkommt!«, rief der und fuchtelte mit den langen Armen. Die beiden, Bruder und Schwester vielleicht, zogen sich erschrocken hinter einen der Krosanke-Möbelwagen zurück. Noch gaben sie die vermeintlich leichte Beute allerdings nicht verloren.
»Nein, schon gut!« Frieda überquerte die Deichstraße. Ernst blieb an ihrer Seite, beschleunigte seine Schritte, um zuerst an dem zerrissenen Karton und den ausgekippten Tafeln zu sein. Schon hockte er auf dem Steinboden und klaubte alles zusammen. Er sah zu Frieda auf. Ein winziges Kopfnicken von ihr reichte, und er wusste Bescheid.
»Denn kommt man her, ihr kleinen Schietbüdel«, sagte er freundlich zu den Kindern. Die trauten dem Braten nicht. Anscheinend erwarteten sie eine Tracht Prügel, wenn sie nur nahe genug herankämen. Als Ernst ihnen jedoch zwei Tafeln entgegenstreckte, überlegten sie nicht lange. Wie kleine Eichhörnchen, die sich eine Nuss holten, huschten sie vor und mit ihrem Schatz auf der Stelle davon. Frieda konnte sie gerade noch in die Steintwiete verschwinden sehen.
»Kann sich eben noch längst nicht jeder gute Hannemannsche leisten«, sagte Ernst nachdenklich, den zerfledderten Karton mit den Tafeln unter den Arm geklemmt.
»Muss ich nu etwa den Schaden bezahlen?«, wollte Spreckels Arbeiter wissen, der wie der sprichwörtliche begossene Pudel mit hängenden Armen einfach nur dastand. Frieda sah, dass er, nicht viel anders als die beiden Kinder, den sehnsüchtigen Blick kaum von der Vollmilch wenden konnte. Noch längst nicht jeder konnte sie sich leisten. Da hatte Ernst zweifellos recht. Aber wie hatte Großvater Carl immer gesagt? Kakao bringt einen Menschen wieder auf die Beine. Nicht nur das, er würde ihm bestimmt auch ein bisschen zusätzliche Kraft geben. Warum war sie nicht gleich darauf gekommen, alle Helfer des Umzugs mit ein paar Riegeln zur Stärkung zu versorgen?
»Nein, natürlich nicht.« Frieda lächelte ihn an. »Es war nicht zu übersehen, dass das keine Absicht war.« Dann wandte sie sich an Ernst: »Falls du gerade keine andere wichtige Aufgabe hast, würde ich dich bitten, die Tafeln an die Arbeiter zu verteilen.« Er machte große Augen. »Verkaufen kann ich die sowieso nicht mehr. Guck dir nur an, wie sie aussehen. Das hübsche Papier ist dreckig oder sogar eingerissen. Wie es aussieht, sind die meisten Tafeln auch zerbrochen.«
Er nickte. »Jo, ist zu befürchten.« Dann fiel ihm anscheinend etwas ein, und schon lächelte er wieder. »Weißt noch, die Sauerei beim Sülze-Heil damals? Als das Fass vom Wagen gefallen und auf den Boden geknallt ist, da kam ’n schöner Schiet zum Vorschein, den der Heil zu Delikatess-Sülze verarbeitet hätte«, sagte er geziert. Dann lachte er. »Das hat den Hamburgern gar nicht geschmeckt, was der ihnen jahrelang für gutes Geld untergejubelt hat. War nicht gerade hilfreich für sein Geschäft. Da isses doch besser, wenn man aus dem kleinen Malheur sogar noch Werbung machen kann.« Ihm wurde offenbar erst jetzt richtig klar, was er da gerade gesagt hatte. »Mönsch, was wär denn, wenn wir aus der Not ’ne Tugend machen würden?«
»Naja, von Not kann ja wohl keine Rede sein«, widersprach Frieda.
»Nee, is eben so’ne Redewendung. Aber trotzdem …«
»Was meinst du, Ernst Krüger?«
»Hast du nicht gesagt, du hast beim Vorbereiten des Umzugs festgestellt, dass da noch ’ne Menge Vollmilchschokolade rumliegt, die du gar nicht auf’m Zettel hattest? Wenn du nu so tust, als wenn mehr Kartons auf den Boden geknallt wären, denn kannst die Tafeln als Bruch zum Sonderpreis anbieten. Umzugs-Schokolade – extra günstig«, verkündete er und malte mit der freien Hand zwei Schlagzeilen in die Luft. »Denn sind die ganz fix weg, ehe die nachher gammelig werden.«
Sie sah ihn an, wie er sich den Karton nun vor den Bauch presste, damit nicht wieder alles auf der Straße landete. »Ernst, du bist genial!«
Er strahlte über das ganze Gesicht. »Jo, plietsch, ne?« Plötzlich runzelte er die Stirn. »Wieso eigentlich? Ich mein, im Grunde hattest du doch schon die Idee …«
»Schokolade vor dem Bauch, das ist es!« Er sah von dem Karton zu ihr und wieder zu dem Karton.
»Falls jemand nach mir sucht, ich bin bei Spreckel«, rief Frieda und lief auch schon in Richtung Speicherstadt davon.
»Wieso, der is doch hier«, hörte sie Ernst noch sagen, doch sie kümmerte sich nicht darum.
Frieda wünschte sich schon so lange eigene Verkaufsstellen für die Hannemannsche Schokolade. Nicht Warenhäuser, wie das der Mendels, sondern eigene kleine Geschäfte, die nichts anderes anboten als sämtliche Pralinen und Tafeln, die Frieda bisher kreiert hatte. Das war natürlich nur ein Traum. Bisher gab es nur die Schokoladenautomaten, die an vier Stellen der Stadt aufgebaut waren. Inzwischen wurden die zwar immer besser angenommen, doch wirklich zufrieden war Frieda damit nicht. Der Aufwand, das Geld zu entnehmen und die Automaten aufzufüllen, war recht hoch. Ein Mitarbeiter musste dafür regelmäßig durch ganz Hamburg fahren. Einmal war ein Automat aufgebrochen gewesen, ein anderes Mal war Ungeziefer hineingekommen und hatte sich durch die Verpackungen geknabbert. Außerdem passte ein hübscher kleiner Laden mit einer adrett gekleideten Verkäuferin, die die Kunden bedienen und ihnen Auskunft zu den unterschiedlichen Sorten geben könnte, viel besser zur Hannemannschen Ware als seelenlose Apparate. Oder für den Anfang eben charmante Verkäuferinnen mit einem entzückenden Bauchladen.
Frieda hatte das Nikolaifleet hinter sich gelassen, die Brücke über Binnenhafen und Zollkanal überquert und eilte nun den Brook entlang. Sie war so aufgeregt, dass sie keinen Blick für die Gesimse und Friese, den mal gelb, mal grün glasierten Stein der mächtigen Speicher hatte, die wie eine Burg auf den Brookinseln thronten. Block H, Spreckelsen & Consorten. Schon der fein würzige Geruch verriet, dass hier Kaffee gelagert wurde. Im Treppenhaus, dessen Fenster auf das Fleet schauten, war es angenehm kühl, trotzdem tupfte Frieda sich den Schweiß von der Stirn, als sie endlich den Verleseboden im sechsten Stock erreicht hatte.
»Moin, Fräulein Hannemann«, tönte es von den langen Tischen, die unter den gläsernen Kuppeln der Dachkonstruktion standen. Einige der Kaffeemiedjes, wie die Frauen, die hier tagein, tagaus Bohnen nach Größe, Farbe und natürlich auch nach Güte sortierten, ein wenig spöttisch genannt wurden, kannten Frieda. Immerhin war sie mit einer von ihnen befreundet oder doch wenigstens gut bekannt. Ulli, eigentlich Ulrike Grotjan, sah von ihrer Arbeit auf. Die Überraschung stand ihr ins Gesicht geschrieben.
»Is was mit Spreckel?«, fragte sie.
»Nein, wie kommst du darauf?« Dann verstand Frieda. »Nein, nein, ihm geht es gut. Er hüpft zwischen den Möbelwagen hin und her wie sonst zwischen den Kaffeesäcken.« Sie lächelte. »Hättest du wohl Zeit für eine kleine Pause?«
Kurz darauf standen sie gemeinsam unten vor dem Speicher und gingen ein paar Schritte in Richtung Kehrwieder.
»Mann, lange nicht mehr so’n Schmachter auf eine Zigarette gehabt«, sagte Ulli und stöhnte. »Nicht, dass das gegen die drückende Wärme helfen würde, aber es hätte getröstet.« Sie grinste schief. »Naja, heute geht es mit der Luft.«
»Ich finde es großartig, dass du mit dem Rauchen aufgehört hast. Du hustest längst nicht mehr so oft.«
»Weiß ich doch selbst«, fiel Ulli ihr ins Wort. »Und ich komme die Treppen zum Verleseboden viel besser rauf. Ist ja nicht so, dass mein Verstand das nicht wüsste, nur meiner Sucht muss ich’s eben ab und zu wieder verklickern.«
»Wie geht es deiner Schwester?«, wollte Frieda wissen. Sie hatte die kleine Marianne eine Ewigkeit nicht gesehen.
»Sie ist jetzt an der Gehörlosenschule in der Bürgerweide. Wohl nicht lange, sie ist schon zu alt. Aber es ist eine Chance. Vor allem ist sie dort eine von vielen. Alle haben die gleiche Einschränkung, niemand starrt sie an oder macht sich womöglich über sie lustig, wenn sie mit den Händen spricht.« Ulli seufzte, blieb stehen und blickte über das Kehrwiederfleet, auf dem gerade ein traditioneller Milch-Ewer festmachte. Eine kleine Attraktion, denn die Segelschiffchen, von denen früher über ein Dutzend auf der Alster unterwegs gewesen sein sollten, waren seit bestimmt dreißig Jahren nicht mehr in Betrieb. Dieses Exemplar war vermutlich für den Museumshafen gedacht, den ein Hamburger Kaufmann einrichten wollte, wie Frieda gehört hatte. »Du bist doch nicht mitten in meine Arbeit geplatzt, um mich nach Marianne zu fragen«, stellte Ulli fest und setzte sich wieder in Bewegung. Es wurde Zeit, sich auf den Rückweg zu machen.
»Nein, aber ich war in dem Gewühl, das Hermann Krosanke mit seinen Möbelpackern veranstaltet, doch nur im Weg. Und ich hatte eine Idee. Im Grunde hatte Ernst die Idee.«
»Dein Freund Ernst!« Ulli grinste.
»Ja, er hat oft wirklich gute Einfälle.«
»Sonst wäre er wohl kaum der Kompagnon deines Vaters geworden. Wenn er schon nicht sein Schwiegersohn wird.« Frieda wusste, dass Ulli sie gern damit aufzog. Als Ulli sie und Ernst zum ersten Mal auf dem Verleseboden zusammen gesehen hatte, war sie der Meinung gewesen, die zwei wären ein Paar. Ausnahmsweise ging Frieda nicht auf Ullis Bemerkung ein, sondern erzählte von dem kleinen Malheur, der Bruchschokolade und der Idee, Hannemannsche Schokolade aus einem Bauchladen zu verkaufen. »Ich weiß ja, dass du viel zu tun hast. Aber wenn du abends nach Feierabend oder am Sonntag durch die Speicherstadt gehen würdest, könntest du dir ein bisschen dazuverdienen. Du hast mal gesagt, du wärst immer an solchen Gelegenheiten interessiert.«
»Klar!« Frieda wollte schon die Details besprechen, da legte Ulli den Kopf schief. »Ich soll mit Schokolade durch Hamburch laufen?«
»Ja.«
»Am besten sofort.«
»Naja, sobald du kannst. Ich müsste natürlich erst mal einen Bauchladen bauen. Lassen.«
»Denn wohl eher mit Kakao. Bei der Bullenhitze schmelzen die Tafeln doch, ehe ich die erste verkauft habe. Da latsche ich dann wohl mit Kakao durch die Gassen.«