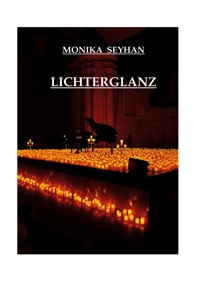Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Flirrend und klirrend Jahreszeiten ein wunderbares Geschenk der Natur, großzügig verteilt auf zwölf Monate. Erlebnisse und Begegnungen mit Menschen an unterschiedlichen Orten zeigen, wie sie sich den Besonderheiten der Jahreszeiten anpassen, oder dem Zufall überlassen. Die einen haben die Wahl, die anderen ergeben sich schicksalhaft? Wunder werden erwartet oder geschehen. Dem Tod wird ins Auge geschaut und Ängste werden überwunden. Glückliche Kinder im Herbst und Krambambuli im Winter. Eine gute Frau im ganzen Jahr und eine die nicht dazugehört. Und immer wieder Ali und Marianne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vierjahreszeiten
Ein wunderbares Geschenk der Natur, großzügig verteilt auf zwölf Monate. Erlebnisse und Begegnungen mit Menschen an unterschiedlichen Orten zeigen, wie sie sich den Besonderheiten der Jahreszeiten anpassen, oder dem Zufall überlassen. Die einen haben die Wahl, die anderen ergeben sich schicksalhaft?
Wunder werden erwartet oder geschehen.
Dem Tod wird ins Auge geschaut und Ängste werden überwunden.
Glückliche Kinder im Herbst und Krambambuli im Winter.
Eine gute Frau im ganzen Jahr und eine die nicht dazugehört.
Und immer wieder Anna und Aslan.
Ich mag alle Jahreszeiten,
die flirrend heißen Sommer
und die klirrend kalten Winter.
Den neugierig sprunghaften Frühling
und den farbig protzenden Herbst.
Inhaltsverzeichnis
Frühling:
Wunder
Ostern
Krieg
Fräulein Esch
Sommer
:
Hochzeit
Eine gute Frau
Wellenbrecher
Karataş
Herbst:
Siedlungskinder
Hand in Hand.
Parkinson u. Co.
Kakao
Winter:
Maribor
Krambambuli.
Jüpp
Tourette
Frühling
Wunder
Sie sind Flüchtlinge. In ihren müden Augen sehe ich die Bilder der vielen, die unterwegs nach Deutschland sind, vertrieben aus der Heimat, mit der Angst vor Verfolgung und Terror. Eine Familie: Mutter, Vater und zwei heranwachsende Töchter. Monatelang waren sie zu Fuß unterwegs und auf einem Boot, durch Landschaften, deren Anblick Hoffnung bedeutete.
Ihr Zuhause ist jetzt eine Turnhalle in der Stadt. 150 Menschen, die sich nicht kennen, teilen in diesem Raum ihre Schlafstätte, die Küche und Toilette.
Übergangsweise! Irgendwann werden sie so leben, wie es menschenwürdig ist. Sie haben Geduld. Sie können warten.
Ob es Zufall ist, dass wir uns begegnen? Fatime ist 15 Jahre alt. Während der Flucht auf dem Weg hierher hat sie türkisch gelernt, die Sprache, in der wir uns unterhalten können. Sie stellt uns die Eltern vor und ihre Schwester Atefe, die 17 Jahre alt und gehörlos ist. Ihre Sprache sind die Augen, die Hände und der Körper. Ein wunderschönes, anmutiges Mädchen, das sich wie eine Feder bewegt, die Arme hebt, den Kopf neigt und mit den Augen beschreibt, was sie empfindet. Die sanfte Art, den demütigen Blick, das ergebene Lächeln und die Schönheit hat sie von der Mutter.
Mariam, die uns vornehm, mütterlich und warmherzig zulächelt und mit einem leichten Kopfnicken auf Ahmad deutet. „Er ist ein guter Mann“, sagt sie.
Ahmad ist jung und unbeholfen, so wie einer, der keine Lust mehr hat. Stark zu wirken sieht aus wie ein Versuch. Den Stolz auf die schönen Töchter kann er aber nicht verbergen.
Die starke Person in der Familie ist Fateme. Ihre Energie ist nicht zu bremsen. Mit einem sicheren Gefühl schätzt sie Situationen ein, behält den Überblick und setzt alles daran, die Familie voranzubringen. „Wir haben es bis hierher geschafft, jetzt leben wir in einer Turnhalle mit vielen anderen. Was müssen wir tun, damit es möglich ist, unser eigenes Leben zu führen? Mein Vater ist fleißig, meine Schwester muss zu einem Arzt. Bestimmt ist in diesem Land jemand, der ihr helfen kann. Sie kann ja nicht hören, die Arme. Ich will zur Schule gehen.“ Sie lacht mit einem umwerfenden Optimismus. „Was müssen wir machen?“ Das ist eine Aufforderung an sich selbst. Es heißt nicht Mach etwas für uns, hilf uns!, nein, sie möchte etwas tun und ist bereit dazu.
Wir machen es gemeinsam. Täglich in aller Frühe erwartet uns die Familie vor der Turnhalle. Zu sechst sitzen wir im Auto, unterwegs von Behörde zu Behörde. Mit all den anderen gerade Angekommenen sitzen wir in Warteschlangen, sehen die stumpfen Blicke und spüren die Schwere der Schicksale. Eine anstrengende Zeit, begleitet von Hoffnungen, Absagen und Zusagen, Bürokratismus mit freundlichen oder mürrischen Beamten. Hilfsbereitschaft und Ablehnung. Tag für Tag und immer noch kein Entrinnen aus der Turnhalle.
Fateme gibt nicht auf, spornt uns an: „Ihr werdet sehen, unsere Ausdauer wird belohnt.“
Recht sollte sie behalten, irgendwann nach all den zermürbenden Tagen ist es so weit, dass wir sie alle mit Sack und Pack in eine eigene Wohnung bringen. Zwei helle Zimmer, eine große, gemütliche Wohnküche mit Balkon, eine geräumige Diele und ein Bad mit Wanne und Dusche. Mithilfe unserer Freunde ist es gelungen, die Wohnung mit Möbeln auszustatten. Ahmad hilft tatkräftig mit und zeigt, wenn auch zaghaft, ein zufriedenes Lächeln. Die Freude ist unbeschreiblich, auch wenn zunächst der Strom nicht angeschlossen ist und Kerzen für die nötige Beleuchtung sorgen. Das erste eigene Zuhause, das erste eigene Bett, ein Kühlschrank, ein Herd, eine Waschmaschine. Tisch und Stühle, ein Sofa und all das, was ein Zuhause ausmacht. Die Augen verlieren ihre Schwermut, es fällt leichter zu lächeln.
Verschwunden sind jedoch nicht die dunklen Nächte, in denen die Angst hochkommt. Albträume, die nicht verschwinden und Fateme in die Arme der Mutter flüchten lässt. Es fällt auch noch schwer, Nahrung zu sich zu nehmen. Obwohl die Mutter eine großartige Köchin ist, schaffen die beiden Mädchen es nicht, das zu essen, was sie mit viel Liebe für sie zubereitet. Sie haben keinen Appetit, geben sich mit 40 Kilo Körpergewicht zufrieden.
Sie brauchen Zeit, Fateme geht zur Schule, versucht den Hauptschulabschluss zu bekommen. Atefe fühlt sich wohl in der Schule für Gehörlose. Die Eltern besuchen Deutschkurse mit der Absicht, die Eingliederung in die noch so fremde Gesellschaft zu schaffen. Wir besuchen sie regelmäßig, lernen die afghanische Küche kennen und haben Freunde gefunden, mit denen wir gerne zusammen sind. Nie findet ein Besuch statt, ohne dass wir miteinander lachen. Es ist gut so.
Verwandte der Familie, genau wie sie aus Afghanistan geflüchtet, wohnen außerhalb Kölns. Man besucht sich gegenseitig. Das Leben nimmt Struktur an. Der Vater arbeitet stundenweise als Friseur. Atefe ist in der Lage, auch als gehörlose junge Frau allein mit der Bahn in die Stadt zu fahren und bummeln zu gehen.
Fateme macht den Führerschein, sie ist jetzt 18, die Verantwortung für die Familie bleibt, und das Auto ist eine große Hilfe bei der Erledigung der alltäglichen Dinge. Sie kümmert sich um die nicht enden wollenden Behördengänge, sie organisiert die Arztbesuche und sämtliche Einkäufe. Als Teenager in modischen Klamotten und mit dem Smartphone in der Hand. Musik hört sie durch die Stöpsel im Ohr. Im Fernsehen schaut sie ihre Lieblingsstars und -serien. Der Schulabschluss ist weiter das große Ziel, ein Geschwisterchen der nächste Traum.
„Unsere Familie sollte noch ein Kind haben, ein Kind, das hier geboren ist, das ohne Angst aufwächst, ein Kind, das in unserer Familie in einem freien Land glücklich werden soll.“
Der Wunsch ist so stark, wird so bedeutungsgroß, dass er sich erfüllt. Sie bekommen ein Baby, vom Glück überrollt danken sie Gott und brauchen bis dahin eine größere Bleibe.
„Die Wohnung ist zu klein, wie sollen wir zu fünft hier zurechtkommen?“ Fateme vergisst, dass sie seit ihrer Zeit in Deutschland noch nie Geld verdient haben und von der Unterstützung durch den Staat leben, dass ihre Wohnung geräumig und gepflegt ist und mit 80 qm eine gute Größe hat. Ahmads Nebenverdienst ist zu wenig für ihr Vorhaben. Sie hoffen auf weitere Unterstützung durch das Jobcenter.
Dankbar sind sie für die sorgenfreie Zeit, den Ausgleich für die vielen Jahre, wo es nichts gab außer der Angst um ihr Leben. Hoffentlich erfüllen sich ihre Wünsche.
Fateme, voller Tatendrang, macht sich auf die Suche nach einem größeren Zuhause. Das neugeborene Kind soll es gut haben. Immobilienportale, das Wohnungsamt, Freunde und Bekannte werden eingeschaltet bei der Suche. Wohnraum ist knapp und teuer. Flüchtlinge sind nicht gerade erwünschte Mieter, ein weiteres Problem.
Fateme lässt sich nicht unterkriegen, unerschütterlich ist sie so lange unterwegs, bis sie die Wohnung, etwas versteckt und abseits gelegen, doch mit vier Zimmern findet. Es herrscht Corona-Lockdown, wir müssen zu Hause bleiben und können bei einer Besichtigung nicht dabei sein. Fateme entscheidet. Sie sagt ja und organisiert den Umzug mithilfe der Verwandten.
Durch die Umstände in dieser Zeit ist unser Kontakt auf WhatsApp reduziert, Fotos der neuen Wohnung zeigen leere Räume und viele Kartons.
Als Ariyan am 01. Mai geboren wird, ist Fateme selbstverständlich dabei. Die Familie ist überglücklich über die Geburt des kleinen, gesunden Jungen und auch wir möchten den neuen Erdenbürger begrüßen.
Unangemeldet fahren wir zum ersten Mal in die neue Wohnung. Eine glückliche Mutter, ein zauberhaftes Baby und die Familie in einer katastrophalen Behausung. Es gibt nichts bis auf überfüllte Kartons in feuchten, vom Schimmel befallenen Räumen. Matratzen liegen auf dem Boden, eine provisorische Spüle und Elektroplatten dienen als Küche.
Fateme winkt ab, als sie unsere entsetzten Blicke sieht. „Es ist noch nicht komplett, Möbel müssen wir noch kaufen, und dass Schimmel in der Wohnung ist, haben wir erst nach dem Einzug bemerkt.“ Sie führt uns durch die Räume, die trostlos, unaufgeräumt und einfach schrecklich aussehen. Die Mutter hat den Säugling im Arm, seufzt, wendet den Blick ab und hebt resigniert die Schultern.
„Was ist passiert? Wo sind eure Möbel? Wie hoch ist die Miete für dieses Loch und wer ist der Besitzer?“ Fragen über Fragen, Unverständnis für das Zurückfallen in eine so erbärmliche Situation. Ich schüttle Fateme an den Schultern und muss mich bremsen, nicht zu schreien. Der Zustand ist schlimmer als der in der Turnhalle.
Fateme zittert, schaut mich mit weit aufgerissenen, tränenbehafteten Augen an. Ein hilfloses Kind!
„Sie hat schön ausgesehen, die Wohnung, vier große Zimmer und ein verwilderter Garten, Platz für uns alle. Endlich jemand, der an uns vermietet, und das Jobcenter war bereit, die Miete von 1400 Euro zu übernehmen. Dass hier alles feucht ist, haben wir zu spät bemerkt. Der Besitzer gibt uns die Schuld an der Feuchtigkeit, obwohl wir erst vor einigen Wochen eingezogen sind. Den Keller dürfen wir seltsamerweise gar nicht betreten, er allein hat den Schlüssel. Und die Miete kommt er persönlich jeden Monat abholen.“
Alles klingt sehr seltsam und keinesfalls korrekt.
„Zum Einkaufen müssen wir mit dem Bus fahren, die nächsten Geschäfte und Nachbarn sind weit weg. Es ist sehr einsam hier, nachts hören und sehen wir Wildschweine hinter dem Haus auf der Wiese. Ich habe Angst und will hier weg.“
Vor mir steht nicht mehr die starke Fateme; klein und verletzlich, ohnmächtig, an der Lage etwas verändern zu können, schaut sie mich verzweifelt an.
Die Hilflosigkeit erschreckt mich, was bleibt, ist mein Unverständnis.
„Und wo sind eure Möbel, eure Betten, die Küche, der Herd, der Kühlschrank, die Waschmaschine?“
Leicht verwundert schaut sie mich an, zieht die Augenbrauen hoch, unsicher kommt die Antwort. „Die hatten wir ja schon ein paar Jahre, wir wollten alles neu haben und dachten, das Jobcenter würde uns einen Zuschuss geben. Dieser wurde abgelehnt mit der Begründung, dass die Elektrogeräte vor vier Jahren erst angeschafft wurden und das keine lange Zeit ist.“
„Wo sind die Sachen jetzt?“ Ich kann es nicht fassen.
„Die Möbel haben wir zum Sperrmüll auf die Straße gestellt und auf die Kippe gefahren, wir müssen jetzt so lange sparen, bis wir wieder etwas Neues kaufen können. Matratzen haben wir noch, die liegen hier in dem kleinsten Zimmer, in dem wir alle schlafen. Dort ist der Schimmel nicht so stark.“
Es reicht, mit Tränen in den Augen, zornig und enttäuscht muss ich hier weg.
Zu Hause kommen wir lange nicht zur Ruhe. In unserem Keller steht noch ein Babybett, das wir am nächsten Tag für Ariyan bringen. Das ergebene Lächeln der Mutter übersehe ich. Ihre Dankbarkeit will ich nicht annehmen. Ahmad arbeitet mehr als 10 Stunden am Tag.
Das Elend hat erneut Einzug gehalten, ich muss mich bremsen bei Schuldzuweisungen und spüre, dass ich es nicht ein zweites Mal schaffen werde, die Hilfe zu leisten, die nötig ist. Wieder einmal ist es die Aufgabe Fatemes, einen Ausweg zu finden. Die Suche nach einer anderen Wohnung ist so gut wie aussichtslos. Wer vermietet schon an Flüchtlinge mit drei Kindern? Ein Weiterleben in der jetzigen Behausung ist genauso unmöglich, es ist einfach furchtbar.
Meine Abende sind ausgefüllt mit Anrufen zu Wohnungsanzeigen und von Fateme. Fragen über Fragen, was soll ich tun, wie mache ich das? Unterstützt durch den Mieterverein wird der Hausbesitzer zu Rechenschaft gezogen, seine Handlungsweise und Geldforderungen sind nicht rechtens. Das Leben in dieser Wohnung weiterhin miserabel.
Es ist Winter, Erkältungen sind an der Tagesordnung. Die Mutter, Ariyan und Atefe werden krank, leiden unter Bronchitis und Asthma. Fateme ist so eingespannt und vernachlässigt die Schule.
Die Gespräche am Telefon werden zu viel, ich verliere die Geduld, lasse meine Wut heraus und schreie Fateme an. Ich mache ihr Vorwürfe wegen der verschwundenen Möbel und der Leichtfertigkeit unnötiger Geldausgaben. Ich gebe ihr die Schuld an der Wohnsituation, zeige meine Enttäuschung und sage, dass mir die Kraft und die Lust für die Hilfe ein zweites Mal fehlt. Ich bin erschöpft und nicht mehr sicher, ob es auch gerecht ist.
Niemals werde ich Fateme im Stich lassen, dieses Mädchen, das um so vieles betrogen wurde. Das weder die Kindheit noch die Jugend genießen konnte und den Alltag in Angst, Not und Verzweiflung erlebt. Nichts ist ihre Schuld, sie ist stark, gibt nicht auf, schaut nach vorn!
Letztendlich ist sie es auch, die mich tröstet: „Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut.“
Am liebsten hätte ich sie in den Arm genommen und sage das auch.
„Das weiß ich doch“, bekomme ich mit dem bekannten Lachen zurück.
Ich bin müde geworden, zu Hause werde ich mich ausruhen. Auf dem Sofa liegend entspanne ich mich und habe so meine Gedanken. Ein Wunder müsste geschehen, das wäre zu schön. Es könnte doch ein Wunder geschehen und plötzlich eine Wohnung angeboten werden. Warum gibt es keine Wunder mehr? Vielleicht bin ich einfach nur blind und übersehe die Wunder, die heute geschehen.
Ich schlafe ein wenig und greife danach zum Telefon.
Selma kommt mir in den Sinn. Selma kennt viele Leute, hat viele Kontakte … vielleicht?
Sie hört mir zu, sie kennt Fateme und ihre Familie und versteht die Problematik. Wohnungen in ihrem ehemaligen Elternhaus sind gerade renoviert und sollen vermietet werden. Zwei Wohnungen sind noch frei. „Wenn ihr Lust habt, schaut sie euch morgen an.“
Lust haben? Welche Frage! Ist das Wunder geschehen?
Meine Beine zittern, ich wage es kaum, Fateme anzurufen.
Am nächsten Morgen stehen wir alle in einer 3-Zimmer-Wohnung, Küche, Diele, Bad, Balkon, Neubau. In einer Umgebung, in der Menschen, Geschäfte und Leben zu spüren sind. Mit Ariyan auf dem Arm geht Mariam von Raum zu Raum, streicht über die sauberen Wände und beobachtet das Leben auf der Straße. Atefe findet sofort den Platz, wo das Bett stehen soll, und Fateme muss alles wissen: „Wann können wir einziehen, wie hoch ist die Miete; ist es kein Problem, dass wir Geld vom Jobcenter bekommen …?“ Und, und, und.
Mir ist schwindelig. Nie habe ich so hautnah ein Wunder erlebt; dankbar umarme ich alle, sie haben mir ein Wunder geschenkt. Einfach so, an einem normalen Tag, zu keinem besonderen Anlass, einfach so! Ein Wunder.
Ostern
Ein sonderbares Gefühl an diesem Gründonnerstag, als Onkel Franz, Mutters einziger Bruder, unerwartet mit seinem schönen schwarzen Mercedes vorfuhr.
Er lebte an der holländischen Grenze und kam eigentlich nur zweimal im Jahr zu uns nach Köln. Zu Mutters Geburtstag und am ersten Januar, dem Geburtstag der Großmutter. Gemeinsam fuhren wir dann ins Sauerland, um diesen Tag zu feiern.
Dass er heute kam, hatte nichts Gutes zu bedeuten. Ich sah Mutters verweinte Augen, als sie aufgeregt zwei große Taschen packte.
„Mach dich fertig, wir fahren ins Sauerland. Großmutter liegt im Sterben.“
Was bedeutete das „im Sterben liegen“? Hatte sie bekannt gegeben, dass sie sterben wolle? Hatte sie sich dazu besonders schön gemacht und hingelegt? Wusste sie den Zeitpunkt?
Der Onkel war genauso nervös wie Mutter und trieb zur Eile.
Die Autofahrt gefiel mir nicht so gut wie sonst. In rasendem Tempo, begleitet von fluchenden Worten über die schleichende Fahrt durch die Dörfer und den aufkommenden Nebel, fuhr Onkel Franz wie ein Wilder.
Mutter murmelte, als würde sie beten, und ich versuchte auf der Rückbank, meine aufkommende Übelkeit zu unterdrücken. Nach drei Stunden waren wir am Ziel und bekamen gerade noch mit, wie ein Priester und zwei rot-weiß gekleidete Messdiener Weihrauch schwenkend ins Haus gingen.
„Die letzte heilige Ölung“, jammerte Mutter, „dann ist es wirklich so weit. Was ist so plötzlich geschehen?“
Ihre Schwester nahm sie herzlich in die Arme. „Es war ein Schlaganfall heute Morgen.“
Großmutter lag in ihrem Bett, sah aus wie ein altgewordener Engel. Ich sah sie zum ersten Mal weiß gekleidet, noch dazu in den weißen Kissen. Die rosa Bäckchen waren der einzige Farbklecks und erinnerten mich an kleine Pfirsiche. Mutter und Onkel schluchzten laut, als sie sich ans Bett setzten. Für mich gab es keinen Grund zum Weinen, und ich schlich mich hinters Haus auf die Schaukel. Meine Cousinen waren nirgendwo zu sehen, Tante Therese hatte sie zum Rosenkranzgebet in die Kirche geschickt.
Die Stimmung im Haus war eigenartig, irgendwie chaotisch, zugleich unheimlich und still. Mutters Geschwister wechselten sich ab bei den Besuchen am Krankenbett und den notwendigen Arbeiten in der Küche.
Eine große Platte mit belegten Broten und eine Kanne Milch standen zur Selbstbedienung auf dem Tisch. Wir Kinder wurden ermahnt, ruhig zu bleiben und uns alleine für die Nacht fertigzumachen. Die Idee, herumzualbern oder zu lärmen, wäre uns so oder so nicht in den Sinn gekommen.
In unserem breiten Schlafkasten lagen wir friedlich nebeneinander. Gertrude verzichtete auf das Lesen ihrer Lieblingslektüre Winnetou.
Angela stellte dauernd die Frage: „Was machen wir, wenn Oma tot ist?“, und ich kam mir sehr erwachsen vor. Ich tröstete sie, dass alles schon seinen guten Weg gehen würde.
Zu frisch waren die Erinnerungen an meine Ferienzeit im Sauerland, wenn Großmutter uns früh am Morgen geweckt hatte und die Milch geholt werden musste. Warum so früh, warum dieser strenge Ton? „Aufstehen, Kinder! Waschen, anziehen, Morgengebet und Milch holen!“ Gertrude und Angela standen schon mit gefalteten Händen vor dem Bett, ich gesellte mich langsam hinzu und murmelte: „Wie fröhlich bin ich aufgewacht …“, dabei beobachtete ich Großmutter, wie sie vor ihrem langen schwarzen Kleid und der schwarzen halben Schürze mit kleinen weißen Blüten die knorrigen, abgearbeiteten Hände auf ihrem Bauch zum Gebet gefaltet hielt. Die grauen Haare hatte sie streng aus dem Gesicht gekämmt, mit großen grünen Augen und einer dicken Nase zwischen roten Bäckchen und schmalen Lippen hatte sie leicht gebeugt im Türrahmen gestanden und auf ihre drei hellblonden, in lange weiße Nachthemden gekleidete, betende Enkelkinder geschaut.
Was ich für diese herbe Frau, die meine Großmutter war, empfand, wusste ich nicht genau. Respekt war das Erste, das mir einfiel, Bewunderung und, glaube ich, so etwas wie Mitleid.
Dass Großmutter in dieser Nacht starb, war fast schon unheimlich. Es war Karfreitag, der Tag, den wir frommen Katholiken nur als den Todestag Jesu kannten. Er war gekreuzigt worden, also am Kreuz gestorben, und unsere Großmutter lag friedlich im Zimmer nebenan, auch sie war tot. Für uns Kinder fühlte es sich unheimlich und ein bisschen mysteriös an. Angela hatte sogar die Hoffnung, dass Großmutter vielleicht am Sonntag wieder aufwachen würde. Wir drei wurden zu einer verschworenen Gemeinschaft, überzeugt davon, dass Oma das Gleiche widerfahren könnte wie damals Jesus. Großmutter war eine fromme und gottesfürchtige Frau gewesen. Wenn sie schon an einem Karfreitag gestorben war, dann würde sie bestimmt am Ostersonntag wieder auferstehen.
Angela atmete erleichtert auf, Gertrude wandte sich wieder zuversichtlich den Karl-May-Büchern zu. Mir kam das alles schon ein wenig verrückt vor.
Jetzt, wo Großmutter tot war, änderte sich die Stimmung im Haus. Allmählich wurde in der normalen Lautstärke gesprochen, die Geschäftigkeit nahm zu, alles Mögliche musste geregelt werden. Der Sarg, die Blumen, der Leichenschmaus, die Todesanzeigen wurden zum Hauptgesprächsthema. Zwischendurch hörte ich sogar ein kleines Lachen und war sehr beruhigt. Jeder hatte etwas zu tun, und ich schlich unauffällig in Großmutters Zimmer.
Während der nächsten Tage lag sie dort, wunderschön in einen Sarg gebettet. Ganz in Weiß, in den Händen einen Rosenkranz, Myrtenzweige um den Kopf, ein schlichtes Kreuz auf dem Kissen. Große Blumentöpfe mit hohen Pflanzen standen um das Bett herum. Mittlerweile erschienen stündlich die Dorfbewohner. Sie kamen, um Abschied zu nehmen, und tranken ein kleines Schnäpschen oder aßen ein Stück Streuselkuchen.
Die traurige Stimmung im Haus war nun endgültig vorbei, die Tanten sprachen von ihrer Mutter in der Vergangenheit, sie erinnerten sich an viele schöne Dinge und bewunderten oder beseufzten das harte Leben, das die Großmutter aufopferungsvoll, ohne zu klagen, gottesfürchtig und in Demut ertragen hatte.