
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die in diesem Band veröffentlichten Geschichten wurden für den Erzählteil im Hauptunterricht an Waldorf-Förder- und -Regelschulen konzipiert. Die Gedichte dienten dem vertieften Textverständnis. Literarische Ambitionen spielen bei den Texten keine Rolle, auch wenn einige Geschichten und Gedichte in der Schulzeitschrift der Christian Morgenstern Schule Wuppertal als Beispiele für die Erzählpraxis im Unterricht veröffentlicht wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Ostern
Anjuschka in der Flut
Gregors Osterfest
Osterfragen
Ostern auf der Syburg
Ostergeschenk
Hans, mein Hirte
Osterglocken
Kosmisches Osterfest
Nicolais Liebesmahl
Ausatmen
Der Bäcker und der Teufel
.
Der Osterzweig
Die neue Menschwerdung
Der Kuchen
Vorfrühling
Fritzken u. der liebe Gott
Don Alonso
Tulpen
Der gute Anton
Kumpel Möpschen
Osterrasen
Johanni
Die drei Goldkinder
Das Glühwürmchen
Der kluge Wassilij
Das Krüglein
Glückspilz Johanna
Sommerliche Kopflosigkeit
Der Ferienbeginn
Die Maus im Kelch
Johannizeit
Das Endspiel
In Mariens Garten
Der Johanni-Sprung
Johannifeuer
D. Gebot d. Sonntagsruhe-
Johannes u. d. Feigenbaum
Johanni
Das Versuchskaninchen
Franziska, guck in die Luft
Michaeli
Wurstelfranz
Michaelische Feststellungen
Hans Hasenfuß
Der Kranichgruß
Der Naschbaum
Schwertträger
Die sieben Brüder
Das Gute
Jelka wartet
Maries Ahnung
Herbstliches Wortspiel
Gerald, der Schmied
An Michael
Die Michaelsprobe
Mut
Schwabbel lernt springen
Michaels Hauch
Der Barbier von Buchara
Herbsttrostlosigkeit
Die fliegende Untertasse
.
Die neuen Gespanne
Der Michi nervt
Herbstliches Wortspiel
Manuela hat Mut
Billy überrascht mich
Sankt Michael
Mäxken und d. schw. Kind
Weihnachten
Das Weihnachtsbrot
Weltenweihnacht
Der Weihnachtsdackel
Weihnachten 2015
Der Wintergarten
Vorahnen
Die Krippe
Nana und das Christkind
Das schönste Weihnachts
Weltenschweigen
Wie das Christkind
Störung erwünscht/ Weihnachts
Der echte Nikolaus
Der Dreikönigsengel
Weihnachtsgeschenke
Drei Könige in Wuppertal
Vorwort
Die in diesem Band veröffentlichten Geschichten wurden für den Erzählteil im Hauptunterricht an Waldorfförder- und Regelschulen konzipiert. Die Gedichte dienten der ergänzenden und vertiefenden Arbeit in rhythmischen Teil. Auf eine jahrgangsbezogene Kennzeichnung der einzelnen Beiträge wurde verzichtet, weil sich beim Lesen schnell eine Zuordnung ergibt.
Wird bedacht, dass diese Geschichten im Unterricht frei erzählt wurden, dann fehlt ihnen in der vorliegenden gedruckten Fassung die interaktive Komponente des lebendigen Vortrags. So wurden die Schüler*innen der unteren Jahrgänge motiviert, sich – beim wiederholten Vortragen einer Geschichte – mitspielend und mitsprechend in den Erzählfluss hineinzubegeben. In den höheren Jahrgangsstufen wurde der Vortrag u. a. durch eingefügte Zwischenfragen und Aufforderungen, sich in die Situation der Helden*innen hineinzubegeben, verlebendigt.
Einige Geschichten zielen auf bestimmte seelische Eigenschaften von Schülern*innen oder Schülergruppen, in einigen Fällen sogar von Klassengemeinschaften ab (z. B. „Die sieben Brüder“). So entstanden die Gedichte wie auch die Geschichten einerseits aus dem jahreszeitlichen Kontext, andererseits aber auch aus den Bedingungsfeldern, in denen die jeweiligen Klassengemeinschaften standen.
Literarische Ambitionen spielten bei den Geschichten keine Rolle, auch wenn einzelne Geschichten und Gedichte in der Schulzeitschrift der Christian Morgenstern Schule Wuppertal als Beispiele für die unterrichtliche Erzählpraxis veröffentlicht wurden.
Ostern
Anjuschka in der Flut
Schuster Schmalsteg und seine Frau wünschten sich einen Sohn – und das schon seit vielen Jahren. Der Junge sollte Schmalstegs Handwerk erlernen und somit die Familientradition aufrechterhalten. Als die Schusterfrau aber einem Mädchen das Leben schenkte, wollten Schmalstegs das Kind nicht behalten, und sie vertrauten es einer Bärin an. Die nahm es mit in ihre Höhle und gab ihm den Namen Anjuschka. Die Kleine hatte aber an der Brust ihrer lieblichen Mutter die erste Milch genossen. Deshalb sehnte sie sich nach ihresgleichen. Kaum dass sie den ersten Gedanken hatte fassen können, verließ Anjuschka ihre Ziehmutter und irrte durch den Wald. Schließlich stieß sie auf ein verlassenes Waldhaus. Dort richtete sie sich gemütlich ein und wartete auf menschliche Gesellschaft.
Nach einigen Tagen stellten sich stattdessen ein Bär und ein Wolf als Mitbewohner ein. Anjuschka hatte sie zwar nicht hereingeboten, aber derlei Hausgenossen pflegen sich ohnehin nur ungefragt aufzudrängen. Die beiden Gäste schätzten zwar Anjuschkas Fleiß, insbesondere ihre Kochkünste, das hinderte sie aber nicht daran, die ganze Arbeit dem armen Kind zu überlassen. Der Bär schlief den ganzen Tag auf der Ofenbank und wachte nur einmal im Monat auf, weil sein Magen knurrte. Dann fraß er alle Schränke leer und legte sich wieder schlafen. Der Wolf ruhte nur tagsüber. Des Nachts fraß er die Töpfe und Teller leer und trieb sich anschließend im Wald herum. Der fleißigen Anjuschka war diese Gesellschaft zwar nicht angenehm, doch dachte sie, dass diese Mühsal allemal besser sei, als in einer Bärenhöhle zu hausen.
Es war Winter geworden und der Bär hatte sich für ein halbes Jahr schlafen gelegt. Der Wolf verdrückte sich auf Monate im Wald, um dort wehrlosen Tieren nachzustellen. Bei seinen Raubzügen stieß er auf einen tolldreisten Buchfinken. Der flog auf Isegrimms Kopf und suchte zwischen den grauen Haaren nach Grassamen.
„Was fällt dir ein, mich ungefragt anzupicken?!“, beschwerte sich der Wolf und schlug mit seinen Vorderpfoten nach dem Vogel. Der wich den Hieben geschickt aus und piepte:
„Gefahr, Gefahr, du lebst in größter Gefahr!“ – Der Graufrack horchte auf:
„Von welcher Gefahr schnabulierst du?“ – Der Buchfink flog einen weiten Bogen um den Wolf.
„In drei Tagen kommt die große Flut. Sie reißt alles fort, was nicht fliegen kann.“
„Mich auch?“
„Dich auch“, erwiderte der Buchfink und flog auf den höchsten Wipfel.
„Mich auch“, murmelte der Wolf und trottete missvergnügt heim. Ohne Anjuschka eines Blickes zu würdigen, bohrte er seine feuchte Schnauze in den speckigen Wanst des Bären. Der Brummbass wachte höchst missgelaunt auf.
„Was stößt du mich?“
„Wir sind in großer Gefahr. In drei Tagen wird unser Waldhaus von der großen Flut fortgerissen. Der Buchfink hat’s mir verraten.“
„Der Buchfink…“, wiederholte der Bär nachdenklich und kratzte seine flache Stirn. „Der hat noch nie gelogen. Also müssen wir uns ein Floß bauen.“
Der Wolf starrte den Bären fassungslos an und dachte bei sich:
‚Das ist doch die blanke Dreistigkeit: Der Kerl verschläft die meiste Zeit.
Wenn er aber mal wach ist, führt er das Regiment. ‘ Um dem dicken Tanzmeister den Schneid abzukaufen, drängte Isegrim:
„Wir fangen gleich morgen früh damit an. Du brichst im Wald die Stämme, und ich leite Anjuschka an, daraus ein Floß zu binden.“
„Gut!“, meinte der Bär. „Aber jeder von uns bekommt seine eigene Hütte auf dem Floß.“
„Selbstverständlich“, erwiderte Isegrim und legte sich schlafen. Der Bär eiferte ihm unverzüglich nach, und Anjuschka durfte den Abwasch erledigen. Wie sie die sauberen Teller übereinander stapelte, sagte sie zu sich selbst:
„Jeder bekommt auf dem Floß seine Hütte. Es ist doch schön, dass meine Hausgenossen auch an mich denken.“ – Am folgenden Morgen begann der Bär, Bäume im Wald zu fällen. Der Wolf leitete Anjuschka an, die Äste von den Stämmen abzuschlagen und ein Floß daraus zu bauen. Am zweiten Tag waren sie schon so weit, dass zwei Hütten darauf gesetzt werden könnten.
„Warum nur zwei Hütten?“, fragte Anjuschka.
„Na! Das ist doch klar!“, erwiderte der Wolf. „Eine für mich und eine für den Bären!“
„Und wo bleibe ich?“, wollte das Mädchen wissen. Der Bär schüttelte lachend seinen Kopf.
„Einer muss doch in unserem Waldhaus bleiben und alles schön sauber halten.“ Anjuschka wusste, dass der Bär sie fressen würde, wenn sie ihm widerspräche. Also schwieg sie und zog sich ins Waldhaus zurück. Dort verschloss sie Fenster und Türen und empfahl sich dem lieben Gott. Da trat der Bär in die Hütte und bat sie:
„Ach, liebes Kind! Back uns zum Abschied noch einen guten Vorrat an Pfannkuchen, damit wir nicht hungern müssen!“ Anjuschka verbuk alles Mehl zu einem gewaltigen Stapel Pfannkuchen und überreichte ihn dem Bären. Der nahm die Gabe ohne ein Wort des Dankes an und trollte sich.
Am Morgen des dritten Tages öffneten sich die Schleusen des Himmels.
Eine gewaltige Flut brach über den Wald herein und riss alles mit sich fort.
Anjuschka hockte mit gefalteten Händen in ihrem Haus und meinte:
„Es ist schon besser, vom Wasser fortgerissen, als vom Wolf oder vom Bären verschlungen zu werden.“ Als das Kind seine Blicke durch das Innere des Häuslein schweifen ließ, sah es vor dem Aschenkasten ein Fass, darin war mit Wein abgefüllt. Und auf dem Fass lag ein frisch gebackenes Brot.
„Das werden meine Hausgenossen vergessen haben“, meinte sie, klemmte das Brot unter ihren linken Arm, hockte sich auf das Fass und wartete. Es dauerte nicht lange, da brach das Wasser ins Waldhaus ein und riss alles mit sich fort. Anjuschka saß aber auf dem Weinfass und gondelte vergnügt talabwärts.
Es dauerte nicht lange, da sah sie jenes Floß, das sie für ihre Mitbewohner zusammengebunden hatte. Zwischen den beiden Hütten stritten sich Wolf und Bär um den letzten Pfannkuchen. Isegrim hatte sich im Pelz des Tanzmeisters festgebissen, und der Bär zerkratzte seinem Widersacher den grauen Frack. In ihrer blinden Wut kugelten sie sich von der einen Seite des Floßes auf die andere. Und es dauerte nicht lange, da schlug das Floß um und begrub die Streithähne samt Pfannkuchen unter sich.
„Recht so“, zirpte der Buchfink, der sich unbemerkt auf Anjuschkas linker Schulter niedergelassen hatte.
„Recht so“, meinte auch Anjuschka und gab dem Piepmatz einen Brocken vom Brot. Der Buchfink hob sich fort und ließ den Krümel unweit des Weinfasses in die Fluten fallen. ‚Schade‘, dachte Anjuschka. Sie hatte dem kleinen Vogel diese Speise von Herzen gegönnt. Da sah sie, wie der Krümel auf dem Wasser trieb und zusehends wuchs. Er weitete sich zu einer Insel aus, an deren Strand Anjuschka mit ihrem Fässlein landete.
Sie bemerkte, dass der Boden unter ihren Füßen aus frisch gebackenem Brot bestand. Als sie das Fässlein anstechen und daraus trinken wollte, hatte sich der Wein in kristallklares Wasser verwandelt. Kaum hatte ein Tropfen davon die Erde benetzt, da spross ein Apfelbäumchen mit zahllosen rotwangigen Früchten daraus hervor. Daraufhin verteilte Anjuschka das Wasser aus dem Fässlein über die ganze Insel. Und alles, was ihr Herz begehrte, wurde dadurch zu neuem Leben erweckt: Der Wald mit den Tieren, die munteren Bächlein und die satten Auen, auf denen die Rehe das frische Gras zupften.
Ja selbst ihr Waldhaus mit dem Ofen, der Bank und dem Herd stand wieder vor ihr.
Nur an den Bären und den Wolf hatte das Kind nicht gedacht. Die blieben auf dem Grund jenes Meeres liegen, in das sich die Fluten ergossen hatten.
Und das war auch gut so, denn niemand vermisste die beiden Gierlappen.
Mit der Zeit gesellten sich zahllose Menschen zu Anjuschka. Sie erfreuten sich der guten Gaben, die ihnen das Kind aus dem Fass hervorzauberte, und genossen mit ihr gemeinsam all das, was ein offenes Herz hervorzubringen vermag.
Osterfragen
Wer könnte ohne Hass
vor einem Mörder stehn,
wer für den Lügenbold
auf heißen Kohlen gehn’,
wer dem, der rafft aus Gier,
sein letztes Hemd verschenken?
Wer könnte selbstlos an
Gedankenlose denken?
Wer dieses ehrlich wagt,
wirkt aus des Lichtes Kraft,
die selbst in größter Not
den wahren Wandel schafft.
Gregors Osterfest
Am Ende jener Straße, die vom großen Wald in die weite Steppe führt, lebte in einem windschiefen Lehmhaus der Bäcker Gregor. Tag für Tag buk er noch vor Sonnenaufgang das Brot, wickelte es in Leinentücher, lud es auf einen klapprigen Leiterwagen und zog damit beim ersten Hahnenschrei durch die umliegenden Dörfer. Gregor genoss bei der Landbevölkerung ein hohes Ansehen, das sein Brot wegen seines Wohlgeschmacks und seiner Bekömmlichkeit als unübertroffen galt.
Vor einigen Jahren fiel der Sommerregen aus, und man fuhr eine verheerende Missernte ein. Das wenige Getreide, welches die Bauern eingefahren hatten, war so teuer, dass sich nur noch die Reichen ihr tägliches Brot leisten konnten. Auch Gregors Kunden fürchteten die Teuerung. Der Bäckermeister beruhigte sie aber:
„Warum soll ich meine Ware verteuern, wenn ich in meinem Speicher noch Vorräte zu alten Preisen habe?“ Tatsächlich hatte der kluge Bäcker auf ein Jahr Mehlvorräte eingelagert, so dass er sein Brot weiterhin auf die erschwingliche Weise anbieten konnte. Deswegen wurde er insbesondere von den Armen wie ein Heiliger verehrt. Das war dem Bäcker aber nicht recht. Ja, er fuhr jeden, der ihm dafür die Füße küssen wollte, wütend an:
„Ist man schon heilig, wenn man für sein Brot den gerechten Preis verlangt?“ – Im Laufe des Jahres wurde durch eine weithin um sich greifende Teuerung das Geld so knapp, dass sich viele Menschen selbst Gregors Brot nicht mehr leisten konnten. Denen schenkte der Bäcker seine Ware. Er wollte aber nicht zugeben, dass er aus reiner Menschenliebe handelte, sondern er entgegnete jedem, die ihn dafür loben wollte:
„Lieber füttere ich euch durch, als dass ihr mir wegsterbt und in zukünftigen, besseren Zeiten kein Brot mehr bei mir kaufen könnt!“
In Wirklichkeit aber hasste Gregor nichts mehr, als dass jemand unverschuldet in Not geriet. Auch hatte er die berechtigte Sorge, dass der Hunger die Menschen dazu verleiten könnte, sich auf unbezahlte Weise an seinen Mehlvorräten zu bedienen. Deshalb verrammelte er, bevor er mit seinem Leiterwagen über Land zog, den Speicher mit zahllosen Riegeln.
Eines Nachts aber, es war vor Palmsonntag, da hatte Gregor vergessen, den Speicher zu verriegeln. Als er am folgenden Morgen seine Vorräte überprüfte, fehlte ein Sack Mehl.
„Der Dieb wird sich, wenn ihm das Stehlen bei mir so leicht von der Hand ging, noch ein weiteres Mal blicken lassen“, meinte der Bäcker. Um ihn auf frischer Tat zu ertappen, legte sich Gregor in der folgenden Nacht auf die Lauer. Mühsam hielt er sich wach, indes brach niemand in den Speicher ein.
So hartnäckig, wie Gregor nun einmal war, setzte er aber seine Nachtwachen fort. – Erst in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag waren um zwei Uhr in der Frühe verdächtige Geräusche zu vernehmen. Der Bäcker nahm einen dicken Prügel zur Hand, um den ungebetenen Gast damit gebührend willkommen zu heißen. Tatsächlich trat ein schmächtiges Männlein ein. Es war einen Kopf kleiner als der Bäcker und so dürr, dass der leiseste Windhauch es hätte umwehen können. Vorsichtig machte es sich an einem der prall gefüllten Mehlsäcke zu schaffen. Gregor sprang hinzu und packte das Männlein am Kragen.
„Da hab ich dich endlich, du verlogener Dieb!“ Der Bäcker wollte schon mit dem Holzlöffel zulangen, da sank das Männlein vor ihm auf die Knie und bat mit weinerlicher Stimme:
„Um Christi Willen! Lasst Gnade walten, guter Gregor! Ich stehle aus Not und nehme mir nur, was mein Leben und das meiner Lieben erhält!“ Gregor ließ von dem Mann ab und schrie:
„Du Tollpatsch! Warum riefst du unseren Herrn an?! Jetzt kann ich dich nicht mehr züchtigen. Dabei hättest du es redlich verdient, du…!“ Während sich Gregors Gemüt in blinder Wut verlor, taten seine Hände das, was ihm sein Herz befahl: Er füllte einen kleinen Leinensack mit Mehl und drückte ihn dem Eindringling in die rechte Hand.
„Nimm das, verschwinde, und lass dir das Mehl in Zukunft von mir schenken!“ Der arme Mann wollte einwenden, dass er als Dieb dieses Almosen nicht verdient habe. Gregor ließ aber keine Gegenrede zu, er eilte in die Backstube und drückte ihm noch zwei Brote in die Arme. Damit entließ er das arme Männlein. Wieder allein, sagte der Bäcker zu sich selbst:
„Dieser Schmachtlappen wollte zwar Mehl stehlen. Aber einen schweren Sack hätte er niemals vom Fleck bewegen können. Wer stellt sich hier denn sonst noch alles ein, um meine Bestände zu plündern?“ Gregor legte sich also auch in den folgenden beiden Nächten auf die Lauer, um den Dieb zu stellen. – Er blieb sogar dem Ostergottesdienst fern, der traditionell in der Nacht auf Ostersonntag gefeiert wurde.
Als die Glocken der kleinen Dorfkirche das Fest einläuteten, erschien unversehens eine in weiße Linnen gehüllte Gestalt in Gregors Mehlspeicher.
Obwohl es stockfinster war, konnte der Bäcker das Gesicht des Eindringlings deutlich erkennen. Es war niemand, den er kannte, aber er schaute den Bäcker so vertraut an, als kenne man sich schon seit Menschengedenken. Gregor gruselte es. Wie war der Mann hier eingedrungen?‘ Er hatte die alte Speichertür nicht knarren hören. Dennoch stand er unversehens vor ihm.
„Du hast jemand anderes erwartet?“, fragte der Fremde. Der Klang seiner Stimme verriet Gregor, wen er vor sich hatte.
„Ja, Herr“, antwortete der Bäcker. Der Eindringling fuhr indes fort:
„Ich bin zu dir gekommen, weil du mich in der Kirche nicht hattest besuchen wollen.“
„Herr!“, erwiderte Gregor, indem er mit seinen Händen rang, „Ihr hättet Euch deswegen nicht in meinen Speicher bemühen müssen! Mein Herz ist immer bei Euch.“
„Das weiß ich, Gregor, deshalb statte ich dir diesen Besuch ab! Deine Seele soll doch Frieden finden.“ Der Fremde strich liebevoll über die aufgestapelten Mehlsäcke, „Ich habe eine Bitte an dich, Gregor.“ Der Bäcker wischte mit einem Taschentuch den Schweiß von seiner Stirn.
„Herr, lasst mich Eure Bitte erfüllen, und Ihr macht mich damit glücklich!“
Da berührte der Besucher den Bäcker an den Schultern und bat ihn:
„Leugne deine guten Taten ebenso wenig, wie du dich ihrer nicht rühmen solltest.“ „Ja, Herr! Ich will es so halten, wie Ihr doch derjenige seid, der mir die Kraft gibt, Gutes zu tun.“ Weil der Fremde schwieg, fasste sich der Bäcker ein Herz und fragte:
„Wollt auch Ihr mir einen Wunsch erfüllen?“ Der Fremde nickte.
„Herr“, fuhr Gregor fort. „Ich habe das erste Mal in meinem Leben die Ostermesse versäumt. Wollt Ihr mir in die Backstube folgen und mit mir gemeinsam das Brot und das frische Quellwasser genießen?“ Der Fremde nickte zustimmend, und Gregor führte ihn in die Backstube. Dort barg er ein Brot aus dem Ofen und Wasser aus einem Quell, der hinter der Backstube entsprang. Der Gast segnete die Gaben, dann speisten sie in stiller Andacht. – Nach dem Mahl wollte Gregor seinem Gast danken, der aber war so unverseh4ens, wie er erschienen war, wieder verschwunden.
Gregor meinte zuerst, er habe alles nur geträumt. Doch belegten das angebrochene Brot und der Krug mit dem Wasser, dass sich alles so zugetragen hatte, wie er es fürderhin in seinem Herzen bewahrte.
Ostern auf der Syburg
In Westhofen, einer kleinen, aber uralten Stadt am Fuße des Sybergs, lebte einst der griesgrämige Schneider Westrup. Er fluchte viel, spuckte des Öfteren aufs Garn und war raffgierig wie ein Hamster. Geiz und Missgunst waren seine besten Freunde. Das bekam sein Lehrling, der Peter, Tag für Tag zu spüren. Obwohl er ein fleißiger und ehrlicher Junge war, verweigerte Westrup ihm selbst noch nach fünf Jahren Lehrzeit den Gesellenbrief.
Der Junge arbeitete nämlich so viel weg, dass davon zwei Gesellen ihr Auskommen hätten bestreiten können. Peter musste aber weiterhin Lehrgeld zahlen. Dafür bekam er drei karge Mahlzeiten am Tag und einem Strohsack in der Besenkammer, der ihm als Bett diente.
Am Gründonnerstag – zwei Wochen vor Abschluss des fünften Lehrjahres – fragte Peter seinem Meister:
„Wollt Ihr mir nun endlich den Gesellenbrief aushändigen? Ich habe Euch fünf Jahre gedient. Nun muss es einmal gut sein.“ Westrup dachte gar nicht daran. Doch wollte er sich nicht die Blöße geben, ihm den Brief schlichtweg zu verweigern. Deshalb legte er sich folgende Ausflucht zurecht:
„Gern stelle ich dir den Brief aus. Du bist in der Tat überfällig.“ Peter wollte schon vor dem Meister auf die Knie fallen und ihm die Hände küssen, als der alte Westrup ihm zwei Kupferkannen in die Hände drückte und sich ausbat:
„Vorher musst du aber nach Syburg gehen und mir aus dem Petersbrunnen Wasser und Wein schöpfen – fein gesondert in jeweils einer Kanne. Gelingt dir das nicht, musst du drei weitere Jahre als Lehrling dienen.“
Peter dachte bei sich: ‚Der Brunnen trägt zwar meinen Namen, aber er wird trotzdem nicht das Gewünschte hergeben! Das könnte doch nur der Teufel zustande bringen!’ Weil Westrup ihm aber keine Wahl ließ, klemmte Peter die Kannen unter seine Arme und machte sich auf den Weg. Nachdem er eine gute Stunde bergauf gewandert war, sah er das Dorf Syburg mit der alten Dorfkirche vor sich liegen. Er lief schnurstracks auf das ehrwürdige Gotteshaus zu und fragte den Pfarrer, wo sich der Petersbrunnen befinde.
Der geistliche Herr runzelte seine Stirn.
„Der Brunnen liegt im Wald hinter der alten Burgruine. Sei aber vorsichtig, man sagt nämlich, dass dort der Teufel haust.“ Peter winkte ab.
„Ich bin bei Meister Westrup in Diensten. Da kann mich auch der Teufel nicht schrecken.“ Er lief in den Wald und suchte den Brunnen, konnte ihn aber nicht finden. Schließlich dämmerte es, und der arme Peter hätte beileibe nicht mehr nach Westhofen zurückgefunden.
Nun war es ausgerechnet jene Nacht, da der Herr einstmals im Garten Gethsemane gebetet hatte, bevor er folgenden Tags gekreuzigt wurde.
Darum war es so finster, als hätten sich alle Sterne vom Himmelszelt verzogen. So musste sich der arme Peter von Baum zu Baum vortasten, um irgendwo einen bemoosten Schlafplatz zu finden. Nach einiger Zeit stieß er auf ein Mäuerchen aus Sandstein.
„Oh!“, rief er vergnügt, „Ich bin auf ein Haus gestoßen, denn es ist mit einer Mauer umgeben! Nichts wie hinübergesprungen und wacker den Eingang gesucht!“ Munter hüpfte Peter über das Mäuerchen. Es war aber der Rand jenes Brunnens, den er gesucht hatte.
Wohl wunderte sich der Junge, dass er hinter der Mauer keinen festen Boden unter den Füßen fand, sondern sehr tief fiel. Aber er landete wohlbehalten auf dem schlammigen Grund des Brunnenschachtes. Wasser war hier nur spärlich vorhanden. Das war Peter aber nur recht, denn andernfalls wäre er womöglich noch jämmerlich ertrunken. Nachdem der Junge eingehend geprüft hatte, ob seine Knochen heil geblieben waren, meinte er:
„Sie werden mich morgen in der Frühe hier finden und wieder herausziehen.“ Mit diesem guten Gedanken schlief er schnell ein.
Am nächsten Morgen – es war der Karfreitag – wachte der Schneiderlehrling auf und wollte aus dem Brunnen Wasser und Wein schöpfen. Der gab aber nichts her.
„Da kann man nichts machen“, murmelte Peter vor sich hin. „Dann diene ich drei weitere Jahre als Lehrling.“ –
Nun wartete er darauf, dass sich eine menschliche Stimme hören ließ. Es war aber den lieben langen Tag nur das zaghafte Pfeifen der Vögel, das Grunzen der Wildschweine und das Bellen der Rehböcke zu hören. Peter dachte an die Leiden Christi. Und er sagte:
„Oh Herr! Du starbst an diesem Tag den Kreuzestod. Ich hingegen werde hier in diesem Loch jämmerlich verdursten. Gelobt sei deine Weisheit.“ Da quoll aus dem morschen Gemäuer des Brunnenschachtes ein feines Rinnsal kristallklaren Wassers. Peter stillte seinen Durst und füllte anschließend eine der beiden Kannen mit dem kostbaren Nass.
Nun verging eine weitere Nacht und mit ihr auch der Karsamstag, ohne dass sich eine Menschenseele zum Brunnen verirrt hätte.
Es kam die Osternacht. Der Schneiderlehrling hockte griesgrämig im Brunnenschacht. Da hörte er in der Ferne das Osternachtgeläute und den Gesang der Gläubigen, die sich vor der Syburger Kirche versammelten, um dem Teufel abzuschwören und ihn auszutrieben.
„Der Beelzebub könnte mir jetzt auch keinen Schrecken mehr einjagen“, knurrte der Junge. – Da machte es „Schwupp“. Und der Leibhaftige stand vor ihm. Er verbreitete ein fahles Licht, roch gewaltig nach Schwefel und wedelte anmutig mit seinem Ochsenschwanz.
„Stets zu Diensten, junger Mann“, meinte der Widersacher und verbeugte sich vor dem Schneiderlehrling. Der atmete erleichtert auf.
„Du hast dir viel Zeit gelassen, alter Ziegenbalg! Wie du siehst, ist die eine Kanne schon mit dem Wasser des Herrn gefüllt. Du könntest mir in die andere reinen Wein einschenken.“ Der Teufel grinste breit.
„Nichts leichter als das!“ Er schnippte mit dem Zeigefinger der rechten Hand am linken Daumen entlang, und aus der Wand des Brunnenschachtes schoss Wein in die leere Kanne.
„Du weißt, was dich mein Dienst kostet?“
„Du willst meine Seele haben, aber...“ – So schnell konnte Peter seine Erwiderung nicht anbringen, wie der Teufel ihn am Kragen gepackt und in die Luft gehoben hatte. Hui! Da flogen die beiden zum Brunnenschacht hinaus und über den Syburger Wald hinweg auf die Dorfkirche zu. Peter hielt die Kupferkannen krampfhaft fest und sortierte seine Gedanken:
‚Wenn ich jetzt nicht den Absprung schaffe, schleppt mich der Stinker noch in sein höllisches Reich.’ Der Teufel ist aber in der Kunst des Gedankenlesens ein großer Meister. Deshalb hatte er schnell erraten, was in dem armen Schneiderlehrling vor sich ging:
„Hüte dich, Bürschchen, etwas Ungehöriges zu tun. Ich werfe dich unweigerlich ab, und du stürzt in die Tiefe.“ Peter wusste nun gar nicht mehr, was er hätte tun können, um der Hölle zu entrinnen. In seiner Not begann er das „Vater unser“ zu beten – laut und deutlich.
Der Teufel kann alles ertragen, aber nicht die heiligen Worte an den himmlischen Vater.
„Muss das sein?!“, schrie er den Schneiderlehrling an.
„Wenn du auf meine Gesellschaft Wert legst, musst du es dir regelmäßig anhören.“ Da fluchte der Beelzebub aufs Hässlichste, lockerte seinen Griff und ließ den armen Schneiderlehrling samt Kupferkannen in die Tiefe stürzen. Peter landete aber wohlbehalten im Wipfel einer Eiche – mitten im Syburger Pfarrgarten.
„So lass ich mir meinen Ausflug mit dem Teufel gefallen“, meinte der Junge und nickte ein, weil es immer noch stockfinster war. – Am Ostermorgen ging der Pfarrer in seinem Garten spazieren und wunderte sich, dass im Wipfel einer alten Eiche der Schneiderlehrling schlief und zwei Kupferkannen in seinen Armen hielt.
„Wartest du da oben auf den Beginn des Gottesdienstes?“ Peter schlug seine Augen auf.
„Wenn du mir mit einer Leiter herunterhilfst, will ich wohl gern deiner Einladung folgen.“ Der Pfarrer holte die lange Leiter, und Peter konnte heruntersteigen. Unten angelangt, meinte er aber:
„Ich habe es mir doch anders überlegt und werde dem Gottesdienst in Westhofen beiwohnen.“ Ehe der Pfarrer dagegen hätte etwas einwenden können, war der Schneiderlehrling schon verschwunden. Wenig später konnte er dem kniepigen Schneidermeister Westrup die Kannen mit dem Wasser und dem Wein übergeben.
„Ist es denn wirklich aus dem Syburger Brunnen?“ Peter ließ sich auf keine Diskussionen ein. Und Westrup gab klein bei.
Da bei ihm kein Lehrling mehr arbeiten wollte, behielt er Peter als Gesellen.
Später erbte der Junge die Schneiderei und verwandelte sie in eine Goldgrube. Selbst aus Syburg kamen die Leute und ließen ihre Kleider bei ihm schneidern. Jeder Kunde war in Peters Stube willkommen. Nur Leute mit Jägerhut, stechenden Augen und Hörnern auf dem Kopf wurden nicht bedient.
Ostergeschenk
Gott gab ihn in unsere Hände:
den eigenen Sohn. Er musste sterben
zur großen Weltenzeitenwende,
damit von ihm wir Geist erwerben.
Hans, mein Hirte
Damals, als man noch zu Fuß reiste und die Kühe den Pflug zogen, lebte auf der großen Heide ein Schäfer namens Hans. In jungen Jahren hatte er den Grundstock für seine Herde mit fünf Schafen gelegt. Die hatte er als Hütejunge für seine treuen Dienste erhalten. Nunmehr, nach 30 Jahren, nannte er die größte Herde sein eigen.
Hans zog mit seinen Schafen in regelmäßigen Abständen durch all jene Dörfer, die an die Weidegründe seiner Herde grenzten. In einem dieser Dörfer lebte ein Metzger, der die überzähligen Tiere schlachtete und das Fleisch zum alsbaldigen Verzehr anbot. In einem anderen Dorf lebte ein Sieder, der die Schafknochen zu Seife verarbeitete. Auch zog ein Milchbauer mit der Herde. Er sammelte die Schafmilch in großen Krügen, fuhr sie auf einem Leiterwagen in seine Käserei und verarbeitete sie zu Schafskäse.
Schließlich lebte am Heidebach ein Lohgerber, der die Schaffelle veredelte.
Die Frau des Gerbers nahm dem Schäfer die Wolle ab und spann sie zu feinen Fäden. So lebte man mit und für den Schäfer, und jeder Heidebewohner war mit Hans, dem Hirten, wohl vertraut.
Auf einem der Heidehöfe, die Hans regelmäßig aufsuchte, lebte ein Knecht namens Johannes. Der war als Prahlhans bekannt; denn alle Tage pries er sich als den stärksten, schönsten und fleißigsten Knecht aller Zeiten. Dabei galt er als der faulste, schwächste und hässlichste Kerl im ganzen Land. Je mehr ihn aber die Leute wegen seiner Aufschneiderei verachteten, desto lauter prahlte er.
Johannes taugte zwar zu keiner vernünftigen Arbeit, doch wurde er vom Heidebauern aus purer Gutmütigkeit als Knecht gehalten. Als er aber eines guten Tages aus dem Geldsack seines Herrn zwei Goldtaler stahl und damit die Gäste in der Dorfschänke frei hielt, wurde er von seinem Gönner verstoßen. Johannes beschimpfte ihn wie ein Rohrspatz. Ja, er bezeichnete seinen ehemaligen Herrn als den größten Spitzbuben auf Erden. Der empfahl ihm aber nur, möglichst schnell das Weite zu suchen. Sonst könne er sich noch eines Besseren besinnen und den untreuen Knecht vor das Landgericht zerren. – Da nun jeder wusste, was Johannes getan hatte, wollte niemand ihn niemand mehr zu sich nehmen. So musste sich der untreue Knecht aufs Betteln verlegen und auf ein Dach über seinem Kopf verzichten.
Wie Johannes nun ziellos durch die Heide streifte stieß er auf Hans, den Hirten. Dem schloss er sich unaufgefordert an. – Hans duldete den zugelaufenen Gesellen aus reiner Menschenliebe, doch störten ihn die Geschwätzigkeit und die Prahlereien des ungebetenen Begleiters so sehr, dass er ihm nach einer Woche den Laufpass gab. Prahlhans zog sich zwar zurück, doch hegte er einen tiefen Groll gegen den guten Schäfer.
„Das werde ich ihm heimzahlen – mich, den besten Schafhirten auf der großen Heide, wie einen tollwütigen Hund fortzujagen.“
In der folgenden Nacht schlich er sich an die Herde des Hirten heran, und weil der Hütehund den untreuen Gesellen kannte, schlug er nich an. So konnte Hans die drei besten Schafe aus der Herde unbehelligt für sich abzweigen. – Der Dieb war aber so einfältig, dass er am folgenden Tag mit seiner kleinen Herde neben der des rechtmäßigen Besitzers über die Heide zog. Die gestohlenen Tiere strebten zwar in ihre alte Herde zurück, doch hielt Prahlhans sie mit einem dicken Stecken unter seiner Hut.
Verwundert beobachtete Hans, der Hirte, das Treiben, und bei der nächsten Rast ging er auf seinen diebischen Nachbarn zu.
„Verzeih, Johannes! Aber deine Schafe sehen dreien aus meiner Herde verblüffend ähnlich – zumal ich diese Tiere seit der letzten Nacht vermisse.“
Prahlhans baute sich vor dem Hirten so mächtig auf, wie es seine erbärmliche Gestalt zuließ.
„Mein Herr, Ihr werdet wohl nicht behaupten wollen, dass diese Schafe gestohlen sind!“ Hans, der Hirte, bemerkte, dass dem Dieb auf diese Weise nicht beizukommen war. Deshalb nickte er wortlos und zog sich zurück. In der Nacht stahl Prahlhans wieder drei Schafe. Und am folgenden Morgen hatte er die Stirn, erneut neben der Herde des guten Hirten über die Heide zu ziehen.
In den darauf folgenden Tagen wiederholten sich die dreisten Diebstähle, so dass Prahlhans allmählich eine stattliche Anzahl Schafe vor sich hertrieb.
Weiterhin zog er neben der Herde des gutmütigen Hirten über die Heide und kümmerte sich nicht um die scheelen Blicke des ehrlichen Hirten.
Eines Tages gelangten sie in ein Dorf, wo der Schulte Gericht hielt. Hans, der Hirte, nahm die Gelegenheit wahr, den diebischen Prahlhans anzuzeigen. Der Schulte zitierte die beiden Hirten mitsamt ihren Herden zu sich. Zum Glück fand der Gerichtstag auf dem großen Tanzplatz des Dorfes statt, so dass alle – die Schafe und das neugierige Publikum – hinreichend Platz fanden.
Zuerst konnte sich der Schulte kein Gehör verschaffen, weil die Schafe unablässig blökten. Schließlich rief er mit fester Stimme:
„Was bedeutet dieser Lärm?! Habt ihr euren Schafen nicht beigebracht, wie man sein Maul hält?!“ Der Prahlhans ergriff als erster das Wort:
„Schafe sind immer laut“, behauptete er aufs Geratewohl. Doch Hans, der Hirte, schlug vor:
„Ich werde dafür sorgen, dass Ruhe einkehrt. Befehlt dem Prahlhans, dass er von seiner Herde Abstand nimmt und sie nicht zusammenhält. Dann wird es schon still werden.“ Der Schulte stutzte. ‚Warum sollte ausgerechnet dadurch Ruhe einkehren, wenn eine der beiden Herden von ihrem Hirten getrennt würde?’ Um des lieben Friedens willen befahl er aber dem Prahlhans, sich von seinen Schafen zu entfernen. Kaum war das geschehen, drängten sich die Tiere beider Herden um Hans und beruhigten sich. Der Schulte fragte den guten Hirten:
„Was will mir das sagen?“ – Hans erklärte es ihm:
„Die Tiere gehörten ursprünglich zu einer Herde. Prahlhans hat mir einen Teil davon gestohlen. Weil die Schafe aber in mir ihren wahren Hirten erkennen, sind sie zur Ruhe gekommen.“ Der Schulte nickte.
„Das ist ein deutlicher Beweis für die Schuld des anderen Hirten!“ Er wies auf den Prahlhans und befahl:
„Nehmt ihn fest!“ Das war aber gar nicht mehr nötig; denn der Büttel hatte den Dieb schon am Kragen gepackt, als dieser sich heimlich davonschleichen wollte. Der Schulte hätte den Betrüger wohl ins Gefängnis werfen lassen, wenn nicht Hans, der gute Hirte, vor den Richterstuhl getreten wäre.
„Wenn Ihr mir noch ein Wort gestattet, euer Gnaden...“ Der Schulte ließ es zu. Und Hans, der Hirte, trug sein Anliegen vor:
„Überlasst mir den Schuldigen, damit er die Sühne für seinen Betrug in meinen Diensten ableisten kann.“ – Der Schulte fand es allemal besser, den Übeltäter wegzugeben, als ihn auf Kosten der Gemeinde im Kerker durchfüttern zu müssen.
„Steht Ihr mir dafür ein, dass dieser Nichtsnutz keinen Schabernack in unserem Dorf treiben wird?“
„Dafür stehe ich mit meinem Hab und Gut ein”, gelobte Hans, der Hirte.
Und er verließ gemeinsam mit dem Prahlhans und seiner Schafherde das Dorf.
„Warum hast du mich vor dem Kerker gerettet?“, fragte Prahlhans den guten Hirten. Der erwiderte:
„Ich habe mein Leben lang kein Schaf verloren gegeben. Mit den Menschen halte ich es ebenso. Der Herrgott hat dich in meine Obhut gegeben.
Deshalb bin ich nun dein Hirte.“ - Das machte einen gewaltigen Eindruck auf den Prahlhans. Er war von Stund an der tüchtigste Gehilfe, den sich Hans, der Hirte, vorstellen konnte. Prahlhans nannte seinen Meister seitdem nur noch ‚Hans, mein Hirte’.
Osterglocken
Osterglocken
Leben locken
aus der Erde.
Neues werde.
Was man für alltäglich hält,
ist Erlösung unsrer Welt.
Öffne die Sinne,
dein Wesen verspinne
mit unserer Erde,
damit die Glocken
dich schocken.
Mensch, werde!
Kosmisches Osterfest
Der Mensch ist nur ein winzig’ Korn
Im übergroßen Weltenall.
Indes! Gott ist als Mensch geborn’,
um zu verhindern unsern Fall.
Wer Raum für ihn in seiner Seele schafft,
der weitet sich und spürt
die Auferstehungskraft.
Nicolais Liebesmahl
In der weiten Steppe vor der alten, ehrwürdigen Stadt lebte dereinst ein alter Einsiedler namens Nicolai. Er hatte zwischen zwei von Dornengestrüpp überwucherten Hügeln einen kleinen Paradiesgarten angelegt und erntete dort die herrlichsten Früchte.
Nach einer alten Gewohnheit pilgerten einmal im Jahr – und zwar zu Frühlingsbeginn – alle Bewohner der Stadt zur Einsiedelei, um mit Nicolai das „Liebesmahl“ abzuhalten. Dazu brachte jeder das mit, was er aus seinen Vorräten erübrigen konnte. Die Reichen lieferten gebratene Hähnchen, kandierte Früchte, Rehrücken, Hasenkeulen, die feinsten Weine und andere Leckereien. Die Armen opferten eine Handvoll frischen Brunnenwassers oder ein wenig Maismehl.
Die Bedürftigen kosteten von den Speisen der Reichen. Und die im Überfluss Lebenden konnten beobachten, wie es dem Armen schmeckte.
Nicolai gab das gedörrte Obst aus dem Paradiesgarten und seinen Segen dazu. Die Reichen waren froh, dass sie etwas Gutes tun konnten, und die Armen freuten sich darüber, wenigstens an diesem Tage auf höchst angenehme Weise gesättigt zu werden.
In jede gute Gewohnheit kann sich aber im Laufe der Zeit etwas Ungemäßes einschleichen. Und so dachte mancher Reiche, er müsse zum Liebesmahl nicht gar so viel von seinen kostbaren Speisen beisteuern. Wenn er unter denen, die da reichlich auftischten, mit seinen Vorräten zurückhalte, werde es kaum auffallen. Und er könne wie all die Jahre zuvor mitspeisen, ohne im Geringsten Anstoß zu erregen.
Das ging auch so lange gut, wie nur wenige Wohlhabende so dachten. Der alte Nicolai spürte den Betrug zwar, doch vermutete er, dass die Betreffenden schon ihre Gründe für eine derart verwerfliche Knauserigkeit hatten. Und er verlor kein Wort darüber.
Eines guten Tages aber dachten alle Reichen das Gleiche – und zwar das falsche Gleiche. Deshalb steuerten sie – wie auch die Armen – entweder ein Krüglein mit frischem Quellwasser oder ein Säcklein mit Maismehl bei.
Nicolai empfing wie all die Jahre zuvor die Gäste vor seiner Klause. Er begrüßte jeden mit Handschlag und inniger Umarmung und bat ihn, seine Gaben auf jenen großen Teppich zu legen, den auf dem Lehmboden seiner Behausung ausgebreitet war. Wie staunten aber die Gäste, als am Ende nur lauter Krüge mit frischen Quellwasser und Säcklein mit Maismehl auf dem Teppich standen.
„Ja! Ihr Lieben“, stellte Nicolai kopfschüttelnd fest, „nun sind wir alle miteinander arm und werden als Arme unser Liebesmahl halten.“ Indem er auf seinen Vorratsschrank wies, fügte er hinzu:
„Auch ich bin in diesem Jahr arm; denn meine Vorräte an gedörrtem Obst sind aufgezehrt, so dass wir auch darauf verzichten müssen.“
Die Gäste schwiegen – die Reichen aus Scham, die Armen vor Enttäuschung; denn sie hatten sich schon seit Monaten auf dieses Mahl gefreut, war es doch die einzige Abwechslung in ihrem eintönigen Speiseplan. So erhoben sich alsbald die ersten Gäste von ihren Sitzen, um den Heimweg anzutreten. Die einen ärgerten sich über die Knausrigkeit der Reichen, die anderen über ihre eigene Dummheit. Nicolai verabschiedete sie als gute Freunde und freute sich, dass doch noch einige blieben. Zu denen sagte er:
„Dann will ich aus euren Geschenken ein schönes Mahl zubereiten.“ Der Einsiedler fachte im Herd ein Feuer an, setzte den größten Topf, den er besaß, darauf und füllte ihn mit dem Wasser aus den Krügen. Als dieses zu brodeln begann, schüttete er das Maismehl dazu und rührte das Ganze mit einem langen Holzlöffel um. Die Gäste beobachteten den Alten bei dieser Verrichtung und schwiegen.
Als der Brei gar war, schlug der alte Nicolai das Kreuz über dem Topf und verteilte die Speise in kleinen Tonschüsselchen. Jeder bekam etwas ab.
Bevor aber jemand hätte zulangen können, bat Nicolai seine Gäste:
„Schließt eure Augen und stellt euch jene Speise vor, die ihr auf dem heutigen Liebesmahl gern gegessen hättet.“
Die Gäste dachten nichts anderes, als dass es ein einfältiges Spiel sei.
Mancher hätte gern etwas Spöttisches dazu bemerkt. Aus Liebe zu dem guten Nicolai schlossen sie aber die Augen und stellten sich ihre Lieblingsspeise vor.
Mit einem „So wünsche ich euch denn einen gesegneten Appetit“ forderte der Einsiedler die Anwesenden auf, kräftig zuzulangen. Nun tunkten alle recht lustlos ihre Finger in die Näpfchen und kosteten von dem Maisbrei.
Wie aber wunderten sie sich, als sie tatsächlich ihre Lieblingsspeise schmeckten!
Der eine hatte Fasan, der andere kandierte Früchte, der nächste eine Hasenkeule und all jene Beilagen auf der Zunge, die er sich dazu gewünscht hatte. Jeder schwelgte in seinen Gaumenfreuden, und keiner fühlte sich zurückgestellt oder beschämt. Während die anderen noch mit ihren Speisen beschäftigt waren, fragte einer der Gäste, er hieß Grischka, den Einsiedler:
„Lieber Nicolai! Was hast du denn geschmeckt?“ Der Gastgeber strich über seinen langen Bart und erwiderte:
„Ich schmeckte den Leib des Herrn und sein Blut.“
„Soll das heißen, dass du dir nichts anderes gewünscht hast, als eine Oblate und einen Schluck Wein?“
„Eine Oblate und einen Schluck klaren Wassers“, verbesserte der Einsiedler den guten Grischka, denn Wein hatte er schon seit Jahren nicht mehr genossen. Da fühlten sich alle Gäste zutiefst beschämt. Niemand hatte an den Herrn gedacht. Sie waren alle nur auf ihre Gaumenfreuden erpicht gewesen. Da meinte der alte Nicolai:
„Nun ziert euch nicht so! Ihr habt alle vom Leib des Herrn genossen; denn er hat eure Leckereien genauso zubereitet wie meine Oblate und mein Wasser.“ Da beruhigten sich die Gäste wieder. Und es endete alles in Freude und Heiterkeit.
Jene aber, die zu früh gegangen waren, hofften, dass sich dieses Wunder wiederholen werde. Dazu kam es aber nicht. Denn für die folgenden Liebesmahle spendeten die Reichen wieder ihre besten Speisen und Armen, das, was sie erübrigen konnten. Keiner wollte sich ein zweites Mal die Blöße geben, als geizig oder missgünstig zu gelten.
Ausatmen
Die Welt, sie atmet sich jetzt aus.
Weit sprießt das grüne Blätterhaus.
Das nimmt sich unseres Odems an,
damit es daraus wirken kann
die Luft, die wir mit Dank erleben,
um Wohnung unserem Geist zu geben.
Der Bäcker und der Teufel
Die Brote und der Butterkuchen von Bäcker Pauly waren so beliebt, dass die Kunden schon um sechs Uhr in der Frühe sein kleines, altmodisches Ladenlokal stürmten. Qualität hat aber seinen Preis. Schon um Mitternacht musste Meister Pauly seinen alten Steinofen „anheizen“. Danach setzte er die Teige für Brot und Kuchen an. Nebenher bestückte er in regelmäßigen Abständen seinen Ofen mit Brennholz.
Um vier Uhr wurde die Glut aus dem Ofen geholt und eine Lage mit Butterkuchen eingeschossen. Fünf Minuten später war der Kuchen fertig.
Dann folgten die Brötchen. Die waren nach 10 Minuten braun gebrannt.
Wenig später kamen das Weizenbrot an die Reihe. Das brauchte eine halbe Stunde. Danach konnten die Roggenbrote in aller Ruhe garen, bevor das Schwarzbrot bis zum frühen Mittag die Restwärme verzehrte.
Am Nachmittag war der Ofen ausgeräumt, und Meister Pauly konnte sich aufs Ohr legen, während seine Frau im Laden den Verkauf regelte. Am Abend wachte der Bäcker auf, um sich nach einer gemütlichen Vesper auf die Arbeit in der Backstube zu freuen.
So hätte es bis zum seligen Erdenabschied des Meisters weitergehen können, wenn sich nicht eines guten Morgens ein merkwürdiger Fremder im Ladenlokal der Bäckerei eingefunden hätte. Seine Erscheinung war so gruselig, dass sich kein weiterer Kunde zu ihm gesellen mochte.
„Grüß Gott!“, rief die Bäckersfrau beherzt. Weil der Fremde bei diesem frommen Gruß heftig zusammenzuckte und nichts erwiderte, fragte sie:
„Was wünschen Sie?“ Der Kunde aalte sich in seinem dunkelgrünen Lodenmantel und erwiderte:
„Ich hätte gern alles, was Ihr Mann an diesem Tag aus dem Backofen birgt.“
Frau Pauly runzelte ihre Stirn.
„Hatten Sie denn etwas vorbestellt?“
„Nein. Ich kaufe alles, jetzt und hier. Ich zahle dafür jeden Preis.“
„Moment mal“, erwiderte Frau Pauly. „Da muss ich erst einmal in die Backstube gehen und meinen Mann fragen, wie er sich das vorstellt.“
„Tun Sie das!“ Der Kunde lehnte seinen rechten Ellenbogen gegen die Glasfront der Theke und wartete. Unterdessen war Frau Pauly in der Backstube eingetroffen, wo sie ihren Mann vom Angebot des Fremden unterrichtete. Der Meister schüttelte seinen Kopf.
„Kommt nicht in die Tüte!“
„Er zahlt aber einen guten Preis. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen.“
Meister Pauly zog seine Schultern hoch.
„Unsere Kunden gehen vor. Die halten uns seit Jahrzehnten die Treue. So etwas ist mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen.“
„Na gut. Und wie soll ich den Fremden abspeisen?“
„Sag ihm, dass ich eher über die Glut aus meinem Ofen laufe, als dass ich ihm auch nur einen einzigen Wecken verkaufe.“ Frau Pauly eilte in das Ladenlokal und erklärte dem Fremden:
„Mein Mann läuft lieber durch die Glut, die er heute Morgen aus seinem Backofen gezogen hat, als dass er Ihnen auch nur eine Wecke überlässt – für welchen Preis auch immer.“
„Das geht in Ordnung“, erwiderte der Fremde, „dann soll er die Glut auf dem Boden ausbreiten und einmal längs drüber laufen.“
„Gut! Ich sag’s meinem Mann.“ In der Backstube angekommen, erklärte sie dem Meister:
„Du, Männe, der Fremde meint, das mit dem Über-die-Glut-Laufen ginge in Ordnung.“ Bäcker Pauly war für einen Augenblick ratlos. Dann aber blitzten seine Augen auf, und er entgegnete:
„Bitte den Fremden in die Backstube. Er soll sehen, wie ich über die Glut laufe.“ Frau Pauly eilte kopfschüttelnd zurück in das Ladenlokal.
„Kommen Sie mal mit. Mein Mann läuft Ihnen was vor.“ Der Fremde folgte ihr in die Backstube. Der Bäcker beäugte den seltsamen Kunden eingehend und meinte:
„So hab ich ihn mir vorgestellt.“ Dann schüttete er die heiße Glut, die er in einer großen Blechtonne aufbewahrt hatte, auf den Boden der Backstube.
Eine Höllenhitze stieg auf, so dass die Bäckersfrau drei Schritte zurückwich.
Der Fremde aber schien sich daran zu ergötzen. Er rückte sogar einen Schritt vor, um den Duft und die Hitze in sich aufzunehmen. Der Bäckermeister stieg in zwei Eimer, die zur Hälfte mit Sand gefüllt waren und grinste den Fremden an.
„Was soll das werden?“, fragte der.
„Das sind meine Schuhe!“ Pauly zog die Eimer an den Henkeln hoch, so dass seine Füße darin einen festen Stand hatten. Dann lief er gemütlich über die Glut. Der Fremde rief wutentbrannt:
„So war das aber nicht gemeint!“ Der Bäcker zog seine Schultern hoch.
„Wie du das gemeint hast, kann ich mir schon vorstellen. Ich habe es aber so gemacht, wie es mir behagt.“ Mit diesen Worten packte der Bäckermeister den Fremden am Kragen und warf ihn hinaus. Der aber rief:
„Solange du lebst, Pauly, hast du Ruhe vor mir. Wenn du aber stirbst, ist mir deine Seele sicher! Dann hole ich dich hier in der Backstube ab.“
Meister Pauly dachte zwar: ‚Bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein hinunter’, aber mit den Jahren, die auf das denkwürdige Ereignis folgten, wurde es ihm immer mulmiger zumute. Als er schließlich alt und wackelig geworden war, erklärte er eines guten Tages seiner Frau:
„Ich spüre, dass meine Zeit abgelaufen ist. Nun muss ich mich, wohl oder übel, dem Teufel stellen.“
„Tu das. Je schneller du Gewissheit darüber hast, ob du mit ihm in der Hölle braten musst oder nicht, desto besser geht es dir.“
Nun hatte Meister Pauly in seiner Backstube eine große Mehlkiste. Morgens war sie randvoll, am Nachmittag so leer, dass selbst eine Maus kein Mahl daran bekommen hätte. An diesem Morgen hatte Meister Pauly aber nicht alles Mehl verbacken, sondern einen Rest zurückbehalten. Er legte sich in die verstaubte Kiste, seine Frau schlug den Deckel über ihm zu, und so warteten die Bäckersleute auf den Beelzebub. Wenig später stellte der sich ein und fragte:
„Na, Meisterin, wo finde ich deinen Mann?“
„Wo soll er schon sein? Er liegt im Bett und versucht, seine Seele auszuhauchen.“ Der Herr im grünen Lodenmantel schüttelte lachend seinen Kopf.
„Nein, Frau Pauly! Er liegt woanders. Das rieche ich. Und er wird heute noch an meiner Seite zur Hölle fahren. Ich hole ihn mir – gleich wo er sich versteckt hält.“
„Gut“, erwiderte die Meisterin und wies auf die Mehlkiste. „Er liegt schon im Sarg und freut sich auf die Reise.“ Der Grünfrack bedankte sich bei Frau Pauly, klemmte die Mehlkiste unter seinen rechten Arm und verschwand damit durch das Kellerloch.
Als er in der Hölle angekommen war, wurde er von seinen Kindern, Geschwistern, Onkeln und Tanten mit großem „Hallo“ gefeiert; denn eine Mehlkiste als Sarg hatten sie noch nie gesehen.
„Schlag auf!“, befahl einer der Oberteufel, und der Grünfrack öffnete den Deckel. Heraus stieg der reichlich mit Mehl bestäubte Bäcker Pauly.
„Gott zum Gruße!“, rief er mit so lauter Stimme, dass alle Teufel einen Schritt zurückwichen.
„Was bist du denn für einer?“, fragte die Großmutter des Teufels, und beäugte den Fremden misstrauisch. Der Bäcker schlug den Mehlstaub aus seinen Kleidern und erklärte dem höllischen Publikum:
„Ich bin schon so alt, dass ich ein wenig Schimmel angesetzt habe.“ Das Großmütterchen spie vor Ekel ein gerüttelt Maß Galle auf den Höllenboden und wandte sich kopfschüttelnd ab. Ihr Enkel ließ sich aber nicht beirren.
„So!“, schnarrte der. „In der Hölle herrschen meine Regeln. Deshalb stehen hier auch keine Sandeimer herum!“ Und er schüttete einige Schaufeln Glut vor die Füße des Bäckermeisters.
„Nun kannst du vor unser aller Augen deine Künste zeigen.“ Bäckermeister Pauly warf eine Handvoll Mehl auf die Glut, und zum Schrecken der ringsum Versammelten stieg eine prasselnde Stichflamme auf. Die verpuffte aber genauso schnell, wie sie entstanden war.
„Das war der Einstand!“, erklärte Meister Pauly dem staunenden Volke.
„Nun will ich, wie es euer Obermeister verlangt, über die Glut laufen.“ Der Bäcker zog Schuhe und Socken aus, spie Speichel in seine Hände, vermischte ihn mit Mehl und pappte den Brei unter seine Füße. Dann stolzierte er in aller Seelenruhe über die glühenden Kohlen. Unter seinen Sohlen brutzelte es zwar mächtig, doch blieben die Füße durch den Mehlbrei unversehrt. Meister Pauly lächelte schelmisch:
„Na, mein alter Höllenmeister? Wollt Ihr noch ein weiteres Kunststück aus meinem reichhaltigen Repertoire bewundern?“
„Es reicht!“, schrie der Teufel. Er stopfte den Bäcker in die Mehlkiste, schlug sie zu und trug sie zurück in die Backstube. Schon am folgenden Morgen gab es in Paulys Bäckerladen wieder frischen Butterkuchen, Brötchen und Brot. Wer aber eine feine Nase hatte, bemerkte noch in den folgenden Tagen den leichten Schwefelgeruch, der in den Kleidern des Meisters hing.
Der Osterzweig
Anne sollte wie all die Jahre zuvor ihre Osterferien beim Großvater in Fröndenberg verbringen. Am Ostersonntag fuhr sie gemeinsam mit ihren Eltern bei strahlendem Sonnenschein dorthin.
„Ein richtiges Auferstehungswetter“, meinte Annes Vater auf der Fahrt von Dortmund Öspel nach Fröndenberg. Und ihre Mutter fügte hinzu:
„Dann sitzt Opa im Kleingarten auf seiner Terrasse.“ Also fuhren sie gleich zur Kleingartenanlage „Die Amsel“. Dort hatte der Großvater den Kaffeetisch gedeckt – mit frischem Apfelkuchen und „Opas Spezialkaffee“, einem Gemisch aus Kakao, Milch und starkem Kaffee.
„Ihr bleibt doch noch ein wenig?“, fragte er die Erwachsenen. Die drucksten verlegen herum.
„Eigentlich nicht“, meinte Annes Mutter. „Wir wollten gleich wieder verschwinden.“
„Nichts da!“, erklärte Opa. „Für ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee habt ihr alle Zeit der Welt.“ In stiller Ergebenheit setzten sich Annes Eltern auf die klapprigen Gartenstühle und genossen den Kaffee und den phantastischen Kuchen. Anne bekam Kakao. Sie trank drei Tassen, schaufelte zwei Stücke Kuchen in sich hinein und verschwand anschließend im Garten.
Was es da alles zu sehen gab! Überall trieben Knospen aus der Erde. Die Märzenbecher blühten schon. Die Mücken spielten, und die Mäuse hielten im Gewächshaus die Pflänzlein kurz. Es war ein verwunschener Garten – mit dichten Hecken, Laub- und Zweighaufen, Krabbelkäfern, Asseln, Viechern im Kompost und einem Igel, der sein Lager im Laub unter dem Nussbaum eingerichtet hatte.

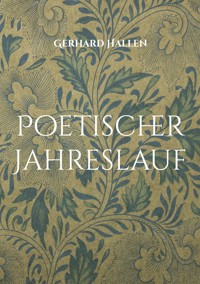















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











