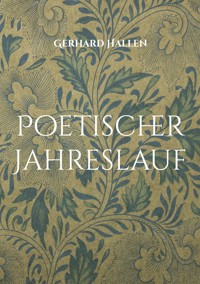Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Einleitend werden sowohl einige aphoristische Gedanken zur geistesgeschichtlichen Entwicklung des Lernens wie auch zwei Modelle vorgestellt, die in der öffentlichen Regelpädagogik auch heute noch Beachtung finden. Sie sollen den Lesern*innen die Möglichkeit bieten, den eigenen Standort mit jenen Prinzipien abzugleichen, die diesen Methoden zugrunde liegen. Im Anschluss daran werden im Kapitel über die Methodik die Kernaussagen des aus der anthroposophischen Menschenkunde schöpfenden Vierschritts vorgestellt und anhand von Beispielen zur Unterrichtsorganisation erläutert. Im Kapitel zur Didaktik folgen Beispiele aus der praktischen Arbeit im Hauptunterricht wie auch in Fachunterrichten. Sie sollen als Anregung zur Entwicklung eigener methodischer und didaktischer Ansätze dienen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Vorbemerkungen
Geschichtliche Momente
Neuzeitliche Unterrichtsmethoden
Entwicklungspsychologische Ansätze bei Piaget und Montessori
Die Frage nach dem menschlichen Geist
Waldorfpädagogik in der digitalen Lebenswelt
Zur Methodik
Die menschenkundlichen Grundlagen des Vierschritts
Zum Begriff des Vierschritts
Das pädagogische Gesetz
Zum Bildbegriff
Aspekte einer optimalen Förderung
Zur Unterrichtsorganisation
Die Auswirkungen des Vierschritts
Der handlungsorientierte Unterricht
Zur Didaktik
Die Anbahnung des Vierschritts (mit Beispielen)
Übungen aus dem rhythm. Teil
Formenzeichnen (1. Klasse)
Malen mit Wasserfarben
Tafelbilder
Rätsel
Schreiben- und Lesen-Lernen
Zur Sprachlehre
Interaktives Rechnen
Zur Pflanzenkunde
Musikunterricht in Bewegung
Geographie zum Anfassen
Der Anfangsunterr. in Geschichte
Der Vierschritt im Handarbeitsunt
Der Vierschritt im Rahmen einer Bienenepoche
Zur Didaktik des handlungsorientierten Unterrichts
Bei den Illustrationen handelt es sich um Skizzen für Tafelbilder.
Vorbemerkungen
Kurze Einleitung
In diesem Kapitel wird aphoristisch aufgezeigt, in welchem kulturhistorischen Zusammenhang die aus der anthroposophischen Menschenkunde schöpfende Unterrichtsmethode Gertrud Langens steht, wie sie sich von den pädagogischen Ansätzen zweier bedeutender Repräsentanten der zeitgenössischen Pädagogik absetzt und welche methodischen und didaktischen Ressourcen sich daraus ergeben.
Geschichtliche Momente
Lernen fand in alter Zeit entweder durch Überlieferung (Nachahmung vorgegebener Traditionen) und/oder an Mysterienstätten statt. Dort wurden Gedanken nicht vorgestellt bzw. über das Gehirn gespiegelt, sondern in der ätherischen Welt (Lebens- bzw. Gedankenäther) ebenso real gesehen, wie wir heute die gegenständliche Welt wahrnehmen. Selbst noch im antiken Griechenland traten Kaufleute erst dann eine Reise an, wenn sie vorher das für sie ‚zuständige‘ Orakel nach der spirituellen Berechtigung ihres Vorhabens befragt hatten.
Mit Beginn des Verstandesseelenzeitalters (ca. 8./7. Jh. v. Chr.) versiegte dieser Strom. Anstelle der Eingebung und der Tradition trat die eigene Verstandestätigkeit, die sich von der Außenwahrnehmung und den aus ihr sich ergebenden Vorstellungen leiten ließ.
Doch war das menschliche Gehirn noch nicht so ‚ausgelegt‘, dass es – wie im ersten Vortrag des Heilpädagogischen Kurses ausgeführt – als Spiegelungsinstrument für die Weltgedanken diente. Die Wahrnehmung löste noch eine Initialzündung zur unmittelbaren Verbindung des menschlichen Ätherleibes mit den im Weltenäther lebenden Gedanken aus. Dazu zwei Beispiele:
In der Antike existierte die Philosophenschule der Peripatetiker. Die Angehörigen dieser Schule konnten ihre Ätherleiber beim Schreiten so weit ausdehnen, dass sie, durch innere oder auch äußere Wahrnehmungen angeregt, Gedanken hellsehend aus dem Weltenäther erfassten.
Eine andere Philosophenschule ging folgendermaßen vor: Der Lehrer und sein Schüler vollzogen Wahrnehmung und Begriffsbildung getrennt voneinander und verknüpften sie synoptisch. So schaute der Schüler auf das Objekt seiner Wahrnehmung, zum Beispiel eine Rose, und der Lehrer ‚las‘ im Ätherleib des Schülers den dazu gehörenden lebendigen Gedanken der Rose. Die Wahrnehmung war zwar schon an das Sinnliche gebunden, die Begriffsbildung aber noch vom Hellsehen geleitet.
Erst allmählich wurde auch das Erfassen von Gedanken als etwas in der Seele Stattfindendes erlebt – im Mittelalter schon so weitreichend, dass in orientalischen Philosophenschulen dem Begriff nur noch der Status eines Nomens – der beliebigen Bezeichnung eines Wahrnehmungsobjektes – zugestanden wurde. Ausschließlich das Sinnlich-Wahrnehmbare bestimmte das wahre Sein (vgl. Steiner, GA 18, S. 35-84, S. 91-100).
Mit Beginn der Neuzeit – und zwar im 15. Jahrhundert n. Chr. – verankerte sich das menschliche Vorstellen so weit im physischen Leib, dass sich Erinnerungsvorstellungen im Spiegelungsinstrument des Gehirns ‚abbildeten‘. Das heutige Wahrnehmen und Vorstellen war ‚geboren‘. (vgl. Steiner: GA 204, 10. Vortrag. Ders.: GA 302/a. Ders.: Heilp. Kurs, GA 317, 2. Vortrag).
Gefangen in eigenen Vorstellungen
Das Spiegeln von Gedanken aus dem Weltenäther durch das Gehirn vermittelte dem neuzeitlichen Menschen das Erleben der eigenen Denkkraft und der Unabhängigkeit von einer nun nicht mehr wahrzunehmenden übersinnlichen Welt. Damit konnte sich der Mensch auf sein eigenes geistiges Wesen fokussieren, auch wenn es sich dabei erst einmal nur um sein ‚Alltags-Ich‘ handelte, denn das Spiegelungsdenken erlischt in der Nacht und entsteht beim morgendlichen Auswachen wieder neu.
Die ‚Gefahr‘ der Spiegelung von Wahrnehmungen wie auch Gedanken über das Gehirn liegt darin, dass sowohl mit dem Wahrnehmen wie auch mit dem Vorstellen ein Akt der Abtötung des Lebendigen, und zwar der Wahrnehmungsinhalte wie auch der Gedanken, verbunden ist. Die Natur wurde als ein komplexer Kausalzusammenhang erlebt, dem eine Vielzahl von Mechanismen zugrunde liege. Das Gehirn wurde als eine Art Schaltkasten, schließlich als Computer, verstanden, der Eindrücke miteinander vernetzt und dadurch Vorstellungskomplexe generiert. Das immer wieder Gleiche führt in einem immer komplexer angelegten Wirkungszusammenhang zu umfassenderen Daseinsformen. Die Wirkung bestimmt das Sein, nicht umgekehrt das Sein bzw. der Geist die Wirkung.
Die Gesellschaft, die sich aus diesen Voraussetzungen aufbaute, war im 19. Jahrhundert die Industriegesellschaft. Man glaubte an die technische Manipulierbarkeit allen Seins und an eine Weiterentwicklung aus rein materiellen Grundlagen.
Man glaubte, dass die Materie sich selbst genügt und alles aus sich hervorbringt. Ja sie könne sich, wenn man nicht den Schlüssel zur Steuerung der ihr innewohnenden Prozesse erforscht, auch wieder von selbst auflösen. Der Mensch, der diese Prinzipien erkennt und damit auch zu beeinflussen versucht, ist nach der Logik des Materialismus ein autonomes Wesen, das aber durch die Gesetze der Materie determiniert ist.
Wie kann aber ein Wesen, das durch die Bedingungen des materiellen Seins vollends prädestiniert ist, seine eigenen Daseinsgrundlagen nicht nur erforschen, sondern dieselben auch dauerhaft und nachhaltig steuern? Logischerweise müsste diesem Wesen eine Instanz innewohnen, der außerhalb dieser Mechanismen steht und dieselben zu steuern in der Lage ist …
Mit anderen Worten: Indem man das Tote wahrzunehmen glaubte und es auch dachte, lebte man in der Illusion, daraus etwas Lebendiges kreieren zu können. Das Ergebnis liegt derzeit in Form von diversen Zivilisationskrisen deutlich auf der Hand…
Mögliche Wege aus der Krise des Materialismus
In seinem Vortrag vom 29. April 1921 (GA 204) wies Rudolf Steiner darauf hin, dass sich seit der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert das menschliche Denken von seiner strikten Bindung an das physische Gehirn zu lösen beginnt und der Zugriff auf die im Weltenäther existierenden lebendigen Gedanken wieder möglich ist. Das wird durch die Aktivität des Ichs in seiner Ausprägung als Bewusstseinsseele und die sich daraus ergebende Entfaltung des Geistselbsts - und zwar durch die Verwandlung des Astralleibes in ein „Gefäß“ für Imaginationen – ermöglicht.
Dabei handelt es sich um eine vom Menschen selbst gesteuerte und nicht – wie im Altertum und im Mittelalter – eine instinktive bzw. mediale, also von außen geführte geistige Entwicklung.
Dass die gesamte Menschheit sich in diese Richtung entwickelt, wird daran erkennbar, dass viele Menschen in bewegten Bildern vorzustellen und auch zu reflektieren beginnen. Dadurch besteht die Chance, die in der Natur stattfindenden Lebensprozesse und die im menschlichen Gegenüber sich vollziehenden seelischen Vorgänge real wahrzunehmen.
Die Natur ist nicht mehr ein Sack voller Chemie, dessen Inhalt sich beliebig manipulieren lässt. Und der Mensch ist nicht jenes Lebewesen, dem ich etwas eintrichtere, damit es dementsprechend handle. Mensch und Natur werden stattdessen in Prozesse gestellt, die wir mit Hilfe der anthroposophischen Menschenkunde fördern können, um dadurch ausnahmslos jeden Menschen in den Stand zu versetzen, sich selbst zu steuern.
Daraus ergibt sich u. a. der pädagogische Auftrag, Schülern*innen den Zugang zu dieser neuen Form des aus dem Gedankenäther-Heraus-Denkens zu ermöglichen bzw. sie nicht durch veraltete Lehrmethoden einzuschränken. Der Unterricht, der dieser Qualität entspricht, ist von Bildhaftigkeit geleitet. Die sich daraus ergebende Unterrichtsmethode ist, wie es im Folgenden noch dargestellt wird, der Vierschritt.
Kunstgriffe der öffentlichen Pädagogik
Nun entwickelte Steiner pädagogische Grundlagen, die auf eine Ätherisierung des Vorstellungslebens abzielten:
Die Eurythmie bewirkt eine lebendige Beziehung des menschlichen Ätherleibes zu den Weltgedanken.
Aus der Rhetorik wurde die Sprachgestaltung,
aus der intellektuellen Unterweisung der bildhafte Unterricht entwickelt.
Der öffentlichen Regelpädagogik entgingen diese Inaugurationen zwar nicht. Sie zog aber verkürzte Schlüsse daraus. So organisierte auch sie das Lernen auf der Grundlage rhythmisch- musikalischer und kinästhetischer Elemente, da sich Lerninhalte dadurch besser einprägen lassen als mit Hilfe des „Einpaukens“ (vgl. u. a. dass das Projekt an der Franz-Sales-Schule-Essen in: www. Lernen in Bewegung).
Bei den daraus abgeleiteten Maßnahmen – wie zum Beispiel dem „Rechnen in Bewegung“ oder der Verbindung von Schriftzeichen mit Sprüchen und Liedern – handelt es sich um ‚Arrangements‘ und ‚Stimulationen’, aber nicht um ein lebendiges Erleben des Wesens von Zahlen, Zahlenbeziehungen oder Lauten. (u. a. Feldenkrais, M.: Abenteuer im Dschungel des Gehirns)
Zur Verdeutlichung dazu ein Beispiel aus dem Lese-und Schreibunterricht:
Im öffentlichen Regelschulzusammenhang erwirbt der Schüler u. a. durch das mechanische Zeichnen von Schlaufen und Umkehrungen die sensomotorischen Fertigkeiten zum Schreiben von Buchstaben. Anschließend prägt er sich mit Hilfe von Sprüchen und Liedern die einzelnen Buchstabenformen ein. Beim Schreiben verschleift er diese Formen zu Silben, später zu Wörtern (sensomotorische Phase).
Parallel dazu wird der Vorgang der Diskrimination von Buchstabenformen geübt, damit diese Fertigkeit in ein Wiedererkennen und Benennen von Schriftzeichen einmündet – was schließlich zur Fertigkeit des Lesens, später des sinnentnehmenden Lesens führt (Kognition).
Dieser Ansatz geht von einem psychomotorischen Reiz-Reaktions-Schema aus, das zum Erwerb der Fähigkeit des Schreibens und in der Folge der Fertigkeit des Lesens führt.
Dagegen verweist Rudolf Steiner in seinen Vorträgen zur Menschenkunde und Pädagogik darauf, dass derartige Vorgehensweisen in ein unlebendiges Verhältnis zur Sprache führen. Da das Kind aber lebendige und entwicklungsfähige Vorstellungen sucht, kann es sich mit den abstrakten Begriffen von Sprache nur unter erschwerten Bedingungen verbinden (Steiner, GA 294, S. 67-79).
Es braucht die lebendige Verbildlichung jener Buchstaben, die für uns Erwachsene nur Konventionen sind. Vergleiche man dazu die Beispiele im Abschnitt über die Didaktik.
Die Synapsen- und Transmitterfaszination
Die moderne Hirnforschung hat Tricks ausgemittelt, mit deren Hilfe Gedächtnisleistungen und Analogieschlüsse u.a. durch optische und akustische Stimulationen verbessert werden.
Nachdem Charles S. Sherrington 1897 das Phänomen des „Leerstandes“ zwischen Nervenzellen im Gehirn entdeckt und sich später die Auffindung der Transmitter (Botenstoffe) hinzugesellt hatte, strebt man die Aktivierung „nicht genutzter“ Hirnareale und damit die Vermehrung von Vernetzungen an, um eine Erweiterung mentaler Fähigkeiten herbeizuführen (vgl. Engel, K.: Neurowissenschaften, S. 9-14).
Die aus den Neurowissenschaften generierte Regelpädagogik schaut infolgedessen auf die Quantität der Verbindungen und betrachtet die qualitative Entwicklung als ein Ergebnis des sich steigernden Umfangs der Synapsen (Komplexität).
Unter anderem wird bewusst mit Assoziationen gearbeitet, die den Verstand ‚in die Irre führen‘ oder phantasievolle Assoziationen mit Nomen verbinden. Damit der Schüler sich beispielsweise das Nomen „Tüte“ einprägt, stellt man ihm das Bild eines Stuhls dazu. Das führt nach Auffassung der Neurowissenschaftler zu einer vermehrten Bildung von Verknüpfungen im Gehirn und damit zu einer Steigerung der Gedächtnisleistung (Dass., S. 45-50).
Menschenkundlich lässt sich dieses Phänomen wie folgt erklären: Die fehlgeleiteten Assoziationen zwingen Ich-Organisation und Astralleib, im Widerstand gegen die Bildvorstellung das „richtige“ Nomen als Engramm einzuprägen – und zwar intensiver und stärker ans Physische gebunden, als es bei einem Nomen der Fall wäre, dem eine lebendige Bildvorstellung zugeordnet wäre. Der im neunten Vortrag der „Allgemeinen Menschenkunde“ beschriebene Weg der kindlichen Geistseele vom Schluss über das Urteil zum Begriff wird zugunsten der mit dem Kopfmenschen verbundenen Abbaukräfte manipuliert.
Das physiologisch sich abbildende Symptom dieser Vorgehensweise ist die Synapsenvermehrung. Derartige Kunstgriffe funktionieren also, sie führen jedoch vom wirklich kreativen Denken weg. Das ist für die Vertreter der Synapsenvermehrung aber kein Problem, denn sie haben einen Begriff von Phantasie und Kreativität, der sich, wie oben schon angedeutet wurde, mit einer gesteigerten Quantität von Assoziationen verbindet.
Die menschenkundlich orientierte Pädagogik geht hingegen davon aus, dass man weniger durch Stimulation als durch Eigenmotivation und eine altersgerechte Verlebendigung des Vorstellens nachhaltige Lernfortschritte erzielt.
Auch wird der Fokus auf jene Entwicklungsstufen gerichtet, die in den Lebensprozessen beschrieben, also mit ätherischen Vorgängen verknüpft sind. Die Synapsenvermehrung ist in diesem Zusammenhang ein Symptom der erfolgreich vollzogenen Wesensgliederentfaltung (vgl. 2. Vortrag HPK, GA 317, hier das „Milchtopfgleichnis“).
Pharmazeutische Hilfen
Die pharmazeutische Forschung hat Mittel (u. a. Psychostimulantien und Phasenprophylaktika) zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und zur Glättung seelischer ‚Extrasystolen‘ entwickelt, die vormals „schwer erziehbare“ Kinder in den Stand der Beschulbarkeit versetzen. Das ist die positive Wirkung der pharmazeutischen Hilfen. Zu berücksichtigen ist jedoch die mögliche Beeinträchtigung der Wesensglieder-Entwicklung.
Durch pharmazeutische Medikationen werden die Symptome einer Unregelmäßigkeit zwar beseitigt, die Ursachen, denen häufig ein unregelmäßiges Ineinander-Wirken der Hüllen resp. Wesensglieder zugrunde liegt, werden damit aber nicht gegriffen (eine stark pointierte Kritik bei: Lehmann, P.: Neue Antidepressiva).
So stehen wir heute vor der Herausforderung, die pharmazeutische Option durch pädagogische und therapeutische Maßnahmen zu begleiten und ggf. aufzuwiegen. Wir können die eigenen Fähigkeiten in der Unterrichtsorganisation und -durchführung so optimieren, dass wir mit Unterstützung durch die anthroposophisch erweiterte Medizin und entsprechende Therapien auch an das „Substantielle“ der jeweiligen Leiden herankommen und ggf. heilend wirken (vgl. Steiners Äußerungen zum Substantiellen einer Störung und zur „Psychographie“ u. a. in den ersten beiden Vorträgen des HPK).
Entwicklungspsychologische Ansätze bei Piaget und Montessori
Im 20. Jahrhundert rückten einige bedeutende pädagogische Reformansätze in den Fokus des erziehungswissenschaftlichen und des öffentlichen Diskurses, die auf eine ‚nicht manipulative‘ respektive dressurfreie Pädagogik hoffen ließen. Zwei entwicklungspsychologische Ansätze, die nachhaltig auf die Praxis einwirkten, sollen hier in gebotener Kürze vorgestellt werden. Sie belegen, dass die Waldorfpädagogik mit ihnen gemeinsame Momente hat, menschenkundlich aber ihren eigenen Weg geht.
1. Piagets Entwicklungspsychologie
Auf der Grundlage seiner durch die universitären Naturwissenshaften geprägten, komplexen und exzellent strukturierten Kenntnisse beobachtete Piaget (1896-1980) die seelische Entwicklung von Kindern und leitete daraus ein in vier Phasen/Stufen gegliedertes Entwicklungsschema ab, das hier in einer stark vereinfachter Form dargestellt wird:
1. Sensomotorische Phase (in den ersten zwei Lebensjahren): In dieser Phase versucht das Kind, sich über die Wahrnehmung und die daraus erfolgende Umweltanpassung bestimmte Denk- und Verhaltensschemata anzueignen. Durch diese tritt es mit seiner Umwelt in Interaktion. Ziel aller kindlichen Aktivitäten ist der Ausgleich zwischen den Umwelteinflüssen und den eigenen Bedürfnissen (Ginsburg/Opper, S. 49-94).
2. Präoperationale Phase (drittes bis siebtes Lebensjahr): das Denken ist noch mit „logischen Irrtümern“ behaftet. Es besteht zum Beispiel die Vorstellung, dass man sein Geschlecht wechseln kann, wenn man als Mädchen die Kleidung eines Jungen anzieht. Wahrnehmungen bestimmen unmittelbar das Vorstellen.
3. Konkrete Operation (achtes bis 11. Lebensjahr): Die Wahrnehmung wirkt sich nicht mehr unmittelbar auf die Begriffsbildung aus. Das Kind kann mehrere Dimensionen einer Situation erfassen und gedanklich verarbeiten – zum Beispiel Zahlen, Einstufungen, Serien (Dass., S. 149-233)
4. Formale Operation (12. bis 16. Lebensjahr): Mit dem Erreichen dieser Phase ist das Individuum in der Lage, Probleme aufgrund hypothetischer Voraussetzungen zu lösen: „Was wäre, wenn...“ Auch können sich die Schüler/innen logische Beweise für abstrakte Probleme ausdenken (Dass., S. 234-66 u. 267-326).
Unschwer erkennen wir die Phasen der kindlichen Entwicklung wieder, wie sie durch die Menschenkunde Rudolf Steiners schon Jahrzehnte vor Piaget dargestellt wurden.
Wenn man sich aber entschlösse, nach dem Modell Piagets seinen Unterricht zu gestalten, wäre man bei allem Respekt, den dieser Pädagoge dem Kinde zollt, der Gefahr ausgesetzt, die Schüler*innen als noch nicht vollkommene Erwachsene zu behandeln, die von der fatalen Bindung an ihre Sinne und den damit verknüpften magischen Vorstellungen zu befreien seien. Piaget hatte die Symptome der Entwicklung exakt beobachtet, die an die Entwicklung der Wesensglieder gekoppelten Ursachen blieben aber unentdeckt.
So können wir von Piaget das Erstellen einer gewissenhaften Symptomatologie lernen. Die sich daraus ergebenden menschenkundlichen Zusammenhänge erfahren wir indes bei Rudolf Steiner.
2. Die Montessori-Pädagogik
Nach Maria Montessori (1870-1952) gliedert sich die Entwicklung des Kindes und später des/der Jugendlichen in drei Phasen:
1. Kindheitsstadium (0 bis 6 Jahre)
2. Kindheitsstadium (6 bis 12 Jahre) und
Jugendalter (12 bis 18 Jahre)
Im ersten Kindheitsstadium (bis zu sechs Jahren) formen sich die Persönlichkeit und die Fähigkeiten des Kindes. Montessori versteht die ersten sechs Lebensjahre als eine zweite embryonale Wachstumsphase, in der sich Geist und Psyche des Kindes entwickeln. Dabei wird gerade das Alter von 3 bis 6 Jahren als jener Zeitraum gedeutet, in dem die zuvor aufgebauten intellektuellen, motorischen und auch sozialen Funktionen weiterentwickelt und in die Psyche eingeschrieben werden. Dieses Eingeschriebene ist für Montessori weitestgehend irreversibel.
Das zweite Kindheitsstadium (6–12 Jahre) bezeichnet Montessori als „stabile Phase“. Die Kinder können nun Wissen erwerben und ihre Erkenntnisinteressen individualisieren. Jedes Kind durchläuft sogenannte „sensible“ Phasen. In diesen Phasen ist es besonders empfänglich für bestimmte Anreize aus der Umwelt, zum Beispiel im Zusammenhang mit Bewegung, Sprache oder sozialen Aspekten. Findet das Kind dann eine Beschäftigung, die seine Bedürfnisse anspricht, kann es sich stark auf den Gegenstand konzentrieren. Es durchläuft einen Erkenntnisprozess, der nicht nur sein Denken, sondern seine gesamte Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflusst.
Montessori prägt für diesen Prozess den Begriff der „Normalisation“, d. h. dem Wiederherstellen der wahren positiven Möglichkeiten, über die das Kind von Natur aus verfügt, die aber bei einer unangemessenen Behandlung durch die Erwachsenen verbogen werden können.
Montessori leitete aus ihren Beobachtungen die Erkenntnis ab, dass der Zugang zum kindlichen Denken nicht auf abstraktem Wege, sondern über die Sinne erfolgt. Greifen und Begreifen werden zur Einheit im Lernprozess.
Aufbauend auf dieser Erkenntnis entwickelte Montessori ihre Lehrmaterialien, die vorrangig die Sinne ansprechen. U. a. ihr mathematisches Material erlaubt dem Kind, durch Berühren und Halten einer einzigen Perle, später dann eines Blocks aus beispielsweise 1000 Perlen einen sinnlichen Eindruck der mathematischen Größen von 1 bis 1000 zu erhalten – und zwar lange bevor das Kind ein abstraktes Verständnis für Zahlen dieser Größe entwickelt.
3. Das Jugendalter (12- 18 Jahre) führt wegen seiner physischen und psychischen Veränderungen zu einer tiefen Verunsicherung. Gleichzeitig entsteht das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Teilhabe. Die Jugendlichen möchten in sozialen Beziehungen leben, Verantwortung übernehmen und als unabhängige Persönlichkeiten ernst genommen werden. Montessori schlägt deshalb vor, ihnen Bereiche auf dem Lande zu schaffen, in denen sie das unabhängige Leben in Gemeinschaft erleben können. Dort sollen sie sowohl intellektuell lernen (und zwar auf einer abstrakteren Basis als in der vorhergehenden Lebensphase) wie auch praktisch arbeiten und die Erfahrung machen, Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen (vgl. Hedderich: Einführung in die Montessori-Pädagogik, S. 26-38). –
Fazit:
Während bei Piaget das Kind als ‚unfertiger Erwachsener‘ zur Erscheinung kommt, nähert sich Montessori dem Entwicklungsgedanken der Waldorfpädagogik stärker an, dringt aber nicht zu den menschenkundlichen Grundlagen vor.
Dennoch sollten wir die von Piaget gewonnenen Einsichten insbesondere zur Aneignung der Kulturtechniken berücksichtigen, da sie in vielen Bereichen das enthalten, was für einen bildgeleiteten Unterricht eine sehr gute Grundlage bildet. Piagets Entwicklungspsychologie hat – wenn auch verkürzt – deutliche Analogien zur anthroposophischen Menschenkunde. So enthalten die Schlüsse, die er aus seiner Didaktik zieht, wertvolle Hinweise für unsere Arbeit.
Ebenso sollten wir einen Blick auf die didaktischen Materialien der Montessori-Pädagogik werfen (Hedderich, S. 52-103). Was nämlich hier dem Kind vorgefertigt zur Sinnesverarbeitung gegeben wird, kann uns anregen, diese Materialien im Waldorfzusammenhang in Eigenarbeit gemeinsam mit den Schülern/innen herzustellen und dadurch den didaktischen Wert des Anschaulichen wesentlich zu steigern. So stapeln wir beim Hausbau Steine zu Reihen, Mauern (Fläche) und Kuben (Raum), um die Fertigkeiten im Multiplizieren zu vertiefen, zu erweitern oder erst einmal anzubahnen.
In diesem Sinne können wir, wie im Kapitel über die Didaktik noch ausgeführt wird, die Unterrichtsmaterialien in Geographie mit den Kindern gemeinsam anfertigen, um die sinnliche Erfahrbarkeit z. B. der Geomorphologie, später der Plattentektonik zu ermöglichen.
Die Frage nach dem menschlichen Geist
In anderen entwicklungspsychologischen Ansätzen finden wir unterschiedliche Vorstellungen von einem Informations- und Fertigkeitsvermittlungs-Input, der bei den Schülern/innen den gewünschten Wissens- und Fertigkeits-Output generieren soll.
Dabei herrscht die Tendenz vor, die Schüler/innen auf mehr oder minder geschickte Weise zu konditionieren. Und man fragt sich, welches Menschenbild in diesen Ansätzen lebt.
Wird der heutigen Psychologie, der Neurologie und der mit ihnen verknüpften pädagogischen Wissenschaft die Gretchenfrage nach dem menschlichen Geist gestellt, so verweisen sie auf die Tatsache, dass es so etwas wie geistige Fähigkeiten/Eigenschaften, aber kein Ich, also keinen autonomen Geist, gebe. –
Das Bewusstsein von einem Ich sei eine Illusion, die sich die menschliche Psyche als Zentrale zur Verarbeitung komplexer Eindrücke selbst schaffe – etwas, was offensichtlich funktioniert, aber nach Auffassung der Wissenschaftler nicht existiert. (vgl. Haeffner: Philosophische Anthropologie. Wulf: Anthropologie, Geschichte, Kultur, Philosophie)
Nun geht es nicht um eine Verteufelung der zur Zeit vorherrschenden Ansätze, sondern einerseits darum, Möglichkeiten einer Erweiterung dieser Auffassungen mit Hilfe der Menschenkunde Rudolf Steiners zu finden und andererseits das durch mechanische Intelligenzmodelle geprägte Denken aus seiner Befangenheit zu befreien und damit eine spirituell orientierte pädagogische Handlungskompetenz zu erlangen.
Denn über eines müssen wir uns im Klaren sein: Auch in fast jedem/r Waldorfpädagogen/in wirken die Strukturen einer materialistischen Denkweise; und je intensiver wir uns mit den Prinzipien der Waldorfpädagogik auseinandersetzen, desto deutlicher treten sie bei der Reflexion unseres pädagogischen Denkens und Handelns zutage:
Wer hat sich noch nicht bei der Vorstellung erwischt, dass die Kinder nun endlich mal „was Richtiges“ lernen sollen – z. B. in Religion die Propheten und Könige lückenlos aufsagen, in der Sprachlehre die grammatischen Regeln so beherrschen können, wie es der Wortlaut der vom Lehrer so schön ausgefeilten Regelsätze vorgibt usw.? Und die junge Kollegin wird mitleidig belächelt, „weil sie mit den Kindern Buchstabenformen bäckt, anstatt das Zeug ordentlich einzupauken. – Na ja. Es hat wenigstens gut geschmeckt…“
Selbst hinter mitreißenden Formationstänzen und künstlerisch gestalteten Liedern für die Anbahnung des Rechnens verbirgt sich vielleicht die knallharte materialistische Vorstellung, dass die Einmal-Eins-Reihen auf diese Weise besser im Gehirnkasten verankert werden.
So meinte ein Kollege nach gut 30 Jahren Oberstufenarbeit an einer Waldorf-Förderschule, er fühle sich seit einiger Zeit stärker zur modernen Hirnforschung hingezogen, weil diese effektivere Methoden zur gedächtnismäßigen Aneignung von Lehrinhalten anböte als die Waldorfschule. Deren Methoden seien für das Lehrpersonal zu anstrengend bzw. zu aufwändig.
In derartigen Aussagen spiegelt sich zumindest eine Irritation wider, die nach einer Standortbestimmung für die Waldorfpädagogik bedarf. Dazu ist die Auseinandersetzung mit der Unterrichtsmethode des Vierschritts durchaus geeignet.
Waldorfpädagogik in der digitalen Lebenswelt
Nun bezieht sich die klassische Waldorfpädagogik auf den historischen Kontext von 1919-24. Damals ging es um die Kompensation zivilisationsbedingter Defizite des Industriezeitalters:
-
Die Menschen waren aus ihrem natürlichen Zusammenhang des bäuerlichen oder handwerklichen Lebens herausgerissen. Insbesondere die ländliche Welt mit ihren spezifischen Rhythmen entfiel zugunsten einer von Arbeitsteilung geprägten Umgebung.
-
Damit waren die Menschen aus ihrem sozialen Kontext herausgerissen und fanden sich in der vom Militarismus geprägten Gesellschaft der wilhelminischen Kaiserzeit wieder.
-
Die industrielle Gesellschaft wurde von der religiösen Anbindung an Kirche und Glaube in den tradierten Formen herausgelöst und auf eine naturwissenschaftlich- materialistisch orientierte Weltanschauung ausgerichtet.
Waldorfpädagogik gab damals die entsprechenden Antworten, indem sie aus der anthroposophischen Menschenkunde eine Pädagogik entwickelte, die u. a. die verlorene Anbindung an die naturgegebenen Abläufe in der eigenen Entwicklung wie auch der Gesetzmäßigkeiten in der Natur nicht nur wiederherstellte, sondern auch in einen zeitgemäßen Kontext stellte. Wertvermittelnde Autoritäten, die im zweiten Lebensjahrsiebt noch die Rolle der Weltvermittler spielen, werden im dritten Lebensjahrsiebt durch Fachleute abgelöst, die bei der eigenständigen Herstellung einer Beziehung zu den Mitmenschen und der Welt beratend tätig sind.
Anstelle der vorindustriellen Ständegesellschaft tritt die im Geistesleben freie und auf der rechtlichen Ebene gleiche Schulgemeinschaft, die u. a. mit Blick auf die finanzielle Ermöglichung des Schulbesuchs das Prinzip der Brüderlichkeit pflegt. Hier wird Dreigliederung im Rahmen des Schullebens angestrebt bzw. praktiziert.
Anstelle der nicht zu hinterfragenden Autorität der Kirchen tritt die Beziehung der Lernenden und Lehrenden zur Welt, die als Emanation schaffender Kräfte erlebt wird. Waldorfschule ist in diesem Sinne religiös orientiert. Diese Orientierung wird aber nicht explizit beschworen und eingefordert, sondern implizit gelebt. So finden auch Menschen, die nicht an Gott glauben oder ihn suchen, hier ihren Platz.
Das waren die Antworten der Waldorfpädagogik auf die Herausforderungen der Industriegesellschaft. Eine digital dominierte Menschheit ist nun weiter reichenden Anforderungen ausgesetzt:
-
Anstelle der Welt der Erscheinungen, die selbst noch in einer arbeitsteiligen Maschinenwelt durch die Sinne erfahrbar und über das Vorstellungsleben deutbar wird, tritt die digitale Welt, die nicht mehr aktiv ergriffen werden kann, sondern in den Rezipienten eindringt. So werden beim Bildschirm die Bilder nicht mehr vom Auge abgegriffen, sondern sie entstehen auf der Netzhaut des Rezipienten. Die digitale Welt wird ein realer Bestandteil einer in uns lebenden Bilder-Welt, die sich zu einer Ersatz-Persönlichkeit konstituiert.
-
Durch die Algorithmen, die u. a. mit Hilfe von Cookies systematisch auf uns ausgerichtet werden, konstituiert sich diese Ersatz-Persönlichkeit. Den Rezipienten werden unendliche Möglichkeiten des Seins und Wirkens suggeriert. Sie sind aber nur ein Korsett, das unbeweglich macht und des freien Handelns beraubt.
-
Anstelle einer religiösen Anbindung entsteht eine Prädestination durch die virtuelle Realität der digitalen Welt. Sie liefert die Handlungsgebote wie auch die moralischen Prinzipien und nimmt dem Menschen die Möglichkeit, als freies Subjekt einer realen geistigen Welt beizuwohnen. Das, was Petrus bei der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor als Haus bzw. Adresse in der geistigen Welt anspricht, ist die Chance für jedes freie menschliche Individuum, einen Wohnsitz in der geistigen Welt einzunehmen. Dieser Wohnsitz reduziert sich in der virtuellen Welt auf die Internet-Adresse oder den Account.
Der digitalen Welt kann die Waldorfpädagogik durch
die Pflege der Sinne
die Pflege der Lebens- und Lernprozesse
einen bildgeleiteten Unterricht
und daraus resultierend mit dem Streben nach einem imaginativen Erleben der Welt begegnen.
Zur Erlangung dieser Ziele gab Rudolf Steiner Gertrud Langen eine Unterrichtsmethode, die auf alten spirituellen Traditionen aufbaut, aber pädagogisch ein neuer, gerade für unsere Zeit angemessener Griff ist.
Die netzartig uns umschließenden virtuelle ‚Realität‘ zu bekämpfen, wäre ein falscher Ansatz. Wir können ihr aber mit dem Vierschritt begegnen.
Schmidt, R.:Digitale Transformation gestalten, in: Perspectives in Inclusive Social Development, Heft 1, 2021, S. 28-44.
Würffel, N:E-Learning in Schule und Unterricht, in: Schulmagazin 3/2010, S. 5-10.
Zur Methodik
Die menschenkundlichen Grundlagen des Vierschritts
Die Entwicklung des Menschen in den ersten 28 Lebensjahren verweist auf jenen Weg, den wir zur Verlebendigung des Unterrichts erfolgreich beschreiten können. So unterscheiden wir folgende vier Entwicklungsphasen (Steiner: Die Erziehung des Kindes, GA 34, S. 4-10):
1. Im ersten Jahrsiebt lebt das Kind in der Wahrnehmung, die noch leibbildend wirkt; denn die Bilder, die ihm durch seine Umwelt gegeben werden, prägen sich über die Nachahmung unmittelbar in den Körper ein.
2. Im zweiten Jahrsiebt erobert das Kind für sich das Lernen. Sein „frei gewordener“ Lebensleib ermöglicht die Bildung eines umfassenden Gedächtnisses, mit dessen Hilfe das Kind bewusst erinnern kann. Nun ist es in der Lage, jene Bilder, die ihm angeboten werden, gezielt zu ergreifen und lebendig nachzuschaffen.
3. Im dritten Jahrsiebt können die Jugendlichen ihr Handeln, Fühlen und Denken in Beziehung zu ihren Mitmenschen und zur Welt setzen – sich an und in der Welt empfinden. Eindrücke, ob durch die sinnliche Wahrnehmung oder durch Gedanken gegeben, werden reflektiert und durch Analogieschlüsse und daraus resultierende Urteile in ihrem Wert eingestuft.
4. Mit dem 21. Lebensjahr will sich der Mensch der Welt als Individualität einprägen. Er kann nun sein Einzigartiges, Spezifisches dazu beitragen. Damit hat er die Stufe der aus dem Ich erwachsenen Kreativität erreicht (vgl. Gelitz, Strehlow: Lebensprozesse, S. 145-204).
Wenn man als Erzieher/in nun meint, im zweiten Lebensjahrsiebt stehe nur die Aneignung von Lerninhalten über das Gedächtnis an, ist man im Fahrwasser der alten ‚Einpauk-Pädagogik‘. Der Unterricht an Waldorf-Schulen greift in allen vier oben beschriebenen Phasen auf Vergangenes zurück, bahnt aber gleichzeitig dasjenige an, was sich noch entwickeln wird.
So wird die Lehrkraft im zweiten Jahrsiebt einerseits auf das im Vorschulalter erworbene Bilderbewusstsein des Kindes zurückgreifen und daran anknüpfen, zum anderen als Repräsentant des Weltgeschehens auf das ‚hinweisen‘, was in der Entwicklung noch folgen wird. Konkret bedeutet das:
Unbefangenes Wahrnehmen, wie es im ersten Jahrsiebt gelebt wird, ist die weiterhin bestehende Voraussetzung für ein reguläres Lernen, später aber auch für ein gesundes Urteilen und eine daraus erwachsende Kreativität.
Die Aneignung von Kenntnissen führt die Schüler*innen im zweiten Schritt zu dem, was ihrem Alter entsprechend eigenständig erlernt werden kann.
Die Reflexion des erworbenen Wissens verweist schon auf das dritte Jahrsiebt. Sie wird durch die Autorität der Lehrperson angeleitet bzw. ‚vorverdaut‘.
Aus dem Gefühl, sicher begleitet zu sein, geht das Kind schließlich aus eigener Motivation den vierten Schritt zur kreativen Hervorbringung eigener Ideen und künstlerischer Leistungen zu. Beispielsweise formuliert es Rätsel, entwirft Aufsätze und Rechenaufgaben, bringt eigenständige künstlerische Erzeugnisse hervor – aber all das in einem Milieu, das von den Lehrpersonen geschaffen ist.
Im Folgenden wird zu untersuchen sein, inwieweit diese Vorgehensweise für den Unterricht praktikabel ist und zu den gewünschten Ergebnissen führt - unter anderem zur Förderung der Kreativität bei Kindern und Jugendlichen.
Zum Begriff des Vierschritts
In der frühen Neuzeit begegnet uns der Vierschritt erstmalig in der Geistlehre des Kirchenreformers und Philosophen Nikolaus Cusanus (1401-64). Dieser entwickelte einen von der Liturgie abgeleiteten vierstufigen Weg zur Erkenntnis, der auch als umgekehrter Kultus aufzufassen ist (vgl. Meffert: Nikolaus von Kues, S. 229-63.)
Während durch die Liturgie (die Abfolge der Messe) das Wesen Gottes zum Menschen geholt/‘heruntergebeten‘ wird, erhebt der Mensch im umgekehrten Kultus seine Geistseele zu Gott. Die Stufen/Schritte der Liturgie und des umgekehrten Kultus stehen in folgender Beziehung zueinander:
1. Der Verkündigung in der Eucharistie stellt Cusanus die Wahrnehmung gegenüber.
2. Der Opferung entspricht der Bildung einer Erinnerungsvorstellung – gleichsam als Opferung der Wahrnehmung.
3. Der Wandlung in der Eucharistie entspricht das Verstehen von Begriffszusammenhängen. Die Erinnerungsvorstellungen werden in Begriffskomplexe eingegliedert. Dadurch verwandeln und erweitern sich die Begriffe, indem sie mit übergeordneten und/oder neuen Zusammenhängen in Beziehung gebracht werden.
4. Der Kommunion steht das durch Erkenntnis gegründete Erleben und aktive Mitgestalten der weisheitsvollen Zusammenhänge im Kosmos gegenüber. Das, was ich wahrgenommen und verwandelt habe, regt meine schöpferischen Ressourcen an und führt zur Hervorbringung neuer Welterscheinungen, die sich dem Weltganzen harmonisch eingliedern. So entstehen u.a. Kunst und Wissenschaft.
Kultus der Messe
Umgekehrter Kultus als Weg der Erkenntnis
Verkündigung
Wahrnehmung
Opferung
Begriff/Erinnerungsvorstellung
Wandlung
Begriffserweiterung/ Begriffskomplexe
Kommunion
Schaffen neuer Weltinhalte
In dieser Hierarchisierung der Aktivitäten des menschlichen Geistes erkennen wir unschwer die menschenkundlichen Prinzipien der Anthroposophie wieder. Sie sind gleichermaßen eine Blaupause für daraus abzuleitende pädagogische Prinzipien.
Zur Pädagogik Gertrud Langens
Die Erzieherin Gertrud Langen (1903-73) stand nun vor der Aufgabe, für die Erziehung Sandroes (6./7. Vortrag des HPK) eine wirkungsvolle Unterrichtsmethode zu entwickeln. Der damals neunjährige Junge stand seit 1923 in der Obhut des Klinisch-Therapeutischen Instituts (Arlesheim).
Neben einer ausgeprägten Schwäche in der Wahrnehmungsverarbeitung litt der Junge unter Schwefelarmut bzw. Eisenreichtum. Sandroe verlor sich in Zwängen und fand kein Interesse an seiner Umgebung. Selbst nach einem Jahr Aufenthalt im Klinisch-Therapeutischen Institut war ein regulärer Unterricht für Sandroe noch nicht möglich.
Frau Langen gelang es erst durch die Einführung des Vierschritts nach zwei weiteren Jahren, dass Sandroe regulär lernen konnte. Ihre Unterrichtsmethode stellte sie in der Zeitschrift Natura 1926/27 (hg. v. Ita Wegmann) unter dem Titel „Ein Beispiel individueller Erziehung nach heilpädagogischen Richtlinien“ vor (S. 153 ff., zit. bei Uhlenhoff S. 31-40). Da der Begriff des Vierschritts von ihr nicht verwandt wurde, sind die Stufen ihres Vorgehens in dieser Veröffentlichung durch Überschriften nachträglich kenntlich gemacht:
1. Das Bild:
„Dr. Steiner hatte mich persönlich noch darauf verwiesen, gerade an dieses Kind (Sandroe, d. Verf.) im Unterricht alles in bildhafter Form heranzubringen. Diesen Wink lernte ich immer besser zu verstehen. Denn da war das Seelisch-Geistige, das sich in die starre Körperlichkeit nicht hineinfinden wollte, das unruhig, ziellos um das Kind herumwogte.
Gelang es mir nun, dass ich in bildhafter Art dem Jungen etwas erzählte, (…) so entließ ich ein geordnetes Seelisch-Geistiges, das den Weg zum Leibe dann auch besser finden konnte. Freilich erforderte es einen Zeitraum von zwei Jahren, bis dieses Kind (…) wirklich innerlich mitging.“
2. Das Bild, in Bewegung gebracht/ Gehen, Sprechen, Denken
„Aber war nun etwas damit erreicht, wenn der Junge lauschend einer Geschichte folgen konnte? – Es handelte sich jetzt (Rudolf Steiner war damals schon verstorben, Anm. d. Verf.) darum, ihn mehr zur Selbststätigkeit zu bringen, nicht nur auf dem Gebiete des Malens, Zeichnens oder Handwerkes, sondern auch auf dem Gebiete der Sprache. Vor dieser Selbsttätigkeit hatte er große Abneigung, ja Angst.
Da fand ich Hilfe durch einen wichtigen Aufschluss, den uns Rudolf Steiner (…) gegeben hat. Beim kleinen Kinde, so erklärte er, entwickelt sich das Sprechen in gesunder Weise aus dem Gehen und Greifen, aus dem ganzen Gestenerleben des Kindes (…). Und wiederum blitzt das Denken erst im Sprechen auf, so dass man die Reihenfolge festhalten muss: Gehen, Sprechen, Denken. Diese Reihenfolge hatte nun bei dem Knaben nicht stattgefunden. Es galt, etwas nachzuholen, was damals versäumt worden war.
Das konnte ich dadurch erreichen, dass ich das Kind die Geschichten, die es mir erzählen sollte, erst dramatisch darstellen ließ. In seinem ganzen Körper, in seinen Gliedern musste er das zu Erzählende erst erleben. So führten wir denn eine leichte Geschichte zu seiner hellen Begeisterung auf. Es war die bekannte Fabel vom Fuchs, der den Storch zu Gast lädt. Er war der Fuchs, ich der Storch, einmal tauschten wir auch die Rollen, damit er sich in jeder Gestalt erleben konnte. (…)
Ich machte mir einen langen Schnabel, band ihn vor den Mund, ihm etwas Schnauzenartiges, dann musste er den Tisch mit flachen Tellern, auf die wir Blätter legten, decken. Er musste bei mir anklopfen, mich zu Gast laden, und wir setzten uns hin. Nun erlebte er, wie ich mit meinem Schnabel auf dem flachen Teller herumfuhr, die Blätter in die Luft warf und schimpfend davonging. Danach kam er zu mir, und nun konnte wiederum er seine dicke Schnauze nicht in die enge Flasche hineinzwingen, während ich mit meinem Schnabel hineinfuhr und die Flasche in die Luft hob.
(…) Nachdem wir die Fabel etwa zehnmal aufgeführt hatten, (…) konnte er sie auch einigermaßen zusammenhängend wiedergeben. Wir führten nun allmählich beinahe alle unsere Geschichten in dieser Art auf, später sogar Siegfrieds Tod oder den Kampf zwischen Lohengrin und Telramund, so dass er dann auch diese menschlichen Vorgänge erzählen lernte.“
3. Reflektiertes Bild, hier: Rätsel raten
„Waren es diese dramatischen Darstellungen, die dem Knaben halfen, seinen astralischen Leib mehr in seine Körperlichkeit hereinzubekommen, so konnte ich erleben, wie beim reinen Gedankenschaffen auch sein Ich sich immer mehr mit ihm verband. Hierzu möchte ich Folgendes erzählen:
Ich hatte schon, nachdem der Junge ein gewisses Alter erreicht hatte, wiederholt Versuche gemacht, ihn zum selbsttätigen Denken zu bringen. Ich hatte versucht, mit ihm zu rechnen, es aber fürs erste wieder fallenlassen müssen, es war zu wenig bildhaft für dieses Kind. Aber mit etwas anderem gelang es mir, ihn zu einem schaffenden Gedankenerlebnis zu bringen, das war mit dem Rätselraten.
Als der Junge einmal in Zürich Dampfer gefahren war und mir begeistert davon erzählte, stellte ich ihm nach einiger Zeit die Frage: ‚Was fährt auf dem Wasser, es ist kein Fisch und auch kein Vogel, und manchmal stößt es einen lauten Schrei aus?‘ Nach einer Weile riet der Junge jubelnd den Dampfer. Ich bildete nun viele Rätsel dieser Art, sie mussten natürlich alle bildhaft und höchst primitiv sein. Ich merkte, in meinem Schüler war etwas wie ein Staunen, das man so beschreiben kann: Man kann also von einem Dampfer auch so sprechen, dass er einen lauten Schrei ausstößt, kein Fisch und auch kein Vogel ist.“
4. Kreatives Bilderzeugen, hier: Rätsel stellen
„Bald kam er denn nun darauf, dass er mir auch Rätsel aufgeben wollte. Damit erwachte er zu innerer Selbsttätigkeit. (…) Vor uns brannte eine hohe Kerze. Sein Blick fiel darauf. Er rief: ‚Du, was ist das, es ist eine Kerze…‘, aber da wurde er unsicher, ein plötzliches Erschrecken malte sich auf seinem Gesicht. Er merkte: So kann man die Sache nicht machen.
Er stotterte, tastete mit der Hand. Ich zitterte innerlich: Wird er’s können? Aber ich musste ihn ja allein lassen. Da blitzte es plötzlich in seinen Augen auf wie eine Befreiung, der ganze Gesichtsausdruck veränderte sich, er rief:
‚Was ist das, es ist hoch, weiß, oben drauf brennt eine Flamme? ‘ Ich rief: ‚Die Kerze! ‘“
Frau Langens Fazit
„Die Wege, die man beschreiten muss, um Kindern zu helfen, die seelisch-geistig zurückgeblieben oder belastet sind, kann man nur in gemeinsamer Arbeit mit dem Kinde selbst finden. Nie kann man sich etwas vorher zurechtlegen, nie eine allgemeine Norm für die Behandlung aufstellen.