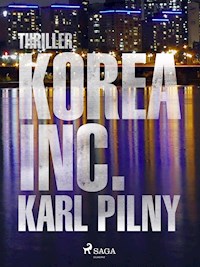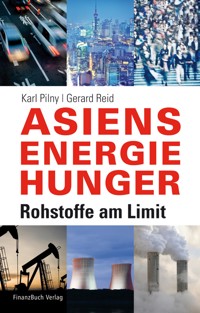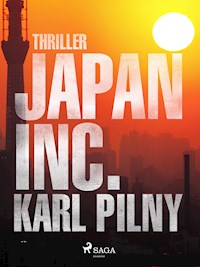
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die politische und moralische Katastrophe Japans gespiegelt im nuklearen GAUEinzigartige Mischung aus hochbrisanten Fakten, topaktuellen Ereignissen und beklemmend realistischer FiktionAtomenergie, bakteriologische Kampfmittel, die japanische Mafia der Yakuza, eine Geiselnahme im Shanghai World Financial Center – wir schreiben das Jahr 1 nach der Katastrophe von Fukushima im März 2011. Die alte Rivalität zwischen Japan, China und Korea findet durch die Tatsache, dass sich Nippon nach Fukushima noch schneller im Sinkflug befindet, neue Nahrung und befeuert den Nationalismus auf allen Seiten. Karl Pilny ist mit diesem Buch ein Politthriller der Extraklasse gelungen.Während eines Empfangs im spektakulären Wolkenkratzer des Shanghai World Financial Center bringen chinesische Studenten 300 Geiseln in ihre Gewalt, um auf die noch immer ungesühnten japanischen Kriegsverbrechen in Nanking 1937 und im Zweiten Weltkrieg aufmerksam zu machen. Insbesondere wollen sie auf die Menschenversuche der ominösen "Einheit 731" hinweisen, deren Forschungsergebnisse bis heute Verwendung finden. Welche Rolle spielen hierbei die Waguni, ein verschwörerisches Netzwerk aus Wirtschaftsführern, Teilen des Militärs und nicht zuletzt der mächtigen Yakuza in Japan? Die Welt steht am Rand einer militärischen Eskalation. Nur der Anwalt Jeremy Gouldens, der eigentlich seine verschleppte Liebe, Cathy Wong, aus den Klauen der Mafia befreien will, kann sie aufhalten.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 990
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Pilny
Japan Inc.
Thriller
Saga
Alles ist in uns selbst vorhanden
Meng Tse
Prolog
Die vier Chinesen, die am 1. Mai des Jahres 2012 kurz vor 02:30 Uhr morgens den Haupteingang des Shanghai World Financial Centers an der Century Avenue betraten, wurden vom Facility Manager bereits sehnlichst erwartet. Sie waren mit Overalls der deutschen Firma »ThyssenKrupp Elevator« bekleidet und trugen, wie es Vorschrift war, Montagehelme aus Polycarbonat, auf denen ebenfalls das Firmenlogo prangte. Es handelte sich um einen Wartungstrupp, bestehend aus einem Ingenieur und drei Mechatronikern. Die Techniker hatten zwei schwere Werkzeugkoffer sowie ein Mini-Laptop dabei. Sie waren etwa acht Minuten zuvor alarmiert und vom Facility Manager persönlich über die Störung informiert worden. Anscheinend steckten zwei Gäste des zweithöchsten Hotels der Welt in einem Fahrstuhl zwischen der 93. und der 94. Etage fest. Es handelte sich allerdings nicht um einen hoteleigenen Aufzug des Park Hyatt. Genaueres ließ sich nicht sagen, da die eingebaute Überwachungskamera offenbar ausgefallen und auch die Notrufleitung seit dem ersten Hilferuf unterbrochen war. Das alles ließ auf ein größeres technisches Problem schließen.
Die vier Männer passierten die Sicherheitsschleuse ohne Beanstandung, die Metalldetektoren blieben stumm. Ihre Namen auf den elektronischen Firmenausweisen stimmten mit der vorliegenden Personenliste überein. Die holografischen Porträtfotos ebenfalls. Daraufhin wurden die Werkzeugkoffer und das Mini-Laptop nur oberflächlich untersucht.
Die gesamte Sicherheitskontrolle dauerte kaum zwei Minuten. Danach bestiegen die Techniker in Begleitung des nervösen Facility Managers einen der insgesamt vier Doppeldecker-Fahrstühle, die von ThyssenKrupp Elevator eigens für das World Financial Center entwickelt worden waren. Sobald sich die aerodynamisch geformten Türen geschlossen hatten, wurden die fünf Männer mit einer Geschwindigkeit von zehn Metern pro Sekunde nach oben katapultiert – im schnellsten Aufzug der Welt.
Als sie einige Tage später von chinesischen Sicherheitsbeamten befragt wurden, konnte sich keiner der Mitarbeiter des Wachpersonals, die in dieser Nacht Dienst gehabt hatten, an irgendwelche Auffälligkeiten erinnern. Die vier einheimischen Mitarbeiter des deutschen Konzerns seien absolut glaubhaft und souverän aufgetreten. Im Übrigen habe man während der dreijährigen Planungs-, Fertigungs- und Montagephase, in der ThyssenKrupp Elevator für den Einbau von über 40 verschiedenen Anlagen im gesamten Gebäude verantwortlich gewesen war, stets ausgesprochen gute Erfahrungen mit den Mitarbeitern des Unternehmens gesammelt. Ja, der Publikumsverkehr sei an jenem frühen Morgen vielleicht etwas stärker gewesen, als zu solch nachtschlafender Stunde gemeinhin üblich, was jedoch aufgrund der zahlreichen anstehenden gesellschaftlichen Ereignisse im Haus zu erwarten gewesen sei. Nein, die routinemäßige Sicherheitsüberprüfung sei trotzdem streng vorschriftsmäßig durchgeführt worden. Ja, absolut korrekt und vorschriftsmäßig. Nein, es habe wirklich auch nicht die leisesten Hinweise auf etwaige terroristische Absichten oder Ähnliches gegeben. Selbstverständlich nicht.
Es dauerte keine zwei Minuten, bis die Männer ihren Einsatzort im 94. Stockwerk erreicht hatten. Hier oben befindet sich die knapp 800 Quadratmeter große »Sky Arena«. Hunderte von Metern über den großen Konferenzsälen in den niedrigeren Etagen gelegen, ist diese höchste Veranstaltungsplattform der Welt exklusiven Anlässen wie den festlichen Banketten der chinesischen und internationalen Hautevolee oder der werbewirksamen Präsentation neuer Luxusprodukte vorbehalten. Hier sollten, auf Einladung der Moto Corporation, drei Tage später rund 200 Persönlichkeiten aus der internationalen Politik- und Geschäftswelt zusammenkommen, wenn die Firma ihren Festempfang zu Ehren ihres Präsidenten Minato Moto gab. Dieses Event, das mehr oder weniger zufällig zeitgleich mit der Eröffnung der großen ostasiatischen »New Energy Conference« in den Konferenzräumen viele Etagen tiefer stattfinden sollte, wurde als eines der wichtigsten gesellschaftlichen Großereignisse des Jahres 2012 im World Financial Center gehandelt.
Schließlich war die Moto Corporation für das Shanghai World Financial Center nicht irgendein Unternehmen – sie hatte es gebaut. Elf Jahre nach dem ersten Spatenstich und nach so manchen Problemen und zwischenzeitlichen Unterbrechungen konnte die japanische Firma im Sommer 2008 endlich den erfolgreichen Abschluss der Bauarbeiten vermelden. Die wahren Kosten waren geheim gehalten worden, die Schätzungen reichen von »etwa 875 Millionen« bis »weit über 1,5 Milliarden US-Dollar«. Auf jeden Fall ist das SWFC ein Bauwerk der Superlative. Mit seinen 492 Metern dominiert der schlanke, komplett verspiegelte Turm die spektakuläre Skyline der Pudong New Area: jenes gigantischen Stadtteils aus der Retorte, der seit 1990 in atemberaubender Geschwindigkeit aus dem Boden gestampft worden ist. Wo 20 Jahre zuvor noch sumpfiger Ackergrund war, leben und arbeiten inzwischen mehr als drei Millionen Menschen. Mit dem »Oriental Pearl«-Fernsehturm, dem Jin Mao Tower, der Börse und dem Pudong New International Airport beherbergt Pudong alle neuen Wahrzeichen der wiedererweckten »Stadt über dem Meer« – denn nichts anderes bedeuten die chinesischen Schriftzeichen »Shanghai«. Auch wenn das zeitgleich errichtete »Taipeh 101« auf Chinas »abtrünniger Provinz« Taiwan dem SWFC knapp den Rang abgelaufen hat, ist es immerhin das höchste Haus auf dem ostasiatischen Festland. Die zahlreichen Störungen während der langen Bauphase hatten zum Teil auch politische Gründe – kein Wunder, wenn ausgerechnet ein japanischer Konzern ein chinesisches Bauwunder errichten soll. So hatten die Architekten, um den in knapp 500 Metern Höhe oft starken Winden weniger Angriffsfläche zu bieten, zwischen 93. und 97. Stockwerk ursprünglich einen kreisrunden Durchlass vorgesehen. Doch dieser Entwurf erinnerte vor allem die chinesischen Patrioten fatal an eine aufgehende Sonne. Die japanische Nationalflagge! Nach allerlei wütenden revanchistischen Protesten musste der Entwurf geändert werden. Jetzt krönt ein trapezförmiger Durchlass zwischen 96. und 100. Stockwerk das elegante Gebäude. So kam das Shanghai World Financial Center zu einem wenig charmanten Spitznamen: Flaschenöffner.
Letztendlich hatte die Moto Corporation durch den Riesenbau aber doch ein deutliches Zeichen der japanischen Präsenz auf dem asiatischen Kontinent gesetzt. Ein unübersehbares Zeichen! Und das ließ da und dort alte Wunden erneut aufbrechen, die eigentlich nie so richtig vernarbt waren. Japanische Aktivitäten auf chinesischem Boden hatten für China in der Vergangenheit selten Gutes bedeutet. Nanking war nicht vergessen. Nanking durfte niemals vergessen werden.
Aus Furcht vor terroristischen Attacken – ob nun von nationalistisch-revanchistischer, fundamentalistischer oder anderer Seite – war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York das Sicherheitskonzept für das in Bau befindliche Gebäude gründlich überdacht und verbessert worden, was entsprechend die Baukosten noch einmal deutlich in die Höhe getrieben hatte. Doch der Mehraufwand hatte sich ausgezahlt: Man war in Shanghai nun überzeugt, mit dem SWFC den sichersten Wolkenkratzer der Welt zu haben.
In den Verhören durch Beamte der chinesischen Geheimpolizei einige Tage später erinnerte sich Facility Manager Herr Shi, dass die Techniker als Erstes eine Telefonverbindung in die stecken gebliebene Aufzugskabine hergestellt hatten. Wenn sie nun erleichtert waren, so ließen sich die vier Männer das mit keiner Miene anmerken. Auch die Stimmen der beiden Eingeschlossenen hätten vor allem ruhig und gefasst geklungen.
Offenbar hatte es einen Kurzschluss gegeben, der das automatische Bremssystem auslöste. Nachdem man sich davon überzeugt hatte, dass für die beiden Hotelgäste in der Kabine keine Gefahr bestand und man sie in wenigen Minuten würde befreien können, bat der Ingenieur, der das Laptop mit sich führte, den Facility Manager höflich, ihn kurz in die Steuerungszentrale im 24. Stock zu begleiten, wo sich auch der zentrale Kontrollraum für die Aufzugsanlagen befindet. Es sei unbedingt erforderlich, die betreffenden Strom- und Anschlusskreise schnellstens auf eventuelle Fehler zu überprüfen – gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Großveranstaltungen, zu denen man so viele Gäste erwartete. Dazu ließe es sich leider nicht vermeiden, die beiden nebeneinanderliegenden Aufzugsschächte zwischen dem 79. und 100. Stockwerk für etwa drei Minuten komplett außer Betrieb zu nehmen. Ob sich dies vielleicht rasch und diskret bewerkstelligen ließe? Solch peinliche Pannen wie ein stecken gebliebener Aufzug sollten sich schließlich keinesfalls wiederholen.
Während der intensiven Verhöre sollte sich der Facility Manager auch daran erinnern, dass sich die angeblichen Mitarbeiter des Wartungstrupp untereinander kaum unterhalten hatten. Auch sei kein einziger Name gefallen. Er habe sich auf die Bitte des IT-Spezialisten hin mit ihm nach unten begeben und könne daher keine genaueren Aussagen über die Arbeiten machen, die die Mechatroniker während seiner Abwesenheit am Aufzug erledigt hatten. Soviel er wisse, sei auch keiner der Wachmänner direkt vor Ort gewesen. Und als er hinterher das Ergebnis ihrer Tätigkeit inspiziert habe, war alles bereits wieder wunschgemäß instand gesetzt. Nur als es den drei Mechatronikern gelungen war, über die Notausstiegsluke der Fahrstuhlkabine zu den Eingeschlossenen vorzudringen, habe es einen kurzen telefonischen Kontakt gegeben. Außerdem habe der IT-Spezialist, sobald er sein Laptop im Kontrollzentrum verkabelt hatte, seine drei Kollegen knapp darüber informiert, dass nun die Energiezufuhr für die abgesprochenen drei Minuten unterbrochen werde, damit er sein Fehlerdiagnoseprogramm durchführen könne. Bald darauf hätten sie sich beide gemeinsam wieder auf den Rückweg in den 94. Stock gemacht. Ja, bei den beiden Befreiten habe er sich persönlich entschuldigt. Das seien sehr höfliche und verständnisvolle Männer gewesen, die sich nach dem Schock zu ungastlicher Stunde verständlicherweise rasch auf ihre jeweiligen Zimmer zurückgezogen hätten. Was sie mitten in der Nacht mit ihren grauen Anzügen und schwarzen Köfferchen, die sie wie Vertreter aussehen ließen, ausgerechnet im Stockwerk über der höchsten Hoteletage zu schaffen gehabt hatten, habe er sie nicht gefragt. Er habe sich auch keine Gedanken darüber gemacht. Nein, es habe keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die beiden Männer im Fahrstuhl und die vier von der Wartungstruppe sich bereits gekannt haben könnten.
Von den Ergebnissen des Abschlussberichts der chinesischen Polizei wurden zweifellos nicht alle Details an die Öffentlichkeit weitergegeben. Möglicherweise hatten die beiden Männer im Fahrstuhl einen speziell manipulierten Elektroschocker benutzt, um den entscheidenden Kurzschluss auszulösen, der das automatische Bremssystem des Aufzugs aktiviert und die Elektrik des Fahrstuhlschachtes lahmgelegt hatte. Das Gerät könnten sie, zusammen mit den Sprengkörpern, leicht in ihren Musterkoffern transportiert haben. Fest steht, dass die vier etwa handtellergroßen Haftminen, mit denen die Aufzüge bestückt wurden, jeweils mit einem starken Magneten sowie einem kleinen Funkempfänger versehen waren, über den die Zündung ausgelöst werden konnte. Weniger Klarheit herrscht hinsichtlich der Frage, wie die Männer die Zünder am oberen Rand der Laufschienen der Fahrstuhltüren im 94. Stockwerk angebracht hatten. Und zwar in beiden Fahrstuhlschächten. Möglicherweise hatten sie die drei Minuten, in denen der Facility Manager auf Bitten des IT-Spezialisten die Fahrstühle außer Betrieb genommen hatte, dazu genutzt, um von dem einen Schacht in den danebengelegenen zweiten zu gelangen. Um an den Verstrebungen der Wände hinüberzuklettern, bedurfte es allerdings eines außerordentlich geschickten, durchtrainierten und minutiös vorbereiteten Mannes, der gewillt war, eine nicht nur lebensgefährliche, sondern offenbar auch recht schmerzhafte Kletterpartie auf sich zu nehmen – dass sich an den messerscharfen Kanten einer der weniger stark zerstörten Querstreben Spuren von Blut entdecken ließen, sprach jedenfalls für die Richtigkeit dieser nicht unumstrittenen Hypothese.
Alle etwaigen weiteren Erkenntnisse halten die chinesischen Behörden nach wie vor unter Verschluss. So ist zum Beispiel völlig unbekannt, was aus den vier chinesischen ThyssenKrupp-Mitarbeitern geworden ist. Ein wenig mehr weiß man über das mysteriöse Verschwinden der beiden aus dem Fahrstuhl befreiten Hotelgäste: Es handelte sich um zwei Japaner, die noch am gleichen Tag ausgecheckt hatten und in ihr Heimatland zurückgeflogen waren. Offenbar waren sie unter falschen Namen im Park Hyatt abgestiegen, denn beim Versuch weiterer Ermittlungen in Japan verlor sich schon bald ihre Spur.
Erster Teil
Die Sendung
1. Tag
Shanghai, 1. Mai 2012. 17:00 Uhr
Am ersten Nachmittag im Mai herrschte am Bund, der berühmten Uferpromenade der südchinesischen Metropole, wie üblich ein reges Treiben. Vermutlich war das Treiben sogar noch reger als üblich. Aus den imposanten Bank- und Geschäftsgebäuden am breiten Boulevard strömten Menschen um Menschen und fluteten in hektischem Gewimmel die Gehsteige und Seitenwege hinab. Nebenan auf der zehnspurigen Fahrbahn brummte der Verkehr. Autos hupten, Motoren heulten, Fahrer fluchten oder ergaben sich seufzend in die unabänderliche Tatsache, dass im unerbittlich anrollenden Verkehrsaufkommen der Rushhour ohnehin nur Stop and Go möglich war – wie sehr man auch hupen und fluchen mochte.
Vor den monumentalen Kulissen der Prachtbauten im Kolonialstil wirkten die wogenden, schnatternden und brummenden Massen, die namenlos die Straßen und Plätze bevölkerten, wie wimmelnde Ameisen. Wie Ungeziefer. Irgendein übermenschliches Wesen einer höheren Existenzform könnte auf die Idee kommen, dass man über dieses lästige, wertlose Ungeziefer nur das entsprechende Gift zu sprühen bräuchte, um es ein für allemal loszuwerden. Dann würde plötzlich gespenstische Ruhe einkehren in den Straßen und Häusern dieser eben noch vor Leben strotzenden Stadt …
Es war ein sonniger Tag. Auf der eigentlichen Promenade, direkt am Wasser des träg dahinfließenden Huangpu mit Blick auf die futuristisch aufragende Skyline des neuen Stadtviertels Pudong am anderen Ufer gegenüber, waren neben spazierenden Touristen und eilenden Geschäftsleuten wie immer auch zahlreiche Jogger unterwegs. Unter ihnen besonders viele »Langnasen« – Geschäftsleute aus Europa und Amerika, die seit der Öffnung Chinas zu Zehntausenden in die fernöstliche Boomtown geströmt waren und in ihrer raren freien Zeit versuchten, sich fit zu halten.
Der durchtrainierte, etwa vierzigjährige Läufer, der mit elastischen Sätzen den Bund entlangschnellte, hatte für die kurzatmigen abendländischen Freizeittraber nur ein verächtliches Lächeln übrig. Er hätte als Japaner durchgehen können, auch wenn er für einen Japaner wohl etwas überdurchschnittlich groß gewachsenen war. Immerhin war er im japanischen Osaka geboren und aufgewachsen, doch sein Name – Kim Park – verwies auf seine wahre Herkunft: Kims Eltern stammten aus dem nördlichen Korea und gehörten zu jenen etwa zweieinhalb Millionen Koreanern, die während der japanischen Besatzungszeit auf Nippons Inseln verschleppt und zur Zwangsarbeit verdammt worden waren. Etwa 700000 von ihnen – darunter auch Kims Großeltern – waren nach der Kapitulation des Kaiserreichs im August 1945 in Japan geblieben, wo ihnen der erhoffte gesellschaftliche Aufstieg indes meist versagt blieb. Kim Park war, nach vielen Umwegen, einer der wenigen Japan-Koreaner, die es geschafft hatten. Doch dafür hatte er einen hohen Preis gezahlt.
Während die meisten der europäischen Langnasen und »Butterstinker«, an denen der Koreaner wie selbstverständlich vorbeizog, in der abgasgeschwängerten Luft der Industriemetropole schon bald nach Sauerstoff japsten, wirkte Kim wie ein ausgeruhter Athlet, der sich aufwärmte. Dass er gerade erst ein hartes, sechzigminütiges Taekwondo-Training absolviert hatte, war ihm beim besten Willen nicht anzumerken. Bis zum Kerry Center an der Nanjing Xi Lu, wo er, nur einige Stockwerke über seiner kleinen Filmproduktionsfirma, in der 30. Etage in einem Penthouse residierte, hatte er noch etwa vier Kilometer vor sich. Ein Klacks.
Kim erhöhte die Schrittfrequenz, als er auf die Nanjing Lu einbog, die turbulente Hauptgeschäftsstraße und pulsierende Lebensader der Stadt. Doch er hatte keinen Blick für die bunten Leuchtreklamen, die aggressiven Straßenhändler und die Scharen von Shoppern, Schaufensterbummlern und Touristen, die Chinas bedeutendste Einkaufsmeile bevölkerten. Er schielte auf den Pulsmesser an seinem schlanken Handgelenk und tat das, was ihm beim Laufen immer schon am leichtesten gefallen war: nachdenken.
Den ganzen Tag schon drehten sich seine Gedanken nur um zwei Dinge. Das eine war eine aufregende Frau, die ihn für heute Abend eingeladen hatte. Das andere war ein aufregendes Drehbuch, dessen Exposé und Anfangsszenen ihm – wie er meinte – zugespielt worden waren. Der Arbeitstitel dieses Werks lautete Yellow Submarine, aber der Inhalt hatte nichts mit dem gleichnamigen Film jener vier Pilzköpfe aus dem fernen Liverpool zu tun. Als Autor firmierte ein gewisser Julian Peek. Kim Park hatte gründlich recherchiert und war zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich bei diesem Namen um ein Pseudonym handeln musste. Kein Einziger der ihm bekannten Filmagenten hatte jemals von einem Drehbuchautor namens Julian Peek gehört – und Kim, der seit fast zehn Jahren in diesem Geschäft unterwegs war, kannte viele Agenten. Selbst die ihm bis dato unbekannte, gutaussehende Agentin mit der sinnlichen Stimme, die einige Tage zuvor unangemeldet in sein Büro geplatzt war, hatte ihm außer dem Filmstoff nur eine gefälschte Visitenkarte hinterlassen.
Kim Parks filmische Produktion ruhte im Wesentlichen auf zwei Säulen: Zum einen produzierte er in Zusammenarbeit mit mehreren großen amerikanischen und britischen Werbeholdings Commercials für den ostasiatischen Raum. Das war sein Brot-und-Butter-Geschäft, mit dem er ganz gut über die Runden kam. Zum anderen hatte er an einer Sendereihe filmisch aufbereiteter Interviews mit asiatischen Berühmtheiten gebastelt: vom thailändischen Punkmusiker mit Drogenproblemen über den provokanten koreanischen Installationskünstler bis hin zum chinesischen Anwalt, der sich für die Rechte der Wanderarbeiter einsetzt. Ihre minimalistische Machart war das Markenzeichen dieser Porträts, die sich unter den seriösen Redakteuren der großen TV-Anstalten mittlerweile eine treue Fangemeinde erworben hatten. Als Interviewer konnte er unbequem werden, wobei er aber stets fair zu bleiben versuchte und eine asiatische Zurückhaltung übte. CNN Asia hatte sich schließlich dazu durchgerungen, dem Newcomer einen Exklusivvertrag anzubieten. Seit anderthalb Jahren hieß es daher einmal im Monat An Appointment with Kim Park.
Er hatte Erfolg. Er war ein bekanntes Gesicht im Fernsehen geworden und die ostasiatische Prominenz riss sich förmlich um seine Interviews. Nur zu gerne hätte er auch diesen nebulösen Drehbuchautor Julian Peek zu einem Treffen vor der Kamera eingeladen. Doch wer seinen wahren Namen nicht nennt, zeigt meist erst recht nicht sein wahres Gesicht.
Kim Parks Unternehmen hatte mit der Produktion von Spielfilmen bisher nichts zu tun gehabt. Und Japan spielte in seinen Arbeiten nur insofern eine Rolle, als zu seinen Auftraggebern im Werbebereich etliche japanische Firmen gehörten. Von einer ersten, erfolglos gebliebenen dokumentarischen Fingerübung einmal abgesehen, hatte er noch nie in Japan gedreht. Daher wunderte er sich, dass man mit diesem unerhört brisanten Projekt ausgerechnet an ihn herangetreten war. Yellow Submarine war ein Film, für den man einen Autor in Japan mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit öffentlich gelyncht hätte. Die Story, die auf bisher unveröffentlichten Fakten zu beruhen schien, erzählte von den Verwicklungen hoher Militärs in grausame Menschenversuche, deren Spätfolgen bis in die jüngste Vergangenheit hineinreichten und die zweifellos auch noch die Gegenwart bewegten. Ein Thema, das Kim Park sofort packte und nicht mehr losließ. Besonders reizvoll fand er auch die erzähltechnische Umsetzung der Filmidee: Nach einer atmosphärisch dichten Einleitungssequenz wurde der Plot konsequent aus der Sicht eines jungen Rechtsanwalts in Tokio aufgefächert, der – angestellt bei einer großen, internationalen Sozietät – eher aus Zufall mit der Führung eines komplizierten Schadenersatzprozesses gegen einen mächtigen japanischen Großkonzern beauftragt wird, dabei zunächst grandios scheitert und erst mit Hilfe seiner couragierten japanischen Freundin weitere Beweise herbeischaffen kann, die nun eine Wiederaufnahme des Verfahrens in greifbare Nähe rücken. Doch dann muss der junge Anwalt erkennen, dass er erneut gegen Windmühlenflügel ankämpft, während eine dunkle Vergangenheit ihre langen Schatten immer bedrohlicher über die Gegenwart wirft.
Als er eine knappe halbe Stunde später sein mit funktionalem Schick eingerichtetes Penthouse auf dem Dach des Kerry Centers betrat, führte Kims erster Weg zum Kühlschrank. Er nahm eine Flasche Perrier heraus, goss den Inhalt in ein großes Glas und warf zwei Magnesiumtabletten hinterher. Er nutzte die Zeit, in der sich die Tabletten sprudelnd auflösten, um in sein Arbeitszimmer zu gehen, wo er die oberste Schublade eines roten Lackschränkchens öffnete, in dem er seine persönlichsten Schätze verwahrte: einige militärische Rangabzeichen und Verdienstmedaillen, seine verbeulte »Hundemarke« aus Aluminium sowie einen Schlüsselanhänger aus Sterlingsilber. Sein Vater hatte darauf zwei gekreuzte Anker prägen lassen, als Sohn Kim sein erstes Kommando als U-Boot-Kapitän erhielt. Wie lange war das schon her? Es waren tolle Zeiten gewesen, damals, bei der südkoreanischen Marine. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er zur Elite gehören dürfen – und nicht zum Abschaum wie in seiner Jugend in Japan. Aber der Preis war grausam hoch. Davon kündete eine große Narbe, die von seinem rechten Schlüsselbein schräg bis hinunter zur siebten Rippe auf seiner linken Körperhälfte führte. Er hatte noch nie über seine Verwundung gesprochen. Auch nicht über die Monate danach; diese dunkelsten Momente seines Lebens in den unmenschlichen Gefängnissen eines der schlimmsten Regimes dieser Welt.
Ganz oben in der Schublade lag die dünne Klarsichtmappe, die das – leider unvollständige – Exposé sowie die ersten Drehbuchszenen zu Yellow Submarine enthielt. Kim zog die Mappe vorsichtig, beinahe ehrfürchtig, heraus und ging, mit einem kleinen Umweg über die Küche, wo er nach seinem Mineraldrink griff, in sein weiträumiges Wohnbüro hinüber. Dort setzte er sich an den Schreibtisch, trank einen Schluck und vertiefte sich erneut in die Lektüre.
»Yellow Submarine«
Drehbuch – Rohfassung
von Julian Peek
Marinebasis kure – Aussen / Tag
Über der langgezogenen Bucht der Marinebasis von Kure, nicht weit von Hiroshima, erhebt sich die Sonne majestätisch aus dem milchigen Grau des Morgens und lässt Himmel und Meer miteinander verschmelzen. Im silbrigen Glitzern der flachen Wellen schiebt sich ein langer Schatten langsam aufs offene Meer hinaus. Das Rauschen des Kielwassers mischt sich mit den heiseren Schreien der Möwen, die das auslaufende Unterseeboot begleiten. Hoch oben an der Abbruchkante der Steilküste beobachtet eine junge Frau, wie das U-Boot Kurs auf die offene See nimmt und zum Tauchgang ansetzt. Der Bug senkt sich, die Flagge am Turm beginnt heftig zu schlagen. Das dunkel schimmernde Haar der Frau steht in reizvollem Kontrast zum hellen Glanz der Gold- und Silberfäden, mit denen ihr festlicher Kimono durchwirkt ist. Auf ihren kalkweiß geschminkten Wangen sind Tränenspuren zu sehen. Während im Hintergrund das Boot unter der Wasseroberfläche verschwindet, hebt sie plötzlich ihre rechte Hand vors Gesicht. Stahl blitzt auf. Mit einer entschlossenen Bewegung zieht sie sich die scharfe Klinge quer über den Hals. Aus der durchschnittenen Kehle spritzt ein hellroter Blutstrahl. Dann fällt sie lautlos über den Rand der Klippe in die Tiefe, hinunter in die brodelnde Gischt, und bleibt seltsam verrenkt auf einem von den Wogen umspülten Felsen liegen. In ihre starren Pupillen eingebrannt: die stolz wehende »Rising Sun« – die alte Kriegsflagge der Kaiserlichen Marine Japans.
Schnitt.
Kim Park atmete tief durch, legte das Manuskript auf den Schreibtisch und trat hinaus auf seine großzügig bemessene Dachterrasse. Aus 130 Metern Höhe ließ er seinen Blick über das abendliche Shanghai schweifen. Über diese herrliche, geheimnisvolle, wuchernde »Perle des Ostens«. Da unten schwirrten mehr als 18 Millionen rastlose Menschen umher, die in zahllosen Hochhausbauten wie die Termiten immer höher hinauswollten. Auch Kim hielt eine bis an den Horizont ungetrübte Sicht für lebensnotwendig, ja überlebensnotwendig. Überleben, ohne verrückt zu werden, war schon immer sein Spezialgebiet gewesen. Mit gutem Grund. Was sollte man auch anderes erwarten von jemandem, der seine besten Jahre eingesperrt verbracht hatte: freiwillig und voller Begeisterung (von jenen unfreiwilligen dunklen Monaten einmal abgesehen). Mit drei Dutzend anderen jungen Männern zusammengepfercht auf engstem Raum in einer knapp siebzig Meter langen Röhre aus Stahl. And we lived beneath the waves in our yellow submarine …
Wer da draußen wusste eigentlich von seiner militärischen Vergangenheit? War dieser Julian Peek etwa ein Marinekamerad von damals, womöglich auch ein Japan-Koreaner? Auf jeden Fall besaß der Mann eine Menge Mumm. Und er kannte sich verdammt gut mit den japanischen Gepflogenheiten aus – und mit einer japanischen Vergangenheit, von der man noch heute nicht gern sprach. Kim musste endlich einen Weg finden, um an ihn heranzukommen. Verflixt, wer sind Sie, Mister Peek?
Kim Park begab sich wieder nach drinnen, nahm die Klarsichtmappe und legte sie an ihren Platz in der Schublade zurück. Heute Abend würde seine Frage jedenfalls nicht mehr beantwortet werden. Heute Abend war die Party bei Cathy – das andere Thema, um das sich seine Gedanken den ganzen Tag schon bewegten. Cathy Wong, diese umwerfende Chinesin aus Los Angeles und Shanghaier Korrespondentin des amerikanischen Vanity Fair-Magazins, hatte dem im Umgang mit anderen immer nüchtern und beherrscht wirkenden Kim gründlich den ansonsten so kühlen Kopf verdreht. In seinen Augen war sie die vollkommene Frau, die mittlerweile allerdings einen gravierenden Fehler hatte: Sie war nicht mit ihm zusammen, sondern mit einem Butterstinker. Jeremy Gouldens – pah! Ein abgehalfterter Winkeladvokat mit dubioser Vergangenheit, der sich erfolglos in der Welt herumgetrieben hatte, bis er vor etwa einem Jahr in die kosmopolitischen Zirkel Shanghais hineingeplatzt war und die vielversprechenden ersten zarten Bindungen zwischen Kim und Cathy brutal gekappt hatte. Was sie nur an diesem hässlichen, latent versoffenen Riesenbaby fand? Gouldens war mindestens zwanzig Jahre älter als Cathy. Viel zu alt für sie. Kim warf einen raschen Blick auf seine Panerai. Es wurde langsam Zeit, zu duschen und sich anzuziehen.
Vor den Fenstern begannen die Lichter der Großstadt zu glitzern. Cathy würde schon noch begreifen, dass sie einen besseren Mann verdient hatte. Er durfte jetzt nicht lockerlassen. Er würde ihr Herz erobern. Irgendwann. Bald.
Shanghai, 1. Mai 2012. 18:15 Uhr
Während Kim Park unter die kühle Brause stieg, saß besagter Butterstinker gerade schwitzend in einem offenen schwarzen Porsche 911 und fluchte. Wenige Hundert Meter vor der Einfahrt in den Renmin-Tunnel, der den Fluss Huangpu unterquert und so das traditionelle Geschäftszentrum Puxi mit der Pudong New Area im Osten der Stadt verbindet, ging nichts mehr. Fünfzig Meter in fünf Minuten. Warum hatte er nicht auf Cathy gehört? Warum hatte er den Wagen nicht in der Tiefgarage des Jin Mao Towers stehen lassen und vernünftigerweise die U-Bahn genommen? Warum würde er einmal mehr zu spät kommen? Ausgerechnet heute Abend, wo er eigentlich den perfekten Gastgeber hatte mimen wollen. Seine Hektik, die brütende Hitze und der erstickende Dunst der Autoabgase begannen sich als leise pochender Kopfschmerz hinter seinen Schädelknochen bemerkbar zu machen. Per Knopfdruck schloss er das Verdeck und hoffte auf die Leistungsfähigkeit der Klimaautomatik.
»Jetzt entspann dich ein bisschen«, sagte sein Beifahrer, Richard Koo, Senior Partner und Grand Seigneur des Shanghaier Büros der internationalen Anwaltssozietät Lexman & Lexman. Und so etwas wie ein guter Freund. Ihn konnte offenbar gar nichts aus der Ruhe bringen. Jeremy hatte ihn noch nie wirklich aufgebracht erlebt. Weder früher, als sie gemeinsam in Japan für Lexman & Lexman Prozesse geführt hatten, noch jetzt, wo sie das Schicksal – und Richards soziale Kompetenz – in Shanghai wieder in einem Büro zusammengebracht hatten.
Jeremy hatte Richard viel zu verdanken. Als sie einander im Frühjahr 2010 nach zehn Jahren ohne Kontakt auf dem Chek Lap Kok Airport in Hongkong zufällig wieder über den Weg gelaufen waren, hatte Jeremy ausgesehen wie ein abgebrannter Hippie und sich auch so gefühlt. Mit seinem Anwaltsleben hatte er abgeschlossen und vegetierte auf hohem Niveau ziellos in den Tag hinein. Richards Menschenkenntnis und seinem geschulten Blick für den wertvollen Kern im Wesen eines Mannes war es zu danken, dass Jeremy wieder Tritt gefasst hatte und nun hier in Shanghai in einem nagelneuen Porsche-Cabrio saß. Dessen knapp 300 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit ihm im Moment allerdings von begrenztem Nutzen waren.
Fünfzig Meter in fünf Minuten. Macht 0,6 Stundenkilometer. Wenn das so weiterging, konnten die Champagnerkorken ohne ihn knallen. Während Jeremy nervöser wurde, las Richard Koo auf dem Beifahrersitz seelenruhig im Shanghai Daily das Kinoprogramm. »Oh, heute Abend kommt Nanking Nanking«, sagte er zu Jeremy, »dieser aufsehenerregende preisgekrönte Kriegsfilm von Lu Chuan über das Nanking-Massaker von 1937/38. Den hast du mir doch mal empfohlen, oder?«
»Ja, aber nicht für heute Abend. Ist außerdem ziemlich starker Tobak. Als ich mit Cathy drin war, mussten wir nach der Hälfte rausgehen. Sie hat es nicht mehr ausgehalten. Ein ›Gemetzel für die Seele‹, wie mal ein Kritiker geschrieben hat.«
»War wohl auch keine besonders clevere Idee, deine zarte Holde zu so einem Schlachtfest einzuladen«, konstatierte Richard scharfsinnig.
»Yep«, antwortete Jeremy knapp, der sich nicht an den verpatzten Kinoabend erinnern wollte. Aber Richard konnte bisweilen unerbittlich sein. »Ist das nicht der Film, wo Chinesen mit Stacheldraht verschnürt, mit Benzin überschüttet und angezündet werden, damit die japanischen Soldaten besseres Licht haben, um in die Luft geschleuderte Babys mit Bajonetten aufzufangen?«
»Komm, hör auf, Richard!« Jeremys Stimme klang gequält. »Wenn man einen Film über Kriegsverbrechen dreht, muss man die Verbrechen eben auch zeigen. Und besonders zartbesaitet ist Cathy ansonsten gar nicht. Erst als wir später in der Century Bar oben im World Financial Center saßen, hat sie mir erzählt, dass auch Verwandte von ihr bei den Massakern umgekommen sind. Davon wusste ich ja nichts. Und dann konnte sie plötzlich nicht mehr weiterreden. Sie war total blockiert. Dass diese schreckliche Nanking-Geschichte und die übrigen japanischen Kriegsverbrechen auch in meinem früheren Leben eine wichtige Rolle gespielt haben, weiß sie bis heute nicht.« Nach einer kleinen Pause fügte er leise und wie zu sich selbst hinzu: »Aber vor der Hochzeit muss ich da wohl endlich reinen Tisch machen.«
Doch Richard Koo hatte scharfe Ohren. »Was höre ich da?«, rief er aufrichtig überrascht, »du willst Cathy heiraten?«
Jeremy versuchte vergeblich, die Frage zu überhören.
»Du willst also im zarten Alter von 49 Jahren wirklich ernsthaft noch eine Heirat ins Auge fassen? Ihr lebt doch ohnehin schon zusammen wie ein altes Ehepaar!«
»Seit über sechs Monaten«, bestätigte Jeremy, der in diesem Moment eine Lücke entdeckte und mit aufheulendem Motor die Spur wechselte. Die halsbrecherische Aktion hatte sie 20 Meter nach vorne gebracht.
»Aber für ein Glas Milch kauft man nicht gleich die ganze Kuh.« Richard Koo zog die Augenbrauen hoch.
Jeremy musterte ihn mit gespielter Empörung. »Dein Vergleich hinkt, Richard. Zugegeben: Manchmal schwanke ich noch ein wenig. Aber eigentlich bin ich fest entschlossen. Jedenfalls gab es noch nie eine Frau, die mich dermaßen fasziniert hat.«
»Im Bett wahrscheinlich.« Es klang nicht ordinär.
»Nein, auch sonst.« Jeremy zupfte nachdenklich an seinem rechten Ohrläppchen. »Man hält es nicht ein halbes Jahr lang mit einer Frau aus, die einen nur im Bett fasziniert.«
»Darf ich daraus schließen, dass du es umgekehrt ohne diese Faszination im Bett wohl nicht mit ihr aushalten würdest?«
»Hm.« Jeremy zuckte die Schultern. »Na ja, sie kann mitunter schon ganz schön anstrengend sein.«
»Du meinst – sie ist eine Frau.«
Jeremy lächelte. Das war Richard. Immer schön nüchtern-lakonisch und down to earth. Die scheinbar verzwicktesten Probleme konnte er schnell auf die einfachsten Grundfakten zurückführen. Kein Wunder, dass Cathy mit ihm so ihre Probleme hatte, sich mal »nicht richtig ernst genommen«, mal »mental unterfordert« fühlte. Frauen sind eben stolz auf ihre Kompliziertheiten.
»Na ja, meinen Segen hast du«, brummte Richard gönnerhaft. »Ich habe es schließlich auch nicht bereut, dass ich auf meine alten Tage noch Mimi geheiratet habe. Unterm Strich jedenfalls. Und mit der ist es auch nicht immer ganz einfach.« Er machte eine versonnene Pause. »Dann fühlst du dich jetzt also endlich geheilt?«
Jeremy warf seinem Freund einen prüfenden Blick zu. Sollte sich ihr Geplauder jetzt zu einem tiefschürfenden Männergespräch entwickeln? Lieber nicht. Nicht heute. »Wie meinst du das?«
»Wir beide wissen doch, dass es dich damals in Japan schon einmal richtig erwischt hat. Der Satz, dass dich noch nie eine Frau so fasziniert hat, kommt mir ziemlich bekannt vor. Und trotzdem ging die Sache damals katastrophal in die Binsen. Und als du dann mit leeren Händen dastandest, hast du alles hingeworfen, und ich habe einen guten Freund und Kollegen verloren. Und die Welt beinahe einen guten Anwalt. Wie hieß sie nochmal, deine schmucke Japanerin? Aikiko?«
»Yukiko«, verbesserte Jeremy zögernd, »und du weißt, dass ich nicht gerne darüber rede. Du bist so ziemlich der Einzige, der von der ganzen Geschichte weiß. Ja – damals ist irgendwas in mir zerbrochen. Aber das ist lange vorbei.«
»Und du hast nie wieder von ihr gehört?«
»Nope. Kein Lebenszeichen. Seit 13 Jahren – nichts.«
Was mochte wohl aus ihr geworden sein? Sie war damals ungefähr so alt wie jetzt Cathy.
»Anyway …«, seufzte Richard Koo.
»Eben. Das Leben geht weiter. Vielleicht bin ich jetzt wirklich ›geheilt‹, wie du das nennst. Cathy hat mich geheilt. Vielleicht bin ich endlich an dem Punkt, wo ich mit meiner Traumfrau eine Familie gründen möchte. Warum auch nicht? Soll ich warten, bis ich so alt und klapprig bin wie du? Am besten, ich frag sie gleich mal, wie viele Kinder sie von mir will.« Damit griff er zum Mobiltelefon, um Cathy anzurufen und das unerquickliche Thema zu beenden.
Besonders erquicklich gestaltete sich das nun anschließende Gespräch mit der Traumfrau – in dem es weniger um Kinder als um unzuverlässige Männer ging – allerdings auch nicht. Jeremy kam ohnehin kaum zum Zug. Richard konnte jedes Wort hören, das aus ihr heraussprudelte. Herrje, war die Kleine sauer. Warum hast du nicht die U-Bahn genommen, du unverbesserlicher Trampel? Jeremys Züge nahmen einen zunehmend leidenden Ausdruck an.
Dennoch war Richard beruhigt. Sein Freund schien sich auf dem richtigen Weg zu befinden.
Damals, als er dem Aussteiger Jeremy Gouldens in Honkong wiederbegegnet war, hätte er ihn um ein Haar nicht wiedererkannt. Wie ein gestrandeter Seefahrer hatte er ausgesehen. Langhaarig, unrasiert und braungebrannt, in verwaschenen Bermudashorts, einem gestreiften T-Shirt und mit vietnamesischen Flip-Flops an den Füßen. Allerdings besaß er zu Richards Erleichterung noch immer seine Kreditkarten, seine Bankkonten in der Schweiz und seine elterliche Wohnung im Londoner Nobelviertel Chelsea. Jeremy hätte sein vergleichsweise bescheidenes Luxusleben wahrscheinlich noch bis an sein Lebensende untätig fortführen können, ohne sein beträchtliches ererbtes Vermögen restlos zu verjubeln.
Jeremy und Richard hatten zwei Stunden in der Frequent Traveller Lounge des Flughafens von Honkong verbracht und über alte und neue Zeiten geredet. Wie ein moderner »Fliegender Holländer« war Jeremy jahrelang in seiner geliebten Jacht »Hebridean Spirit« über die Weltmeere gesegelt. Doch die Begeisterung, mit der er davon berichtete, war Richard gleich etwas aufgesetzt vorgekommen. Schnell hatte er begriffen, wie sehr die furchtbare berufliche und persönliche Niederlage, die Jeremy als Rechtsanwalt in Japan erlitten hatte, noch immer an ihm nagte. Davor konnte man nicht einfach wegsegeln. Der Mann brauchte Hilfe; etwas, woran er sich festhalten konnte. Beim letzten Aufruf seiner Maschine nach Shanghai war Richard entschlossen aufgestanden und hatte dem Herumtreiber eine Gardinenpredigt gehalten: »So kannst du nicht weiterleben, alter Junge. Willst du vor die Hunde gehen? Weil du nicht abschütteln kannst, was einmal gewesen ist? Weil du es vielleicht gar nicht abschütteln willst? Glaubst du denn, an mir ist die Sache spurlos vorübergegangen? Aber ich habe den Arsch zusammengekniffen und weitergemacht. Über das Trauma deines Scheiterns kannst du nur wegkommen, wenn du dich nicht permanent im alten Leid suhlst, sondern nach vorne blickst und dich mit neuen Herausforderungen konfrontierst.« Dann hatte er Jeremy seine Visitenkarte in die Hand gedrückt. »Du kannst jederzeit wieder in die Firma zurück. Darauf gebe ich dir mein Wort. Komm nach Shanghai und fang wieder an. Nicht als Partner, sondern zunächst als angestellter Anwalt. Du brauchst nur anzurufen. Und überleg nicht wieder zehn Jahre!«
Jeremy überlegte zehn Monate, dann rang er sich zum Anruf durch. Als er in Shanghai eintraf, trug er, sehr zu Richards Erleichterung, einen maßgeschneiderten Anzug aus der Londoner Savile Row und statt Flip-Flops handgemachte Schuhe von John Lobb. Ohne großes Tamtam führte Richard den neuen alten Kollegen in sein Büro im 35. Stockwerk des Jin Mao Towers und überhäufte ihn mit Arbeit. »Am besten, du legst gleich los. Es gibt eine Menge zu tun.« Wenige Wochen später hatte Jeremy dann Cathy getroffen. Seither hatte er seinen Entschluss, ins geregelte Leben zurückzukehren, nicht wieder bereut. Höchstens manchmal ein bisschen.
Wie jetzt gerade.
Mit nervtötender Langsamkeit verschwand die endlose Autoschlange vor ihnen nach und nach in einem schwarzen Loch. Die Einfahrt zum Tunnel erinnerte Jeremy an das klaffende Maul eines Drachen, der sich gierig selbst verschlingt. Gleich würden auch sie verschlungen werden.
Shanghai, 1. Mai 2012. 18:45 Uhr
Im Innenhof der betagten Kolonialvilla in der Französischen Konzession, jenem noblen Villenviertel, das der tobenden Bauwut bislang einigermaßen unbeschadet zu trotzen vermocht hat, hing die modrige Luft schwer und drückend über dem Teichbecken mit den Lotusblumen. Jeremys Anruf hatte die dicke Luft nicht vertreiben können. Im Gegenteil. Cathy Wong war wütend. Sehr wütend sogar. Punkt sechs hatte er zu Hause sein wollen. Warum musste er immer unpünktlich sein? Das durfte er sich vor Gericht doch auch nicht erlauben. Warum hatte er nicht auf sie gehört und die Metro genommen? Er hatte doch versprochen, noch etwas beim Vorbereiten zu helfen. Jetzt ließ er sie hier alleine rotieren, und die ersten Gäste konnten jeden Augenblick eintreffen. Typisch!
Seit einem halben Jahr bewohnten sie nun gemeinsam dieses Kleinod. Cathy hatte nie begriffen, wie es Jeremy geschafft hatte, für sie so ein Haus zu finden. Sogar zu einem annehmbaren Mietpreis – und das im angesagtesten Wohnviertel der Stadt, einen Steinwurf entfernt von der Einkaufsstraße Changle Lu. In einem Viertel, wo sich alles, was Rang und dicke Geldbeutel hat, gegenseitig überbietet, um eines der begehrten alten Häuser zu ergattern: neureiche Yuppies, internationale Galeristen, weltweit operierende Unternehmen der Systemgastronomie und nicht zuletzt die Strippenzieher aus der Welt der organisierten Kriminalität – die »chinesischen Mafia« der Triaden war bekanntermaßen stark in den hiesigen Immobilienmarkt involviert. »Ich kenne zufälligerweise den Besitzer«, hatte Jeremy wortkarg gemurmelt, als Cathy einmal nachzubohren versuchte, »und der schuldet mir was …« Cathy selbst hatte Gao Feng, ihren großzügigen Vermieter, noch nicht kennengelernt. Aber seinem Namen war sie schon des Öfteren begegnet, leider in zumeist wenig vertrauenserweckenden Zusammenhängen. »Er ist viel auf Reisen«, so Jeremys knappe Auskunft, »und außerdem scheut Gao die Öffentlichkeit.« Mehr sagte er nicht.
Vielbeschäftigt und öffentlichkeitsscheu. Das passte in dieses Viertel. Die Französische Konzession hatte schon immer als ideales Terrain für zwielichtige Figuren gegolten. Als sie vor zwei Jahren wieder nach Shanghai gekommen war, zurück in die chinesische Heimat ihrer Eltern, hatte sie ein kleines Appartement in der 14. Etage eines Wohnblocks weit außerhalb mit Kakerlaken teilen müssen und dafür eine fast ebenso hohe Miete gezahlt. Cathy hatte sich mit Jeremys dünnen Ausflüchten abspeisen lassen und sich vorgenommen, keine weiteren Fragen zu stellen.
Mit dem »Besser-keine-Fragen-Stellen« hatte sie bereits hinreichend Erfahrungen gesammelt. Cathy Wong war amerikanische Staatsbürgerin; die Wongs hatten sich im Jahre 1938, nach einer dramatischen Flucht aus dem von den Japanern besetzten Nanking, schließlich in Los Angeles niedergelassen. Nicht allen Mitgliedern der weitverzweigten Familie war es gelungen, den Kriegsgräueln zu entkommen. Solange sich Cathy zurückerinnern konnte, war das Thema Nanking innerhalb der Familie tabu gewesen. Über die Massaker an der Zivilbevölkerung, die Massenvergewaltigungen und sonstigen Grausamkeiten wurde konsequent geschwiegen. So hielten es die Wongs seit 75 Jahren. Was Cathy über den Japanisch-Chinesischen Krieg wusste, hatte sie sich in der Universitätsbibliothek und im Internet angelesen. Aber über dieses Wissen konnte sie sich mit ihrer Familie nicht austauschen. Sie hatte niemals Fragen stellen dürfen. So hatte sie auch ihre gesamte Jugend hindurch klaglos akzeptiert, dass ihr Vater ihr strengstens verboten hatte, japanische Produkte zu kaufen. Nicht einmal einen harmlosen Walkman hatte er ihr gegönnt.
Cathy war zweisprachig und behütet aufgewachsen. In Kalifornien hatte sie sich immer wohlgefühlt. Ihr Vater, der bereits seit Mitte der fünfziger Jahre die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, betrieb eine kleine Take-away-Kette im Großraum Los Angeles, die aus dem Chinarestaurant seiner Eltern hervorgegangen war. Er war das mit Abstand erfolgreichste Mitglied des Wong-Clans und vergaß nie, sich um die anderen Familienmitglieder zu kümmern. Für Cathys »kleinen Cousin« Chen zum Beispiel, einen hochintelligenten, aber psychisch labilen Jungen, dessen Vater viel zu früh verstorben war, hatte er gesorgt wie für einen eigenen Sohn. Er hatte ihm die komplette Ausbildung bezahlt und finanzierte ihm jetzt sogar noch ein Zweitstudium an der renommierten Fudan University, hier in Shanghai. Chen studierte Chinesische Geschichte, denn Restaurantchefs, so meinte Cathys Vater, wenn einmal die Rede auf ihren verschrobenen Cousin kam, hätten die Wongs bereits genug in ihren Reihen. Auch wenn sie Chen, der in einem Studentenwohnheim der Universität hauste, für einen kommunikationsgestörten Nerd hielt, mit dem sie herzlich wenig anfangen konnte, hatte es sich nicht vermeiden lassen, ihn zu ihrer Party einzuladen. Familienbande sind eben Familienbande.
Während Chen letztlich mehr ein Sorgenkind war, konnte sich Cathys bisheriger Lebenslauf wahrlich sehen lassen. Makellose Schulzeugnisse hatten ihr zunächst ein Stipendium an der New Yorker School of Journalism ermöglicht, wo sie als eine der Besten ihres Jahrgangs abgeschlossen hatte. Danach war sie zum ersten Mal wieder in die alte Heimat ihrer Eltern zurückgekehrt, um in Shanghai Chinesische Literatur zu studieren – ebenfalls an der Fudan-Universität. Obwohl sie nebenher noch einen eigenen Internetblog unterhielt und als freie Rechercheurin für westliche Medien arbeitete, absolvierte sie ihr Studium zwei Semester unter der Regelstudienzeit. Nach ihrer Rückkehr in die Staaten hatte Cathy ein Angebot der Los Angeles Times vorgefunden und sich voller Enthusiasmus ins Reporterleben gestürzt. Mit ihrem umfangreichen Hintergrundwissen, ihrer freundlich-bestimmten Hartnäckigkeit und ihrem blendenden Aussehen hatte sie einige aufsehenerregende Storys ausgraben können. Als sich ihr dann vor zwei Jahren die Chance geboten hatte, für das namhafte Vanity Fair-Magazin in dessen neu eröffnetes Büro in Shanghai zu wechseln, hatte sie keine Sekunde gezögert. Plötzlich war sie Korrespondentin und die Nummer 5 im Büro. Mit gerade einmal 30 Jahren! Ihr Vater hatte sie zu diesem gewagten Schritt ermutigt. Cathy war auch der Meinung, ihren Eltern etwas zurückzahlen zu müssen. Sie wollte ihnen nicht so auf der Tasche liegen wie ihr feiner Herr Cousin, der ihrer Meinung nach völlig nutzlos mit dem mühsam Ersparten ihres Vaters gepäppelt wurde.
Die alte englische Standuhr in der Diele schlug sieben. Wo blieben die Gäste? Wann würde Jeremy endlich kommen? Sie versuchte ihn noch einmal anzurufen, erreichte ihn aber nicht. Wahrscheinlich befand er sich noch immer tief unter dem schlammigen Grund des Huangpu.
Als sie gerade entschieden hatte, lieber noch ein paar Bier- und Weisweinflaschen mehr kaltzustellen, läutete es an der Tür. Für einen Moment hoffte Cathy, dass schuldbewusst grinsend ihre Langnase vor ihr stehen würde. Doch das breite Grinsen, in das sie nach dem Öffnen der Haustür starrte, entsprang nicht kantig britischen, sondern runden chinesischen Zügen. »Chen!«, rief Cathy, »schön, dass du da bist. Du bist der Erste. Wolltest du nicht erst später kommen?«
Chen, der ein legeres weißes Hemd über einer dunkelblauen Drillichhose trug, verzog säuerlich den Mund. »Ich konnte es eben kaum erwarten, dich wiederzusehen«, antwortete er knapp. »Und natürlich Jeremy«, schob er in einem etwas gelangweilt wirkenden Tonfall hinterher wie ein Schüler, der vor dem Lehrer sein Sprüchlein aufsagen muss.
Cathy wusste natürlich, dass ihr kleiner Cousin – der im Übrigen nur zwei Jahre jünger war als sie – Jeremy nicht ausstehen konnte und anlässlich seiner sporadischen Telefonate nach Los Angeles jede Gelegenheit nutzte, um bei seinem Ziehvater gegen Cathys Lebensgefährten zu stänkern. Dabei kannte er Jeremy nicht einmal richtig. Aber Chen mochte keine Ausländer. Die Gweilos hatten sein Volk in den Opiumkriegen gedemütigt; sie hatten den Pekinger Sommerpalast zerstört und den Boxeraufstand blutig niedergeschlagen, sie hatten wiederholt auf Kosten Chinas mit den Japanern paktiert – er könnte die Liste noch endlos fortsetzen. Dass Chen in China im Grunde selbst eine Art Ausländer war, hatte wahrscheinlich eher noch dazu beigetragen, seinen Patriotismus zu steigern. Seine Eltern waren Ende der siebziger Jahre, in der Zeit der Modernisierung nach Maos Tod, aus Kalifornien nach Shanghai zurückgekehrt, hatten hier aber nie wieder so recht Fuß fassen können, und der bald darauf geborene Chen hatte sich in seiner Kindheit und Jugend immer ein wenig wie ein Fremdkörper behandelt gefühlt.
»Wo steckt sie denn eigentlich, deine imperialistische Langnase?«
»Jeremy? Im Stau«, seufzte Cathy. »Mein guter Chen«, setzte sie hinzu, während sie ihn am Arm zur Bar im Innenhof führte, »vielleicht kannst du mir heute Abend ja einen klitzekleinen Gefallen tun …« Chen sah seine Cousine misstrauisch an »… und dich mit deinen politischen Ansichten etwas zurückhalten – ausnahmsweise mal keine deiner dogmatischen Chinareden halten und auch deine despektierlichen Äußerungen über Angehörige anderer Völker unterlassen? Wir haben heute Abend ein – na ja – internationales Publikum hier.« Statt zu antworten, zog er mit provozierender Langsamkeit eine Flasche Tsingtao-Bier aus einem Berg von Scherbeneis. Das Bier aus der größten Brauerei Chinas, ursprünglich als »Germania-Brauerei« von deutschen Siedlern in Quingdao gegründet, stellte in seinen Augen eine der wenigen positiven Hinterlassenschaften der Kolonialzeit dar.
»Ja?«, fragte Cathy geduldig, »versprochen?« Sie hätte ihn ohrfeigen können.
»Es ist schließlich deine Party, Cathy«, antwortete Chen unerträglich lässig und trank.
»Ich glaube an dich, mein Lieblingscousin!« Cathy konnte die spätpubertäre Überheblichkeit dieses Grünschnabels nicht ausstehen. Sie war erleichtert, als es in diesem Moment erneut an der Haustür läutete.
Chen sah ihr verächtlich nach. Immerhin trug seine rehäugige Cousine heute keinen Designerfummel, sondern ein knöchellanges klassisches Qipao aus karmesinroter Seide. Aber warum stöckelte sie darunter in so geschmacklosen High Heels herum? Traditionelle Lotusfüßchen, dachte Chen, ja – die wären perfekt gewesen. Schließlich konnten Frauen, die sich freiwillig in diese hochhackigen Pumps zwängten, auch nicht besser laufen als die lotusfüßigen chinesischen Frauen früher, denen die Fußknochen von Kindesbeinen an abgebunden und dauerhaft verkrüppelt worden waren. Aber seine Cousine war ja so modern, so aufgeklärt, so entsetzlich verwestlicht. Anders als Chen fehlte ihr der Sinn für die große chinesische Idee, die eines nahen Tages die Welt erobern würde. Er nahm noch einen kräftigen Schluck, dann öffnete er rasch eine zweite 0,33-Liter-Flasche. Heute hatte er Durst.
Cathy war zum zweiten Mal zum Eingang geeilt. Voll freudiger Erwartung – doch weder standen neue Gäste noch Jeremy vor der Haustür. Sondern ein junger Kurierfahrer von UPS, der fragte: »Wohnt hier ein Mr. Jeremy Gouldens? Eine Expresssendung.«
Mit Verblüffung nahm Cathy die Sendung entgegen und quittierte den Empfang. Sie schloss die Eingangstür und wiegte nachdenklich das Paket in ihren Händen. Es war in geschmackvolles grün-weißes Geschenkpapier eingeschlagen, nicht besonders schwer und in Japan aufgegeben. In Kyoto. Hatte Jeremy nicht dort gelebt, bevor er nach Tokio ging? Kyoto-shi, Kamitakano 13–7, Sakyo-ku. Dabei schien es sich um die Adresse zu handeln. »Y. Murata«: Das war der Absender. Auf Englisch hatte jemand, wohl dieser Murata, hinzugefügt: »Unbedingt persönlich zu übergeben.« Vielleicht hätte man das noch auf Chinesisch ergänzen sollen, damit es auch der Kurierfahrer mitbekommt, dachte Cathy. Sollte da etwas vor ihr verheimlicht werden?
Vielleicht handelte es sich auch bloß um irgendeinen Anwalt. Oder es war jemand von der juristischen Fakultät. Sie erinnerte sich, dass Jeremy einmal erwähnt hatte, eine Zeit lang an der Universität von Kyoto gearbeitet zu haben. Im Grunde ging sie das alles auch nichts an. Er kannte viele Leute, sie kannte viele Leute. Ihr wurde schmerzhaft deutlich, wie wenig sie über sein früheres Leben wusste – über die Zeit, bevor sie sich kennengelernt hatten. Die Zeit, als noch nicht sie sein Leben gefüllt hatte. Na gut, sie band ihm ja auch nicht lang und breit auf die Nase, mit wem sie geflirtet hatte, bevor es zwischen ihnen beiden gefunkt hatte. Schon gar nicht heute Abend.
Das hübsche Geschenkpapier irritierte sie aber doch. Immerhin duftete es nicht nach Frauenparfüm. Aber warum wohl sollte es nur ihm persönlich übergeben werden? Und nicht seiner Lebensgefährtin? Auf einmal schlug sie sich mit der flachen Hand an die Stirn. Wie konnte sie nur so begriffsstutzig sein! Wer hatte denn um Mitternacht Geburtstag? Sie! Cathy musste unwillkürlich lächeln.
Vorsichtig legte sie sein Geschenk deutlich sichtbar auf den Frisiertisch der Garderobe. Dort konnte er es nicht übersehen.
Kyoto, 24. Mai 1997. Kurz vor Mitternacht
Sakura! Die letzten zarten Kirschblüten lösten sich von ihren Zweigen und schwebten im leichten Wind taumelnd zu Boden. Der weiße Rausch war fast so schnell wieder verflogen, wie er gekommen war. Alles Leben ist vergänglich. Jeremy Gouldens lief mit offenem Hemdkragen vor dem U-Bahnhof Kokusaikaikan auf und ab und wartete auf die letzte Bahn. Sein Haar war zerzaust, sein Gesicht leicht gerötet, das zerknitterte Sakko trug er über der Schulter. Er hatte ein wenig zu viel getrunken. Sakura, Sakura! Schon oft hatte Jeremy dieses beliebte japanische Volkslied in einer Karaokebar mitgesungen. Sake und Singen war ein gut verträgliches Medikament gegen die Einsamkeit, die ihn jetzt häufiger überfiel, zwölf Flugstunden entfernt vom heimatlichen London. Es half zuverlässig, den Druck abzubauen, der auf ihm lastete, seitdem er eine einjährige Dozentur für Zivilprozessrecht an der ehrwürdigen ehemaligen Kaiserlichen Universität von Kyoto angetreten hatte. Er war nun schon seit acht Monaten in diesem fremden Land und wurde täglich mit strengen Regeln konfrontiert. Wie hieß es hier so schön? Herausstehende Nägel werden eingeschlagen. Der junge Rechtsdozent hatte angefangen zu begreifen, warum die so erfolgreich expandierende Japan Inc., das undurchsichtig verschlungene »Unternehmen Japan«, eine der höchsten Selbstmordraten auf dem Globus aufwies.
Sakura, Sakura! Gesinge und Sake schienen ihm immer noch besser, als sich nach einem harten Arbeitstag den verlockenden Angeboten des Mizu Shobai hinzugeben, des »Wasserhandels«, wie man hier die eher frivolen Seiten des nächtlichen Amüsierbetriebs nannte. Besser auch, als sich an einem der zahlreichen öffentlichen Sexautomaten mit gebrauchten Schulmädchenhöschen oder Sadomaso-Mangas zu versorgen. So etwas gehörte sich nicht für einen jungen britischen Juradozenten in Japan. Schon gar nicht, wenn man so ein ehrwürdiges japanisches Haus bewohnen durfte wie er. Das Haus gehörte einem Sake-Brauer aus Kobe. Es lag etwas außerhalb im Nordosten Kyotos in den Bergen, in der Nähe des alten kaiserlichen Sommerpalastes Shugakuin, und hatte einen klassischen japanischen Garten, in dem ein Dutzend seltener Bambusarten wuchsen.
Trotz des schönen Hauses fiel es Jeremy immer noch schwer, in diesem fremden, rätselhaften Land heimisch zu werden, dessen gleichermaßen feudale wie konforme Gesellschaft vom Unterschied zwischen uchi und soto – innen und außen – bestimmt wurde. Sowie von der Tatsache, dass sich die Bewohner Nippons für Abkömmlinge der Sonnenkönigin Amaterasu hielten. Und sich damit grundlegend von allen anderen »Rassen« zu unterscheiden glaubten. In jeder größeren Buchhandlung gab es ein paar Regalmeter mit Nihonjinron-Literatur; pseudowissenschaftlichen Werken, in denen »bewiesen« wird, dass die japanische Haut anders ist, ebenso das japanische Blut, die japanischen Haare und natürlich das japanische Gehirn. Seit prähistorischen Zeiten bewahre die japanische Rasse eine einzigartige, mystische Essenz, die sie allen anderen Rassen überlegen mache. In den dreißiger und vierziger Jahren hatte – ähnlich wie auf der anderen Seite des eurasischen Doppelkontinents der Wahn der »Arier« – die propagierte Einzigartigkeit der Eroberer furchtbare Konsequenzen für die Bewohner der von Japan besetzten Staaten Asiens gezeitigt; seit den achtziger Jahren diente sie nun vor allem als wirtschaftspolitisches Instrument: Wegen des anderen japanischen Schnees durften zum Beispiel keine westlichen Skier importiert werden. Die rigorose Durchsetzung solcher Handelshemmnisse hatte zu Spannungen mit den westlichen Industrienationen geführt.
Nein, dachte Jeremy, der in der milden Nachtluft langsam wieder nüchtern wurde: Dies ist längst ein Wirtschaftskrieg, der mit härtesten Bandagen geführt wird. Sogar das Rockefeller Center in New York gehörte inzwischen Mitsubishi! Und er, der Idealist und selbsternannte Weltverbesserer, wollte vermitteln. Er wollte übersetzen und Brücken bauen, er wollte helfen und für gegenseitiges Verständnis werben. Dafür war er nach Japan gekommen. Es durfte kein uchi und kein soto mehr geben. Für ihn existierte nur ein uchi. Begriff denn niemand, dass die gesamte Menschheit vor riesigen Problemen stand? Überbevölkerung, Umweltverschmutzung, Krieg und Terror, die zunehmende Verarmung der Dritten Welt. Jeder Mensch war gleich, hatte die gleichen Rechte und Pflichten. Aber offenbar gab es zu viele Japaner, die das anders sahen.
Und im November würde er nun also nach Tokio gehen. Spätestens seit heute Abend gab es kein Zurück mehr. Er hatte das exzellente Angebot der Tokioter Dependance der internationalen Anwaltssozietät Lexman & Lexman angenommen. Die Aussichten waren auch allzu verführerisch, nicht nur was das Gehalt betraf. Wenn man dort Wort hielt, würde er gleich an einem sehr komplizierten größeren Fall mitarbeiten können. Und das nicht einmal erst ab November. Man hatte ihn gefragt, ob er schon jetzt, selbstverständlich gegen Bezahlung, stundenweise vor Ort in Kyoto einige Recherchearbeiten übernehmen könne, vorrangig in der Universitätsbibliothek und an verschiedenen Archiven und Seminaren. Seine eher dürftig bezahlte Dozententätigkeit ließ ihm bei allem Druck doch einen gewissen Rahmen an Freizeit, und so sagte er sofort zu.
Heute Abend hatte er sich mit dem für ihn zuständigen Prozessanwalt, Mr. Koo, getroffen, der gerade in Kyoto unterwegs war – anscheinend in gewissen Angelegenheiten, die ebenjenen Prozess betrafen. Jeremy hatte zu dem besonnen und sympathisch wirkenden Mitvierziger spontan Vertrauen gefasst, und die Aussichten, die Mr. Koo ihm bei Bier und Sake in der Karaokebar eröffnet hatte, elektrisierten ihn. Soviel Jeremy seinen Andeutungen hatte entnehmen können, ging es da um gewaltige Schweinereien eines international operierenden Pharmakonzerns, die dies bisher stets zu vertuschen gewusst hatte. Aber Mr. Koo war zuversichtlich, diesmal gewinnen zu können. Wenn er, Jeremy, ihm dabei half! Genau dafür war er ja Anwalt geworden: um für die Gerechtigkeit und das Gute zu kämpfen. Und plötzlich war er mittendrin im Heldenkampf. Wieder schwirrte ihm der Kopf.
Sakura, Sakura, Kirschblüten unter dem Frühlingshimmel.
So weit das Auge reicht.
Shanghai, 1. Mai 2012. 20:30 Uhr
Wenn die Korrespondentin eines bedeutenden Magazins zu einem festlichen Abendessen Gäste nach Hause einlädt, ist das immer auch mit Arbeit verbunden. Mit Stress und Versagensängsten. So viel konnte schiefgehen. Doch wenn sie sich jetzt in ihrem von Fackeln erhellten Innenhof umschaute, konnte sie durchaus zufrieden sein. Cathy besaß seit jeher ein Faible für bunte Mischungen. Sie hatte ihren etwas gewagten, scharf gewürzten Gästecocktail offensichtlich doch perfekt gemixt, und es war ein überraschend harmonisches Ganzes entstanden. Abgesehen davon, dass die Olive noch fehlte: Jeremy, der noch immer im Stau stand. Aber es ging auch ohne ihn. Die Gäste standen in Paaren oder kleinen Gruppen herum, Gläser in der Hand, übten sich im Smalltalk und schienen sich zu amüsieren. Einzig Chen, der etwas abseits auf einem Bistrostuhl saß, getrocknete Krebsschwänze und gedämpfte Shanghai Crabs in sich hineinschaufelte und nebenher in einem Stapel alter Vanity Fair-Hefte blätterte, wirkte wie üblich etwas isoliert. Aber wie er so dasaß und sich an seiner Tsingtao-Flasche festhielt, machte auch er einen recht zufriedenen Eindruck. Und es war ihm hoch anzurechnen, dass er heute in der Tat wild entschlossen schien, sich manierlich aufzuführen und allen potenziellen Fettnäpfchen aus dem Weg zu gehen.
Für Punkt 21 Uhr war das Abendessen angesetzt, das ein eigens für den Anlass engagierter Koch sowie zwei hübsche weibliche Bedienungen im großzügigen Speisezimmer der alten Villa anrichten würden. Vorweg ließ sie klassische chinesische Horsd’œuvres reichen. Dazu gab es Bier, Wein, Scotch, diverse Longdrinks und – als Besonderheit – auch Sake. Cathy hatte die Aufnahme des japanischen Nationalgetränks in ihr Getränkesortiment für eine clevere Idee gehalten, da sie, Jeremy zuliebe, auch ein japanisches Pärchen eingeladen hatte: Yoshi und Kumiko Satori. Kumiko war eine alberne Gans, die ständig kicherte und aus irgendeinem unerfindlichen Grund in einer unmöglichen Schulmädchenuniform gekommen war. Cathy ging ihr möglichst aus dem Weg. Jeremy, wäre er denn da gewesen, hätte sich ohnehin nur für ihren Ehemann Yoshi interessiert, der seit kurzem die Shanghaier Dependance der Waguni K.K. leitete. Obwohl wenig bekannt, sei das doch eine sehr wichtige Firma, hatte Jeremy ihr eingeschärft. Eine Sogo Shosha, wie man die berühmten japanischen Handelshäuser nennt, die von Chemikalien und Textilien bis hin zum Kernkraftwerk oder Flugzeugträger so gut wie alles besorgen können. Mit seinen 45 Jahren war Yoshi, ein schmallippiger dünner Mann, aus japanischer Sicht noch relativ jung. Natürlich war es für Jeremy ein großartiger Glücksfall, dass dieses einflussreiche Unternehmen gerade an ihm so interessiert war. Trotzdem ärgerte es sie plötzlich, diese wildfremden Leute auf ihrer Party zu haben. Soweit Cathy es beurteilen konnte, war auch noch keiner der Eingeladenen mit den Satoris warmgeworden. Toll, dass Jeremy so pünktlich war: wie immer, wenn sie ihn brauchte!
Die meisten anderen Gäste, Kollegen aus Zeitungs- und Fernsehredaktionen, kannten sich bereits. Da war etwa ihre beste Freundin Coco, die für die amerikanische Vogue die Laufstege Asiens abklapperte und es heute wie immer genoss, mit ihrer Konversationskunst und ihrem Aussehen eine andächtige Schar vornehmlich männlicher Zuhörer um sich zu sammeln. Oder Mei-Ling, eine etwa 50 Jahre alte, hagere Chinesin mit wasserstoffblonden Strähnen, die sich zur Feier des Tages in einen hautengen, schwarz glänzenden Latexoverall hineingequetscht hatte. Mei-Ling drehte seit zwei Jahrzehnten Independent-Filme. Ihr jüngstes Werk, Land der Töchter, war recht erfolgreich auf einigen internationalen Festivals gelaufen. Sie stand im Ruf, lesbisch zu sein, was für ihre Arbeit an diesem Film über das funktionierende Matriarchat des chinesischen Bergvolks der Mosuo in der Provinz Yunnan sicherlich von Vorteil gewesen war.
Mimi Koo stand im krassen Gegensatz zu Mei-Ling. Die hinreißend schöne Malaiin war mit Jeremys Vorgesetztem Richard verheiratet. Wann immer Cathy von taktlosen Bekannten auf den recht großen Altersunterschied zwischen ihr und Jeremy angesprochen wurde, verwies sie auf Mimi und Richard, zwischen denen die Kluft noch etliche Jahre breiter war, deren Ehe aber dennoch harmonisch zu funktionieren schien. Mimi stammte aus einem schwerreichen Elternhaus, und das sah man. Es hieß, allein ihre Armbanduhr, eine Sonderanfertigung des Hauses Bulgari, habe eine Million Dollar gekostet: das bescheidene Hochzeitsgeschenk ihres Vaters, eines malaiischen Reeders, der angeblich über beste Beziehungen zu den Piraten verfügte, die die Straße von Malakka mit ihren Schnellbooten unsicher machten. Seine Tochter stand heute als zweites Attraktionszentrum mit in der Gruppe um Coco, schien sich ein wenig zu langweilen und war wohl verärgert, dass ihr Mann noch nicht gekommen war. Der saß noch im Auto mit Jeremy.
Neben ihr stand der koreanische Werbefilmproduzent, wie immer sein Glas Perrier in der wohlgeformten, genauso schlanken wie kräftigen Hand. Aha, der scheint sich wohl auch von Coco bezirzen zu lassen. Na ja, vielleicht ist er ja was für sie. Coco steht auf animalische, athletische Typen. Als er sah, wie Cathy zur Gruppe hinüberblickte, löste er sich von Mimi und Coco und kam zu ihr herüber. »Na, wo bleibt denn dein Sugar Daddy so lange?«, fragte er mit der Miene eines Unschuldslamms.
Sie funkelte ihn an. »Du bist heute wieder sehr witzig, Kim«, meinte sie schnippisch. »Alte Männer sind eben nicht mehr so schnell, da muss man Geduld haben. Das hat auch seine Vorteile.« Wie sie es hasste, auf den Altersabstand zwischen ihr und Jeremy angesprochen zu werden! Gerade von Kim, der schließlich auch nicht mehr der Jüngste war, auch wenn er sich, zugegeben, sehr gut gehalten hatte. »Weißt du, ich habe Jeremy für heute ein wenig Ausgang gegeben, weil er die letzten Wochen so brav abgewaschen hat«, ergänzte sie scherzend, um im gleichen Atemzug Ming-Lei zu sich heranzuziehen und sie dem Produzenten vorzustellen. »Kennt ihr euch? Ihr arbeitet zwar auf verschiedenen Seiten, doch in derselben Branche. Vielleicht kannst du sie ja mal interviewen, Kim.« Und schon unterhielt sich die chinesische Vogelscheuche mit der koreanischen Testosteronbombe. So einfach ging das. Manchmal jedenfalls.
Die Standuhr in der Diele schlug neunmal. Genau jetzt hätte das Essen serviert werden sollen. Sie hatte dem Koch und seinen Mädels signalisiert, noch eine Viertelstunde zu warten. Jeremy fehlte noch immer. Vielleicht sollte sie ihn doch noch einmal anrufen. Als sie sich ihren Weg in den Flur gebahnt hatte, wo es ruhiger war, stieß sie auf Yoshi Satori, der vor dem Frisiertisch stand und musternd Jeremys grün-weißes Paket in den Händen hielt. Als er sie kommen sah, streckte er es ihr entgegen und meinte lachend. »Wusste ich es doch, dass es heute noch einen besonderen Anlass zu feiern gibt. Darf man schon gratulieren?« Er bemerkte, dass Cathy die Sache eher peinlich war, und schob rasch hinterher: »Aber eigentlich suche ich ja nur einen Ort, wo ich mir vorm Essen mal die Hände waschen kann.«
»Die Tür, vor der Sie jetzt stehen, ist jedenfalls der Ausgang«, informierte ihn Cathy mit einem Lächeln. »Die Toiletten sind auf der anderen Seite gegenüber.«
Satori bedankte sich und drückte ihr mit einer gezierten Verbeugung das Päckchen in die Hände, als handele es sich um sein Geschenk. Sie stand einen Moment nachdenklich, nahm dann die ominöse Sendung und schloss sie im Sekretär in der Diele ein. War doch keine so gute Idee gewesen, das Päckchen hier offen hinzulegen und so gleichsam alle Gäste schon beim Hereinkommen mit der Nase darauf zu stoßen, dass heute Nacht ihr Geburtstag war und sie keine Geschenke mitgebracht hatten. Etwas taktlos, Cathy! Jeremy ging noch immer nicht ans Telefon. Es würde doch wohl nichts passiert sein?
Von draußen im Hof hörte sie das schrille Geschnatter Kumikos und eine sich überschlagende hohe, ungehaltene Jungmännerstimme – Chen. Bitte nicht.
Bis Cathy im Innenhof angelangt war, hatte sich die Situation offenbar wieder etwas beruhigt. Kumiko und Chen standen sich schweigend an der Bar gegenüber und taxierten einander mit funkelnden Blicken. Chen war also, allen Versprechungen zum Trotz, doch ausfallend geworden. Während er die Japanerin finster anstarrte, schenkte er sich mit seiner bekannten demonstrativen Langsamkeit ein Weißweinglas voll Sake ein, schnupperte daran, täuschte ein kurzes Nippen vor, verzog angewidert das Gesicht – und leerte den gesamten Inhalt in den Ausguss. »Das Zeug ist ja widerlich, schmeckt wie Benzin. Warum schüttet ihr das nicht lieber gleich in eure Autos, wo euch doch eh längst der Sprit ausgeht?«
»Chen!«, rief Cathy dazwischen. Als er seine Cousine sah, stemmte er entrüstet die Arme in die Hüften. »Cathy, Cathy, wieso tischst du uns dieses entsetzliche Gesöff auf? Willst du uns alle vergiften? Japanischer Reiswein! Warum nicht der gute Shao Xing aus China? Das muss ich jetzt aber gleich kräftig mit Bier runterspülen.« Er griff sich eine weitere Pulle aus dem dahinschmelzenden Scherbeneis.
»Vielleicht solltest du stattdessen lieber nach Hause gehen. Ich zahl dir das Taxi.« Sie hätte ihn doch besser im Auge behalten sollen. Während er scheinbar friedlich herumsaß, hatte er vielmehr die Zeit genutzt, sich unverschämt rasch einen Affen anzutrinken. Und dann wurde er unleidlich, das wusste Cathy. Da entwickelte er ein geradezu dämonisches Vergnügen daran, andere zu provozieren und bevorzugt alle Nichtchinesen mit seinen chauvinistischen Thesen vor den Kopf zu stoßen. Frau Satori wirkte allerdings auch nicht mehr ganz nüchtern. Sie schien sich mehr über Chen zu amüsieren, als wirklich beleidigt zu sein. »Du bist aber lustig, Kleiner!«, kicherte sie. »Gehst du schon zur Schule?«
Hinter Cathy erschien plötzlich Yoshi Satori und griff seine Frau etwas unsanft am Arm, was sie sofort verstummen ließ. »Immerhin darf er schon Bier trinken und damit unsere verdienstreiche Getränkeindustrie unterstützen, auch wenn er keinen Sake mag«, sagte Yoshi Satori und verbeugte sich knapp vor Chen, der die höfliche Geste mit einem angedeuteten Kratzfuß persiflierte. Satori runzelte die Stirn. »Mit wem haben wir das zweifelhafte Vergnügen?«
»Chen Wong. Ich bin Cathy Wongs Cousin. Cathys chinesischer Cousin!«
»Na, dann zum Wohl«, sagte Satori und deutete auf Chens schon wieder halb geleerte Flasche. »Chinesisches Bier«, betonte Chen. »Chinesische Getränkeindustrie.«
»Natürlich«, erwiderte Satori, der kein Interesse daran hatte, die Situation eskalieren zu lassen. Trotzdem verspürte er eine brennende Neugierde, diesen chinesischen Feuerkopf ein wenig auszutesten