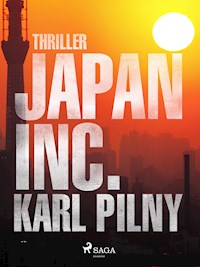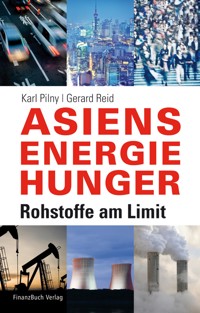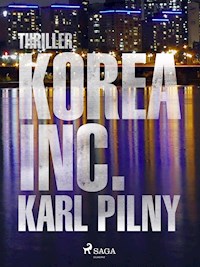
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Anwalt Jeremy Gouldens, den Thrillerfans bekannt aus Japan Inc., die attraktive Schauspielerin Mie kennenlernt, glaubt er sich am Ziel seiner Träume. Doch unvermittelt sieht er sich einem undurchschaubaren Netz aus politischen Verwicklungen, Mord und Intrigen gegenüber, dessen Fäden von Deutschland in die Schweiz führen und schließlich in beiden Koreas zusammenlaufen. Fragen über Fragen stellen sich: Wie weit sind Schweizer Banken in Geldwäsche und Atomgeschäfte verwickelt? Welchen schmutzigen Deal plant eine südkoreanische HightechFirma mit dem Norden? Was verbirgt sich wirklich hinter der undurchdringlichen Fassade, die das Regime in Pjöngjang aller Welt präsentiert und mittels Propaganda und Gehirnwäsche auch vor dem eigenen Volk aufrechterhält? Als Jeremy Gouldens versucht, den Schleier zu lüften, blickt er in ein abgründiges Grauen. Der Politthriller der Extraklasse geht in die zweite Runde. Wieder überzeugt Karl Pilny durch seine intime Kenntnis der Region. Sein Buch ist eine einzigartige Mischung aus hochbrisanten Fakten, topaktuellen Begebenheiten und beklemmend realistischer Fiktion.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1173
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Pilny
Korea Inc.
Thriller
Saga
Prolog
Berlin fror.
Der verharschte Schnee an den Seiten der Boulevards türmte sich noch, grau und schmutzig, doch tagsüber zeigte die Sonne bereits, wie sich Frühling anfühlen könnte. Kurz nach Mittag war an diesem Februartag das Brandenburger Tor in strahlend kaltes Licht getaucht.
Wer vom Brandenburger Tor unter den Linden entlangflaniert, erreicht in zwanzig Minuten die große Baustelle am Schlossplatz. Hier hatte sich sechzig Jahre zuvor, als rings die Stadt in Trümmern lag, noch das gewaltige Stadtschloss erhoben, das 1950 gesprengt wurde, um dem riesigen Palast der Republik Platz zu machen. Nachdem man „Erichs Lampenladen“ Stein um Stein abgetragen hatte, sollte dort nun das Stadtschloss wiederauferstehen – ganz, als seien die Jahrzehnte von Zerstörung und Wiederaufbau, der Umbrüche und brutalen Ideologiewechsel nichts als ein unruhiger Traum gewesen.
Wenige Meter nördlich, hinter dem großen Dom – einst gewissermaßen die kaiserliche Hauskapelle des Hohenzollernschlosses –, befindet sich an der Spree eine der vielen Haltestellen der Berliner Ausflugsdampfer. Bei der kleinen Stadtrundfahrt fährt man die Innenstadt ab: zunächst spreeabwärts bis zum Reichstag und danach spreeaufwärts an der Museumsinsel vorbei bis nach Treptow.
Ebendiesen Weg hatte heute die „Alexander von Humboldt“ eingeschlagen. Das großzügig ausgestattete Ausflugsschiff zog seine gewohnte Pendelroute durch das Herz der Metropole. Hinter den Panoramafenstern des schwimmenden Salons blickten Touristen aus aller Welt auf das winterliche Berlin hinaus: Straßen, Brücken, Häuser, historische Stätten; winterlich graue Grünflächen dazwischen. Bauten. Zeichen. Chiffren. Manche Fassaden trugen Aufschriften. Vom Grill Royal leuchtete Love herüber, in unwirtlichem Blau glitt DDR Museum vorbei, dann eine blutrote Leuchtschrift: Capitalism kills.
Schließlich war die Oberbaumbrücke passiert und die Skulptur des „Molecule Man“, die am Zusammentreffen der Stadtteile Friedrichshain, Kreuzberg und Alt-Treptow dreißig Meter aus dem Wasser ragt, markierte den Wendepunkt. Die „Alexander von Humboldt“ drehte bei. Während an den gemütlich im Salon sitzenden Passagieren das wechselnde Panorama vorbeizog, befand sich auf dem Sonnendeck darüber an diesem frostigen Februartag kein Mensch. Fast keiner.
Dann tauchte das kleine Mädchen auf. Gelangweilt war sie durchs Schiff geschlendert, hatte an einer Tür gerüttelt, vor der ein Schild hing, das sie nicht lesen konnte. Sehr zu ihrer Freude hatte die Tür sich geöffnet, und nun war sie hier oben, genoss zitternd die Sonnenstrahlen und den kalten Wind. Endlich das Abenteuer, das Papi ihr versprochen hatte. Ob er sie wohl schon vermisste?
Sie stellte sich an die Reling und sah über die Kulisse der vorbeiziehenden Großstadt hinaus. Das Schiff näherte sich dem steinernen Gewölbe der Schillingbrücke. Die dunkle Brücke machte dem Mädchen Angst. Sie warf lange Schatten. Wie der Eingang in einen Tunnel. Und jetzt kam die Decke so nah, als wollte sie sich auf sie herabstürzen. Instinktiv zog das Mädchen den Kopf ein. Vielleicht sollte sie lieber zurück nach unten gehen.
Aber schon wieder blauer Himmel über ihr. Am Horizont ragte am Alexanderplatz der Fernsehturm. Um den hohen Turm besser sehen zu können, schlenderte sie in Richtung Bug. Aber da war noch ein Häuschen mit großen Fenstern, in dem ein Mann saß, den Blick starr nach vorn gerichtet. Was machte der da?
Sie fasste das niedrige Häuschen genauer ins Auge und nun sah sie etwas Verwunderliches. Ein paar Schuhe. Schwarz. Oben auf dem Dach des Häuschens. Schuhe in einer gleichfalls schwarzen Hose. Kein Zweifel, da oben lag jemand. Schlief er? War er krank? Es schien ihr nicht richtig, dass da oben jemand lag.
Das Schiff glitt unter einer weiteren Brücke hindurch. Gut, dass der Mann dort oben lag, jetzt hätte er nicht aufstehen dürfen.
Da hörte sie Rufe von unten. Ein aufgelöst wirkender Mann kam auf Deck gestürzt. Als er das Mädchen sah, trat ein erleichterter, dann zorniger Blick auf sein Gesicht. „Ich hab dich überall gesucht. Du darfst doch nicht einfach fortgehn. Komm sofort mit runter.“
„Aber hier ist es so schön, Papi. Und der Wind ist lustig.“ – „Aber man darf heute gar nicht hoch. Da unten ist ein Schild. Mich wundert, dass die Tür nicht abgeschlossen war.“ – „Da vorn in dem Häuschen ist doch auch jemand.“ – „Das ist aber der Kapitän, der das Schiff führt.“ – „Und wer ist das auf dem Dach?“ – „Wie bitte?“ – „Schau doch, die schwarzen Schuhe!“ – „Tatsächlich, das ist aber ...“ Ein beunruhigter Ausdruck trat in sein Gesicht. Er ging auf die Kapitänskajüte zu, in deren Innern der Schiffsführer ungerührt nach vorn blickte. „Hallo? Alles in Ordnung mit Ihnen?“
Erst als er seine Frage wiederholt hatte, richtete sich die Gestalt auf dem Kajütendach auf. Sie war ganz in Schwarz gekleidet und wirkte wenig erfreut, Vater und Tochter hier oben auf dem Sonnendeck zu sehen. Das Mädchen fand, dass die schwarze Gestalt mit der komischen Kapuze über dem Kopf ausgesprochen böse blickte. Wie ein Teufel. Und die Augen waren komisch.
Hinter der schwarzen Gestalt kam die nächste Brücke näher. Besonders niedrig, dunkel, breit. Der Teufel vor dem Tor zur Hölle.
Die Gestalt zischte etwas Bedrohliches. Aus einer Sporttasche neben sich hatte sie einen ovalen Gegenstand gezogen. Was war das? So was hatte das Mädchen noch nie gesehen. Ihr Vater offenbar schon, denn er stieß einen erschreckten Schrei aus, der jedoch vom ohrenbetäubenden Quietschen der Bremsen eines auf den Schienen rechts der Spree vorbeifahrenden Zuges weitgehend verschluckt wurde. Er stürzte auf die schwarze Gestalt zu, stemmte sich aufs niedrige Kajütendach, versuchte, ihr das Ding aus der Hand zu reißen. Die schwarze Gestalt war viel kleiner, aber drahtig und durchtrainiert. Es gab ein kurzes Handgemenge; dann riss sich die Gestalt los, duckte sich rasch nach hinten weg. „Papi!“, schrie das Mädchen.
Aber da war die Brücke schon zur Stelle, hatte ein grauer Stahlträger seinen Kopf gerammt und seitlich weggerissen. Mit blutigem Schädel klatschte der Mann in die Spree. Wie in Zeitlupe legte sich der Schatten der Brücke über alles.
Mit einer lichten Höhe von vier Metern gehört die Jannowitzbrücke zu den niedrigsten Brücken im Berliner Stadtzentrum.
Die schwarze Gestalt rutschte vom Kajütendach. Jetzt musste alles schnell gehen. In seiner Kajüte hatte der Kapitän endlich gemerkt, dass um ihn herum etwas vorging. Doch er konnte die Geräusche nicht einordnen und das Dämmerlicht unter der Brücke erschwerte die Orientierung. Schon war die Gestalt in die Kajüte gehuscht.
Als das Schiff Sekunden später die Brücke passiert hatte, saß am Steuer eine kleine, schwarze Gestalt. Hinter ihr lag ein menschlicher Körper. Die stoßweise aus seinem Hals quellende Fontäne wurde schwächer, erlosch, ging in ruhiges Fließen über. Die schwarze Gestalt am Steuer davor spähte angestrengt nach Backbord.
Dort, am Ufer der Spree, thronte wie ein gestrandetes Raumschiff ein mächtiger Achtziger-Jahre-Bau. Silbrig und hellblau spiegelten sich die Strahlen der Februarsonne in den kalten Metallkacheln der Fassade. Ein abweisender Koloss, ein Riesenwesen aus einer anderen Galaxie, das sprungbereit geduckt am Ufer zu lauern schien. Eine Anzahl dunkel gekleideter Herren, gerade nach draußen getreten, stand auf dem Vorplatz. Das große Gebäude mit seinen sieben Stockwerken war in den letzten Tagen der DDR als Sitz des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes errichtet worden. Seit über einem Jahrzehnt beherbergte es nun die chinesische Botschaft. Von einer Säule rechts am Portal blickte reglos die Plastik eines chinesischen Wächterlöwen über den drei Meter hohen Hochsicherheitszaun, der den Vorplatz umgab, sowie über den im Moment unbesetzten kleinen Polizeistand jenseits der Straße Märkisches Ufer auf die Spree hinaus.
Entschlossen riss die kleine, schwarze Gestalt das Steuer herum, zog einen scharfen Bogen durch die beckenartige Erweiterung der Spree hinter der Brücke, lenkte das Schiff bedenklich nahe an der Ufermauer wieder auf die Brückenbögen zu. Dann sprang sie aufs Sonnendeck hinaus. In der linken Hand hielt sie den ovalen Gegenstand. Im letzten Moment bevor das Schiff wieder unter die Brückenbögen glitt, holte sie aus und warf ihn mit athletischer Kraft und geschulter Präzision in einem hohen Bogen hinüber.
Augenblicke später ein donnerndes Geräusch. Vom Botschaftsgebäude her erhebt sich ein blitzender Feuerball und dicker Rauch.
Schon ist das Schiff unter der Brücke hindurch. Die schwarze Gestalt wendet sich um, zieht ein Messer, Blut frisch an der Klinge. In wenigen Sekunden muss das Schiff mit der Ufermauer kollidieren. Der Zeitpunkt dieses Zusammenstoßes sollte später auf exakt 13.02 Uhr datiert werden. Mit dem Blutmesser in der Hand tritt die schwarze Gestalt an das Mädchen heran, das nichts von alledem begriffen hat.
Nur, dass etwas Schreckliches geschehen ist. Wo ist Papi?
Das Mädchen schluchzt. Der schwarze Teufel kommt näher, hebt das verschmierte Messer. Das Mädchen starrt dem schwarze Teufel in die Augen. Aus Kleinemädchenaugen, in denen endlich die ersten Tränen perlen. Die schwarze Gestalt zögert kurz, flucht unverständlich und springt über die Reling hinab in die eiskalte Spree.
Erst jetzt beginnt das Mädchen brüllend zu weinen.
Erster Teil
Der Film
Einen Tag zuvor, Berlin, Hotel Grand Hyatt
„Ach, entschuldigen Sie, wie ungeschickt von mir.“
Der großgewachsene Mann mit den graublauen Augen hatte, während er sich suchend im Raum umsah, durch eine allzu heftige Ellbogenbewegung aus Versehen eine neben ihm vorbeieilende Gestalt gerammt, die ihrerseits seine Bewegung nicht bemerkt hatte, da sie gerade angestrengt damit beschäftigt war, bei ihrer erhöhten Geschwindigkeit nichts von dem randvollen Champagnerkelch in ihrer rechten Hand zu verschütten – eine Bemühung, die jene ruckartige Ellenbogenbewegung nun zum Scheitern verurteilt hatte.
„Tut mir sehr leid, ich hab Sie nicht gesehen.“ Mit verkniffener Miene blickte er ins zornige Gesicht einer hochgewachsenen Blondine mit schulterlangem Haar und einer Nase, die ihn, wiewohl im Grunde nicht unhübsch, eigentümlich an ein Ferkel erinnerte. Mit Erleichterung nahm er zur Kenntnis, dass er nur einige Tropfen über den Ausschnitt ihres schulterfreien Glitzerkleides verschüttet hatte, das ihren üppigen Busen ein wenig zu sehr zur Geltung brachte.
Das nun nicht mehr ganz randvolle Champagnerglas fest in der Hand, funkelte ihn die große Blonde zornig an. Dann rümpfte sie verächtlich die Ferkelnase, schimpfte etwas auf Deutsch, was der kantige Brite nicht recht verstand – „Schieb ab, Trottel“? – und verschwand hinter ihren drei schick gekleideten männlichen Begleitern, die sich nun dicht um sie scharten, um ähnliche Kollisionen fortan tunlichst zu vermeiden. Dann war sie auch schon davongerauscht. Die Dame hatte es offensichtlich eilig, sich in eine der geschlossenen Gesellschaften in den verschiedenen Konferenzräumen des ausgebuchten Hotels zu begeben.
Jeremy Gouldens war sich sicher, die nicht mehr ganz jugendfrische Blondine schon einmal irgendwo gesehen zu haben. Aber woher kannte er sie nur? Eine typisch deutsche Walküre – vielleicht Sängerin in Bayreuth? Nein, nein. Er fuhr durch sein dünner werdendes, graumeliertes Haar, kratzte sich. Dann, als er begriff, schlug er sich mit der Hand an die Stirn. Nebenan im Theater am Potsdamer Platz feierte die Berlinale ihren letzten Abend, und er war im Hotel nun wirklich nicht der Einzige, der etwas mit der Filmindustrie zu tun hatte – vermutlich war es heute sogar schwer, überhaupt jemanden zu finden, der nicht auf die eine oder andere Weise mit der Medienwelt zu tun hatte. Ein Großteil der nationalen und auch ein Teil der internationalen Filmprominenz war in Berlin zu Gast – selbst George Clooney sollte gesichtet worden sein –, und natürlich konnte Jeremy die große Blonde nur irgendwo auf der Leinwand oder dem Bildschirm gesehen haben. Schließlich hatte er sich in den letzten Jahren, seit er häufig in der Schweiz war und viel mit Deutschen zu tun hatte, jede Menge deutsche Filme angesehen, schon um seine eingerosteten Sprachkenntnisse aufzubessern. Ach, kam ihm jetzt, war das nicht vielleicht diese Schauspielerin gewesen, die immer die tapfere Heldin ist und am Ende die Welt oder zumindest irgendwelche verfolgten Kinder, Flüchtlinge, Wale rettet? Wahrscheinlich hatte die bedeutende Dame seinen Rempler für die plumpe Anmache eines Autogrammjägers gehalten.
Wie auch immer, Jeremy hatte für große, blonde, europäische Schauspielerinnen momentan keinen Bedarf, selbst wenn sie erfahrene Weltenretterinnen waren. Er war auf der Suche nach einer eher zierlichen, schwarzhaarigen Schauspielerin mit asiatischen Zügen. Mit genau so einer sollte er heute nämlich verabredet sein.
Er sah auf die Uhr. Galten Koreaner nicht als besonders pünktlich? Ihm selbst war jedenfalls eingeschärft worden, bei Geschäftsterminen mit Koreanern immer pünktlich zu erscheinen. Nun gut, ein wirklich offizielles Treffen war der Termin heute auch wieder nicht.
Erneut ließ er seinen Blick über das in der Lobby versammelte internationale Publikum schweifen. Die Frauen schienen einander an Putz und Kleiderpracht übertreffen zu wollen; daneben wirkten die Herren in ihren dunklen Anzügen, an denen die Krawatte meist das Bunteste war, eher farblos und unauffällig. Seltsam, dachte Jeremy, dass es bei den Menschen in Sachen Schmuck und Schönheit genau umgekehrt ist wie bei Pfauen, Paradiesvögeln, Zierfischen oder fast überall sonst in der Tierwelt, wo das Männchen stets das auffälligere, buntere Wesen ist. Aber, Jeremy sei ehrlich, ist es im Grunde nicht gut so? Seitlich in der Tizian Lounge drängte sich das feiernde Publikum aus mehr oder weniger prominenten Gästen und sonstigen Medienmenschen, vermischt mit allerlei Schaulustigen beim „Celebrity spotting“. Durch die Kollision mit der Weltenretter-Walküre neugierig gemacht, vertiefte er sich in die wechselnden Bilder und Szenen vor seinen Augen und meinte nun, weitere vertraute Gesichter ausmachen zu können. Fast hatte er das Gefühl, sich selbst mitten in einem Film zu befinden. Als Statist? Oder würde nun gleich jemand mit einer Frage an ihn herantreten und die Kamera genau auf ihn zoomen?
Ach ja, der Film. Sein Film. Seit langem lag das Drehbuch zu seinem halbautobiografischen Filmprojekt Yellow Submarine in Jeremys Schublade – sowie in einigen anderen Schubladen von Produzenten, Agenten, Regisseuren, Schauspielern –, aber der Beginn der Dreharbeiten verzögerte sich weiter. Jeremy war eigens nach Berlin geflogen, in der Hoffnung, beim Filmfestival der Sache vielleicht den entscheidenden Ruck zu geben, aber nun war der letzte Berlinale-Abend gekommen und es hatte sich kein Erfolg eingestellt. Jeremy wusste, dass auch er an den Verzögerungen seinen Anteil hatte; vor allem mit seiner Pingeligkeit in gewissen Besetzungsfragen hatte er sich selbst Stolpersteine in den Weg gelegt.
„Ah, der sehr verehrte Herr Jeremy Gouldens, da sind Sie ja endlich!“ Der kleine dickliche Asiate mit seiner schrillen Krawatte legte die Hände an die Seite und machte eine betont tiefe Verbeugung. Jeremy wusste, dass J. D. Lee, der lange in Amerika gelebt hatte und nun seit Jahren in Hongkong residierte, äußerlich zwar viel Wert auf die traditionellen koreanischen Höflichkeitsformen und -formeln zu legen schien, sie in Wirklichkeit aber nur eher ironisch zitierte – vergleichbar einem älteren Wiener, der einer steifen Hamburger Dame scherzhaft einen Handkuss gibt. J. D. Lee war einer der albernsten Menschen, denen Jeremy je begegnet war, und doch tat er alles, was er machte, so lächerlich es auch sein mochte, im vollsten Ernst und ohne jemals zu lachen, so dass sich Jeremy manchmal fragte, ob sich J.D. dieser Lächerlichkeit überhaupt bewusst war. Trotzdem war er in seiner Arbeit ein hervorragender Mann; ein quirliger Mensch mit jeder Menge Kontakten, einer unermüdlichen Energie und einem sprühenden Ideenreichtum. An J. D. lag es jedenfalls nicht, dass die Umsetzung des Filmprojekts ins Stocken geraten war.
„Wo haben Sie denn gesteckt, ich habe Sie schon überall gesucht!“, fuhr der kleine Koreaner fort und runzelte dabei die Stirn, was spielerisch wirkte, ohne dass Jeremy sich da hätte sicher sein können.
Jeremy verkniff es sich, „Das Gleiche wollte ich Sie gerade fragen“ zu sagen, auch wenn es stimmte. Er hatte seit zwanzig Minuten mit seinen unübersehbaren 1,85 Metern hier am Empfang gestanden und die Eingangstür im Blick gehabt, und das konnte sich J. D. auch denken. Dem Koreaner war es offenbar lieber, eine Lüge in den Raum zu werfen, als sich für seine Unpünktlichkeit zu entschuldigen. Jeremy hakte die Sache ab, indem er sie unter dem Oberbegriff „Mentalitätsunterschiede der Völker“ katalogisierte – was diesen Punkt betraf, hatte er während seiner Aufenthalte in Ostasien so viele Erfahrungen gemacht, dass ihn nichts mehr wunderte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!