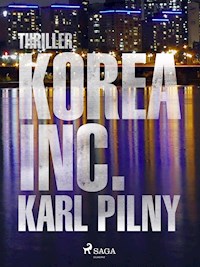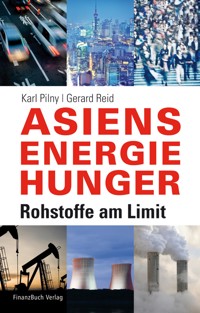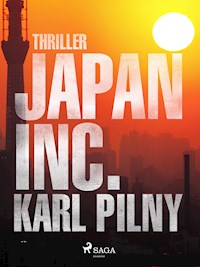Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2008
In Asien spielt die Musik der Märkte des 21. Jahrhunderts. China und Indien stehen dabei im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Doch welche Rolle spielen die kleineren südostasiatischen Staaten wie Singapur, Thailand und Indonesien, die ebenfalls zum großen asiatischen Wirtschaftsraum gehören?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.campus.de
Pilny, Karl
Tiger auf dem Sprung
Politik, Macht und Märkte in Südostasien
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2008. Campus Verlag GmbH
Besuchen Sie uns im Internet: www.campus.de
E-Book ISBN: 978-3-593-40474-5
|4|Für meine Familie
|10|Prolog
Allen periodischen Rückschlägen und Risiken zum Trotz wird sich das globale wirtschaftliche und politische Gravitationszentrum bis zur Mitte dieses Jahrhunderts dahin verschieben, wo es zuvor schon viele Jahrhunderte lang war: nach Asien.
Diese Grundannahme meines vor drei Jahren erschienenen Buches Das asiatische Jahrhundert – des ersten von drei Bänden zum Thema – ist bislang nicht widerlegt worden. Im Gegenteil: Der im zweiten Band der Trilogie, Tanz der Riesen, beschriebene unaufhaltsame Aufschwung von Indien und China – Chindia – geht unvermindert weiter. In welchem Ausmaß die beiden Riesen zusammen tanzen werden, ist noch nicht ganz abzusehen. Es wäre jedoch zu kurz gedacht, sich nur auf den phänomenalen Aufstieg der beiden bevölkerungsreichsten Länder der Erde zu konzentrieren. Selbst wenn man Japan als die trotz aller Stagnation nach wie vor zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mitberücksichtigt, wird man dennoch nicht der Dimension und Dynamik von Gesamtasien gerecht. Neben den »alten Tigerstaaten«, die in den neunziger Jahren bis zur Asienkrise 1997 die Schlagzeilen dominierten, beherbergt das Dickicht der Weltwirtschaft noch etliche andere Raubkatzen, eben die »Tiger auf dem Sprung«.
»Indonesien: das neue Indien«, »Vietnam: das neue China« – so die immer häufiger zu hörenden Formeln zur Erfassung eines Phänomens, das sich nicht nur auf einzelne Länder erstreckt.
Asien ist seit einigen Jahren mit durchschnittlich 7 Prozent pro Jahr die weltweit am schnellsten und nachhaltigsten wachsende Region und beheimatet mit seinen rund vier Milliarden Einwohnern rund 60 Prozent der Weltbevölkerung. Auf dem flächenmäßig größten Kontinent sind die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt, |11|China und Indien, wobei Letzteres in der Mitte des Jahrhunderts mit 1,6 Milliarden dann China mit 1,4 Milliarden überholt haben dürfte. In der gleichen Zeit wird die Bevölkerung Europas von heute 730 Millionen auf dann 650 Millionen Einwohner schrumpfen.
Schon heute trägt Asien nach Berechnungen der Weltbank ein Drittel zum globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei, bis 2040 sollen es mehr als 60 Prozent sein. Es gibt guten Grund zur Annahme, dass im Jahr 2050 drei der vier größten Wirtschaftsmächte aus Asien kommen, nämlich China, Indien und Japan.
Nach einer Studie der Deutschen Bank wird bis 2020 hohes Wirtschaftswachstum vornehmlich in Asien erzielt: Indien, Malaysia und China sollen danach mit einem durchschnittlichen Wachstum von 5 bis 6 Prozent pro Jahr die am nachhaltigsten und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften weltweit sein. Ohnehin sind unter den zwölf in den letzten 25 Jahren am schnellsten gewachsenen Volkswirtschaften zehn aus Asien.
Ausmaß und Auswirkungen des Wirtschaftswachstums in Asien suchen in der Geschichte ihresgleichen, bedeuten aber letztlich nur eine Wiederherstellung der vorkolonialen Ausgangssituation, als Asien noch am Anfang des 19. Jahrhunderts einen größeren Anteil an der weltweiten Industrieproduktion hatte als die USA und Europa zusammengenommen.
Es ist nachvollziehbar, dass das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis in den zum Teil noch jungen asiatischen Staaten – aber auch in denen, die zu den ältesten der Menschheitsgeschichte gehören – genauso schnell wachsen wie die Wirtschaft.
Das aus dem Assyrischen stammende Wort »Asien« (»Sonnenaufgang«) bezeichnet keinen homogenen Erdteil, sondern im Osten des sogenannten Abendlandes gelegene Gebiete. Dieser abstrakte Begriff umfasst also eine Vielzahl von unterschiedlichsten geografischen, ethnischen, religiösen und sprachlichen Regionen auf dem größten und bevölkerungsreichsten Kontinent der Erde. Das Zusammenwachsen der asiatischen Staaten – politisch und wirtschaftlich –, das begleitet wird von einem Aufkeimen einer asiatischen Identität, und nicht zuletzt die starken Emotionen, die der vermeintliche asiatische »Angriff|12|« in Europa auslöst, waren ausschlaggebend für meinen Versuch, in einer Trilogie Asien als Ganzes zu betrachten.
Während sich die ersten beiden Bände Ostasien – streng genommen Nordostasien – und Südasien widmeten, liegt im vorliegenden Band der Fokus auf den zwischen Indien und China gelegenen, früher »Hinterindien« oder »Indochina« genannten Ländern. »Zentralasien«, das für den Austausch abendländischer und orientalischer Kultur über die Seidenstraße eine grundlegende Rolle spielte, muss aus Platzgründen hier ausgeklammert werden. Das Gleiche gilt für West- und Kleinasien.
Am Ende der Betrachtung Südostasiens wird eine Gesamtschau aller drei Teile Asiens zeigen, ob das asiatische Jahrhundert schon begonnen hat, welche weitere Entwicklung zu erwarten ist und welche konkreten Auswirkungen dies auf uns hat: Wird es wirklich zu einem weltweiten Krieg um Wasser, Wissen und Wohlstand kommen? Oder hält der Wiederaufstieg Asiens auch Chancen und Möglichkeiten für uns alle bereit?
Mit all seinen Extremen, Superlativen, Widersprüchen, mit all der Größe, Fülle und Vielfalt stellte und stellt Asien den idealtypischen Spiegel unserer Hoffnungen, Ängste, Versäumnisse und Sehnsüchte dar. Gleiches gilt auch für die Asiaten: Der Spiegel wirft uns letztlich auf beiden Seiten auf uns selbst zurück.
|13|Teil I: Woher?
|15|Historischer Abriss
Die Wahrnehmung Südostasiens als einheitlicher historischer Raum ist noch relativ jung und findet eigentlich erst seit dem Vietnamkrieg statt. Davor wurden im Deutschen geografische Bezeichnungen wie »Indochina« oder »Hinterindien« verwendet, die allerdings nicht die gesamte Region umfassten. Dennoch verweisen sie darauf, dass sich in Südostasien die Dominanzen der indischen und der chinesischen Kultur über Jahrhunderte immer wieder abwechselten, ergänzt durch arabischen und später europäischen Einfluss. Neben den sich auf den Reisanbau stützenden Agrarstaaten existierten hier Handelsstaaten, deren Basis der Seehandel und manchmal die Piraterie bildete.
Diese sicherlich vielfältigste und von Gegensätzen geprägte Region Asiens besteht aus einem festländischen und einem insularen Teil. Der Festlandssockel mit den heutigen Staaten Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Myanmar sowie Singapur und einem Teil Malaysias ist durch die Malaiische Halbinsel wie durch eine Brücke mit den Inselarchipelen von Indonesien, den Philippinen und Brunei kulturgeschichtlich verbunden.
Aufgrund der geografischen und historischen Vielfalt der Region ist es schwierig, eine geregelte Abfolge von Epochen auszumachen. Doch kann man im Wesentlichen vier geschichtliche Perioden unterscheiden:
Zwischen dem 1. und 13. nachchristlichen Jahrhundert gab es eine Vielzahl regionaler Königreiche, die nach stetiger Expansion und Konsolidierung zu zentralisierten Flächenstaaten heranwuchsen.
Durch die Südwärtswanderung der Thai-Völker, mitausgelöst durch die Mongoleneinfälle im 13. Jahrhundert, kam es im 14. und 15. Jahrhundert zum Aufstieg der Thai-Staaten.
|16|ϳϳNach deren Schwächung im 16. bis zum 20. Jahrhundert erfolgte die Herausbildung moderner Territorialstaaten, die parallel zum Anwachsen des europäischen Einflusses verlief, welcher in der Kolonialisierung großer Teile der Region gipfelte.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der in ihm erfolgten japanischen Besetzung kam es zu einer Dekolonialisierung und der Herausbildung der größtenteils noch heute existierenden Nationalstaaten.
1. Regionale Königreiche
Eines der Zentren der frühen Geschichte Südostasiens lag im nördlichen Vietnam, wo im 2. Jahrhundert vor Christus mit dem Reich Au Lac und dem Nordvietnam und Südchina umfassenden Nanyue Urbanisierung, Fortschritte in der Landwirtschaft und überregionaler Handel einsetzten.
Diese von der chinesischen Han-Dynastie eroberten Gebiete wurden als Provinz Giau Chi bezeichet, die ab dem 7. Jahrhundert zu einem chinesischen Protektorat namens An Nam (»befriedeter Süden«) umgewandelt wurde. In der Folge wechselten sich verschiedene Dynastien ab.
Im Gegensatz zu dem dank des chinesischen Einflusses regen Staatsbildungsprozess im nördlichen Vietnam begann dieser im Süden erst im 9. Jahrhundert auf der Grundlage der reichen Reiskammern in den Tiefebenen am Mekong und Irrawady.
Im unteren Mekongtal siedelten die Khmer, die nach einer Reihe von lokalen Fürstentümern im 9. Jahrhundert mit dem Reich von Angkor einen mächtigen Bewerber um die Hegemonialmacht auf dem südostasiatischen Festland schufen. Die Tempelanlage von Angkor Wat war dem hinduistischen Gott Vishnu geweiht und lag unweit der Hauptstadt Angkor Thom. Das streng hierarchische Imperium verband das Gottkönigtum mit einer effizienten Bürokratie, und dank des lukrativen Reisanbaus und regen Handels war dieser nach dem sogenannten mandala-Prinzip organisierte Staatenkreis auch sehr wohlhabend.
|17|Ein ganz ähnlicher Prozess der Urbanisierung und Staatenverdichtung fand im Tal des anderen großen Stromes, des Irrawady statt. Der Aufstieg des birmanischen Reiches von Pagan brachte ab dem 9. Jahrhundert einen mächtigen Mitbewerber um die Macht auf dem Festland. Doch beide Reiche, das hinduistische der Khmer und das buddhistische von Pagan, fielen schließlich den Mongolenstürmen des 13. Jahrhunderts sowie dem Aufstieg anderer lokaler Reiche zum Opfer.
2. Aufstieg der Thai
Die stärksten dieser neuen Mitspieler brachte insbesondere das Gebiet des heutigen Thailands hervor.
Aufgrund der kulturellen historischen Nord-Süd-Achse in China galt für Jahrhunderte die Region südlich des Yangtse-Stromes als ferne unwirtliche Region. Dieses Land diverser Barbarenstämme und hier angesiedelter Strafgefangener wurde yueh genannt, aus dem später die Bezeichnung viet hervorging.
Aufgrund einer massiven Besiedlungspolitik während der Han-Dynastie wurden ab dem 1. Jahrhundert jedoch die ursprünglich hier lebenden, miteinander verwandten Völker der Shan, Thai und Lao entlang der großen Flüsse immer weiter nach Süden gedrängt. Während die Shan in Assam und in Birma ansässig wurden, gelangten die Thai in das Gebiet des heutigen Thailand und des Mekongdeltas.
Die in den Süden vordringenden chinesischen Siedler vermischten sich mit den yueh und stellten in der Folge den Hauptanteil der Überseechinesen, die in mehreren Wellen zwischen dem 13. und dem 19. Jahrhundert in benachbarte südostasiatische Länder auswanderten und dort wirtschaftlich sehr erfolgreich wurden. Diese Gruppen der Hokkien-, Teochiu-, Hokchiu-Dialekt sprechenden chinesischen Familienclans organisierten sich in sogenannten kongsis, eine Mischung aus Unternehmen, Kollektiv und Familienverbund, die bis zum heutigen Tag großen wirtschaftlichen und politischen Einfluss in den jeweiligen Gastländern gewährleisten.
Nach ihrer Verdrängung aus dem Süden Chinas siedelten sich im |18|heutigen Thailand erfolgreich die Thai an. Mit Sukothai entstand kurz nach den Mongoleneinfällen in den 1270er Jahren ein erstes überregionales Thai-Reich; dieses wurde jedoch wie das parallel im Norden Thailands, bei Chiang Mai, entstandene Lan-Na-Reich vom Reich Ayuthaya überstrahlt.
Die 1351 von einem chinesischen Kaufmann gegründete gleichnamige Hauptstadt erblühte schnell und stellte schon bald eine ernste Rivalin für das Khmer-Reich dar. Doch die von dem Kaufmann unter seinem Herrschernamen Ramathibodi begründete Dynastie betrieb eine gleichermaßen aggressive wie erfolgreiche Eindämmungspolitik. Nachdem Sukothai unterworfen wurde, führten die wiederholten Angriffe Ayuthayas 1431 schließlich zu einer Verlegung der Hauptstadt des Khmer-Reiches in die Gegend des heutigen Phnom Penh.
Dieser Machtkampf beeinflusste sogar das insulare Südostasien, wo aufgrund der ständigen Bedrohung durch Ayuthaya der immer mächtiger gewordene malaiische Herrscher Parameshvara im heutigen Malakka um 1400 eine neue Hauptstadt gründete, die in der Folge große Teile der Malaiischen Halbinsel sowie Indonesiens dominierte. Bis in das 19. Jahrhundert hinein besaß Malakka an der gleichnamigen Seestraße gelegen eine Schlüsselrolle beim Handel zwischen Indien und China.
Da Parameshvara 1411 zum Islam übergetreten war, kam ihm und seinen Nachfolgern mit dem Titel eines Sultans große Bedeutung bei der erfolgreichen Verbreitung des Islam in Südostasien zu.
Indessen wurde das kambodschanische Reich von Angkor im Lauf des 15. und 16. Jahrhunderts durch die beständigen Angriffe Ayuthayas so geschwächt, dass es immer mehr unter vietnamesischen Einfluss geriet. Im Gebiet des heutigen Vietnam hatte es immer wieder chinesische Invasionen und kurzfristige Kolonialreiche gegeben, und im entstehenden Vakuum hatte sich im 16. Jahrhundert im Norden des Landes die Sippe der Trinh durchgesetzt und die Hauptstadt in Hanoi begründet. Im Süden dehnte sich die Sippe der Ngyuen bis an den Golf von Thailand aus, wo sie auch das Reich der Khmer zu einem Vasallenstaat machte. Ende des 18. Jahrhunderts beendete eine Rebellion die Herrschaft beider Sippen, wobei es allerdings dem letzten Nguyen-Herrscher |19|noch gelang, mit französischer und siamesischer Hilfe in der Hauptstadt Hue einen neu etablierten gesamtvietnamesischen Thron einzunehmen.
Während also das Khmer-Reich unterging und Kambodscha schließlich durch die ursprünglich als Gegengewicht zu den Vietnamesen ins Land geholten Franzosen 1863 zum französischen Protektorat wurde, kristallisierten sich Birma und Ayuthaya/Siam als Hauptmächte auf dem südostasiatischen Festland heraus.
Wechselseitige Kriegszüge zwischen dem siamesischen und dem birmanischen Reich kulminierten im Jahr 1767 in der Eroberung und völligen Zerstörung Ayuthayas durch birmanische Truppen. In der Folge wurde die Hauptstadt Siams in das neu gegründete Bangkok verlegt.
3. Europäische Kolonialisierung
Seit dem 16. Jahrhundert hatten sich abwechselnd verschiedene europäische Staaten in der Region etabliert. Zunächst erlangten die Portugiesen mit der Eroberung Malakkas im Jahr 1511 eine Schlüsselstellung und stießen von dort weiter in den Indischen Ozean vor und eroberten große Teile Javas und anderer Inseln des indonesischen Archipels.
Etwa gleichzeitig näherten sich die Spanier vom Pazifik her. Fernando de Magellan hatte 1521 die Philippinen erreicht und damit direkt die Portugiesen bedroht. Aufgrund akuter Finanzprobleme verkaufte Kaiser Karl V. 1529 im Vertrag von Saragossa jedoch die Molukken an Portugal. Manila wurde ausgebaut und die Philippinen blieben noch bis 1898 bei Spanien, bis sie dann an die Vereinigten Staaten fielen, die Sieger im Spanisch-Amerikanischen Krieg.
Seit dem 17. Jahrhundert hatten auf dem Gebiet des heutigen Indonesien die Niederlande immer mehr Einfluss gewonnen. Die Niederländische Ostindien-Kompanie (VOC) hatte von ihrer Hauptniederlassung Batavia aus nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch immer mehr Gewicht erlangt und konnte 1641 die Portugiesen aus Malakka vertreiben.
|20|Bis zu den Napoleonischen Kriegen blieb die Region von der 1799 wegen Überschuldung aufgelösten VOC dominiert, dann wurde mit Großbritannien ein neuer Wettbewerber immer mächtiger. 1824 kam es zu einer grundlegenden vertraglichen Regelung zwischen den beiden Rivalen. Die Niederländer durften das Gewürzmonopol über die Molukken behalten und traten dafür Malakka ab und tolerierten den Ausbau britischer Macht auf der Malaiischen Halbinsel.
Der dadurch gesicherte Zugang zu China wurde von den Briten durch die sogenannten Straits Settlements an der Straße von Malakka ausgebaut. Unter Thomas Raffles wurde 1819 Singapur gegründet; der weitere Ausbau des britischen Einflusses im heutigen Malaysia führte 1852 mit der Eroberung Mandalays schließlich auch zur endgültigen Einverleibung Birmas.
Frankreich kam als kolonialer Mitspieler relativ spät in die Region und hatte erst zwischen 1860 und 1883 Vietnam von Süden her erobert. Es wurde mit dem seit 1863 existierenden Protektorat Kambodscha und dem seit 1893 französischen Laos zu Französisch-Indochina vereint.
4. Unabhängigkeit
Mit Ausnahme des unabhängigen, allerdings Frankreich nahestehenden Königreichs von Siam war also zu Beginn des 20. Jahrhunderts beinahe ganz Südostasien durch die europäischen Mächte kolonialisiert.
Eine einschneidende Veränderung brachte erst der Zweite Weltkrieg mit sich, der aus asiatischer Sicht bereits 1931 beginnt, als das kaiserliche Japan Ernst macht mit der Errichtung einer »Großasiatischen Wohlstandssphäre« unter japanischer Führung.
Nach dem selbstinszenierten Vorfall von Mukden 1931 überfällt Japan im Herbst 1937 die Mandschurei und marschiert in Nordchina ein. Der darauffolgende Vernichtungs- und Eroberungskrieg gegen China wird mit dem Überfall auf die in Pearl Harbor stationierte US-Pazifikflotte am 6. Dezember 1941 auch in den Pazifik getragen. Die japanische |21|Armee erobert mit großer Geschwindigkeit und Grausamkeit weite Teile Südostasiens.
Insbesondere der Fall Singapurs im Dezember 1942 hat Symbolcharakter, denn dieses Kronjuwel und nachgerade Symbol britischer beziehungsweise europäischer Kolonialherrschaft galt als uneinnehmbar. Einzig Thailand, Birma und Teile Vietnams entgehen einer Besetzung durch die Japaner.
Als sich die japanische Armee unter wachsendem Druck der vorrückenden Amerikaner im Frühjahr 1945 aus Südostasien zurückzieht, hinterlässt sie eine Schneise der Verwüstung und unklare Machtverhältnisse. Die Regierungen in Vietnam, Laos und Kambodscha erklären sich für unabhängig, was aber von ihrem Kolonialherrn Frankreich nicht anerkannt wird. Ähnliches geschieht in Indonesien sowie in Birma und in Malaysia. Mögen auch einige der Unabhängigkeitserklärungen an die europäischen Herren durch die japanische Besetzung ermöglicht oder ausgelöst worden sein, so ist die japanische Sichtweise, das Kaiserreich habe einen Befreiungskrieg im Namen der unterdrückten asiatischen Völker gegen den weißen Herrenmenschen geführt, zu weit hergeholt. Im Gegenteil: Die japanische Kolonialherrschaft war, wenngleich kurz, sehr hart und oftmals grausamer als die der Europäer. Bis zum heutigen Tage gibt es daher in vielen asiatischen Ländern noch erhebliche Ressentiments gegen Japan, dass sich auch keine sonderliche Mühe bei Entschuldigungen und Entschädigungen gegeben hat.
In vielen Ländern Südostasiens führte die neu erlangte oder erst nach blutigen Kriegen errungene Unabhängigkeit zu einer inneren Polarisierung, die den Nährboden für jahrzehntelange Bürgerkriege bereitete. Bestes Beispiel für einen solchen Verlauf ist das ehemalige Französisch-Indochina.
In Vietnam hatte der Begründer der Unabhängigkeitsbewegung Viet Minh, Ngyuen Ai Quoc – bekannter unter dem Namen Ho Chi Minh –, im September 1945 die Demokratische Republik Vietnam mit der Hauptstadt Hanoi ausgerufen. Dies wurde von Frankreich nicht anerkannt, und die Kolonialmacht besetzte mit britischer Hilfe den Süden des Landes. Nach der vernichtenden Niederlage in Dien Bien |22|Phu 1954 zogen sich die Franzosen zurück, was die Teilung des Landes in einen kommunistischen Norden und einen den Westmächten zugewandten und von einer korrupt-kapitalistischen Regierung beherrschten Süden zementierte. Das direkte Eingreifen der Vereinigten Staaten führte zum äußerst blutigen Vietnamkrieg, in dessen Verlauf die USA alleine auf das kleine Laos mehr Bomben abwarfen, als während des gesamten Zweiten Weltkriegs gefallen waren. Erst 1973 kam es zu einem Waffenstillstand, der das Ende des unabhängigen Südvietnam bedeutete und am 2. Juli 1976 den Weg frei machte zur Proklamation des wiedervereinigten Landes als »Sozialistische Republik Vietnam«.
Auch Kambodscha durchlitt ein ähnliches Schicksal, als nach der Unabhängigkeitserklärung durch König Sihanouk im März 1945 die Auseinandersetzung mit den Franzosen erst 1954 zur vollen Souveränität führte. 1970 bildete der Sturz Sihanouks den Auftakt eines blutigen Bürgerkriegs, bis 1973 die kommunistischen Roten Khmer den Sieg davontrugen. Unter ihrem Anführer Pol Pot (eigentlich Saloth Sar) errichteten sie ein Terrorregime, dem bis 1978 fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung von rund fünf Millionen Menschen zum Opfer fiel. Erst der Einmarsch vietnamesischer Truppen 1978 beendete die killing fields und trieb die Roten Khmer in den Dschungel, wo sie bis heute einen – wenngleich deutlich reduzierten – militärischen und politischen Machtfaktor darstellen. Die Entwicklung in Laos, das stark durch den Vietnamkrieg in Mitleidenschaft gezogen worden war, ähnelt der in Kambodscha; nach Abschaffung der Monarchie wurde am 1. Dezember 1975 die Demokratische Volksrepublik Laos ausgerufen.
Niederländisch-Indien war seit 1942 von den Japanern besetzt, die vor ihrem Abzug im August 1945 noch die Unabhängigkeitserklärung durch den späteren Staatspräsidenten Sukarno anschoben, um die Rückkehr der Holländer zu verhindern. Nach diversen Auseinandersetzungen wurde 1949 der Republik Indonesien schließlich die volle Souveränität zugestanden.
Nach dem erfolgreichen Putsch gegen Sukarno machte sich 1966 General Suharto zum Ministerpräsidenten und blieb bis zu seinem Sturz 1998 im Amt. Erst seitdem setzt ein immer stärker werdender Demokratisierungsprozess ein, der allerdings durch separatistische |23|Unruhen in den weitläufigen Inselwelten des rohstoffreichen Landes erschwert wird. Der letzte Teil des riesigen Archipels, das sich ursprünglich in portugiesischem Besitz befindliche und 1975 von der Republik Indonesien annektierte Osttimor, erlangte erst 1999 staatliche Unabhängigkeit. Das Sultanat von Brunei auf Borneo wurde ebenfalls recht spät, nämlich erst 1984, von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen.
Malaysia weist ähnlich ausgeprägte ethnische Gegensätze auf wie Indonesien. In den Straits Settlements der Briten brach nach dem Abzug der Japaner ein Guerillakrieg um die Unabhängigkeit aus, der von 1948 bis 1960 zur Ausrufung des Notstands führte. Dennoch gelang den lokalen Eliten unter britischer Herrschaft 1948 die Gründung der Federation of Malaya, doch die volle Unabhängigkeit errang Malaya erst 1957. Sarawak, Norborneo und Malaya wurden 1963 zum Königreich Malaysia vereinigt, das Ende der sechziger Jahre durch ethnische Unruhen erschüttert wurde.
Dem Wunsch der Briten nach einem Sonderstatus für Singapur, wo zahlreiche indische und chinesische Gemeinden lebten, wurde 1955 entsprochen, als der Kleinstaat eine eigene Regierung zugebilligt bekam. Der ursprünglich eingesetzte David Marshall wurde jedoch schon 1959 von dem energischen und charismatischen Lee Kuan Yew abgelöst, der mit seiner Peoples Action Party Wahlsieger und erster Premierminister der Republik Singapur wurde. Nach einem kurzen Intermezzo des Anschlusses an Malaysia von 1963 bis 1965 bewahrt sich Singapur bis heute seine Unabhängigkeit. Der Vater des enormen wirtschaftlichen Erfolges von Singapur, Lee Kuan Yew, beherrscht bis heute als »Senior Advisor« die politische und wirtschaftliche Bühne seines Landes.
In einer weiteren britischen Besitzung, Birma, war es nach dem schon bekannten Muster während der japanischen Besetzung zu einem Guerillakrieg gekommen, in dessen Verlauf der Guerillaführer Aung San eine zentrale Rolle spielte. Der Vater der heutigen Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wurde allerdings noch als Interimspremierminister 1946 ermordet.
Nach dem Abzug der Japaner kam es am 17. Oktober 1947 zur Unabhängigkeit |24|der Birmanischen Union. Seitdem 1988 Präsident San Yu durch einen Putsch gestürzt wurde, herrscht in Birma eine Militärregierung, die 1989 das Land in Myanmar umbenannte. Seit 1992 steht die Militärjunta unter Führung von General Than Shwe, der als Hardliner gilt und auch den Aufstand der Mönche im Frühjahr 2008 blutig niederschlagen ließ. Trotz einiger Lockerungen steht Aung San Suu Kyi noch immer unter Hausarrest.
Thailand – wo es zudem nicht ein so großes ethnisches und religiöses Konfliktpotenzial wie etwa in Malaysia und Indonesien gab – hatte im Gegensatz zu den anderen Staaten der Region nicht mit den Folgen der japanischen Besatzung und Dekolonisierung zu kämpfen. Im Gegenteil: Es hatte formell seine Unabhängigkeit bewahrt und eng mit den Japanern kooperiert, nicht zuletzt, um die politische und wirtschaftliche Macht der Überseechinesen zu reduzieren. Das Militär spielte dabei eine zentrale Rolle und hatte sich mit japanischer Hilfe die Herrschaft über die Opium produzierenden Shan-Völker im sogenannten Goldenen Dreieck gesichert. Diese gleichermaßen strategisch wichtige wie aufgrund des Drogenanbaus auch lukrative Grenzregion zwischen Thailand, Laos und Kambodscha war schon das bevorzugte Rückzugsgebiet der Reste der kaiserlich japanischen Armee und der Kuomitang-Truppen gewesen, als Chiang Kai Chek 1948 nach Taiwan floh. Beide hatten durchaus nicht nur dort miteinander kooperiert. Später fanden auch die aus Kambodscha vertriebenen Genozid-Adepten der Roten Khmer dort Zuflucht. In jedem dieser Fälle war immer auch Schutz, Duldung und Kooperation durch führende Kreise Thailands, insbesondere des Militärs, unabdingbar.
Eine Gruppe um General Phin Choonhavan und Marschall Phibun putschte sich 1947 an die Macht, deren verschiedene Mitglieder und Verwandte in den nächsten 50 Jahren sich an der Spitze des Landes abwechselten. So General Phao (1947–1957), Feldmarschall Sarit (1957 – 1963), General Krit (1964–1976) und General Kriangsak (1976–1980). Dieser wollte im Rahmen einer »nationalen Rückbesinnung« König, Religion und Nation wieder ins Zentrum der Politik und des Alltagslebens stellen, wodurch König Rama IX. wieder größeren Einfluss gewann. Der hochbetagte Monarch stellt bis zum heutigen Tag die |25|höchste moralische Instanz seines Landes dar. Dennoch wiederholen sich immer wieder Militärputsche, so nach den umfassenden Demokratisierungsprozessen der neunziger Jahre und den fehlgeschlagenen politischen Reformen unter Premierminister Thaksin zuletzt im Herbst 2006.
Die Philippinen schließlich erlangten nach der Rückeroberung von den Japanern durch General MacArthur im Jahr 1946 die Unabhängigkeit. Die zahlreichen sozialen und religiösen Spannungen verbunden mit separatistischen Bestrebungen wurden während der Militärdiktatur von Ferdinand Marcos 1965 bis 1986 relativ gut kaschiert, treten in den instabilen demokratischen Regierungen seit den neunziger Jahren aber wieder verstärkt hervor. Gerade die islamistischen Abspaltungsbemühungen in Abu Sayaf und Mindanao sorgen immer wieder für Unruhe.
Abschließend ergibt sich als Hinterlassenschaft der europäischen Kolonialherren eine Vielzahl widersprüchlicher Aspekte. Infrastruktur, Ausbildungswesen und Affinität zu westlichen Inhalten stehen neben einem jungen, dafür umso pointierter vorgetragenen Nationalismus. Auch der Kommunismus, der zu vielen blutigen Kriegen führte, ist hier zu nennen.
Die Bedeutung der zugrunde liegenden Wertvorstellungen ist bei einer so heterogenen Region, die eine enorme Vielfalt an ethnischen Gruppen, politischen Strukturen, klimatischen und geografischen Faktoren aufweist, evident. Daher gilt es, kurz die vorherrschenden Moral und Wertegemeinschaften vorzustellen.
|26|Werte und Wandel
Vielleicht noch mehr als der Rest des Kontinents scheint Südostasien von Gegensätzen geprägt zu sein: fanatische Aggressivität, friedvolle Duldsamkeit und Toleranz, roher Materialismus, Rassismus, Gefühle von Sendungsbewusstsein und Minderwertigkeit, tatkräftige Nächstenliebe, Extreme von Armut und Reichtum, harmonischer Ausgleich von Mensch und Natur, Raubbau.
Die rauschhafte wirtschaftliche Entwicklung Ostasiens gehört weltweit zu den wichtigsten Entwicklungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Gegensatz zum Aufstieg Japans knapp 100 Jahre davor handelt es sich nicht mehr um den Aufstieg eines einzelnen Landes, sondern einer ganzen Region. Die seit Jahrhunderten behauptete und mit Waffengewalt verteidigte Überlegenheit der westlichen Kultur gegenüber Asien gerät sichtbar ins Bröckeln, und das Machtgleichgewicht verschob und verschiebt sich zusehends von Europa nach Asien. Das Selbstvertrauen der asiatischen Länder wächst, und eine vorbehaltlose Unterwerfung unter westliche Werte, wie in Japan und China im 19. Jahrhundert, wird nicht mehr als notwendig erachtet. Während der Meiji-Restauration wie auch nach der totalen Niederlage gegen die USA 1945 hatte Japan alles scheinbar Überlegene aus dem Westen kaum hinterfragt übernommen. Ähnliches geschah in China hinsichtlich des Einflusses der Sowjetunion. Das Motto zur Meiji-Zeit war in Japan also Loslösung und geradezu Verleugnung von Asien und Anschluss an Europa. Doch nur 100 Jahre später ist in Japan die Distanzierung von Amerika und die Hinwendung zu Asien auf dem Vormarsch.
Japan ist dabei, sich wieder zu asiatisieren und trotz seiner besonderen kulturellen Eigenheiten mit einer grundsätzlichen asiatischen |27|Kultur zu identifizieren. Parallel dazu akzeptiert und respektiert China wieder sein eigenes Kulturerbe, und ein neuer chinesischer Kulturnationalismus verbreitet sich. Japan und China sind wichtige Wegbereiter für die Anerkennung der asiatischen Kultur und der asiatischen Werte.
Schon Mitte der neunziger Jahre hatte Singapur die auf dem Konfuzianismus basierenden »asiatischen Werte« verkündet. Trotz der kleinen Delle durch die Asienkrise 1997 glauben Asiaten heute mehr denn je, dass Ostasien wirtschaftlich bald den Westen uneinholbar hinter sich gelassen haben wird, und die Meinung, der wirtschaftliche Erfolg sei ein Produkt der überlegenen asiatischen Kultur, welche dem dekadenten und zügellosen Westen weit voraus sei, gewinnt an Anhängern. Zwar akzeptieren die Asiaten, dass es in Asien auch strukturelle und kulturelle Unterschiede gibt, glauben aber dennoch fest daran, dass das fast allen Ländern in dieser Region gemeinsame Wertesystem des Konfuzianismus eine tragfähige Klammer darstellt.
Mit dem wachsenden Selbstbewusstsein und dem wirtschaftlichen Erfolg steigt auch der universalistische Anspruch der asiatischen Werte. Wie im Westen wird zunehmend wirtschaftlicher Reichtum als Beweis für moralische Überlegenheit betrachtet. Wenn erwartungsgemäß Ostasien – oder besser Asien insgesamt – innerhalb der nächsten 30 Jahre in eine globale Hegemonialstellung aufrückt, folgte daraus die unmittelbare Berechtigung und der Anspruch, diese Werte auch auf andere Regionen anzuwenden.
Es könnte also nicht mehr und nicht weniger auf dem Spiel stehen, als asiatische Werte von universeller Bedeutung zu exportieren und im Rahmen eines pazifischen Globalismus zunächst eine Globalisierung Asiens und dann eine neue Weltordnung herbeizuführen. Bis zur Geltendmachung eines globalen und moralischen Führungsanspruches durch China, Indien und andere asiatische Mächte wäre es dann nur noch ein kleiner Schritt.
Es ist gleichwohl wenig wahrscheinlich, dass der Westen von asiatischen Werten überrollt wird. In China, der zentralen Macht in Asien, gibt es keinen kulturellen Fundamentalismus, der sich durch Widerstand gegen Modernisierung, eine Abschottungshaltung oder gar einen |28|latenten Minderwertigkeitskomplex auszeichnen würde, wie er in Japan über die letzten 200 Jahre vorherrschend war. Die Versuche der Regierung, den erstarkenden Konfuzianismus politisch nutzbar zu machen und einem lebhaften Patriotismus an die Seite zu stellen, scheinen zu funktionieren. Ein einseitiger Nationalismus, der zu einer »splendid isolation« führte, ist daraus aber nicht ohne Weiteres abzuleiten.
Es ist allerdings zu erwarten, dass durch die wachsende wirtschaftliche Bedeutung Asiens auch eine asiatische Denkweise im Westen immer größeres Gewicht erlangt. Da in Asien der Konfuzianismus mit seiner Betonung des Ganzen, das stets über dem Einzelnen steht, eine tragende Rolle spielt, könnten sich die sozialen Haupttugenden sukzessive wandeln: von Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen zu der Bereitschaft, sich in die Gesellschaft einzufügen. Das Konsensprinzip, nach dem man sich arrangiert und Konflikte möglichst vermeidet, könnte im Westen Einzug als prägendes Prinzip halten.
Asien stellt weltanschaulich keine homogene Region dar. Konfuzianistisch geprägte Gesellschaftsordnungen wie China, Japan, die beiden Koreas, Vietnam sowie die chinesischen Auslandsgemeinden treffen auf die hinduistische Gesellschaftsordnung, vor allem in Indien und Nepal sowie den indischen Auslandsgemeinschaften in Südostasien. Der Theravada-Buddhismus, der klassische Selbsterlösungsbuddhismus, hat in Myanmar, Kambodscha, Laos, Sri Lanka und Thailand seine Hauptanhängerschaft. Auch der Islam darf nicht vergessen werden, der in Brunei, Indonesien, Malaysia und in den Südphilippinen stark verbreitet ist.
1. Religion und Philosophie
Rechnet man Vorderasien, also den Nahen Osten, kulturell zu Asien, so sind alle wichtigen Weltreligionen in diesem Erdteil begründet worden. Diese werden durch die verschiedenen ethnischen Gruppen transportiert: der Hinduismus durch den Einfluss Indiens, der des Buddhismus durch den Einfluss Chinas und später Japans, der Islam durch |29|die Araber und das Christentum durch die Europäer. Schließlich auch der Konfuzianismus und auch der Taoismus durch die große und wirtschaftlich bedeutende Gruppe der huaren, der Überseechinesen.
Hinduismus
Im Hinduismus werden der gesellschaftliche Rang und die religiöse Reinheit durch die Geburt festgelegt. Das Kastenwesen, das sich durch Inflexibilität auszeichnet, erfordert den karmischen Auftrag anzuerkennen und das Leben nach ihm auszurichten. Die Glaubensregeln beeinflussen also nicht nur das Ritual- und Frömmigkeitsverhalten der Einzelpersonen, sondern bewirken zahlreiche Alltagstabus, angefangen vom Verbot spezieller Nahrungsmittel bis hin zum Verbot der Ehe mit Partnern aus anderen Kasten, was wiederum sehr schwerwiegende wirtschaftliche, soziale und politische Konsequenzen mit sich bringt. Die Reformfähigkeit des Hinduismus, der sich in Indien eher durch ein nationalistisches Gedankengut auszeichnet, scheint begrenzt zu sein. Der Hinduismus kann für die Volkswirtschaften, in denen er eine große Rolle spielt, vor allem in Indien, also eher als Entwicklungshindernis denn als fortschrittsfördernd betrachtet werden.
Buddhismus
Der Buddhismus, im 6. Jahrhundert v. Chr. durch Gautama Buddha begründet, hat im Lauf der letzten 2500 Jahre unendlich viele Transformationen mitgemacht. Er spielt vor allem in seiner Ausprägung als Mahayana-Buddhismus nach wie vor eine große Rolle. Von Indien ausgehend erfasste er China, danach Korea, Japan und verschiedene Länder Südostasiens. Allein in Japan gibt es knapp 2000 verschiedene buddhistische Sekten, und die Ausprägung in anderen Ländern ist ebenso vielfältig. Der kleinste gemeinsame Nenner aller buddhistischen Schulen ist die Einsicht, dass die Welt ein unablässiger Strom von Geburt, Tod und Wiedergeburt und damit voller Leiden ist. Es bedarf der Erkenntnis, dass die sogenannte Wirklichkeit eine Welt der Illusion darstellt, und dass es notwendig ist, sich aus diesem Strom zu |30|lösen und von diesem Leiden zu befreien. Die Lehre vom »Achtfachen Pfad« Buddhas ermöglicht den Weg aus der Verstrickung in Unrast und Irrtum. Am Ende dieses Weges steht die Erlösung, das sogenannte Nirvana, also das absolute bewegungslose Nichts. Aus der kühlen Strenge des Hinayana (»Kleines Fahrzeug«) des Urbuddhismus, in dem die Welt der Illusion und Leiden kontrastreich dem Nichts gegenübergestellt wurde und Erlösung nur für einige wenige Menschen durch strenge Abwendung von der Welt möglich war, entstand mit dem Mahayana (»Großes Fahrzeug«) eine Art Volksreligion. Dadurch ist der Buddhismus zur Gnadenreligion geworden, denn es gibt Helfer, die dem Menschen bei dem Bestreben, dem Leiden zu entfliehen, beistehen. Verschiedene Grade auf dem Weg der Erkenntnis entsprechen verschiedenen Graden der Heiligkeit, also der Teilhabe am Absoluten. Trotz der Relativierung der Welt und dem Streben, sich aus ihr zu lösen, ist der Buddhismus nicht wie der Hinduismus ein Hindernis auf dem Weg zur ihrer praktischen Bewältigung und insofern auch kein Wirtschaftshemmnis. In Japan etwa verschmolz der Buddhismus mit dem animistischen Shintoismus zu einer fruchtbaren Einheit. Viele Elemente des Buddhismus wurden daher zum Nationalcharakter Japans, wie etwa der ausgeprägte Sinn für die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit alles Irdischen, das natürliche Empfinden für das unablässige Auf und Ab und Werden und Vergehen. Auch die Bedeutung von Stille und Versenkung und das Aufhäufen von Kredit, den man für gute Taten bekommt, ist ein Element des Buddhismus. Diese durchaus praktische Eigenheit führt ebenso zu einem flexiblen kaufmännischen Denken wie zu der Neigung, harten Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten wenn möglich aus dem Wege zu gehen und Ausgleich und Harmonie anzustreben. Hilfreich ist dabei auch die außerordentliche Toleranz, die der Buddhismus seit jeher aufweist und die ein reibungsloses Neben- und Miteinander verschiedener Religionen, aber auch politischer Einstellungen befördert. Ein Kompromiss erscheint also in jedem Falle klüger, eleganter und kräftesparender als Kampf und Streit. Die Ähnlichkeit mit dem Harmoniestreben des Konfuzianismus wie auch des Taoismus ist augenfällig.
Im ersten Jahrhundert nach Christus war der Mahayana-Buddhismus |31| von Indien nach China gekommen und fand dort eine rasche Ausbreitung. Er erleichterte der chinesischen Bevölkerung, die mit der das Nicht-Handeln propagierenden Ethik Lao-Tses vertraut war, den Zugang; Taoismus und Buddhismus übernahmen vieles voneinander und glichen sich in mancher Hinsicht einander an. Verschiedene Schulen des Buddhismus entstanden in China. Der Amidismus, eine eher volkstümliche Richtung des Buddhismus, erlangte große Popularität gerade in den einfachen Schichten und konnte seine Vorrangstellung bis in die heutige Zeit behaupten. Eine wichtige Rolle spielt ebenfalls der Chan-Buddhismus, der von dem indischen Mönch Bodidharma begründet wurde, der Anfang des 6. Jahrhunderts nach China kam. Er begründete die Schule der Meditation oder des inneren Lichts, die jede Bindung an Konventionen und Gesetze ablehnte und die Erlösung vom Leid der Welt allein in der Meditation suchte. Lange Zeit von der Kommunistischen Partei unterdrückt, gelangte der Chan-Buddhismus in der Volksrepublik China erst in den achtziger Jahren wieder zur Geltung, während er in Taiwan, Hongkong und bei den Überseechinesen immer eine große Zahl von Anhängern besaß. Im 12. Jahrhundert kam er nach Japan und erlangte als Zen große Bedeutung.
Die oft wiederholte Ansicht, dass in Asien – im Gegensatz zum Westen – Religion und säkulare Welt nicht getrennt seien, ist bestenfalls missverständlich formuliert und vielmehr Ausdruck eines europäischen Stereotyps, das in der Praxis keinen Bestand hat. Abgesehen von fundamentalistischen Strömungen, etwa im Islam und im Hinduismus, zeichnen sich die meisten asiatischen Länder durch einen sehr pragmatischen Umgang mit Religion aus. Sowohl in China als auch in Japan, den beiden wichtigsten Volkswirtschaften, besteht ein harmonisches Nebeneinander von Konfuzianismus, Buddhismus und, im Fall der Volksrepublik, Kommunismus mit vielen regionalen Elementen. Es ist dieser tolerante Charakter der gegenseitigen Befruchtung, des Praxisbezogenen, Politischen, Vernünftigen und Harmonischen, der die Religionsausübung in Asien so erfolgreich macht. Aufgrund dieser Eigenschaften ist auch keine aggressive Indoktrination westlicher Staaten durch asiatische Religionen zu erwarten, sondern vielmehr von einer subtilen, indirekten Wirkungskraft auszugehen. Die |32|große Popularität indischer und chinesischer Weltanschauungen und Weisheitslehren, die schon seit Ende des 19. Jahrhunderts das europäische Geistesleben befruchten, ist die erste Blüte am Baum der Synthese.
Konfuzianismus
Vom Leben des Begründers des Konfuzianismus, Meister Kong, der im 5. Jahrhundert vor Christus als Zeitgenosse von Buddha und Perikles lebte, sind keine eigenen Schriften überliefert. Ähnlich wie bei Lao-Tse, dem Begründer des Taoismus, ist ein Kanon klassischer Schriften, die durch seine Schüler aufgezeichnet wurden, erhalten. Eines der klassischen Werke sind die Lunyü, die Lehrgespräche, die zahlreiche Aphorismen und Aussprüche von Konfuzius enthalten und durch den Sinologen Richard Wilhelm in den dreißiger Jahren kongenial übersetzt wurden.
Meister Kong war kein Religionsstifter. Er entwickelte eine praktische Lehre, die auf sozialer Ordnung und Frieden basiert. Die Harmonie wird als das zentrale Prinzip der Schöpfung aufgefasst, und sie gilt es in allen Lebensbereichen zu verwirklichen. Das Spiegelbild der sittlichen Ordnung im Kleinen, in der Familie, muss die soziale Ordnung und Harmonie in der Gesellschaft sein. Die sittliche Ordnung ist klar strukturiert und basiert auf fünf zentralen menschlichen Beziehungen, nämlich Vater und Sohn, Fürst und Untertan, Mann und Frau, älterer Bruder und jüngerer Bruder, Freund und Freund. Diesen Beziehungen entsprechen die fünf Tugenden: Menschlichkeit, Rechtlichkeit und Wohlwollen, Anstand und Sitte, Klugheit, Zuverlässigkeit. Aus ihnen erwachsen die drei sozialen Pflichten der Loyalität, Pietät und Höflichkeit (Li). Gerade Li, das Höflichkeit, Dankbarkeit und Anstand beinhaltet, ist von zentraler Bedeutung für das soziale Leben der Menschen. Konfuzius wird zu Unrecht für die rückwärtsgewandte fortschrittshindernde Einstellung der Staatsbeamten im alten China verantwortlich gemacht. Im Gegenteil, er war in mancherlei Hinsicht ein revolutionärer Denker, dessen Aktualität nach wie vor ungebrochen ist. Ihm ging es nicht darum, abstrakte Gedankengebäude zu errichten |33|und die Welt zu analysieren, sondern der Mensch und seine konkreten Handlungsmöglichkeiten im Alltag sind für ihn zugleich Ausgangswie Endpunkt. Die Frage, wie er durch konkretes Handeln das perfektioniert, was sein innerstes Wesen ausmacht, steht im Zentrum der Existenz, sowohl des Einzelnen als auch des Gemeinwesens. Nach Konfuzius gibt es nur Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Menschlichkeit besitzt nur derjenige, der fünf Haltungen in der Welt kultiviert, nämlich Würde, Weitherzigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Eifer und Güte. So wenig wie Konfuzius abstrakte Gedankengebäude errichtet, so wenig verliert er sich in spirituellen oder gar himmlischen Erlösungskonstrukten. Maßgeblich ist für ihn die erst Jahrhunderte später als goldene Regel in Europa geschaffene Auffassung, dass Gegenseitigkeit das zentrale Lebensprinzip ist. Was man selbst nicht wünscht, dass tue man anderen nicht an.
In China gab es kein Konzept eines Schöpfergottes, der außerhalb von allem existiert und Himmel und Erde erschaffen hat. Vielmehr bildet alles Sichtbare – Himmel, Erde, Mensch und die »Zehntausend Dinge« – eine Einheit. Hierin liegt die einzige Wahrheit, die nicht in jenseitigen Gefilden zu finden ist. Durch das Bewahren von Maß und Mitte und die Ausübung von althergebrachten Riten, wobei äußere Form und innere Einstellung übereinstimmen müssen, bringt man das immanente Prinzip der Selbstorganisation, also die Göttlichkeit und Einzigartigkeit der Schöpfung, zum Ausdruck.
Als die Zhou-Dynastie um 1100 vor Christus die Macht von der Shang-Dynastie übernahm, musste sie diesen Umsturz rechtfertigen, und so wurde etabliert, was für die nächsten 3000 Jahre bis zum Ende der Quing-Dynastie im Jahr 1912 Gültigkeit besaß, dass nämlich der Kaiser das Mandat »des Himmels« hatte. Wenn der Sohn des Himmels nicht mehr der wahre Hüter der Moral ist, weil er nicht höchsten moralischen Ansprüchen genügt, entzieht ihm der Himmel seine Gunst, und eine neue Dynastie darf sich auf einen Mandatswechsel berufen. Durch den direkten Kontakt des Herrschers mit dem Himmel werden Priesterkasten überflüssig, eine Verweltlichung der Religion hat stattgefunden. Und in diesem Sinne ist auch die Lehre des Konfuzius sozialer Sprengstoff gewesen. Denn weder eine privilegierte Priester- noch |34|eine privilegierte Adelsschicht haben ein Monopol auf den Kontakt mit dem Himmel. Vielmehr gilt der revolutionäre Satz »Wer die Riten erfüllt, ist ein Edler, unabhängig von Stand und Geschlecht«.
Der in der Provinz Shan Dong geborene Meister Kong (551–479 vor Christus) entstammte einem alten, aber verarmten Geschlecht, das sich bis zu den Königen der Shang-Dynastie zurückverfolgen lässt. Meister Kong, oder Konfuzius, wie er durch die Jesuiten dann genannt wurde, war ein Philosoph, der sich wenig für die Frage nach Sein oder Nichtsein, sondern vielmehr dafür interessierte, wie man die Gesellschaft am besten organisieren kann. Er praktizierte und lehrte also keine metaphysischen Theorien, sondern eine sehr praktische Philosophie, die sich vor allem durch Moralismus, Irreligiösität und Konservatismus beschreiben lässt und von einem geradezu revolutionär modernen Denken geprägt ist, das sich durch einen nüchternen Skeptizismus und eine klassenlose Mitmenschlichkeit auszeichnet. Bildung, Wissen und Menschlichkeit sind jedem unabhängig vom sozialen Stand und materiellen Umständen zugänglich. Dennoch erkennt Konfuzius an, dass sich die Menschen schon bei der Geburt durch ihren Wissensstand und ihr Talent zur Erwerbung von Wissen unterscheiden. Sein Menschenbild ist dynamisch, woraus folgt, dass er dem Menschen die Kraft zuspricht, durch subjektives Handeln sein eigenes Schicksal sowie seinen Status innerhalb der Gesellschaft zu beeinflussen. Die Tür steht jedem offen, ein innerlich stabiler und äußerlich angesehener Mensch zu werden. Das Leitbild ist der Junzi, der Edle, der nicht durch Geburt, sondern durch unablässiges Bemühen um Bildung und Sittlichkeit zu einem solchen wird.
Konfuzius kennt keinen Unterschied zwischen Staat und Gesellschaft, sondern nur eine Ordnung, die aus den Regierenden und den Regierten besteht. Nur wenn untereinander harmonische Beziehungen herrschen, können das Gemeinwesen und der Einzelne gedeihen. Zwar leugnet Konfuzius nicht, dass es Reibungen und Konflikte gibt, er hat jedoch den unerschütterlichen Glauben, dass in konfliktträchtigen Beziehungen als Konsequenz von Selbstbeherrschung und Verzicht auf Gewaltanwendung Vertrauen zwischen den Menschen entsteht und dadurch die Harmonie wiederhergestellt wird. Gewaltanwendung als |35|Mittel zur Konfliktaustragung ist somit überflüssig und schädlich. Konfuzius lehnt zwar nicht ab, transzendente Kräfte anzuerkennen, doch sein Denken ist prinzipiell nicht auf das Jenseits, sondern auf das Diesseits gerichtet. Gleichwohl respektiert er die religiösen Zeremonien, weil er an die Kraft der Tradition und die soziale Funktion der Rituale glaubt. Der Konfuzianismus ermöglichte daher der breiten Bevölkerung, das vorhandene Brauchtum zu bewahren und in die neue Lehre zu integrieren, gewährleistete also maximale Flexibilität bei größtmöglicher Stabilität.
Der durch Konfuzius’ älteren Zeitgenossen Lao-Tse begründete Taoismus konnte sich hingegen nicht durchsetzen. Die im Tao-Te-King, das Buch vom Tao und seiner Kraft – dem einzigen erhaltenen Werk, das auf Lao-Tse, von dessen Leben kaum etwas bekannt ist, zurückgeführt wird –, überlieferte Lehre gilt im Vergleich mit dem Konfuzianismus oft als ursprüngliche, geradezu anarchistische Individualphilosophie. Das ist aber nur bedingt richtig: Lao-Tses Forderung, im Einklang mit dem Tao zu sein, das oft als Weg oder Bahn, aber auch als Natur wiedergegeben werden kann, bedeutet, im Einklang mit der Natur zu leben. Deswegen sind einfacher Sinn, Natürlichkeit, Selbstlosigkeit und Wunschlosigkeit die Haupttugenden. Wissen, Geschäftigkeit und Gerechtigkeit erscheinen als künstliche, unnatürliche Hindernisse auf dem Weg zur Harmonie. Zwar decken sich die Werte mit denen des »Edlen« im Konfuzianismus, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im sozialen Engagement. Während im Taoismus der Gelehrte im Einklang mit der Natur und sich selbst lebt und dem Prinzip des Handels durch Nicht-Handeln (Wuwei) folgt, hat der Edle bei Konfuzius die Pflicht, sich selber zu vervollkommnen, um die Welt und das Gemeinwesen in Ordnung zu bringen. Konfuzius sagt, dass ein Gebildeter, der nur an ein angenehmes Leben zu Hause denkt, nicht würdig ist, als ein Gebildeter betrachtet zu werden. Der Edle muss ständig bemüht sein, nach außen zu wirken und Verantwortung zu übernehmen. Die Selbstkultivierung des Edlen dient also nicht dazu, sich selbst zu befreien. Vielmehr handelt es sich um einen Prozess, bei dem der Mensch zu einer moralisch integren, innerlich starken Persönlichkeit wird, die sich durch ein soziales und politisches Verantwortungsbewusstsein |36|auszeichnet. Der Edle verfolgt das Prinzip des Zhong Yong, die Einhaltung der Mitte, die ihn vom Gemeinen unterscheidet. Doch diese Kombination von Flexibilität und Prinzipientreue, mit welcher der Edle seine verschiedenen Rollen als Sohn, Untertan, Bruder, Freund und Vater spielen können muss, hat den Zweck, dem Allgemeinwohl zu dienen. Die Selbstkultivierung und somit auch die Innerlichkeit sind somit also niemals Selbstzweck, sondern notwendiger Bestandteil des großen Ganzen.
In den konfuzianistischen Gesellschaften ist daher nicht alles wie etwa in hinduistischen Gesellschaften durch die Geburt vorgegeben, vielmehr kann man sich durch Leistung nach oben arbeiten. Die Trennung von Gesellschaft und Religion ermöglicht eine größere Mobilität durch die Einführung einer Meritokratie. Der Konfuzianismus, der auf einer rationalen weltlichen Haltung basiert, zeichnete sich durch spirituelle Nüchternheit aus. Das berühmte Wort von Konfuzius, »man solle sich Geistern und Dämonen gegenüber im Großen und Ganzen so verhalten, als ob es sie gäbe«, führt dazu, dass es im wirtschaftlichen Leben so gut wie keine religiösen Tabus gibt.
In den neunziger Jahren wurden durch Lee Kwan Yen in Singapur und ebenfalls durch den malaysischen Staatspräsidenten Mahatir in zehn Geboten die sogenannten asiatischen Werte propagiert, um eine »Asiatisierung« Asiens voranzutreiben und der zu starken Verwestlichung, die bisweilen als eine Art »geistiger Verschmutzung« gesehen wird, Einhalt zu gebieten.
Viele dieser Werte stammen aus dem Konfuzianismus und besagen unter anderem, dass die Nation vor der Gruppe kommt und die Gruppe in Form von Gesellschaft und Familie wiederum vor dem Ich steht. Deswegen ist auch ein übertriebener Wohlfahrtsstaat abzulehnen. Starke Familien sind die höchste Gemeinschaft des Staates. Bildungseifer und Lernkultur müssen hochgehalten werden. Sparsamkeit, Bescheidenheit und Konsumzurückhaltung müssen ebenso gefördert werden wie Teamgeist und eine moralisch einwandfreie saubere Umgebung. Für diese Zwecke ist Pressezensur gestattet. Man kann diese zehn Gebote wohl mit dem Doppelgebot zusammenfassen, dass das Ganze dem Einzelnen unter- und der Konsens der Kontroverse überzuordnen |37|ist. Die zeitlose Gültigkeit und die wirtschaftlich-politische Nützlichkeit dieser Prinzipien liegen auf der Hand.
Christentum
Zu den fünf Weltreligionen zählt auch das relativ junge, gleichwohl weitverbreitete Christentum. Diese im 1. Jahrhundert entstandene Religion zählt weltweit etwa zwei Milliarden Anhänger, darunter 1,1 Milliarden Katholiken, und übertrifft damit die 840 Millionen Hindus, 377 Millionen Buddhisten und 15 Millionen Juden deutlich.
Die katholische Mission von der Bekehrung der Ungläubigen war von Anfang an eng mit der wirtschaftlich getriebenen Eroberungspolitik der katholischen Seemächte Spanien und Portugal in Asien verknüpft. Ähnlich wie in Südamerika arbeiteten Priester und Soldaten Hand in Hand bei der Errichtung kolonialer Strukturen und der wirtschaftlichen Ausbeutung der neu gewonnenen Kolonien. Mit dem Aufstieg der protestantischen Mächte England und Holland ging ein Bedeutungsverlust der katholischen Kirche in Indien, Japan und Indonesien einher. Bis zum heutigen Tage spielt das Christentum aber noch eine wichtige Rolle in den Philippinen und auch in Südkorea.
Islam
Der Islam entstand im Nahen Osten, spielt aber für Zentral- und Ostasien eine immer wichtigere Rolle. Die Gesamtzahl der Muslime weltweit beträgt über eine Milliarde Menschen und wächst kontinuierlich. Von ihnen leben 30 Prozent in Indien, rund 18 Prozent in der arabischen Welt und beinahe ebenso viele, nämlich 17 Prozent, in Südostasien. Die vier Länder mit den größten muslimischen Gemeinden befinden sich alle in Asien: Indonesien mit rund 208 Millionen, Pakistan mit 146 Millionen, Indien mit 127 Millionen und Bangladesch mit 120 Millionen Muslimen. Im Großen und Ganzen kann die in Südostasien praktizierte Form des mehrheitlich sunnitischen Islam als moderat bezeichnet werden.
|38|Malaysia mit seinen 60 Prozent muslimischen Malaien, 25 Prozent buddhistischen und konfuzianischen Chinesen und rund 10 Prozent Christen verschiedener Ethnien gilt als Musterland der Region, was das harmonische Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen betrifft. Der traditionellen malayischen Kultur ähnelt der Islam durch die starke Betonung der Beziehungen innerhalb einer Gruppe – wichtig ist, wen man kennt, wer von wem abhängig ist und wem gegenüber man selbst verpflichtet ist – sowie anderer Elemente. Dass dies auch wirtschaftlich funktioniert, zeigen die stetigen Zuwachsraten, auch und gerade in religiös geprägten Sektoren wie etwa dem Islamic Banking, in dem sich Malaysia und Singapur gerade eine weltweite Position aufbauen.
Grundsätzlich stellt das Zusammenwachsen der hochliquiden Wirtschaftsräume im Nahen Osten und in Asien einen wichtigen Trend der nächsten Jahre dar. Es liegt auf der Hand, dass dabei die muslimisch geprägten Länder Asiens eine wichtige Brückenrolle spielen.
Der seit Beginn des Jahres 2008 amtierende neue Generalsekretär der ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Vereinigung südostasiatischer Staaten), Surin Pitsuwan, war früher Außenminister Thailands. Als Muslim beschäftigt ihn besonders die Frage, warum die Muslime in Südostasien moderater, flexibler und aufgeschlossener sind als jene im arabischen Herzland des Islam. Er führt dies unter anderem darauf zurück, dass der Islam durch den Hinduismus und den Buddhismus genötigt war, sich zu modernisieren und anzupassen. Gerade in Ländern wie Malaysia habe sich der Islam effektiv mit einer Globalisierung und Gewaltenteilung auseinandersetzen müssen.
Obgleich der Islam in Südostasien gemeinhin als relativ mild und nicht extremistisch bezeichnet wird, spielt zum Beispiel der Fastenmonat Ramadan eine große Rolle. Große Teile der Bevölkerung, selbst wenn sie nicht regelmäßig zur Moschee zum Beten gehen, befolgen den Ramadan, der zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Essen, Trinken, Rauchen oder sexuellen Kontakt verbietet.
Die meisten südostasiatischen Muslime stammen aus dem Nahen Osten, beispielsweise aus dem Jemen die sogenannten Hadramis, die einen großen Teil der indonesischen Bevölkerung stellen. Dank der |39|engen Familienbande sind diese Gruppenzugehörigkeiten heute noch von großer Bedeutung. Familienclans bieten seit Jahrhunderten das ideale Vehikel, um bestimmte Handelssegmente in der Hand zu behalten. Aus diesem Grund ist der internationale Diamantenhandel stark von den Jains aus Indien dominiert, der internationale Reishandel wird hauptsächlich von Teochiu-Chinesen kontrolliert, was auch für den internationalen Heroin- und Opiumhandel gilt.
Auch der internationale Terrorismus der islamischen Welt wird durch Familien und lokale Splittergruppen gefördert. Die bereits genannten Hadramis spielen eine zentrale Rolle. Fast alle der führenden islamischen Extremisten in Indonesien sind Angehörige dieser Volksgruppe und untereinander verwandt. Diese starken lokalen oder familiären Beziehungen haben bis jetzt das Vordringen eines pan-asiatischen muslimischen Extremismus weitgehend verhindert. Es bleibt abzuwarten, inwieweit logistische und finanzielle Hilfe durch Osama Bin Laden und die Wahhabisten in Saudi-Arabien dazu führen wird, dass sich der Islamismus in Asien insgesamt zusammenschließt und konzertierte Aktionen durchführt. Der derzeit laufende Unabhängigkeitskrieg in Südthailand und in den Südphilippinen ist schon seit einigen Jahren im Gange und hat viele lokale Komponenten. Inwieweit die Radikalisierung innerhalb des Islam, die vor allem aus dem Nahen Osten hervorgeht, auf den Rest der islamischen Welt in Asien übergreifen wird, ist derzeit schwer abzuschätzen.
2. Kolonialismus und Kommunismus
Das Machtvakuum und die Orientierungslosigkeit, die nach einer jahrzehnte-, teils jahrhundertelangen Fremdherrschaft zurückbleiben, betreffen Kollektive wie Volksgemeinschaften genauso wie Individuen. Verbinden sie sich noch mit Traumata, so kann es ebenso lange dauern, bis eine gefestigte – kollektive oder individuelle – Persönlichkeit entsteht. In etlichen Ländern der Region hatte der Kommunismus versucht, das Vakuum der Kolonialherrschaft zu füllen, und sich oftmals auch aktiv im Widerstand gegen dieselbe beteiligt.
|40|Vietnam, Kambodscha und Laos sind die eindringlichsten Beispiele, wie Länder infolge von Bürgerkriegen zerrissen wurden. Der Kampf gegen den Kommunismus rief schließlich auch internationale Unterstützer wie die USA, aber auch kommunistische Staaten wie die Volksrepublik China und die Sowjetunion auf den Plan und oftmals ins Land. Diese Stellvertreterkriege verlängerten das Leid der um Einheit, Identität und Unabhängigkeit ringenden Ex-Kolonien erheblich.
Auch bei den vordergründig rassistisch bedingten Massakern, die 1965 in Indonesien Hunderttausende von Chinesen das Leben kosteten, schwang die Angst vor dem rotchinesischen Kommunismus mit. Bis zur Gegenwart spielen kommunistische Untergrundgruppen in Malaysia, Thailand und den Philippinen eine Rolle.
Last, but not least führte das Erbe der Kolonialherren, ähnlich wie im Nahen Osten, in etlichen Regionen, in denen verschiedene ethnische und religiöse Gruppen künstlich zusammengebracht wurden, zu erheblichen Spannungen. So birgt das besonders heterogene ehemalige niederländische Indonesien, wo der Widerstand gegen die Kolonialherren zu hohen Verlusten geführt hatte, zahlreiche Brandherde, von denen das ehemals portugiesische Osttimor sicher der bekannteste ist.
3. Nationalismus und Zentralismus
Nachdem jahrhundertelang fremde Mächte Gehorsam und Tribut eingefordert hatten, stand nach der mühsam errungenen Unabhängigkeit die möglichst rasche Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls im Vordergrund. Wenngleich ein solches bei zahlreichen ethnischen und religiösen Gruppen wie den Chinesen, Indern und Muslimen bereits vorhanden war, so galt es jetzt, dieses so weit als möglich auf die neu gegründeten, oftmals sehr disparaten Staatsgebilde zu übertragen. Die Herausbildung nationaler Identitäten und eines jeweils zugehörigen Nationalgefühls hatte daher mancherorts Priorität vor sozialem Ausgleich und Umverteilung.
Das Nationalgefühl musste mit den seit Jahrhunderten existierenden |41|Zusammengehörigkeitsgefühlen von Religion, Rasse, sozialer Schicht und Familie konkurrieren. Zum Teil gelang es, die nationale Identität als zusätzliches Bezugssystem zu etablieren, manchmal sogar, sie an erste Stelle zu setzen, allerdings scheint sie oftmals auch von untergeordneter Bedeutung zu sein: Gerade bei den stark verbundenen Clans der indischen und chinesischen Volksgruppen stellt sich in so manchem südostasiatischen Land die Frage, ob der Vorrang nun der Volks- oder der Staatsangehörigkeit zukommt.
Die Auslandschinesen
Die große wirtschaftliche Bedeutung der ethnischen Chinesen, von denen rund 60 Millionen in Südostasien leben, ruft auch Rassismus hervor. Zum einen sind diese Volksgruppen in den jeweiligen Gastländern überdurchschnittlich erfolgreich. Sie verfügen über enorme Mengen an Kapital, politischem Einfluss und internationaler Vernetzung. Diese Familienclans gelten vielen als die wahren Herren Südostasiens. Während sie einerseits enge Familienverbünde pflegen und sich Außenstehenden gegenüber abschotten, waren sie wiederholt Neid, Verfolgung und Pogromen ausgesetzt. Diese Mischung aus innerer Abgeschlossenheit, Elitenbildung und wirtschaftlich-politischer Macht provozierte immer wieder heftige Reaktionen. Kein Einzelfall war der siamesische König Rama VI., der so weit ging, in einem Traktat Anfang des 20. Jahrhunderts die ethnischen Chinesen als die Juden Asiens zu bezeichnen, deren Rassismus mit unersättlicher Gier und dem Fehlen jeglicher Loyalität gegenüber ihrem Gastland gekoppelt sei. Es mag bei solchen Voraussetzungen daher nicht überraschen, dass noch in den sechziger Jahren bei Pogromen in Indonesien und Malaysia Hunderttausende Chinesen getötet wurden.
In der Tat waren und sind die chinesischen Unternehmer Südostasiens auch am Wiederaufstieg Chinas an die Weltspitze beteiligt. Sie waren Investoren der ersten Stunde, nicht nur in den Sonderwirtschaftszonen der frühen achziger Jahre, und haben durch riesige Mengen an Kapital, Know-how und die Errichtung zahlreicher Produktionsstätten den sich anbahnenden Wirtschaftsboom in der Volksrepublik |42|maßgeblich unterstützt und für sich genützt. Bis zum heutigen Tag ist diese zusätzliche »Schattenvolkswirtschaft« der Auslandschinesen, zusätzlich auch und gerade durch Taiwan und Hongkong, ein Trumpf Chinas, über den die Rivalen Japan und Indien nicht oder nicht im gleichen Maße verfügen.
Zentralistische Strukturen
Nachdem der Kolonialismus, der 1498 mit Vasco da Gama begonnen hatte, mit der indischen Unabhängigkeit 1947 und dem Rückzug Frankreichs aus Indochina sein Ende gefunden hatte, war zum ersten Mal seit 400 Jahren (fast) ganz Asien ohne Fremdherrscher.
Doch der Abzug von Sach- und Personalmitteln der Kolonialmächte, die Kämpfe und Zerstörungen, das Wertevakuum und die Überlebenszwänge riefen nach raschem Handeln. Aus diesem Grund glaubte man an die Notwendigkeit der Schaffung straffer zentralistischer Machtstrukturen, deren Mittelpunkt die neuen Hauptstädte bilden sollten. In Phnom Penh, Jakarta, Manila, Rangun und Hanoi wurden zum Teil die alten Administrationen soweit möglich übernommen, auf jeden Fall aber sehr schnell schlagkräftige Machtapparate geschaffen. Nur in Malaysia und seit einiger Zeit in Indonesien gibt es einigermaßen dezentrale Strukturen.
China
Die durch den rasanten Aufstieg Chinas – der staunenden Welt durch die im August 2008 abgehaltenen Olympischen Spiele auf das Eindrucksvollste vorgeführt – ausgelösten Ängste in der westlichen Welt, verbunden mit den Unruhen in Tibet und anderen autonomen Gebieten wie der Provinz Xinjiang, werfen die Frage auf, ob und wie der Nationalismus in China erstarkt ist. Streng genommen gibt es in China eigentlich keinen Nationalismus, der auf Abstammung beruht. Wenn überhaupt, hat es immer nur einen »Bekenntnis-« oder »Gesinnungschinesen«, aber nicht den »Abstammungschinesen« gegeben. Die einigende und sinnstiftende Funktion, ein starkes »Wir-Bewusstsein«, |43|kam weder durch Religion noch durch Geburt, und somit Hautfarbe, Dynastie und Geografie zustande, sondern einfach durch die Tatsache, dass man sich auf eine bestimmte Wertordnung – mithin bestimmte Form der Zivilisation im Sinne des Konfuzianismus – eingelassen hatte. Dieses Bewusstsein, der höchsten zivilisierten Welt anzugehören, hatte sich allerdings nie auf die breiten bäuerlichen Massen in China erstreckt. Im Japanisch-Chinesischen Krieg begann sich ein Nationalpatriotismus der Landbevölkerung herauszubilden, der von den Kommunisten unter Mao genutzt und ausgebaut wurde und erstmals in der langen Geschichte Chinas zu einem Bauernpatriotismus führte.
Im Vergleich zum homogenen, kulturgeschichtlich lange isolierten Japan und dessen ausuferndem, von Sendungsbewusstsein getragenem Ultranationalismus war das Vorhandensein von Großmachtdenken in China immer schwach ausgeprägt, obwohl es durchaus Anhänger von Prinzipien wie Kuoda (»Ausbreitung« oder »Überlebensraum«) gibt. Doch im Gegensatz zu Japan sind solche Äußerungen in China meistens defensiver Natur. Es fehlt die ins Extrem gesteigerte Formulierung und Militanz. Blut-und-Boden-Polemik, rechtsextreme Organisationen und Imperialismus, wie etwa in Japan, sucht man in China vergebens. Gleichwohl soll nicht unterschlagen werden, dass sich in den neunziger Jahren, angestachelt durch Japan und insbesondere durch Shintaro Ishiharas 1989 erschienenes Buch Wir sind die Weltmacht, der Nationalismus in Asien stärker verbreitet hat. Der Ministerpräsident von Malaysia, Mahathir bin Mohamad, sprang auf den nationalistischen Zug auf und veröffentlichte gemeinsam mit Ishihara sein Buch Voice of Asia, nach dem sich die westlichen Länder im materiellen und moralischen Niedergang befinden. Von Zeit zu Zeit erscheint ein chinesisches Äquivalent unter einem an Ishihara erinnernden Titel, wie etwa 1996 China kann nein sagen oder Wettrennen mit den USA.