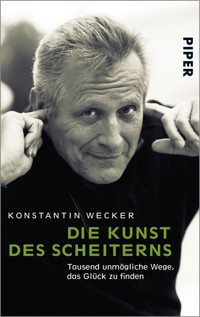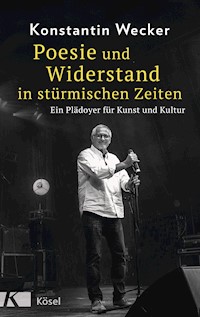8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Gedichte aus fünf Jahrzehnten Konstantin Weckers Lieder haben Epoche gemacht und seine Gedichte ebenso. Von den frühesten Gedichten, die er als Sechzehnjähriger schrieb, bis hin zu neuen, bislang unveröffentlichten Texten versammelt dieser Band die Gedichte Konstantin Weckers. »Meine Gedichte«, so schrieb Wecker einmal, sind Versuche, »sich dem einzigen, wirklich eigenen Gedicht anzunähern, das zu schreiben mir bestimmt ist«. Immer wieder beeindruckt Konstantin Weckers großes Vertrauen in die Kraft der Poesie und der Liebe, sein leidenschaftliches Bekenntnis zu einem intensiv gelebten Leben und der Glaube an die Veränderbarkeit der Welt. Mit bislang unveröffentlichten Gedichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Konstantin Wecker
Jeder Augenblick ist ewig
Die Gedichte
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2012
© 2012Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41496-8 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-14153-6
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Inhalt
Vorwort
1963 bis 1979: Eine ganze Menge Leben
1980 bis 1984: Ich möchte weiterhin verwundbar sein
1985 bis 1989: Jetzt eine Insel finden
1990 bis 1999: Stürmische Zeiten, mein Schatz
2000 bis 2012: Wut und Zärtlichkeit
Quellennachweise
Verzeichnis der Gedichtüberschriften und -anfänge
Vorwort
Konstantin Wecker gehört zu den wenigen Menschen, denen die Lyrik sozusagen angeboren ist. Es kann keinen Zweifel geben, dass er bereits als (im Takt) zappelnder Säugling lyrisch nach Milch gerufen hat– das wurde ihm, zusammen mit der außergewöhnlichen Musikalität, in die Wiege gelegt. Konstantin Weckers Lyrik ist keine elitäre, keine krampfhaft erarbeitete, denn die Texte sind keine Kopfgeburten, sie sind Wecker’sches Herzblut, die Symbiose von Herz und Verstand, die Sprache seiner Seele. Das macht seine Gedichte authentisch und so glaubhaft. Konstantin Wecker ist ein lyrischer Mensch, er kann nicht anders. Egal ob ein hauchzarter Liebesgesang oder der wütende Schrei nach Gerechtigkeit: die Sprache ist stets poetisch. Poetisch zart, poetisch wild– ob er nun im Lichte steht oder durch die Finsternis wandelt. Die Gedichte von Konstantin Wecker sind geschrieben von einem wahrhaftigen Menschen für Menschen. Sie werden freigegeben von seinem Herzen, sie berühren in ihrer Zärtlichkeit und in ihrer Wut. Konstantin Wecker spricht zu den Menschen nicht von einem Sockel herab, sondern von Angesicht zu Angesicht. Was er zu sagen hat, sagen muss, wird verstanden. Daher für manchen Rezensenten ungeeignet. Einzigartigkeit kann man überheblich und weltfremd zelebrieren oder freudvoll und wohlwollend mit anderen feiern. Konstantin Wecker tut Letzteres mit unbeirrbarer Leidenschaft.
Konstantin Wecker ist ein Poet. Poet– das ist einer, der außerhalb der Wirklichkeit lebt– was auf Konstantin Wecker, den so ausgesprochen politischen Menschen, nicht zuzutreffen scheint. Doch außerhalb der Wirklichkeit leben heißt nicht, diese nicht zu erkennen. Im Gegenteil, denn von außerhalb bildet sich eine ganz andere und oft weit stimmigere Sicht dieser Wirklichkeit, die leider oft, zu oft, eine Unwirklichkeit ist, eine Heimsuchung und nicht selten Katastrophe, was Konstantin Wecker nur zu genau verinnerlicht hat.
Poet ist aber auch einer, der sich sehnt, der träumt, der trauert– alles, was Sehnsucht weckt, ist poetisch–, damit muss man, wenn von Konstantin Wecker die Rede ist, nicht nur die Sehnsucht nach der Nachtigall meinen, die es ja dank der Ausdünstungen unserer Zivilisation schon fast gar nicht mehr gibt, von den rauschenden Mühlrädern ganz zu schweigen. Man muss auch an die Sehnsucht nach einer besseren Welt denken, einer Welt der Gerechtigkeit, des Friedens, der– ja, man wagt es gar nicht mehr laut zu sagen– Humanität, der Menschlichkeit. Davon zu singen ist Konstantin Wecker nie müde geworden.
Doch Spitzwegs Poet im Dachstübchen– das darf nicht das Bild des Poeten Konstantin Wecker prägen. Konstantin Wecker ist ein zorniger Poet, ein Prophet, erinnert in manchen seiner Lieder an diese kompromisslosen Rufer in der Wüste, von denen die Bibel spricht, der Schrei Gottes– das ist nicht zu viel gesagt– kommt aus ihrer Kehle, und ich scheue diesen gewaltigen Vergleich nicht, auch wenn er pathetisch klingen mag: Wenn Konstantin Wecker seinen »Willy« oder »Sage nein« singt, dann kommt das Wort Gottes aus seiner Kehle, vielleicht nicht das Wort eines Gottes einer bestimmten Religion oder Konfession, viel eher eines ganz anderen Gottes (ich zitiere: eines Gottes, den es gibt, weil sonst die Welt gottlos wäre, eines Menschengottes der Menschlichkeit). Er ist ein Schreier, und er hat recht, wenn er schreit, aufschreit– es ist ja zum Aufschreien, wenn man die heutige Welt mit wachem Sinn betrachtet. Er ist ein Wacher– ein Wächter, wir tun gut daran, auf ihn zu hören.
Konstantin Wecker singt sich die Verzweiflung von der Seele und ist dadurch– ich habe das Vergnügen, ihn doch ganz gut zu kennen– auch noch dazu ein heiterer Mensch. Früh ist er mit Musik– klassischer– in Berührung gekommen. Sein Vater war Sänger, Tenor– Konstantin Wecker hat ihm eins seiner anrührendsten, seiner– ja eben– poetischsten Gedichte gewidmet. Ich kenne kein anderes Beispiel eines so herzlichen Bekenntnisses eines Sohnes zu seinem Vater. Die 68er-Bewegung riss Konstantin Wecker mit, wie nicht anders zu erwarten, sein politisches Engagement verließ ihn von da an nicht mehr.
Konstantin Wecker ist ein Bekenner, ein Rufer, ein– ja auch, im besten Sinn– Prediger, einer, der uns ins Gewissen redet. Und damit komme ich zum Besten, was ich von ihm sagen zu können glaube: Er ist kein Wegweiser, der stehen bleibt, nur zeigt, wo es hinzugehen hat, er geht selber mit. Er ist, und das ist der innerste Kern seines Wesens, er ist die Ehrlichkeit selbst. Was er singt und sagt, meint er ehrlich und aufrecht.
Bleib aufrecht, lieber Konstantin, du Poet der Ehrlichkeit, bleib aufrecht, was auch immer an dir rüttelt.
Herbert Rosendorfer
Eine ganze Menge Leben1963–1979
Kaum dass ich mir bewusst war,
dein Haar zu halten
und das Licht auf deiner Haut zu fangen
und das Pflaster leuchtete wieder
schön,
wie die Mauer Schatten gab
und das Haus im Tierkreiszeichen stand,
abbrüchig,
aber mit tausend Kellern,
kaum dass ich mir bewusst war,
dass du im Licht standst
und in der Stunde,
kaum dass ich mir bewusst war–
begann ich schon
unseren leis atmenden Fluchtversuch zu bemerken.
Kinderlied
Komm mit zu den Kieseln, Kind,
wir wollen sie ins Wasser werfen,
wir wollen sie rollen lassen,
die bunten Kiesel,
Kind.
Ich will mit dir spielen
im Sand,
ich will deine Augen haben,
ich will dein Finger sein,
ich bin der Kiesel,
rund,
bunt an den Ufern, Kind,
da wollen wir spielen
und:
Komm mit zu den Kieseln,
Kind.
…wenn ein Baum hier wäre
oder ein Blatt
oder nur der Geruch eines Baums
oder die Farbe eines Blatts,
wenn der Tau hier wäre,
der das Blatt nicht freigibt,
oder eine Nase voll Rinde
oder ein Tropfen Grün,
wenn ein Baum hier wäre
oder ein Blatt…
Die in Bahnhöfen das Glück suchen
sind wartesaalblau,
singen Schienensang,
die in Bahnhöfen das Glück suchen,
träumen Zeitungstraum.
Und wenn sie aufstehen
von den harten Begebenheiten,
die in Bahnhöfen das Glück suchen,
gehen sie alle unter die Räder.
Noch im Liegen denken sie an Bettzeug
und erlaubten Schlaf.
Und das Wasser
hat einen Mann,
der treibt es.
Klein sitzt er
am Grund. Macht
Welle um Welle.
Die Käfer
Käfer laufen
Käfer surren
Käfer zirpen
Käfer schwirren
Käfer auf Erde
Käfer auf Tau
Käfer braungold
Käfer grünblau
Käfer schwebt
in singender Luft
Käfer krabbelt
in Blütenduft
Käfer in Rinde
vom Himmelbaum
Käfer träumt
Wurm-Traum
Käfer möchte
auf hohe Wipfel
Käfer kann nicht
kommt nie auf den Gipfel
Käfer mordet
Engerlingkind
Käfer frisst
Kind geschwind
Käfer schießt
Engerling tot
Erde wird
blutrot
Käfer bist du,
Engerling er
Krieg haut zu
Mensch ist nicht mehr
Musst
von den Pflastern
die Ritzen
meiden,
Seevogel,
sollst
meine Erde nicht
umpflügen
Bin ein Kieselschiff,
darfst mich
ich
nennen
Es stürzen die Windgesichter,
halt fest:
die Zäune sind umgefallen,
entzähmt
die kaum riechbare Haut der
Mädchen,
die untastbare Welt ihrer
Wortwahl,
wieder prangt der Galgen
und der Stimmbruch
einer Generation
lastet im Fleisch mir
Komm mit zu den feuchten Wurzeln,
satt trink dich,
nimm eine Handvoll Erde,
du,
die Steine am Fluss
schimmern rötlich,
pass auf:
ich zeichne ein Loch in die Luft,
reite fort,
reite fort,
zögere nicht,
es schwindet so rasch
Aus den Sümpfen
sie blickte den Mohn
pflückte einer
und die Farnmähne
viel Ungebornes
der Moorbrüder
und die Mantelnacht
entdeckte sie
wer weiß
Ohne zu wissen
fiel ein sehr kleiner Mond
in deine biegsame Hand
wir waren’s:
unsere Wundergestalten
zauderten nicht
Der Wind
malt eine Fahne ins Wasser,
so tief
träumen die Freunde
und einen silbernen Pinsel,
hingegossen ans Ufer
schau,
der deine Hand hält,
ist dein Traumgefährte,
webt Bilder und Wunderflüche
und sein Atem ist der
schweigsame Regen der Nacht
Bohr ein Loch in den Sand,
sprich ein Wort hinein,
sei leise,
vielleicht
wächst dein kleines Vertrauen
irgendwann
groß in die Sonne
Bist ein seltner Fisch
wieder
hat sich mein Netz
in dir
verfangen
Nach abgestandnem Männerfleisch
schmeckt diese Luft,
nachts im Asyl
der Obdachlosen.
Und Bett an Bett
und Welt an Welt,
ein gleicher Atemzug,
der sich in allen wiederholt.
Einstimmig
ist der Gesang,
nachts
im Asyl der Obdachlosen.
Zellen
die Quadrate erwachsen
sehr
drüberhingleiten:
ich fehle nicht
unter den Händen
die Hornsohle,
festgeschnallt ans Haar,
zählen:
ein Tausendstel zu früh
ein Tausendstel zu spät
schon:
ich würde entarten
so
zieht sich’s dahin.
Wieder dort sein
still liegen,
den Regen riechen,
rasseln lassen,
pitschnass sein,
ganz still liegen,
die Hand
weiß
in den Sand wühlen
Du aber geh in den Wind
denke an zarte Begebenheiten,
deinen Vermutungen gib dich
und abends
wenn du Hoffnung löffelst,
lass dich fortweben
mit dem Wort an der Leine
Anfang
Anfang.
Du hast lange geschwiegen,
dann,
der Schrei
(jener weltberühmte
oft zitierte Schrei),
die Bäume,
die Gesichter,
du wirst ein guter Junge genannt werden,
du wirst ein fleißiges Mädchen genannt werden,
der Pfarrer,
die Tanten
mit ihren triefenden Stirnen,
mit ihrem Gespür für das, was immer war
und wem er jedenfalls sehr ähnlich sieht,
du spürst ihren Sahnetortenatem,
du lernst,
dich vor den Menschen zu ekeln.
Anfang.
Da ist ein großer Himmel,
da sind Hund und Katze,
Vogel und Auto,
Kühlschrank und Vater
und Regen,
ein manchmal harter,
ein manchmal schmiegsamer Regen,
da sind
die Ahnen,
die Gebote,
die Verbote
die Zeigefinger,
du wirst ein widerspenstiger Junge genannt werden,
du wirst ein unmoralisches Mädchen genannt werden,
die Moralisten werden dich Hurenbock heißen,
die Nymphomaninnen werden dich Hure nennen,
du versuchst,
Wälder schön zu finden,
Zärtlichkeit vor den Verstand zu stellen,
ahnst,
der Geruch von frischer Erde ist wichtig,
dann wird es dir verschlossen,
dich zu öffnen.
Anfang.
So viele fremde Freunde
mit ihren schönen Nasen,
mit ihren weichen Mündern,
sie brauchen dich,
sie sprechen zu dir
mit ihren spitzen Nasen,
mit ihren klobigen Mündern,
tuscheln und zischen,
jetzt eine Höhle bauen,
sich schwarz färben,
Pfeil und Bogen und Asche im Gesicht
und dann los:
den Vätern in den Hintern treten,
Gedichte schreiben,
Reden halten,
tun,
du wirst ein zerstörerischer Mann genannt werden,
du wirst eine ungetreue Frau genannt werden.
Anfang.
Noch weißt du nichts
von den kleinen klebrigen Hotels,
von den Wohnküchen,
von denen,
die ihr Leben aus dem Rinnstein saufen,
von den verderblichen Lichtern
über den Eismeeren,
von den süßlichen Gerüchen in den Lazaretten,
weißt noch nichts
von den Gebeten in den Gefängnissen,
von den Briefen der Töchter an ihre
verschollenen Väter,
von all diesen Nächten und Tagen,
von alledem
weißt du noch nichts.
Ich hab geträumt
Heut hab ich geträumt, am 15.10.
beginnt der Krieg. Der Himmel ist rot.
Aus den Flüssen steigen mannsgroße Frösche
und die Ratten programmieren den Tod.
Die Bürger pressen die Aktentaschen
pflichtbewusst an die Köpfe. Die Nacht,
der Pilz und das kreischende Licht
haben mich um meinen Schlaf gebracht.
Aufstehen. Müde. Etwas verbraucht–
war das nun Prophetie?
Ein Blick aus dem Fenster: Alles wie sonst.
Passieren kann so was ja nie.
Zueignung
Geboren in zwar knappen Zeiten,
aber keine Komplikationen im
Mutterleib.
Kein Kaiserschnitt,
nichts, was den Ausgang versperrt hätte,
nichts Aufregendes, diese Geburt:
farblose Laken und eine Hebamme mit
Raucherbein.
Wär gerne am Amazonas zwischen zwei Regenzeiten
in die Welt geglitten
oder in einer Waschküche
heimlich als
Makel einer zwölfjährigen Mutter
oder in einem Luftschutzkeller
unter den Trompetensalven der Bomben–
hätte gern mehr Action gehabt bei meiner Geburt.
Versuche dies nachzuholen:
Gedichte schreiben,
endlose Triller am Klavier
zu häufiges Lächeln, wenn Mädchen den Raum betreten,
anstatt
sich einfach unter die warm und weich tropfende Sonne zu legen
und die Menschwerdung endlich einmal zu
vergessen.
Venedig
Als ob an ihren angefressnen Pfählen
die Stadt mit letzter Kraft sich stützen wollte,
so taumeln die Paläste mit den Säulen
aus feuchtem Marmor steil zum Meer. Als rollte
ein großer Donner aus dem Grund der Erde,
der diese müde Stadt zum Sinken bringt.
Als stiegen aus den Flüssen dunkle Pferde,
die alles niedertrampeln: und Venedig sinkt.
Und mit ihm sinken alle Illusionen
der großen Herrschaft einer kleinen Welt:
Galeeren, Filmfestspiele und Inquisitionen.
Das Spiel ist aus. Der Wasservorhang fällt.
Du träumst vielleicht und fährst in schwarzen Booten
noch einmal die vertanen Welten ab,
und du befreundest dich mit all den Toten,
die diese Stadt ins Meer gespien hat,
die steigen noch ein letztes Mal ins Leben
und feiern Feste, und mit festem Tritt
und dunklen Rufen lassen sie die Erde beben.
Es ist so weit: Venedig sinkt, und du sinkst mit.
Rom
Schon mit dem ersten Licht ist diese Stadt
in Leben eingetaucht und Kraft.
Die Häuser schimmern zwar noch etwas matt,
doch durch die Straßen rinnt schon all der Saft,
den Rom im Überfluss besitzt. Man spürt
das dumpfe Pochen aus den Katakomben,
wo sich der erste Christenleichnam rührt.
Sie werden alle kommen und mit Bomben
aus Glut und Hitze um sich schmeißen.
In ein paar Stunden steht die Stadt in Brand.
Die Götter stehn in Positur und gleißen
und halten bunte Dias in der Hand.
Unter dem Titusbogen weiden deutsche Schafe
und die Cäsaren lassen es geschehn.
Statt aufzuwiegeln wie einst jener Sklave,
wolln sie zerbröckeln und auf Marmor stehn.
Die grauen Päpste kauern auf St. Peter
und geifern ihren Segen auf die Stadt
und suchen Gott. Was soll’s, da oben steht er
und jammert, dass man ihn vergessen hat.
Er soll sich vorsehn, dass ihn jene Pferde,
die seit Jahrtausenden die Sonne ziehn,
nicht niedertrampeln. Denn schon glüht die Erde
und alle grellen Lichter werden fliehn
und ins Inferno tauchen. Die Paläste
verlieren ihre Schatten und verstummen.
Die Zeit der Katzen kommt und die der Feste,
die greisen Dichter steigen aus den Niederungen,
und endlich kann sich Rom besaufen
die Brüste prall und voll von Wein,
Gelächter fangen an zu laufen
und schwellen an und brechen in dich ein,
und du ertrinkst und taumelst durch die Gassen,
die Häuser flattern auf, du rennst vorbei,
du willst die ganze Stadt umfassen–
Rom hat dich endlich. Nie mehr bist du frei.
Für Rainer Maria
Als der Schwan sehr majestätisch,
grenzenlos und so ästhetisch
durch noch Ungetanes schritt,
nahm ich dich zum Ufer mit.
Und dann schlang ich meine Hände
sehnsuchtsvoll um deine Lende,
während ich vom Mondlicht sprach,
gab dein Körper stückweis nach.
Du entflammtest, ich entbrannte,
und das Tier, das Unbekannte,
war sehr weiß und adlig rein
und schien tugendsam zu sein.
Und der Abend neigte sich,
unser Glück verzweigte sich,
ich fing an dir zu nesteln an,
dem Tier erschien das wundersam.
Und grade als ich an der Schwelle
meines Glücks die Weichen stelle,
fing voll Scham der dumme Schwan
grauenvoll zu singen an.
Du entrücktest, ich erzürnte
und der Schwanensänger türmte
und entschwebte ohne Schwere
schweigend ins Imaginäre.
Ich werde dich zum Abendessen essen
Ich werde dich zum Abendessen essen.
Du wirst vielleicht erstaunt sein, aber ich
will dich auf keinen Fall mit falschem Maß bemessen.
So sagt man doch: Vor lauter Liebe fress ich dich.
Ich will mein ganzes bürgerliches Denken
in diesem kannibalen Akt vereinen.
Du sollst dich mir noch einmal restlos schenken,
dann bist du frei. Ich werd dich nicht beweinen.
Wer liebt, besitzt, das darf man nicht vergessen,
und wer besitzt, hat nun mal mehr vom Leben.
Drum werd ich dich zum Abendessen essen,
dann muss ich dich dir niemals wiedergeben.
Hymne an den Frühling
Du. Es atmet sich leichter.
Der Geschmack von Kastanien pirscht sich an.
Die Mädchen huschen wieder.
Du. Selbst die Gebrauchtwagenverkäufer
glauben ganz kurz nicht mehr an ihren Beruf.
Jetzt heißt’s
Zeitungen suchen zum Zudecken.
Endlich:
Hochkonjunktur der Sportwagenfahrermützenhersteller.
Die Intellektuellen
bereiten sich auf die Biergärten vor.
Du. Man kann dich beißen.
Ein paar tragen dich unterm Busen, Frühling.
Wie dumm.
Sonst alles beim Alten.
Die Schlagerproduzenten tunen ihr Hüsteln.
In den Karateschulen wird weicher getreten.
Zu Hause wartet die Unruhe.
Noch ’ne Erinnerung an Marie A.
(für B.B.)
Wir trafen uns in einem Regenbogen,
der Regen war schon lange fortgezogen,
nur noch des Bogens Bogen spannte sich
uns übers Haupt und glänzte fürchterlich.
Du warst im Blau und ich im Rot gesessen,
wir haben fast die Welt um uns vergessen,
da drücktest du dir einen Pickel aus,
der war sehr weiß und sah sehr picklig aus.
Ich will dagegen allgemein nichts sagen,
denn jeder kann mal einen Pickel haben.
Jedoch zur Zeit der höchsten Weltentrückung
verschafft derselbe seltene Verzückung.
Du pickeltest, nun gut, ich sah zu Boden,
der Regenbogen hat sich schon verzogen,
kaum war noch Blau, kaum war noch Rot zu sehn.
Nur noch der Pickel war sehr weiß und blieb bestehn!
Für Gottfried Benn
Schweigender nie. So viel durchforstet im Hirn.
Kämpfe und Frost. Und eine blutende Stirn.
Dieses verrottete Ich macht sich zum Absprung bereit,
die Zunge nach innen gerollt und von leeren Parolen befreit.
Schweigender nie. Schon viel zu viel Fremdes durchlebt.
Das lähmende »Wie« endlich ad acta gelegt.
Dann Aufsturz ins All. Die Zeit ohne Vorzeichen sehn.
Schweigender nie. Drüber und überstehn.
Zwölfzeiler eines herben und erfolgreichen Künstlers auf dem Männlichkeitstrip
Er peitscht mit seinen Schritten den Asphalt,
der ist verwundet, fast betäubt und windet sich.
Sein Atem ist aus Eisen, blank und kalt.
Er geht zum Spiegel und bezeichnet sich als fürchterlich.
Und dann befällt ihn auch ein Gruseln vor sich selbst:
Wie herrlich herrisch seine Zähne blinken.
Er richtet seine Schultern und ist Held
und macht sich auf, die rechte Faust zu zinken.
Dann sticht er in die Kneipe und sein Atem
befällt wie Eis den Raum. Man wartet ab.
Er ist bereit und lächelt sanft in Raten
und schreitet in die Männerherrlichkeit hinab.
Reinheitsgebote überall,
jedes Gramm Fleisch
wird ausgelotet,
kein Meter Film ohne
Durchleuchtung,
Waschmittel geben
Gesetze,
dem Fleisch wird sein
Duft
und der Haut wird das
Atmen verweigert,
sogar das Wort ist zum
Lasttier geworden,
seine Zuhälter befällt schon die
Fettsucht.
Sie sollen Verträge haben mit der
Metzgerinnung
betreffs der
Hirnpreise.
Stur die Straße lang
Stur die Straße lang und nichts denken,
nur: Es ist heiß heute.
Irgendjemand schüttet Licht aus.
Der Motor läuft erstaunlich ruhig.
Auf der Brücke lächeln brave Kinder.
Sie träumen davon, Handgranaten nach unten zu schleudern.
Die Tachonadel zittert ein wenig. Das ist normal.
Natürlich geht es südwärts.
Du hast deiner Frau nicht mal mehr die Meinung gesagt,
doch vor deinem Chef endlich die Hosen runtergelassen.
Schön. Am Mittag zittert die Luft