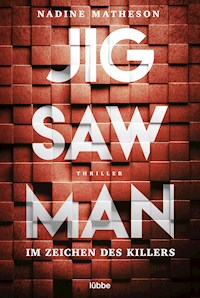9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als DI Anjelica Henley zu einem neuen Tatort gerufen wird, schwant ihr nichts Gutes: In einer kleinen Londoner Kirche wurde ein Pastor brutal ermordet. Während Henleys Team den Tatort genauer untersucht, entdecken sie in einem Nebenraum einen angeketteten, halbtoten jungen Mann. Henleys Bauchgefühl sagt ihr, dass der junge Mann nicht vom Mörder eingesperrt worden ist. Aber wer war es dann? Und warum wurde der Pastor ermordet? Henley sucht fieberhaft nach Antworten, aber stattdessen stößt sie nur auf immer mehr Leichen, die auf die gleiche Art zu Tode gequält wurden wie der junge Mann aus der Kirche. Haben Henley und die Serial Crimes Unit es etwa mit einem religiösen Serienmörder zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumVersPrologKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35KAPITEL 36KAPITEL 37KAPITEL 38KAPITEL 39KAPITEL 40KAPITEL 41KAPITEL 42KAPITEL 43KAPITEL 44KAPITEL 45KAPITEL 46KAPITEL 47KAPITEL 48KAPITEL 49KAPITEL 50KAPITEL 51KAPITEL 52KAPITEL 53KAPITEL 54KAPITEL 55KAPITEL 56KAPITEL 57KAPITEL 58KAPITEL 59KAPITEL 60KAPITEL 61KAPITEL 62KAPITEL 63KAPITEL 64KAPITEL 65KAPITEL 66KAPITEL 67KAPITEL 68KAPITEL 69KAPITEL 70KAPITEL 71KAPITEL 72KAPITEL 73KAPITEL 74KAPITEL 75KAPITEL 76KAPITEL 77KAPITEL 78KAPITEL 79KAPITEL 80KAPITEL 81KAPITEL 82ÜBER DIESES BUCH
Als DI Anjelica Henley zu einem neuen Tatort gerufen wird, schwant ihr nichts Gutes: In einer kleinen Londoner Kirche wurde ein Pastor brutal ermordet. Während Henleys Team den Tatort genauer untersucht, entdecken sie in einem Nebenraum einen angeketteten, halbtoten jungen Mann. Henleys Bauchgefühl sagt ihr, dass der junge Mann nicht vom Mörder eingesperrt worden ist. Aber wer war es dann? Und warum wurde der Pastor ermordet? Henley sucht fieberhaft nach Antworten, aber stattdessen stößt sie nur auf immer mehr Leichen, die auf die gleiche Art zu Tode gequält wurden wie der junge Mann aus der Kirche. Haben Henley und die Serial Crimes Unit es etwa mit einem religiösen Serienmörder zu tun?
ÜBER DIE AUTORIN
Nadine Matheson wurde in Deptford in Südwest–London geboren und ist dort auch aufgewachsen. Sie arbeitet als Verteidigerin in Strafrechtsverfahren, kennt also die Welt ihrer Serie genau. Sie hat außerdem den Schreibwettbewerb der Londoner Universität gewonnen, JIGSAW MAN – IM ZEICHEN DES KILLERS ist ihr erster Roman.
N A D I N E M A T H E S O N
JIGSAW MAN
DERTOTEPRIESTER
T H R I L L E R
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2022 by Nadine Matheson
Titel der englischen Originalausgabe: »The Binding Room«
Originalverlag: Harper Collins, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ralf Reiter, Köln
Titelillustration: © kornik/shutterstock; © llaszlo/shutterstock
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0352-9
luebbe.de
lesejury.de
»… traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen.«
1. Johannes 4:1
Prolog
Der Splitter eines Rippenknochens durchstößt die dünne, schlüpfrige Membran seines rechten Lungenflügels. Gelblicher Eiter, der den unverkennbaren Geruch von verwestem Fleisch abgibt, sickert aus der infizierten Wunde in seinem Rücken. Gleich unterhalb seines Schulterblatts hat sich die rostige Sprungfeder der Matratze in das geschwollene Fleisch gebohrt.
Verzerrte Stimmen gellen auf und verstummen wieder, fast als spielte jemand am Lautstärkeknopf eines billigen Radios. Er schreit, aber nichts ist zu hören. Seine ausgedörrte Kehle kann die Laute seiner Not nicht mehr bilden.
»Du musst aufhören.«
»Was machst du da für eine Scheiße? Ich hab dir gesagt, du sollst aufhören.«
Als sengende Hitze sich über seine Fußsohlen ausbreitet, windet er sich, seine Zehen werden steif, die alten Brandblasen platzen. Das Seil schneidet ihm tiefer ins nackte Fleisch der Handgelenke. Blaue Adern pochen und leuchten unter der durchscheinenden Haut: Sein Blut kämpft darum, frei fließen zu können.
Schwere Schritte nähern sich ihm. Unter Schmerzen dreht er den Kopf zur Wand.
»Was machen wir denn jetzt? Wir können ihn nicht … was machen wir …«
»Halt die Fresse.«
Sieben Wörter spielen auf Endlosschleife in seinem Kopf. Ich will nicht sterben. Bitte hört auf.
Er hört ein Wispern, als ein Krampf seinen Körper durchläuft und sein Kopf gegen die blutbespritzte, moosbedeckte Wand schlägt. Der Aufprall erzeugt eine zweite Fraktur in seinem Schädel. Er spürt die warme Haut eines anderen Menschen auf seiner Brust. Eine kurze Erholung, ein wenig Trost. Heiße Luft umhüllt sein Ohr. Er hört ein Wispern.
»Weiche.«
Hände drücken ihm fest gegen die Brust, und eine dritte Rippe bricht entzwei und sticht ihm in den linken Lungenflügel; er bekommt keine Luft mehr.
Tränen tränken das Tuch, das seine Augen bedeckt.
»Du wirst ihn umbringen.«
Bitte.
Er würgt trocken und atmet stark parfümierten Weihrauch ein. Das schmerzhafte Husten rüttelt an den gebrochenen Knochen in seiner Brust. Fauliger Schleim füllt seinen Rachen und überzieht seine Zunge.
Er versucht zu treten. Ein zweites Händepaar drückt auf seine Oberschenkel, klemmt die Nerven ab und erzeugt unerträgliche Schmerzen. Ihm ist, als verbrenne er von innen heraus bei lebendigem Leib.
»Wir müssen gehen.«
»Sieh ihn dir an. Liegt da wie ein Hund.«
Eine Hand packt ihn am Kinn und drückt zu.
»Ich habe dir gesagt, dass er den Teufel in sich hat.«
KAPITEL 1
Henley starrte den Kalender auf dem Schreibtisch an, so ein Wohlfühlding. Genieße jeden Augenblick, stand in großen goldenen Prägebuchstaben vor einem abstrakten Druck in bunten Primärfarben, und das Datum erwiderte ihren Blick. Montag, 17. Februar. An dem Tag war nichts Besonderes. Keine denkwürdigen Anlässe, kein Zahnarzttermin. Nur ein Tag.
»Alles okay?«
Dr. Isabelle Collins hielt beim Einschenken des grünen Tees aus der Glaskanne inne, als Henley sich vorbeugte und den Kopf zwischen die Knie nahm.
»Alles gut«, antwortete Henley. Sie hob den Kopf wieder, schloss die Augen und wartete darauf, dass das vertraute, aber unangenehme Gefühl verging.
»Sind Sie sich sicher?«
»Das passiert andauernd. Es hat nichts zu bedeuten.«
»Alles hat etwas zu bedeuten. Möchten Sie mir erzählen, was Sie derart aus dem Gleichgewicht gebracht hat?«
»Nein«, sagte Henley. Sie musste sich zusammenreißen.
»Wie ich Ihnen bereits sagte, funktionieren solche Sitzungen gewöhnlich am besten, wenn Sie reden«, erwiderte Dr. Collins und füllte nun die Porzellantasse mit Tee. »Wir haben jetzt 7 Uhr 43.«
»Und Sie sind enttäuscht, dass ich mich Ihnen in den vergangenen zwölf Minuten noch nicht geöffnet habe.«
»Ein Wasserkessel, den man beobachtet, fängt nie an zu kochen, Anjelica.«
»Gott, Sie klingen ja wie meine Mutter.«
»Hmm, nach fünf Monaten erwähnen Sie sie zum ersten Mal. Tatsächlich haben Sie in den ersten fünfzehn Minuten einer Sitzung noch nie so viel geredet wie heute.«
»Ich dachte, Sie hätten gesagt, dass ein Wasserkessel, den man beobachtet, nie zu kochen anfängt.«
»Das ist richtig, aber in dem Moment, in dem Sie den Blick von dem Kessel nehmen, wird er überkochen. Ich habe Ihnen bei unserer allerersten Sitzung gesagt, dass ich nicht beabsichtige, Ihre oder meine Zeit zu verschwenden. Wenn ich auf geselliges Schweigen aus wäre, hätte ich mir schon längst eine Katze zugelegt.«
Henley zog eine Braue hoch. »Sie sind heute Morgen ein wenig bissig.«
Dr. Collins zuckte mit den Schultern. »Wie schon gesagt: fünf Monate. Ich möchte Sie auf den Weg schicken – in dem Wissen, dass Sie die Trauerarbeit geleistet und nun akzeptieren können, was Ihnen zugestoßen ist; dass Sie imstande sind, Ihr Leben zu führen, ohne fürchten zu müssen, Sie könnten in sich zusammenfallen. Sie sollten aufrichtig über das sprechen, was Ihnen widerfahren ist, und das schließt den Verlust Ihrer Mutter mit ein.«
»Dass ich meine Mutter erwähnt habe, bedeutet noch lange nicht, dass es jetzt plötzlich zu einem Ausbruch von Trauer kommen wird.« Henley fuhr mit dem Finger am Kragen ihrer Bluse entlang und zupfte ihn von der Haut weg.
»Ich warte nicht auf Jammern und Zähneklappern, aber vielleicht auf eine Anerkenntnis der Tatsache, dass der Tod Ihrer Mutter fast ein Jahr zurückliegt.«
»Dessen bin ich mir bewusst.«
»Und das macht Ihnen keine Sorge? Dieses Gefühl kalter Distanz?«
»Das ist keine Distanz. Ich kann mich nicht von meiner Mutter distanzieren, als wäre sie ein Fall, in dem ich ermittle, aber ich kann es abschotten, damit es mich nachts nicht wachhält.«
»Es? Dass es Sie nachts nicht wachhält oder dass Sie tagsüber nicht an sie denken müssen, genau jetzt, in diesem Moment. Sie blenden sie aus.«
Henley starrte Dr. Collins an. Momente wie diesen konnte sie schon nicht mehr zählen. Herausforderungen, gegen die sie sich nicht verteidigen konnte. Dr. Isabelle Collins hing nicht der gefühlsseligen Methodik an, die Dr. Afzal, Henleys vorheriger Therapeut, angewendet hatte. Dr. Collins stichelte, provozierte und lehnte sich dann zurück und beobachtete. Henley hatte noch nicht herausgefunden, ob Collins alle ihre Patienten so behandelte oder diese Art für Henleys Stunden an jedem zweiten Montagmorgen reserviert blieb. Henley rutschte auf ihrem Stuhl umher und widerstand dem Drang, die Jacke auszuziehen, obwohl Dr. Collins dafür gesorgt hatte, dass in ihrem Sprechzimmer nahezu tropische Temperaturen herrschten.
»Es besorgt mich, dass Sie noch immer nicht bereit sind, über Ihre Mutter zu sprechen oder über Ihren alten Vorgesetzten, Detective Chief Superintendent Rhimes«, sagte Collins.
»Über Rhimes brauche ich nicht zu reden, und meine Mum ist nicht der Grund, weshalb ich hier sitze«, erwiderte Henley. »Ich weiß, wo sie ist. Sie liegt in einem Eichensarg sechs Fuß unter der Erde des Friedhofs Brockley. Grabnummer 19R5QA.«
»Aber wo Olivier ist, wissen Sie nicht?«
Henley verkrampfte sich, als sie seinen Namen hörte. Sie hatte ihr Bestes getan, um den Mann zu vergessen, der beabsichtigt hatte, sie auf die lange Liste seiner Opfer zu setzen, und nicht nur einmal, sondern zweimal versucht hatte, sie umzubringen. Henley hatte zu viel Energie darauf verwendet, sich einzureden, dass Peter Olivier tot war und ihr nichts mehr anhaben konnte, aber es gab Tage, an denen sie schwören konnte, dass sie seinen Atem im Nacken spürte.
»Ich weiß, dass wir das durchgesprochen haben, aber es sind fünf Monate vergangen. Logisch gesehen, was sagt Ihnen Ihr Verstand? Stellen Sie sich vor, mit der Familie eines Opfers zu reden.«
Die Knoten in Henleys Schultern zogen sich straffer. Sie atmete ein und dachte an das, was Pellacia ihr gesagt hatte, als sie ihn im Krankenhaus besuchte.
»Ich würde Ihnen sagen, dass niemand in diesem Wasser überleben kann. Er war bereits verletzt, bevor ich auch nur … bevor er mich angriff.«
»Aber Sie zweifeln noch immer an seinem Tod?«
»Ich zweifle nicht.«
»Ihrem Mann haben Sie gesagt, dass er tot ist.«
»Das war das, was er hören musste. Was sollte es nützen, wenn er befürchten müsste, dass Olivier noch immer irgendwo frei herumläuft?«
»Aber was nützt es Ihnen, was Sie tun?«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie haben noch nicht losgelassen, Anjelica. In Ihrem Leben wird kein Raum für irgendetwas anderes sein, je länger Sie sich an den Gedanken klammern, dass Olivier noch am Leben sein könnte.«
Dr. Collins zog das Notizbuch mit dem festen Einband aus der Ritze ihres Sessels, wo sie es hingesteckt hatte, und schlug es auf. »Vergangenen Monat habe ich Ihnen eine niedrige Dosis Zopiclon verschrieben. Wirkt das Medikament nicht?«
»Und ob es wirkt«, sagte Henley. »Es haut mich um, und wenn ich aufwache, bin ich zu nichts zu gebrauchen. Ich fühle mich dann, als würde ich durch einen Nebel irren.«
»Also sagen Sie mir, dass Sie aufgehört haben, es zu nehmen?«
»Ich muss meine Arbeit machen.«
»Welche Arbeit meinen Sie? Ehefrau, Mutter oder Kriminalbeamtin?«
Henley merkte, wie die Wut sie überfiel. »Wollen Sie mich kritisieren? Wollen Sie andeuten, dass ich meinen Job über meine … meine häuslichen Pflichten stelle?«
»Ich kann das nicht beantworten. Können Sie das zu Ihrer Hausaufgabe machen? Seien Sie ehrlich mit sich, wer Sie sind und was Sie wollen.«
»Ich weiß, was ich will. Ich will ohne das Gefühl aufwachen, dass mir jemand die Brust eindrückt, und sicher sein, dass ich den Tag überstehe, ohne in die Krise zu geraten.«
»Das wird nicht geschehen, bevor Sie sich endlich dem stellen, womit Sie wirklich ins Reine kommen müssen. Olivier ist ein Auslöser, aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass Sie noch eine ganze Menge mehr zurückhalten.«
Tote, eisige Luft klammerte sich wie besessen an den Winter, und es begann zu schneien. Henley schloss den Reißverschluss ihres Mantels so hoch, wie es ging, und zog sich die Mütze tief ins Gesicht, bevor sie aus dem umgebauten Lagerhaus auf der Shad Thames trat, in dem Dr. Isabelle Collins wohnte und arbeitete. Das Kopfsteinpflaster der Straße war mit glattem schwärzlichem Eis überzogen. Von den Stahlbrücken, die von den Gebäuden links und rechts die Straße überspannten, hingen gefährlich aussehende, scherbenartige Eiszapfen hinunter. Auf dem Weg zum Auto machte sich Henley Vorwürfe. Sie selbst hatte um Hilfe gebeten. Sie hatte Rob die zerknitterte Visitenkarte von Dr. Collins gereicht und ihn angefleht, einen Termin für sie zu machen. Einen Termin, den sie dann zweimal abgesagt hatte. Sie hatte sich vorgenommen, ihre Seele zu entblößen, und sich weisgemacht, es wäre leichter, mit jemandem zu reden, mit dem sie nichts verband.
Doch kaum hatte sie auf dem hellgrünen Sofa Platz genommen, war sie zur Auster geworden, und der brühheiße Kaffee aus ihrer übervollen Tasse war ihr auf die narbige Haut der rechten Hand gelaufen. Henley kam sich vor wie eine Betrügerin.
»Ey! Weg da!«, rief sie, als sie einen Polizeihelfer sah, der auf ihren Wagen zuging. Sie versuchte zu rennen, rutschte aber auf dem eisigen Pflaster aus und musste sich an einem Laternenpfahl festhalten und stehen bleiben.
»Hier ist nur Anwohnerparken«, sagte der Polizeihelfer und nahm seinen Handheld heraus.
»Nicht auf dieser Straßenseite. Legen Sie sich nicht mit mir an, Kollege.« Henley erreichte ihren Wagen und holte die Autoschlüssel aus der Tasche. »Die Gebührenpflicht für Parkplätze beginnt um 8 Uhr 30, aber wir haben erst …«, Henley las die Uhrzeit von ihrem Handy ab, »8 Uhr 29. Also weg von meinem Wagen.«
Während der Polizeihelfer widerwillig zurücktrat, kämpfte Henley gegen den Wunsch an, ihm ihren Dienstausweis unter die Nase zu halten, und öffnete die Wagentür. Sie ließ den Motor an und wartete, dass der Wagen sich aufheizte. Schneeflocken fielen auf die Windschutzscheibe, und die Bürgersteige füllten sich mit Menschen, die lustlos zu ihren Arbeitsstellen in der Stadt unterwegs waren. Als ihr warm genug war, machte sie sich auf den Weg zur Serial Crimes Unit.
KAPITEL 2
Uliana Piontek hielt sich gut am Handlauf fest, als der Doppeldeckerbus abrupt an der Haltestelle gegenüber Deptford DLR Station bremste, die zur Docklands Light Railway gehörte, einer Privatbahn mit fahrerlosen Zügen. Sie reckte den Hals, um die Uhrzeit zu erkennen. 13:32 blitzte auf der digitalen Anzeige, und die automatisierte Frauenstimme verkündete fröhlich, der nächste Halt sei Deptford High Street, sie würden aber vorübergehend anhalten, um den »Service zu regulieren«. Umleitungen und ein Unfall auf der Blackheath Road hatten zur Folge, dass die Busse der Linie 53 und Uliana zu spät kamen.
Sie drückte den Stopp-Knopf und drängte sich, Entschuldigungen murmelnd, durch die dichte Menge von Fahrgästen, die unnatürlich nah beieinanderstanden. Uliana fluchte, weil eine übergewichtige Frau, deren grobporiges Gesicht vor Schweiß glänzte, ihr einfach keinen Platz machen wollte. Kurzerhand reckte sie sich über den Kopf der in eine Daunenjacke gekleideten Frau, drückte den roten Notknopf und sprang aus dem Bus, während der Fahrer ihr hinterherschimpfte.
In den Schaufenstern der Geschäfte spiegelten sich Blaulichter, und das schrille Geheul von Sirenen zerstach die kalte Luft. Der Verkehr auf dem Deptford Broadway bremste abrupt und machte Platz für einen Gefangenentransporter und seine Polizeieskorte. Uliana sah es gar nicht ein, in der bitteren Kälte stehen zu bleiben. Sie hielt den Kopf gesenkt, vergrub das Gesicht in ihrem übergroßen purpurnen Schal und näherte sich endlich dem Art-Déco-Gebäude, das früher ein Kino gewesen war, dann eine Bank und ein vietnamesisches Restaurant und heute die erste Megakirche von Deptford beherbergte, die Kirche des Propheten Annan.
Vereinbart war, dass sie die Kirche jeden Samstagabend um zwanzig Uhr reinigte und jeden Montag und Mittwoch um elf. 90 Pfund. Bar auf die Hand. Der Pastor hatte gesagt, dass sie im Himmel reich entlohnt würde, und hatte ihr die Hand aufs Knie gelegt, während er das Angebot machte. Was immer der Pastor vielleicht gedacht hatte, die einzigen Tätigkeiten auf den Knien, zu denen Uliana bereit war, bestanden im Beten und darin, den Staubsauger einzustecken. Das hatte sich allerdings geändert, als er ihr noch hundert Mäuse mehr anbot. Sie drehte die Lautstärke an ihrem Handy auf; sie hoffte, der verstärkte Bass vertriebe die Erinnerung daran, wie der Pastor sie bei den Haaren gepackt und auf die Knie gezwungen hatte.
Uliana ignorierte die anzüglichen Rufe ihrer osteuropäischen Landsleute, die auf der Baustelle an der anderen Straßenseite arbeiteten. Sie winkte einem Mann zu, der neben der Kirche stand und rauchte; das kleine Gebäude beherbergte ein Gamestudio, bei dem er angestellt war.
»Scheiße«, sagte Uliana, als sie den Wagen des Pastors auf dem behelfsmäßigen Parkplatz entdeckte, einen funkelnagelneuen Range Rover Discovery. Die Wintersonne funkelte auf dem angelaufenen goldenen Kruzifix, das am Rückspiegel hing. Bevor sie den Hintereingang der Kirche erreichte, verlor Uliana den kleinen Schlüsselbund zweimal aus ihren vor Kälte starren Fingern. Sie schob den Schlüssel ins Schloss, musste ihn aber nur ein Stück gegen den Uhrzeigersinn drehen, und die Tür öffnete sich. Hier stimmte etwas nicht. Sie trat ins dunkle Foyer und blinzelte, während ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Ein dünner Streifen gedämpften Lichts kroch unter der Bürotür rechts von ihr hindurch.
»Caleb«, rief Uliana, schaltete das Licht im Foyer ein und näherte sich dem Büro. Das Zimmer war leer bis auf Calebs Mantel, der über einer Stuhllehne lag. Das einzige Geräusch stammte vom Filter des kleinen Aquariums in der Zimmerecke. Wieder rief sie seinen Namen, verließ das Büro und stieg die Treppe hoch. Sie nahm den Staubsauger aus dem Putzschrank und schleppte ihn die Treppe hinunter, still über den Umstand fluchend, dass niemand hier den nötigen Verstand besaß, um die Reinigungsgeräte in dem Schrank im Erdgeschoss zu verstauen. Sie schloss den Staubsauger an, stellte ihr Handy noch lauter und begann mit der Arbeit. Sie zog an der Schnur und schob den Hoover durch die beiden Türflügel in den Kirchensaal.
Uliana Piontek roch Pastor Caleb Annan, bevor sie ihn sah, und sie erkannte den Geruch von Blut, das mit Gewalt vergossen worden war.
KAPITEL 3
»Wir haben alle verloren«, sagte DS Paul Stanford, während er Henley eine Quality-Street-Büchse hinhielt.
»Wovon um alles in der Welt redest du da?« Henley legte den Mantel ab und warf ihn auf einen freien Schreibtisch. »Sind da gar keine Toffees mehr drin?«
»Du solltest den Mantel gleich anbehalten. Die Heizung tut’s schon wieder nicht. Entweder ist sie wieder ausgefallen, oder sie haben uns hier ganz vergessen und die Rechnung nicht bezahlt. Im Pott sind hundertvierzig Pfund und keine Toffees.«
»Warum sind da hundertvierzig Mücken drin?«
Stanford rollte mit den Augen, ein Ausdruck gespielter Genervtheit. »Denk mal an unsere Wette«, sagte er. »Wegen ihm. Unserem glorreichen, voll ausgebildeten Detective Constable Ramouter.«
»Was habe ich getan?«, fragte Ramouter aus der Küche, wo er misstrauisch den Boden einer Kaffeetasse beäugt hatte, bevor er zum Spülmittel griff.
»Das ist doch albern.« Henley hörte das Surren der elektrischen Heizlüfter und den eisigen Wind, der draußen pfiff und die Scheiben klappern ließ.
»Du hast es geschafft, Ramouter. Du bist noch hier«, sagte Stanford. »Wir hatten eine Wette laufen, wie lange du bei der SCU bleibst.«
»Und du hättest nicht geglaubt, dass ich es sechs Monate lang schaffe?«
»Kollege, ich hätte nicht gedacht, dass du sechs Tage lang durchhältst. Wenn du Kaffee machst, nehme ich einen.«
»Du solltest nicht so fies zu ihm sein.« Henley wickelte sich aus ihrem Schal und stopfte ihn in die Lücke, die sich gebildet hatte, als der Putz und der dreißig Jahre alte Kitt aus dem Fensterrahmen gebröckelt waren.
»Ich bin doch nicht fies. Ich mache ihm ein verfluchtes Kompliment. Nach allem, was passiert ist, hätte es ihm niemand verdenken können, wenn er zur Tür rausgeflitzt wäre wie ein geölter Blitz.«
»Ist er aber nicht. Er ist dabeigeblieben. Also, was wirst du mit dem Geld anstellen?«
»Ich könnte es Ramouter geben. Er könnte sich dafür ein Zugticket nach Bradford kaufen oder so was.«
»Na, wer wird jetzt weich«, sagte Henley, als das Telefon auf ihrem Schreibtisch klingelte.
»Oder ich könnte im Curryhaus die Straße runter einen Tisch bestellen. Das wäre Teambuilding.«
»Oder ein normaler Freitagabend mit dir, wo du über deinem Chilihühnchen einschläfst.«
»So eine Unverschämtheit«, erwiderte Stanford, als Henley abnahm. Ramouter erschien neben ihm und reichte ihm eine dampfende Tasse Kaffee.
»Gut. Verstehe.« Henley griff nach dem Block mit blauen Post-its und nahm einen Kuli mit abgenagter Kappe aus dem Becher auf ihrem Schreibtisch. »Mir war nicht klar, dass wir noch in Bereitschaft sind. Können Sie mir die CAD-Details schicken? Nein, ich kann sie nicht selbst abrufen, das System ist wieder unten. Danke. Wer hat die Leiche gefunden? Gut.«
Henley zog den Klebezettel vom Block und klebte ihn an Ramouters Kaffeebecher.
Er pellte ihn ab und sah ihn neugierig an. »Wenn der Verkehr mitspielt, sind wir in einer Viertelstunde dort.«
»Du hast keine Zeit, deinen Kaffee auszutrinken.« Henley legte auf und nahm sich Schal und Mantel.
»Eine Leiche in einer Kirche?«, fragte Ramouter. »Ernsthaft?«
»So steht es auf dem Zettel.«
»Warum sind wir dafür zuständig?«
»Wir sind zuständig, weil der Borough Commander entschieden hat, dass die Serial Crime Unit der Homicide and Serious Crime ruhig ein paar Fälle abnehmen kann«, sagte Henley müde.
»Anscheinend glauben die alle, dass wir hier den ganzen Tag rumsitzen und Netflix bingen«, stöhnte Ramouter. »Ist es überhaupt ein Mord?«
»Das erfahren wir erst, wenn wir dort sind.«
»Darf ich es sagen?« Auf Stanfords Gesicht breitete sich ein Grinsen aus.
»Nein, darfst du nicht.« Henley nahm ihre Handtasche und ging zur Tür, Ramouter im Schlepptau. Sie kannte Stanford so gut, dass sie genau wusste, was er sagen würde.
»Ich setze einen Zehner, dass es Reverend Green war, mit einem Kerzenleuchter in der Bibliothek!«, rief Stanford, und Henley knallte die Tür hinter sich zu.
»Ich sage es nicht noch einmal. Bleiben Sie von der Absperrung weg.«
»Was ist denn da los?«
»Wenn ich heute Morgen gewusst hätte, dass ich mir mittags den Arsch in der Kälte abfriere, wäre ich im Bett geblieben.«
»Ich wette, die haben ’ne Leiche gefunden oder so was.«
»Guck, das CSI ist auch schon da.«
»Ich bin nur für ’n Kaffee vor die Tür, und jetzt sagt mir die Polente, ich kann nicht zurück in mein Büro.«
»Scheiß drauf. Ich geh nach Hause.«
»Ich sag dir, die haben ’ne Leiche gefunden.«
»Wär nicht das erste Mal.«
»Ich verstehe diese Kids nicht mehr. Dauernd stechen sie sich gegenseitig ab. Kein Respekt mehr vor dem Leben.«
»Die können es so viel aufhübschen, wie sie wollen, aber Deptford bleibt eben Deptford, was?«
Im Gemurmel der neugierigen, mürrischen Menge gingen Henley und Ramouter auf die Kirche zu.
»Das soll eine Kirche sein?« Ramouter sah an der cremefarbenen Sandsteinfassade hoch. »Ich hätte ja etwas anderes erwartet, etwas … ich weiß auch nicht … etwas Kirchenmäßigeres. Einen Turm vielleicht. Das hier sieht aus wie eine Bank.«
»Das war eine NatWest-Bank, als ich siebzehn war«, sagte Henley. »Die Miete war hier immer niedrig. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.«
»Ich hab schnell mal bei Google …«
»Na klar.«
»Und auf dem Deptford Broadway gibt es noch sieben andere Kirchen.«
»Überrascht mich nicht«, sagte Henley. »Jede Londoner Hauptstraße ist gespickt mit Wettlokalen, Kirchen und Currybuden.«
Henley und Ramouter zeigten ihre Dienstausweise der fröstelnden Polizistin am weiß-blauen Absperrband. Henley wandte sich zu der kleinen Gafferschar auf der anderen Straßenseite um. Die Leute hatten nichts an sich, was hervorstach oder die Härchen in Henleys Nacken veranlasste, sich aufzustellen, aber sie wusste aus Erfahrung, dass einige Mörder von Natur aus voyeuristisch veranlagt waren.
»Wie es aussieht, ist Dr. Choi schon hier.« Ramouter zeigte auf den Wagen der Lieblingspathologin der Serial Crime Unit, mit der Henley befreundet war; er parkte zwischen einem Polizeimotorrad und einem kleinen weißen Kastenwagen der Spurensicherung, auf dem in schwarzer Schrift Forensic Services Crime Scene Investigation stand.
Henley blieb stehen und sah sich auf dem kleinen Parkplatz um. Sie entdeckte keine Überwachungskameras.
Als sie sich dem Tatort näherte, empfand sie Gleichmut. Sie hieß die Regung willkommen; sie war ihr eine Verschnaufpause vor der Unruhe, die ihr gewöhnlich durch die Adern pochte und die sie nur in den Griff bekam, wenn sie sich mit ihrem Rezept zur Apotheke bequemte. Henley entdeckte den Polizisten, nach dem sie suchte. Er stand über das Dach eines Polizeiwagens gebeugt und blätterte, den Stift im Mund, in seinem Notizbuch.
»PC Tanaka? DI Henley von der SCU.«
Police Constable Tanaka sah auf und nahm ein wenig zu eilfertig Haltung an, während Henley noch auf ihn zuging.
»Ma’am«, sagte er.
»Das ist mein Kollege, DC Ramouter.«
PC Tanaka drehte sich um, wollte das Notizbuch vom Dach des Streifenwagens nehmen und ließ es zu Boden fallen. »Scheiße«, sagte er und bückte sich danach. »Entschuldigung.« Er wischte den schmutzigen Schneematsch vom blauen Umschlag. »Es ist verflucht kalt.«
»Sie waren der erste Beamte vor Ort?«, fragte Henley.
Tanaka atmete kurz durch und nickte. Henley merkte, dass er seine Sache gut machen wollte. Vorgesetzte über einen Mordschauplatz zu informieren war etwas anderes, als sich um Einbrüche und häusliche Gewalt zu kümmern oder einzuschreiten, wenn sich ein paar Cracksüchtige auf einer Hauptstraße prügelten.
»Wir, das heißt der Sarge, Sergeant Rivers, und ich, wir waren auf dem Rückweg zum Revier. Das ist um die Ecke bei Deptford Station. Wir hatten gerade unsere Schicht beendet und kamen von dem McDonald’s die Straße hoch …«
PC Tanaka hielt inne und holte Luft.
Er tat Henley leid. Seine Nerven und möglicherweise der Schock hatten ihn im Griff. Sie sah einen Ausdruck von Mitgefühl in Ramouters Gesicht, während sie beide darauf warteten, dass Tanaka fortfuhr.
»Sorry, Boss, ich meine, Ma’am.« PC Tanaka riss sich zusammen und stellte das knisternde Polizeifunkgerät leiser. »Wie gesagt, wir waren auf dem Rückweg zum Revier, und einer der Typen aus dem Gamestudio warf sich uns praktisch auf die Motorhaube. Er schrie was von einer Leiche. Wir fanden die Putzfrau völlig hysterisch im Teeraum der Agentur. Sie weigerte sich, wieder rauszugehen und uns zur Kirche zu begleiten. Ich ließ sie mit dem Sarge zurück und ging in die Kirche und … Tja, was ich da gesehen habe, werde ich nie mehr vergessen.«
KAPITEL 4
Henley umging die Überreste von PC Tanakas Mittagessen, vermischt mit seinem Magensaft, vor der Kirchentür. Das Gotteshaus strahlte keine Wärme und kein Willkommen aus, aber in der Luft hing der vertraute Geruch nach verbranntem Weihrauch und Olivenöl, den Henley aus ihrer Kindheit kannte, in der sie gegen ihren Willen an den Gottesdiensten ihres Onkels teilnehmen musste. Das Blut roch sie trotzdem. Der Geruch des Todes verankerte sich an jedem einzelnen Haarfollikel ihrer Nase und kitzelte sie im Rachen, als sie den Kirchensaal betrat.
Henley blieb vor der lebensgroßen Pappfigur eines gut gekleideten Schwarzen mit ausgebreiteten Armen stehen, dessen Haupt etwas umgab, das sie nur als einen Heiligenschein hätte beschreiben können. Wer immer in die Kirche des Propheten Annan eintritt, der wird errettet. An der Wand hing ein Foto in einem Goldrahmen, das denselben Schwarzen neben einer schwarzen Frau zeigte.
»Der Prophet, Pastor Dr. Caleb Annan, und First Lady Serena Annan. First Lady?«, fragte Ramouter. »Kapiere ich nicht.«
Henley seufzte und sah zu, wie ihr Atem als Fähnchen in die Luft entwich, das sich schließlich auflöste. »So nennen sie die Frau eines Pastors. Ist was Amerikanisches.«
Die beiden gaben ein hübsches Paar ab. Eher glamourös als spirituell, fand Henley, eher effekthascherisch als wohltätig.
»Macht sie irgendwas? So eine First Lady?«, fragte Ramouter.
»Kommt darauf an. Manchmal ist sie bloß ein Gesicht, mit dem sich der Pastor schmückt, eine Trophäe, aber in den meisten Fällen ist sie genauso aktiv wie er.«
Henley war sich im Klaren darüber, dass sie beide das Gleiche taten: Sie zögerte das Unausweichliche hinaus.
»Was ist das überhaupt für eine Kirche? Sieht mir nicht nach dem üblichen Lobgesang aus.« Ramouter blieb an einer unechten Schriftrolle stehen, die an die Tür zum Kirchenschiff genagelt war. »Wir sind eine lebendige Kirche, die jeden willkommen heißt, der bereit ist, sich erretten zu lassen«, las Ramouter vor, während er den Türflügel aufdrückte.
»Hör auf«, erwiderte Henley und rückte die Gummibänder des Mund-Nasen-Schutzes zurecht, die ihr hinter den Ohren in die Haut drückten. Links von Henley strömte diffuses Winterlicht durch die Lücken in den schweren roten Samtimitatvorhängen vor den Isolierfenstern. Der Kirchensaal war riesig. Wenigstens dreihundert Stühle wurden von einem Mittelgang getrennt. Henley drehte sich um und sah zu einem Balkon hoch, auf dem vermutlich weitere hundert Sitze Platz fanden. Der Saal war nicht gereinigt. Unter den Stühlen lagen leere Wasserflaschen, Kaffeebecher aus Pappe und Süßigkeitenverpackungen.
Pastor Caleb Silas Annan war dreiundvierzig Jahre alt und lag in Fötushaltung auf der linken Seite unter dem Altar. Die langen Beine hatte er an den Leib gezogen, und der linke Schuh fehlte; seine senffarbene Socke hatte ein kleines Loch an der Ferse. Die erste Reihe von Stühlen, die einmal sorgsam gegenüber der erhobenen Bühne mit dem Altar angeordnet gewesen waren, lagen nun über den Boden verstreut. Unter einem Stuhl entdeckte Henley einen Slipper aus schwarzem Wildleder.
»Sie sind von Gucci, falls es dich interessiert«, sagte Anthony. »Ich mag die ja gar nicht.« Der Spurensicherungsexperte folgte Henleys Blick von dem einsamen Schuh zu dem weißen Tuch, das halb vom Altar herunterhing und mit blutigen Handabdrücken übersät war, sodass es aussah wie ein primitives Kinderbild. Zwei Kerzenleuchter aus Messing waren auf den Boden gekippt. Eine große Bibel, in braunes Kunstleder gebunden, lag aufgeschlagen neben dem Kopf des Pastors. Die Pathologin, Dr. Linh Choi, kauerte neben ihm, tief in Konzentration versunken, während sie einen Finger, den ein Handschuh schützte, auf eine Wunde an seinem Hals legte.
»Ich hätte nicht gedacht, dass du uns die Gnade deiner Gegenwart erweist«, sagte Anthony, während er auf Henley zutrat.
»Mir war nicht klar, dass du Dienst hast«, erwiderte Henley. »Du hast Glück, dass du uns bekommst. Wie geht’s dir?«
»Selbe Scheiße, andere Toilette. Überarbeitet, unterbezahlt, unterschätzt, und hier drin ist es arschkalt. Trotzdem, ich hab eine Kleinigkeit für dich.« Anthony löste einen Asservatenbeutel von seinem Klemmbrett und reichte ihn Henley. Nach einem Vierteljahrhundert als CSI hielt Anthony an seinem verlässlichen alten Klemmbrett und schriftlichen Berichten fest, statt die launischen billigen Tablets zu benutzen, die seine Abteilung angeschafft hatte. »Wie ich sehe, sind Sie immer noch bei uns, DC Ramouter? Wir konnten Sie noch nicht zurück ins Moor jagen?«
»Das sagen Sie jedes Mal, wenn Sie mich sehen«, entgegnete Ramouter.
»Betrachten Sie es als Zeichen, wie sehr mir Ihr emotionales Wohlergehen am Herzen liegt.«
»Das weiß ich zu schätzen«, sagte Ramouter, als Henley ihm den Asservatenbeutel reichte. Er musterte das Foto auf dem hellrosa UK-Führerschein, der in drei Wochen ablief.
»Wie lange ist er schon tot?«, rief Henley zu Linh hinüber.
»Irgendwas zwischen zwölf und achtzehn Stunden.« Linh richtete sich ächzend auf. »Mein Gott, meine Knie. Mit dir alles okay?«
»Es geht.« Henley kniete sich neben den Leichnam. »Ist er erstochen worden?«
»Zahlreiche Stiche in die Brust und in den Rücken. Sein sehr teurer Kaschmirpulli ist durchgeweicht mit Blut.«
»Was denkst du?«, fragte Ramouter, als er sich Henley anschloss; sein Schutzanzug knisterte, als er die Hände auf dem Rücken verschränkte. »Einbruch, der außer Kontrolle geriet?«
Henley schüttelte den Kopf. »Nach allem, was wir bisher gesehen haben, hat der Kampf nur hier stattgefunden. Das kommt mir nicht vor wie ein Einbruch, es sei denn, die Spurensicherung findet Hinweise auf ein unerlaubtes Eindringen. PC Tanaka sagt, die Putzfrau kam zu spät zur Arbeit und hat bei ihrer Ankunft bemerkt, dass die Tür nicht abgeschlossen war.«
»Wenn die Tür unverschlossen gewesen ist, könnte es ein Verbrechen aus Gelegenheit gewesen sein.«
Henley schüttelte erneut den Kopf, richtete sich auf und zeigte auf die schweren Kerzenleuchter auf dem Fußboden.
»Die Dinger sind aus Messing und kosten mindestens dreihundert Pfund. Warum sie nicht mitnehmen? Und hast du den Wagen des Pastors draußen gesehen?«
»Der riesige SUV«, sagte Ramouter. »Schwer zu übersehen. Hast du gesehen, dass er nagelneu ist – frisch aus dem Autohaus?«
»Habe ich. Wenn wir zurück sind, rufst du die Zulassung ab. Ich wäre nicht überrascht, wenn er ihn gerade erst gekauft und auf die Kirche angemeldet hat.«
»Du bist ein klein bisschen zynisch, kann das sein?«
»Du musst noch eine Menge lernen, Ramouter, aber die Sache ist die: Wenn das ein Einbruch aus Gelegenheit war, wieso den Wagen und die Kerzenleuchter hier zurücklassen? Nichts von Wert wurde entwendet, jedenfalls nicht, soweit ich es erkennen kann.« Henley ging hinter den Altar. Linh war wieder in der Hocke und klopfte mit dem Stift auf ihr Notizbuch.
»Die Putzfrau, Uliana heißt sie, hat gedacht, der Pastor wäre früh in die Kirche gekommen«, sagte Henley nachdenklich. »Aber das kann nicht sein, wenn er schon bis zu achtzehn Stunden tot gewesen ist. Entweder hat er gestern Abend jemandem die Tür geöffnet, den er kannte, oder ein unzufriedenes Gemeindeschäfchen ist zurückgeblieben, oder …«
»Es könnte trotzdem ein Einbruch gewesen sein, der aus dem Ruder lief«, beharrte Ramouter achselzuckend. »Wer immer das war, wurde vielleicht überrascht. Der Kerl hier hat ihn gestellt, der Einbrecher hat ihn umgebracht und ist abgehauen.«
»Nach allem, was ich hier sehen kann«, Linh stand auf, reckte sich und bezog fast beschützend Stellung neben Henley, »war die Tat fieberhaft und wild. Hätte es sich um einen ertappten Einbrecher gehandelt, würde ich ein, zwei Stichwunden erwarten, und das wäre alles. Soweit ich es sehen kann, hat er aber Stichwunden an den Händen, an den Schultern, im Rücken und im Gesicht.«
Henley bückte sich wieder und betrachtete den Pastor aus der Nähe. Eine dicke Goldkette mit einem großen, diamantbesetzten, blutbespritzten Kruzifix schmiegte sich in die Falten seines Halses. Henley spürte, wie ihre eigenen Halsmuskeln zuckten, als sie den sechs Zentimeter langen, klaffenden Schnitt in der fleischigen schwarzen Wange des Pastors betrachtete. Die offene Wunde legte den Kieferknochen frei, Backenzähne und eine gefleckte Zunge, umgeben von geronnenem Blut. Das rechte Auge des Pastors stand offen. Die Pupille war starr und erweitert. Getrocknetes Blut bedeckte die Wimpern wie unbeholfen aufgetragene Mascara.
»Sehen wir uns um«, sagte sie zu Ramouter. Ihr lief es kalt den Rücken hinunter, und ihr schauderte. Die Wände bedeckten Bibelzitate in Goldrahmen und Fotos eines Caleb Annan, der sich auf der Kanzel in Rage redete.
»Ach, das darf doch echt nicht wahr sein«, murmelte Henley, als sie vor einem besonders großen Foto des predigenden Pastors stehen blieb, neben dem ein Bibelzitat hing:
»Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur! Denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug: Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen«, las Ramouter vor. »Will unser toter Pastor damit sagen, dass er Gottes auserwähltes Werkzeug ist? Schon sehr von sich überzeugt, was?«
»Nichts Schlechtes über die Toten sagen. Wenigstens jetzt noch nicht.« Henley zog die schweren Vorhänge aus Samtimitat beiseite. Die deckenhohen doppelverglasten Fenster mussten dringend gereinigt werden und ließen sich nicht öffnen. Henley sah hoch und entdeckte große Lüftungsschlitze einer Klimaanlage in der Decke. Eindeutig ein Fortschritt gegenüber den Kirchen ihrer Kindheit, wo man sich im Winter den Hintern abfror und im Sommer fragen musste, wer da einen unheiligen Handel mit dem Teufel geschlossen hatte, weil man im eigenen Saft schmorte.
»Erkundige dich mal bei der Spurensicherung, wie sie in den Büros vorankommt«, bat sie Ramouter, als sie zum Eingang zurückgekehrt waren und im Foyer standen. »Sorg dafür, dass alle Dokumente, Laptops und Tablets beschlagnahmt werden.«
»Mach ich.«
»Und frag nach, ob es irgendeine Spur von der Mordwaffe gibt. Ich bezweifle zwar, dass der Mörder so blöd war, sie zurückzulassen, aber man weiß ja nie. Ich sehe mich oben um.«
KAPITEL 5
Im obersten Geschoss hatte sich ursprünglich ein großer offener Raum befunden, der in eine Reihe von Zimmern unterteilt worden war. Die Trennwände sahen aus, als wären sie einmal die Stützmauern eines Konservatoriums gewesen. Henley stand in der Tür einer Art Heimstudio und sah zu, wie ein CSI-Beamter fotografierte, während ein anderer sorgfältig Fingerabdruckpuder aufbrachte. Die rückwärtige Wand war grün gestrichen, und davor standen zwei braune Ledersofas mit einem gläsernen Couchtisch in der Mitte. Auf dem Tisch ragte ein großes Kruzifix neben zwei Wassergläsern und einer halb leeren Karaffe auf, alle schon mit schwarzem Fingerabdruckpuder bepinselt. In der Ecke stand eine Videokamera auf einem Stativ. Die Kamera lief noch, und eine abwechselnd rot und blau blinkende LED zeigte an, dass der Akku fast leer war. Henley würde die Kamera an Ezra schicken lassen, damit er nachsah, ob etwas aufgezeichnet worden war. In der rechten Zimmerhälfte befand sich ein großer Tisch, der eingerichtet war, um Video-Podcasts zu filmen. Zwei Mikrofone, Kopfhörer, ein Audio-Interface und ein Laptop lagen verloren neben einem neuen iMac Pro. Dank Ezra, des forensischen Analytikers der SCU, wusste sie, dass dieser Computer um die fünftausend Pfund gekostet haben dürfte. Im ganzen Obergeschoss fanden sich keinerlei Spuren eines Tumults.
Henley ging zum Lagerraum und betrat ihn. An der hinteren Wand war ein Regalsystem, bedeckt mit einem Laken. Sie zog es beiseite und entdeckte hinter dem Regal eine Tür.
»Was zum Teufel ist das?«, fragte sie sich. Die Tür war mit einem Vorhängeschloss versperrt. Sie legte den Finger unter den Bügel, und er gab nach. Das Schloss war nicht eingeschnappt. Henley nahm es ab und öffnete die Tür. Sie musste die Maske über ihrem Gesicht mit der behandschuhten Hand bedecken: Ein überwältigender Gestank nach Urin, Kot und Nässe drang auf sie ein, und sie begann unkontrolliert zu husten. Henleys Augen wollten sich nicht an die Dunkelheit im Raum gewöhnen, und sie wischte einen Tränenstrom beiseite, als ihre Augen ein Scharren in der Ecke des Raums erfassten und ein eisiger Hauch über ihr Gesicht strich. Sie öffnete den Reißverschluss ihres Schutzanzugs, nahm das Handy aus der Jackentasche und schaltete die Taschenlampe ein. Das Licht beleuchtete weiße Teiche aus erstarrtem Wachs am Boden und Kerzen, die ganz heruntergebrannt waren. Wasser lief an moosigen Wänden herunter, und aus einem roten Plastikeimer in der Ecke hing der Schwanz einer toten Ratte.
Henley fand keine Worte und richtete das Handy nach rechts. Ihr Blick folgte dem Licht, bis es auf den Rand einer fleckigen Matratze auf einem alten Bettgestell fiel. Gebrochene rostige Sprungfedern ragten aus dem billigen zerfransten Stoff. Eine dicke Stahlkette, an einem Rohr festgebunden, fesselte die Fußgelenke von zwei schmutzbedeckten skelettartigen Beinen. Die Haut an den Fußsohlen war ein Flickwerk aus geschwärzter, blasiger Haut. Auf dem eingesunkenen Bauch lagen Rattenkot und eine tote Kakerlake. Das Taschenlampenlicht prallte von harten Rippen ab, die gegen dünne, von purpurnen Adern durchzogene Haut drückten, übersät mit getrockneten Schnitten und Brandwunden. Rote Schnur mit einer Kruste aus getrocknetem Blut war dem Mann um die Handgelenke gebunden. Die Fesseln waren noch intakt.
»Ramouter!«, rief Henley laut, als sie sich zu den Handgelenken des toten Mannes vorbeugte. Haut und Fleisch waren von den rauen Fesseln bis auf die Knochen weggescheuert. »Ramouter!«, rief Henley erneut. »Linh, Anthony. Ich brauche hier oben jemanden.«
Henley beugte sich noch näher zu dem jungen Mann. Der Schmerz, der sich ihm tief ins Gesicht eingegraben hatte, war vom Tod zementiert worden. Seine Jochbeine zeichneten sich scharf auf der Haut ab. Trockenes Erbrochenes verkrustete die Mundwinkel seiner aufgesprungenen Lippen. Überlange, feuchte braune Locken hingen schlaff in eine schmutzverschmierte Stirn. An einem Nagel in der Wand hinter ihm hing ein großer Rosenkranz. Auf der Matratze lag eine kleine Bibel, rechts neben seinem Kopf. Aufgeschlagen war die Offenbarung 20:10:
Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält, in alle Ewigkeit.
»Was zum Teufel …?«
Henley stolperte zurück, als Ramouters Stimme erklang, und stürzte über die tote Ratte. »Lass das sein! Du hast mich zu Tode erschreckt!«
»Sorry, Boss«, sagte Ramouter. Er stand reglos neben Henley, die Augen auf den Toten gerichtet.
»Wo ist Linh?«, fragte Henley, richtete sich rasch auf und klopfte sich ab. Sie sah hoch und entdeckte einen Lichtschalter mit einem schwarzen Fingerabdruck auf dem Knopf. Es gab keine Möglichkeit, Licht zu machen, ohne eine Spur zu vernichten, die sich als entscheidend erweisen konnte.
»Kommt. Sie wollte gerade wegfahren, als du gerufen hast. Ist er tot?«
Henley nickte wortlos.
»Warum um alles in der Welt sollte jemand … das ist …«, stammelte Ramouter. Er hielt sich eine Hand vor den Mund und trat näher an die Leiche heran. »Das ist doch abgefuckt.«
»Ich brauche frische Luft.« Übelkeit hatte Henley überwältigt. Sie ging zur Tür und wäre fast mit Linh zusammengestoßen, die einen CSI-Ermittler bei sich hatte.
»Hey, was ist los? Alles in Ordnung?«, fragte Linh, stellte ihren schwarzen Koffer auf den Boden und zog sich ein Paar frische latexfreie Handschuhe über.
»Alles okay. Ich muss nur mal kurz raus. Er ist da drüben.«
Linh zog sich wortlos die Brille vom Scheitel auf die Nase und ging zur Leiche.
Henley nahm die Kapuze des Schutzanzugs ab, denn Hitze übermannte sie. Sie hieß den scharfen Schock der kalten Luft willkommen, der sie empfing, kaum dass sie die Kirche verließ. Sie durfte den Umstand, dass mit ihr nicht alles okay war, nicht ignorieren. Tote hatte sie schon gesehen, daher bestand kein Grund, weshalb dieser Leichnam ihr derart die Fassung raubte. Nach einigen Minuten kehrte sie zum versteckten Raum zurück und beobachtete von der Tür aus, wie Linh den Toten untersuchte. Ramouter hielt auch den Mund und sah zu, wie der CSI-Beamte auf Anweisung Linhs den Toten vorsichtig anhob, damit sie ein Thermometer in dessen Rektum einführen konnte.
»Hmm«, murmelte Linh, nachdem sie das Thermometer herausgezogen und die Temperatur abgelesen hatte.
»Warum machst du hmm?« Henley kehrte in den Raum zurück.
»Pst.« Linh griff in ihren Koffer, holte ein Stethoskop heraus und beugte sich über den Toten.
Die einzigen Geräusche stammten vom vorbeifahrenden Verkehr auf der Straße und den dumpfen Lauten der Aktivitäten im Erdgeschoss.
»Anjelica«, sagte Linh, »wir brauchen einen Krankenwagen. Er lebt noch.«
KAPITEL 6
Er hätte tot sein müssen. Sein Puls war schwach, sein Blutdruck niedrig. Er war ausgetrocknet, und alle vierundzwanzig Rippen waren gebrochen. Der Schädel hatte Frakturen, und er litt an einer Subarachnoidalblutung. Seine Nieren waren geschädigt, und er hatte eine Infektion der tieferen Bronchien. Sein Körper hatte heftige Krämpfe erlitten, als die Rettungssanitäter ihm einen Katheder am linken Handrücken einführten, ihm Kochsalzlösung gaben und eine Sauerstoffmaske über das Gesicht zogen.
»Er sah tot aus«, sagte Ramouter, nachdem die Türen des Krankenwagens geschlossen worden, das Blaulicht aufgeflammt war und die Sirenen ihr Geheul angestimmt hatten. »Er roch wie ein Toter.«
»Er muss wochenlang dort gelegen haben.« Henley streifte die blauen Überschuhe und den Schutzanzug ab, warf alles in den schwarzen Müllsack und zog sich rasch den Mantel über.
»Glaubst du, der Pastor wusste Bescheid?«, fragte Ramouter. »Vielleicht ein Motiv, ihn umzubringen?«
»Ich wäre überrascht, wenn er nichts davon gewusst hätte, aber ob es das Motiv war, ihn zu töten? Ich weiß es nicht, aber bei einer Sache bin ich mir sicher: Wer immer den Pastor umgebracht hat, ahnte nichts von dem armen Burschen, der oben gefangen gehalten wurde.«
»Das wissen wir eigentlich nicht. Was, wenn der Mörder Bescheid wusste und ihn zurückgelassen hat? Es könnte wirklich so einfach sein.«
»Das stimmt, aber …« Henley sah auf die Uhr. Vier Uhr war vorüber, und auf keinen Fall schaffte sie es rechtzeitig nach Hause, um ihre dreijährige Tochter Emma zu baden und sie zu Bett zu bringen. »Nichts ist je einfach.«
»Also, dann haben wir einen Mord und einen versuchten Mord aufzuklären?«
»Hoffen wir, dass es dabei bleibt.«
Die Kirchentüren öffneten sich, und ein Transportsack mit dem Pastor wurde zu dem wartenden privaten Leichenwagen hinausgeschoben. Die Fenster des Fahrzeugs waren schwarz getönt und hüllten seine Insassen in Anonymität.
»Also, unser Opfer …«
Detective Chief Superintendent Pellacia hielt inne und sah zur Decke, als die uralten Rohre aneinanderrasselten, ein Geräusch, das im ganzen Gebäude zu hören war.
Zwölf Sekunden später legte DS Stanford seine Hände auf den Heizkörper neben seinem Schreibtisch und rief: »Das Ding geht wieder.«
»Juhu«, erwiderte DC Roxanne Eastwood sarkastisch, krempelte die Ärmel ihres Hoodies herunter und zog sich die Kapuze über den Kopf.
Pellacia räusperte sich. »Wie ich schon sagte. Unser Opfer. Wer ist es, Henley?«
Henley suchte Pellacias Blick, als er ihren Namen aussprach, aber er sah sie nicht direkt an. Er fixierte vielmehr einen Punkt gleich über ihrem Kopf.
»Welches?« Henley antwortete auf eine Weise, die Pellacia zwang, sie anzusehen. Er rieb sich dabei die Säcke unter seinen Augen.
»Das tote.«
»Das tote Opfer ist Caleb Silas Annan.«
»Aber er nennt sich Der Prophet Dr. Caleb Silas Annan«, fügte Ramouter hinzu.
»Der Prophet?«, fragte Pellacia ungläubig. »Woher wissen Sie das?«
»Es steht überall auf den Postern und den Handzetteln, die im Foyer ausliegen, und auf der Website der Kirche«, erklärte Ramouter. »Er hat die Kirche sogar nach sich benannt, und er war definitiv kein Arzt.«
»Und das wissen Sie woher?«
Henley grinste, als Stanford ihr wissend zuzwinkerte. Der Detective Sergeant wusste, dass sie gerade ein wenig stolz auf Ramouter war.
»Ich habe bei der Ärztekammer angerufen, und er ist weder als approbierter noch als nicht approbierter Arzt in ihrer Datenbank. Nach einer raschen Google-Suche glaube ich nicht, dass er irgendeinen Doktortitel trägt, aber bekannt ist er.«
»Uns bekannt?«, fragte Pellacia.
Henley nickte und reichte Kopien von Annans Strafakte herum. »Wir haben ihn noch nicht offiziell identifiziert, aber er ist im Police National Computer. Die PNC-Suche ergab, dass Caleb Silas Annan drei Decknamen hat: Kaysen Abani, David Onyeka und Edward Silas Annan. 2008 wurde er vom Southwark Crown Court wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt.«
Stanford pfiff leise in seiner Ecke des Raums. »Muss was Großes gewesen sein. Für einen gefälschten Führerschein kriegt man keine dreieinhalb Jahre.«
»Nein, das nicht.« Pellacia blätterte in den Seiten der Strafakte Annans. »Wofür er auch verurteilt wurde, es muss um einen großen Wert gegangen sein. Hier steht übrigens, dass er neulich Kaution gestellt und sich am 21. Februar auf dem Revier Stoke Newington zu melden hat.«
»Tja, den Termin wird er platzen lassen«, sagte Stanford.
»Wissen wir, weshalb man da gegen ihn ermittelt hat?«, fragte Pellacia, ohne Stanford zu beachten.
»Das System ist ausgefallen, deshalb weiß ich nicht, was gegen ihn vorlag«, antwortete Henley. »Ich habe Joanna gebeten, den Custody Sergeant von Stoke Newington zu kontaktieren und herauszufinden, wer der zuständige Beamte ist und wieso Annan festgenommen wurde. Was die nächsten Angehörigen betrifft, war er offenbar mit Serena Malikah Annan verheiratet, und im Gegensatz zu ihrem Mann hat sie keine Vorstrafen.«
»Hat ihr schon jemand mitgeteilt, dass ihr Mann tot ist?«
»Noch nicht.«
»Was soll das heißen, noch nicht?« Pellacia bewegte lautlos die Lippen, während er auf die Uhr sah. »Es ist fast fünf Stunden her, dass er tot aufgefunden wurde.«
»Das weiß ich selbst.« Henley bemühte sich um einen ruhigen, sachlichen Ton. »Aber ich wollte die Aufgabe nicht von zwei PCs der nächsten Wache erledigen lassen, und Serena Annan war nicht zu Hause, als Stanford und Eastwood sie aufsuchen wollten. Ramouter und ich gehen später vorbei und versuchen, die Neuigkeit loszuwerden.«
Ramouter hatte überrascht den Kopf gedreht. »Wir?«
»Ja, wir. Das Letzte, was ich will, ist, dass zwei grüne PCs Mrs. Annan sagen, dass ihr Mann ermordet wurde, nur um dann bei ihr herumzulungern und auf uns und die Beamten von der Opferbetreuung zu warten.«
»Sie haben wenigstens für Opferbetreuung gesorgt?«, fragte Pellacia.
»Ich habe mir Bethany Stewart und PS Levine geschnappt. Bethany war nicht gerade begeistert.«
»Sie ist von nichts jemals begeistert.«
»Kann man ihr kaum verdenken. Sie ist schon Opferbetreuerin bei drei Morduntersuchungen und einem Vermisstenfall. Wir machen uns auf den Weg, sobald sie mir simst, wann sie dort sein kann.«
»Und das andere Opfer? Schon eine Ahnung, wer er ist?«
»Nicht die geringste«, antwortete Henley. »Er liegt im Lewisham Hospital auf der Intensivstation. Mein letzter Stand: Die Ärzte sind sich nicht einmal sicher, ob er die Nacht übersteht. Hoffentlich kommt er durch.«
»Versuchter Mord oder Mord tun sich nicht viel«, sagte Pellacia. Das Telefon in seinem Büro klingelte, und Henleys Handy machte mit einem Ping auf eine Textnachricht aufmerksam.
»Ob er stirbt oder nicht, macht einen entscheidenden Unterschied«, erwiderte Henley, während sie Ramouter winkte, seinen Mantel zu holen. »Für wenigstens eine Familie besteht vielleicht ein Funken Hoffnung.«
Weil der Rotherhide Tunnel geschlossen war, kroch der Verkehr im Schneckentempo über die A2. Als die Ampeln auf der Blackheath Hill wieder rot wurden, hielt Henley den Blick starr auf die Straße vor sich gerichtet. 150 Meter rechts von ihr, jenseits der zweispurigen Fahrbahn und mitten in der Heide, war die Stelle, an der Olivier sie vor fast drei Jahren niedergestochen hatte.
»Was guckst du da?«, fragte Henley, als Ramouter neben ihr leise pfiff. Er hatte die ganze Zeit auf seinem Handy getippt.
»Ich wollte mal wissen, wie viel Annans Haus so wert ist. Sie haben das Haus vor zwei Jahren gekauft. Schätz mal, für wie viel.«
»In Blackheath? Vermutlich für eine absurde Summe. Anderthalb Millionen.«
»Von wegen. Zwei Millionen. Sechs Schlafzimmer, vier Badezimmer, Dachterrasse. Weißt du, was ich mir mit so viel Geld in Bradford kaufen könnte?«
»Die ganze Stadt«, antwortete Henley mit einem Grinsen, und endlich setzte sich der Verkehr wieder in Bewegung.
»Wow, das ist ja … wie würdest du das nennen?«
»Schonungslos, aber mit ernstem Hintergrund. Warum siehst du es nach?«
Ramouter zuckte mit den Schultern. »Du hast gesagt, er war wegen Betrugs vorbestraft. Ich hätte nicht gedacht, dass er mit einer Pastorenstelle viel Geld verdient, trotz des SUVs für sechzig Riesen, der vor der Kirche parkte. Wie verdient man überhaupt Geld mit einer Kirche?«
»Du wärst überrascht.«
»Er könnte dafür verantwortlich sein, dass unser anderes Opfer eingesperrt war und halb zu Tode gefoltert wurde. In einer Kirche, die man nach sich selbst benannt hat, kann niemand gefangen gehalten werden, ohne dass man davon weiß.«
»Das geht dir ja überhaupt nicht aus dem Kopf, dass er seine Kirche nach sich selbst benannt hat.«
»Kommt mir einfach ein bisschen anmaßend vor.«
Henley seufzte, nahm die zweite Ausfahrt im Kreisverkehr und fuhr auf die Shooters Hill.
»Falls, und ich meine falls, sich herausstellt, dass Caleb Annan von dem Mann im Hinterzimmer wusste, dann befassen wir uns damit, aber vergiss nicht, ganz gleich, was wir herausfinden, Caleb Annan ist und bleibt unser Mordopfer. Nichts kann daran etwas ändern.«
Die Sichel eines teilweise verdeckten zunehmenden Mondes hing über einem dreistöckigen Haus mit Fenstern rechts und links von der Tür, das kieselgrau gestrichen war. Henley war beeindruckt, während sie den Schotterweg entlangfuhr.
»Wie oft hast du es schon gemacht?«, fragte Henley. Sie sah zu, wie Ramouter den Schal von seinem Schoß hob und ihn in den Händen verdrehte.
»Wovon sprichst du?«
»Wie oft musstest du schon bei jemanden an die Tür klopfen und ihm sagen, dass ein geliebter Mensch tot ist?«
Ramouter legte den Schal um, hielt den Blick aber gesenkt. »Nie«, sagte er und öffnete die Tür.
»Hast du je einen anderen Officer …«
Henley versagte die Stimme, als die eiskalte Luft durch den Türspalt pfiff und ihr übers Gesicht strich.
Ramouter schüttelte den Kopf. »Du wirst es doch nicht mich tun lassen, oder?«
Henley erhielt keine Gelegenheit zu antworten, denn ein Sicherheitsscheinwerfer schaltete sich ein und stellte sie beide ins Rampenlicht.
KAPITEL 7
Die Frau, die ihnen die Tür öffnete, passte nicht zum Haus. Eine Hand mit Fingernägeln, die bis aufs Nagelbett heruntergekaut waren, legte sich um den Rand des Türblatts und öffnete es nur einen schmalen Spalt weit. Sie war Mitte zwanzig und trug keinerlei Make-up. Ihre Haare bedeckte ein festgebundenes navyblau-weißes Kopftuch, aber an den Seiten waren lose schwarze Strähnen entkommen. Henley konnte die Ethnizität der Frau nicht bestimmen, aber sie sah aus, als hätte sie alles getan, um ihre Schönheit zu kaschieren. Henley hob ihren Dienstausweis.
»Guten Abend. Mein Name ist Detective Inspector Henley, und das ist mein Kollege, Detective Ramouter.«
Henleys Vorstellung veranlasste die Frau nicht, die Tür vollständig zu öffnen.
»Was wollen Sie?«, fragte sie hastig. Ihre Stimme klang sanft und leise und hatte einen leicht melodischen Einschlag. Sie schob die Hand durch den Spalt und ergriff Henleys Ausweis.
»Wir sind hier, um Mrs. Serena Annan zu sprechen. Ist sie zu Hause? Es ist wichtig, dass wir …«
Henley machte einen Schritt zurück, als sie ihr die Tür vor der Nase zuknallte.
»Nicht sehr gastfreundlich«, sagte Ramouter. Gleich darauf öffnete die Tür sich wieder.
»Erwartet Mrs. Annan Sie?«, fragte die Frau. »Sie lässt mich normalerweise wissen, wenn sie Besuch erwartet.«
»Das ist kein Höflichkeitsbesuch«, erwiderte Henley gereizt. »Wer sind Sie?«
Die Frau zog den Kopf ein, als wäre sie ein Kind, das von den Eltern ausgeschimpft wird.
»Dalisay Ocampo. Ich gehöre zur Familie. Es tut mir leid. Kommen Sie herein.«
Henley bewahrte ein Pokerface, als Ramouter ihr seinen gewohnten Was-zum-Teufel-war-das-denn?-Blick zuwarf.
Henley und Ramouter traten in den Hausflur und schlossen hinter sich die Tür. Das Haus sah teuer aus und roch auch so. In der Luft hing schwer der Duft von würzigen Früchten ähnlich dem Glasfläschchen mit dem Lieblingsbadeöl ihrer Schwiegermutter, das Emma, hilfsbereit wie sie war, in die Toilette geworfen hatte.
»Sind das die Kinder der Annans?«, fragte Henley. Sie war vor einer Vase mit langen weißen Lilien stehen geblieben, die neben einem Foto zweier lächelnder Kinder auf dem Beistelltisch aus Mahagoni stand. Ein Junge und ein Mädchen in ihrer Sonntagskleidung. Gestellt und oberflächlich.
»Ja«, antwortete Dalisay fast verschwörerisch, als gebe sie Wissen weiter, über das sie eigentlich gar nicht verfügen dürfte. »Malilah ist sieben und Zyon fünf.«
Über dem Tisch hing ein großes Bild von Serena Annan und ihrem Mann. Links davon war ein goldenes Kruzifix an der Wand befestigt. Es wirkte eher dekorativ und üppig denn wie ein Zeichen frommer Ergebenheit. Wäre das Foto nicht gewesen, hätte Henley große Mühe gehabt zu schlussfolgern, dass es wirklich das Zuhause einer Familie war. Keine Spielzeuge, keine herumstehenden Schuhpaare, keine Legosteine auf der Treppe. Keine Kleidungsstücke, die über dem Heizlüfter trockneten. Keine Pakete neben der Haustür, die darauf warteten, dass ein Nachbar sie abholte. Das Haus machte einen sterilen Eindruck, als wäre von den Möbeln gerade erst die schützende Folie aus Plastik abgezogen worden.
»Bitte«, sagte Dalisay und drückte die Tür des vorderen Empfangsraums auf. »Wenn Sie hier warten, hole ich Mrs. Annan.«
Henley sah zu, wie Dalisay eine Hand auf das blank polierte Holz des Geländers legte und sorgsam die teppichbedeckten Stufen hinaufging, als fürchtete sie, sie könnte einen Abdruck hinterlassen.
»Hier ist es unnatürlich sauber«, sagte Ramouter. Er stand an der Seite, die Füße fest auf den Parkettbohlen, sorgfältig bedacht, nicht auf den fuchsienroten Teppich in der Mitte des Raums zu treten. An der Wand hing ein großer Fernseher, dazu weitere Fotografien. Hochzeiten. Taufen. Die üblichen Schulfotos junger Kinder, denen die Vorderzähne fehlen. Eine weiß eingebundene Bibel lag auf dem Couchtisch in der Mitte des Zimmers neben einem geöffneten Laptop und teuren Bildbänden. Henley hatte keine Gelegenheit zu schauen, was auf dem Laptop war, bevor eine Frau in den Raum trat.
»Dalisay sagt, Sie sind von der Polizei.« Serena Annan war größer als Henley und Ramouter. Henley schätzte sie auf knapp einsneunzig in ihren Pantoffeln. Die Haare waren zu einem lockeren Dutt zurückgebunden. Sie schloss die Tür hinter sich.
»Das ist richtig, Mrs. Annan. Ich bin Detective Inspector Henley von der Serial Crime Unit der Greenwich Police Station.«
»Die Einheit für Serienverbrechen? Ich verstehe nicht.«
»Das ist das Dezernat, dem wir unterstellt sind.«
»Und wer sind Sie?« Serena wandte sich Ramouter zu, als wäre sie gerade erst gewahr geworden, dass noch jemand im Raum war und schlecht roch.
Henley beobachtete Ramouter, als er sich vorstellte. Er war höflich, aber trotz Ramouters relativer Gefasstheit entgingen ihr nicht die leichten Falten der Anspannung auf seiner Stirn. Etwas in ihrem Bauch verriet ihr, dass Serena nicht überrascht war über die Neuigkeit, die sie ihr eröffnen würden. Henley zählte die Minuten. Drei Minuten waren verstrichen, und Serena Annan hatte noch nicht nach ihrem Mann gefragt. »Mrs. Annan, ich fürchte, ich habe sehr schlechte Neuigkeiten für Sie. Ihr Ehemann …«
»Ist ihm etwas zugestoßen?«
»Zu meinem großen Bedauern muss ich Sie informieren, dass Caleb Annan tot ist.«
Henley wartete auf die üblichen Einwände. Sie lügen. Sie sind im falschen Haus. Sie haben einen Fehler begangen. Ich habe doch erst heute Morgen mit ihm gesprochen. Nichts davon kam. Serena Annan zeigte eine unausgesprochene und entnervende Akzeptanz.
»Was ist ihm passiert? Gab es einen Unfall?«, fragte sie schließlich.
»Nein. Er war in keinen Unfall verwickelt.«
Es gab Regeln. Es gab ein Protokoll und einen Ratgeber, wie man den nächsten Angehörigen informieren sollte, dass ein geliebter Mensch getötet worden war. Sie waren in der angemessenen Wortwahl unterwiesen worden. Sanfte Formulierungen. Mitfühlend. Aber manchmal musste man das Pflaster einfach abreißen. Etwas sagte Henley, dass Serena Annan es verkraften konnte.
»Er wurde getötet, Mrs. Annan.«
»Getötet. Wie meinen Sie das?« Serena Annan ließ sich aufs Sofa sinken.
Henley suchte in ihrem Gesicht nach Anzeichen für Schock, Verleugnung oder Wut, aber dort war nichts zu sehen. Die Emotionslosigkeit machte Henley unbehaglich.
»Ihr Mann wurde von der Reinigungskraft, Uliana Piontek, heute Nachmittag um ein Uhr fünfzig tot aufgefunden«, sagte Henley langsam.
»Sind Sie sicher, dass es Caleb ist?«
»Nun, er ist noch nicht offiziell identifiziert worden.«
»Und Sie sagen, die Putzfrau hat ihn gefunden?«
»Richtig.«
»Sie könnte einen Fehler begangen haben. Sie ist nicht sehr verlässlich.«
»Wir müssen Sie bitten, Ihren Mann offiziell zu identifizieren«, sagte Henley behutsam.
»Sie wollen, dass ich es mache?«
»Es sei denn, Sie fühlen sich nicht in der Lage …«
»Ich bin dazu durchaus in der Lage«, unterbrach Serena Annan sie mit Nachdruck.
Henley empfand weiterhin Unbehagen. Sie wartete auf irgendein Zeichen, dass Serena von den Neuigkeiten betroffen wäre, die sie gerade erhalten hatte, aber da war nichts. Keine Einwände. Kein Gemurmel, sie glaube es nicht. Keine Tränen.
»Wann soll ich den … Mann, den Sie aufgefunden haben, identifizieren?«, fragte Serena.
»Sie müssen es nicht auf der Stelle tun, das würde ich nicht von Ihnen verlangen.« Henley sagte es fast, als wollte sie Serena auffordern, sich anmerken zu lassen, dass es in der Tat ein Schock für sie war. »Sie brauchen es auch nicht allein zu tun. Sie könnten …«
»Ich muss die Familie informieren«, sagte Serena nüchtern, geschäftsmäßig. »Und dem Gemeinderat. Und … o Gott … die Kinder …«
Erst da zeigte Serena Annan erste Anzeichen eines Zusammenbruchs. Sie biss sich auf die Unterlippe und rannte aus dem Zimmer.
»Kommt es mir nur so vor, oder erschien sie dir auch nicht besonders überrascht?«, flüsterte Ramouter. Die Türglocke schrillte.
»Nein, das war sie nicht«, sagte Henley leise. Sie drehte sich um und sah, wie Dalisay langsam zur Haustür ging. Als Nächstes hörte sie Bethanys vertraute raue Stimme, und die Tür wurde wieder zugeknallt.
»Tut mir leid, wir sind spät dran«, sagte sie, als sie mit PS Levine in den Raum geführt wurde.
»Schon gut«, sagte Henley. »Ist immer ein Glücksspiel, hierherzukommen. Sergeant Levine, ich glaube, Sie kennen DC Ramouter noch nicht.«
»Hatte noch nicht das Vergnügen.« PS Levine schüttelte Ramouter die Hand. Levine war längst im Pensionsalter und hätte zu Hause sitzen sollen, um seine Golftrips zu planen, aber er kam einfach nicht mit der Langeweile zurecht. Er war einer von Henleys liebsten Custody Sergeants gewesen, als er noch den Haftzellenblock der Walworth Police Station leitete, wusste aber, dass sich viele von seinem großväterlichen Gebaren täuschen ließen. Er war gütig und warmherzig, aber auch scharfsinnig und ließ niemandem auch nur eine Sekunde lang irgendwelchen Unsinn durchgehen.
»Ach, noch mehr von Ihnen«, sagte Serena Annan, als sie wieder ins Zimmer kam. Henley hielt nach Anzeichen von Kummer Ausschau: gerötete Augen, eine laufende Nase. Nichts. Ihr Haar war gebürstet, sie hatte den Lippenstift nachgezogen. Sie setzte sich aufs Sofa, schlug die Fußgelenke übereinander, hob die Hand an den Hals und strich über das diamantenbesetzte Kruzifix, das an ihrer goldenen Kette hing.
Serena stellte keine Fragen, sondern ließ Bethany erklären, wer sie und PS Levine waren und was ihre Rolle als Opferbetreuungsbeamte beinhaltete.
»Wo sind nur meine Manieren?«, sagte Serena. »Möchten Sie Tee oder Kaffee? Ich kann Dalisay welchen bringen lassen.«
»Nein, danke. Ramouter und ich brauchen nichts«, sagte Henley. »Ich habe nur noch ein paar Fragen, bevor wir gehen. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen, Mrs. Annan?«