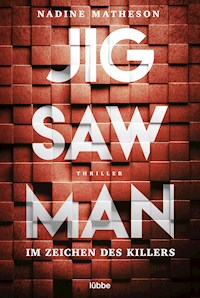
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der menschliche Körper ist ein wunderbares Puzzle, einzigartig in seiner Präzision und seiner aufeinander abgestimmten Perfektion!
Der Jigsaw Man liebt Puzzles über alles. Doch ein perfektes Puzzle ist nur eines, das in seine Einzelteile zerlegt ist. Nur so kann er die wahre Schönheit erkennen - indem er jedes Teil für sich betrachtet. Hände, Füße, Beine, Arme, Köpfe. Welche Freude! Und wahre Freude muss man teilen, nicht wahr? In der ganzen Stadt ...
Wirst du sein nächstes Opfer sein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumPrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57Kapitel 58Kapitel 59Kapitel 60Kapitel 61Kapitel 62Kapitel 63Kapitel 64Kapitel 65Kapitel 66Kapitel 67Kapitel 68Kapitel 69Kapitel 70Kapitel 71Kapitel 72Kapitel 73Kapitel 74Kapitel 75Kapitel 76Kapitel 77Kapitel 78Kapitel 79Kapitel 80Kapitel 81Kapitel 82ÜBER DIESES BUCH
Der menschliche Körper ist ein wunderbares Puzzle, einzigartig in seiner Präzision und seiner aufeinander abgestimmten Perfektion!
Der Jigsaw Man liebt Puzzle über alles. Doch ein perfektes Puzzle ist nur eines, das in seine Einzelteile zerlegt ist. Nur so kann er die wahre Schönheit erkennen - indem er jedes Teil für sich betrachtet. Hände, Füße, Beine, Arme, Köpfe. Welche Freude! Und wahre Freude muss man teilen, nicht wahr? In der ganzen Stadt …
ÜBER DIE AUTORIN
Nadine Matheson wurde in Deptford in Südwest-London geboren und ist dort auch aufgewachsen. Sie arbeitet als Verteidigerin in Strafrechtsverfahren, kennt also die Welt ihrer Serie genau. Darüber hinaus hat sie den Schreibwettbewerb der Londoner Universität gewonnen, THE JIGSAW MAN ist ihr erster Roman.
N A D I N E M A T H E S O N
JIGSAWMAN
I M Z E I C H E ND E S K I L L E R S
T H R I L L E R
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by NJ Matheson Ltd.
Titel der englischen Originalausgabe: »The Jigsaw Man«
Originalverlag: HarperCollins
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ralf Reiter
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-8810-7
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Prolog
06:44 Uhr. Greenwich Pier, Ebbe, und Jacob Thomas geht mit seinem Hund am Ufer spazieren. Dass er gleich Leichenteile finden wird, damit rechnet er nicht. Er geht über grauen Lehm, nasse Kiesel und Glassplitter. Holzstücken und weggeworfenen Autoreifen weicht er aus. Als er Petra, seine Hündin, von der Leine lässt, fällt ihm auf, dass etwas auf dem Boden das Sonnenlicht reflektiert. Er bückt sich und zieht vorsichtig daran. Gestern hat er eine Anstecknadel aus dem Mittelalter und eine römische Münze gefunden, heute ist es nur ein Stück von einer Badewannenkette. Enttäuscht steht er auf und sieht, dass seine Hündin im Schlamm an etwas schnüffelt. Es ist Spätsommer, die Hitzewelle hält noch immer an. Tatsächlich steigen die Temperaturen sogar noch immer von Tag zu Tag. Jacob wischt sich beim Gehen den Schweiß von der Stirn. Sein billiges Polyester-T-Shirt klebt an den Speckwülsten um seinen Bauch. Um 06:48 Uhr erreicht er die Hündin und sieht, was ihre Aufmerksamkeit erregt hat.
»Ach du Scheiße …«
Jacob packt die Hündin an ihrem blauen Halsband und zieht sie zurück. Adrenalin strömt durch seinen Körper, und er spürt den Puls in den Ohren. Das gleiche Gefühl hatte er auch schon gestern, als er die römische Münze entdeckt hat. Neugier gemischt mit Aufregung. Beides verfliegt rasch. Jetzt überwältigen Ekel, Angst und Übelkeit ihn. Seine freie Hand zittert, während er das Handy aus der Tasche zieht. Es fällt zwischen die nassen Kiesel. Jacob wischt das Display an der Jeans ab und prüft, ob die Kamera sauber ist. Dann fotografiert er den abgetrennten Arm.
Eine Meile entfernt überwacht Heather Roszicky, eine Professorin für Archäologie, eine Gruppe von Studenten im zweiten Jahr bei der Feldarbeit am Ufer der alten Deptford-Werft. Heather lehnt an der Ufermauer, schaut auf ihre Uhr und seufzt. Noch vier Stunden bis zur Flut, aber sie will einfach nur weg und zurück in ihr Büro. Sie muss endlich das Manuskript ihres Buches über den Niedergang der Flussarchäologie in London fertigstellen, bevor ihr Lektor seine Drohung wahrmacht und ihr den Hals durchschneidet. Sie hat den Abgabetermin nämlich schon zweimal versäumt, und ihr Vorschuss ist mittlerweile aufgebraucht.
Ein lauter Schrei zerreißt die ruhige Luft, und Heather sieht eine ihrer Studentinnen auf sie zu rennen, ein Mädchen mit Namen Shui. Die restlichen Studenten weichen derweil langsam von den moosbewachsenen Felsen zurück. Shui stolpert über ein Stück Holz und stürzt zu Boden.
»Was ist denn los?«, verlangt Heather zu wissen.
Shui schüttelt den Kopf und bricht in Tränen aus, als Heather sie in die Höhe zieht. Die Studenten reden laut miteinander, und plötzlich laufen sie alle auf Heather zu. Irgendjemand packt sie am Arm und zieht sie zu den verfaulten Stufen einer alten Anlegestelle. Heather spürt, wie ein Schrei in ihrer Kehle aufsteigt, als sie in das verschlammte Wasser blickt und inmitten der schwarzen und grünen Holzstücke einen kopflosen Torso sieht.
Christian Matei, ein Küchenbauer, geht in Richtung 15 Nelson Mews, die letzte Sackgasse an der Watergate Street in Deptford. Der Fluss ist nicht weit entfernt, und Christian glaubt, das Schreien einer Frau zu hören, doch dann wird er von jemandem abgelenkt, der Trompete spielt, und zwar schlecht. Als er sich dem Haus nähert, öffnet er das Tor und wirft seinen leeren Kaffeebecher in Richtung der Mülltonne, die in der Einfahrt steht.
»Scheiße«, knurrt er auf Albanisch, seiner Muttersprache, als der Becher an der Mülltonne abprallt und auf den Boden fällt. Als er sich bückt, um den Becher wieder aufzuheben, erregt etwas seine Aufmerksamkeit. Einen halben Meter entfernt tanzt ein Fliegenschwarm um ein Objekt auf dem Boden neben einem weggeworfenen Autoreifen. Galle gemischt mit Kaffee sammelt sich in Christians Hals. Kurz darauf bedeckt sein Erbrochenes die Fliegen, die über das verfaulte Fleisch eines abgetrennten Beins krabbeln.
Kapitel 1
Das Wichtigste war, ruhig zu bleiben. Er durfte nicht sehen, dass er sie getroffen hatte. Wieder einmal.
»Rob, dafür habe ich keine Zeit. Ich werde zu spät zur Arbeit kommen«, sagte Henley, als sie sich die Wagenschlüssel vom Sideboard schnappte und zur Tür ging.
»Genau das ist das Problem. Das hast du nie. Du …«
Das Knallen der Haustür erstickte den Rest seiner Worte, aber sie wusste ohnehin, wie es weiterging.
Du hast nie Zeit. Für dich kommt die Arbeit immer zuerst.
Detective Inspector Anjelica Henley schaute zu dem Reihenhaus mit der frisch gestrichenen blauen Tür zurück. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, was es wohl über sie aussagte, dass sie mit Vergewaltigern und Mördern glücklicher war als mit ihrem eigenen Mann. Sie fühlte, dass ihre Wut schneller zunahm als die Hitze in der Luft. Als sie ins Auto stieg, zeigte das Thermometer auf dem Armaturenbrett vierundzwanzig Grad, und dabei war es noch nicht einmal halb acht. Da sie jedoch gegen den Verkehr fahren musste, würde sie nur fünfzehn Minuten brauchen, um von ihrem falschen heimischen Idyll in Brockley in die relativ vernünftige Welt des Dezernats für Serienmorde zu kommen, die sogenannte SCU. Sie betrachtete ihr Spiegelbild im Rückspiegel. Sie hatte das Haus viel zu schnell verlassen und vergessen, die kleine Narbe auf ihrer rechten Wange und die dunklen Ringe unter den Augen abzudecken. Das Klingeln ihres Handys unterbrach die neuesten Verkehrsmeldungen von BBC London. Stephen Pellacia stand auf dem Display.
»Wo steckst du?«
»Auch dir einen guten Morgen. Ich bin auf dem Deptford Broadway. In gut zehn Minuten bin ich da«, antwortete Henley.
»Komm nicht aufs Revier«, sagte Pellacias Stimme aus den Lautsprechern. Er sprach schnell, als versuche jemand anders, seine Aufmerksamkeit zu erregen. »Du musst einen kleinen Umweg machen, zum Ende der Watergate Street.«
»Zur Watergate Street? Warum das denn? Ich habe viel zu viel gegen dich in der Hand, als dass ich den Laufburschen für dich spielen müsste.«
»Wir haben einen Fall. Ein Haufen Körperteile ist in der Gegend verstreut gefunden worden. Es ist allerdings noch zu früh, um zu sagen, ob sie alle zum selben Opfer gehören oder ob wir es mit mehr als einem zu tun haben. Ramouter ist schon unterwegs. Er wird dich da treffen, und …«
Henley machte eine Vollbremsung, als plötzlich ein Moped vor ihr kreuzte. Sie war sofort angespannt, als hätte man einen Schalter umgelegt. »Was meinst du damit, Ramouter ist schon unterwegs? Warum hast du denn nach dem geschickt?« Sie versuchte zwar, ihren Ärger zu verbergen, doch es gelang ihr nicht. »Wie kommst du darauf, dass ich …?«
Pellacia ignorierte sie. »Ich schicke dir die CAD-Details.«
Henley schlug mit der Hand aufs Lenkrad. Das Letzte, was sie jetzt brauchte, war ein übertrieben enthusiastischer, unerfahrener Detective, der ihr an den Fersen klebte, ein gottverdammter Azubi.
Die Watergate Street, unweit der verstopften Creek Road, war um 07:40 Uhr für gewöhnlich ein ruhiges Wohngebiet, doch jetzt standen die Bewohner vor ihren offenen Haustüren und fragten sich, warum gerade ein Korso von Streifenwagen durch ihre Straße gefahren war. Trotz der hellen Sonne am wolkenlosen blauen Himmel herrschte in der Straße ein geradezu unheimliches Zwielicht. Die Äste mächtiger Kirschbäume bildeten ein fast undurchdringliches Dach über dem Asphalt. Henley parkte gegenüber einem Pub mit Namen The Admiral, nur ein paar Meter von der Polizeisperre entfernt, an der sich ein kleines Grüppchen Gaffer versammelt hatte. Mehrere Fahrzeuge bremsten ab und wendeten nach rechts, als sie erkannten, dass ihre übliche Abkürzung zur Rushhour gesperrt war. Detective Constable in Ausbildung Salim Ramouter stand auf der anderen Seite des Absperrbands, ein kurzes Stück von den Gaffern entfernt. Er trug einen eleganten marineblauen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte, und Henley sah, dass seine schwarzen Schuhe glänzten. Ramouter war neu im Team, aber nicht neu bei der Polizei. Dennoch wirkte er wie ein Frischling, der noch nicht wirklich mit der Realität in Kontakt gekommen war, die ihn von nun an auf den Straßen Londons erwartete. Pellacia hatte Henley gesagt, für Ramouter sei Detective Sergeant Stanford verantwortlich, dass Stanford ihm zeigen würde, wo’s langgeht. Sie selbst hatte Ramouter kaum Aufmerksamkeit geschenkt, als Pellacia ihn vorgestellt hatte. Er wirkte größer, als sie ihn in Erinnerung hatte, über einen Meter achtzig. Auch trug er einen Bart, von dem Henley vermutete, dass er damit seine Jugend verbergen wollte.
Ramouter verschränkte immer wieder die Arme vor der Brust und dann hinter dem Rücken. Henley gefiel nicht, wie eifrig und unvorbereitet er wirkte, aber sie selbst sah gerade auch nicht wie die Autorität in Person aus. Sie trug Jeans, Turnschuhe, ein Wonder-Woman-T-Shirt und einen Blazer, der schon seit einer Woche auf dem Rücksitz ihres Autos lag. Das war mehr fürs Büro geeignet und weniger für einen leitenden Beamten am Tatort.
»Guten Morgen, Inspector.« Ramouter streckte die Hand aus. Henley ignorierte sie.
»Wo ist Stanford?« Sie zeigte einem Uniformierten ihren Dienstausweis, der daraufhin das Absperrband hob.
»Er ist mit Uniformierten und Kriminaltechnikern auf dem Weg zu dem Tatort in Greenwich«, antwortete Ramouter, zog seine Hand zurück und folgte Henley. Kurz blieben sie vor 15 Nelson Mews stehen. Zwei Beamte in blauen Overalls kauerten am Boden und sicherten Beweise, ein dritter machte Fotos von der Einfahrt. Die Haustür stand offen, und Henley sah eine weibliche Beamtin im Flur. Sie sprach mit einem jungen Mann.
»Ihnen ist doch klar, wo wir hingehen, oder?«, fragte Henley, als Ramouter die Hand aufs Tor legte.
»Wir gehen zu Mr. Matei, um ihn zu befragen.«
»Ja, und wenn wir damit fertig sind, dann schlage ich vor, Sie bitten einen der Kriminaltechniker um ein Paar Überschuhe, wenn wir zu den Stufen kommen.«
Henley sah Angst in Christian Mateis bleichem Gesicht. Sanft legte sie ihm die Hand auf den Arm. Er zitterte immer noch. Henley spürte das Zittern unter seiner Haut, während sie immer wieder kurz zur Treppe schaute. Nahezu übergangslos schaltete sie von angepisst auf warmherzig und empathisch um. »Würden Sie vielleicht gerne in ein anderes Zimmer gehen?«, fragte sie.
»Ich muss nach Hause«, erwiderte Matei.
Sein albanischer Akzent war stark ausgeprägt, doch sein Englisch war perfekt. Seine Worte waren präzise und beherrscht, als hätte er sie mehrmals im Kopf geübt, bis er selbstbewusst genug war, sie auch laut auszusprechen.
»Wie lange arbeiten Sie schon hier?«, fragte Henley, trat kurz von ihm weg und schloss die Tür.
»Seit zwei Tagen. Wir haben gerade damit begonnen, das Haus zu entkernen.«
»Wem gehört das Haus?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich habe ihn nie kennengelernt … mein Chef aber schon.«
»Und wie heißt Ihr Chef?«
»Raymond Da Silva. Ihm gehört das Bauunternehmen.«
»Großartig«, sagte Henley und schrieb die Information in ihr Notizbuch. »Sie haben gesagt: Wir haben gerade damit begonnen, das Haus zu entkernen. Wer arbeitet denn noch mit Ihnen hier?«
»Darren. Er hat mir heute Morgen eine SMS geschickt, dass er sich verspäten würde. Das war kein Problem. Ich habe einen Schlüssel. Ich habe meinen Kaffee ausgetrunken, den Becher weggeworfen, und dann habe ich … dann habe ich die Fliegen gesehen.« Er wurde wieder bleich. »So viele Fliegen.«
»Ist schon okay. Möchten Sie etwas Wasser?«
Christian Matei schüttelte den Kopf und winkte ab.
»Und dann haben Sie die Polizei angerufen?«, fragte Henley.
»Nein. Nein. Ich konnte nicht. Ich weiß nicht, warum … Ich bin einfach ins Haus gerannt. Darren kam gut zehn Minuten später, und er hat dann die Polizei gerufen.«
Es war nicht weit von 15 Nelson Mews zu den Watergate Steps, wo die Straße zu einer schmalen Kopfsteinpflastergasse wurde. Am Ende der Gasse befand sich ein öffentlicher Park. Henley schaute in den Park, als sie daran vorbeigingen. Eine Gruppe von Studenten saß dort auf den Bänken an einem Teich. Daneben standen eine ältere Frau und ein chinesisches Mädchen. Sie sprachen mit einem Polizisten.
»Das ist Heather Roszicky«, sagte Ramouter. »Sie hat den …«
»Ich weiß, was sie gefunden hat.«
Auf dem Weg die Gasse hinunter wurde der Geruch des Flusses immer stärker. Es war eine Mischung aus abgestandenem Wasser und Motoröl. Henley hörte das Wasser auf dem Kies plätschern. Dank der baulichen Neugestaltung in den letzten Jahren endete die Gasse nicht länger an den Watergate Steps, die zum Fluss hinunterführten. Rechts befand sich eine große Terrasse, die an den Borthwick-Kai grenzte, wo die alte Fleischfabrik mit ihren Kühlhallen einer Mischung aus teuren Wohn- und Geschäftsgebäuden gewichen war.
Anthony Thomas, ein erfahrener Tatortermittler, tauchte oben auf der Terrasse auf und zog seine lilafarbenen Gummihandschuhe aus. Zum letzten Mal hatte Henley vor zwei Jahren mit ihm an einem Tatort zusammengearbeitet. Jetzt versuchte sie, die Erinnerung daran in eine ganz weit entfernte Schublade ihres Verstandes zu schieben. Dennoch sah sie unwillkürlich ein verschwommenes Bild von Anthony, der sie sanft in einen Raum führte, wo sie sich auf eine große Plastikplane stellen sollte. Die Klimaanlage ließ sie frösteln, und sie bekam eine Gänsehaut. Sie hörte nicht wirklich, was Anthony sagte, während er unter ihren Fingernägeln kratzte, durch ihr Haar kämmte und darauf wartete, dass Beweise zu ihren Füßen fielen. Henley war übel gewesen. Sie hatte Angst gehabt und sich verwundbar gefühlt, während der Arzt sie untersucht und ihre Verletzungen auf eine Körperkarte eingetragen hatte, die er auf ein Stück Papier gezeichnet hatte. Die Erkenntnis, dass sie das Verbrechen war, ein Ding, das man untersuchen musste, hatte sie wie ein Schlag in die Magengrube getroffen. Das schmerzte sie mehr als das Messer, das ihr in den Bauch gedrungen war. Sie hatte dafür trainiert, Detective zu sein, nicht Opfer. Dafür gab es kein Handbuch.
»Ich habe nicht damit gerechnet, dich hier zu sehen«, sagte Anthony. »Willst du es dir mal anschauen?«
»Muss ich wohl«, antwortete sie und deutete auf die Kiste zu Anthonys Füßen. Sie war dankbar dafür, dass er keine große Sache daraus machte, dass sie das erste Mal seit zwei Jahren das Büro verlassen hatte.
»Großartig. Genau wie in alten Zeiten«, sagte Anthony, bückte sich, griff in die Kiste und holte ein Paar blaue Überschuhe heraus. »Wer ist dein Freund?«
Henley stellte Ramouter vor und nahm die Überschuhe.
»Ah, ein Frischling. Ich habe auch einen.« Anthony deutete zu einem jungen Mann, der stocksteif hinter ihm stand und eine Kamera in Händen hielt. Er hatte seinen Overall bereits bis zum Hals geschlossen. Er wirkte wachsam, aber auch aufgeregt, während sein Blick zwischen Henley und Anthony hin und her zuckte. »Was für ein Spaß«, bemerkte Anthony mit einem Seufzen. »Ich sehe euch dann unten.«
»Kommen Sie«, sagte Henley zu Ramouter, als sie ihm die Überschuhe gab. »Gehen wir mal da runter und sehen uns an, womit wir es zu tun haben.«
Henley schaute auf den tätowierten Torso, der mindestens fünf Fuß von den schlammigen Wassern der Themse entfernt lag. Natürlich konnte der Torso einfach von der Strömung flussabwärts getragen worden sein, aber es sah so aus, als wäre er absichtlich zwischen den moosbedeckten Stufen und dem verrotteten, gebrochenen Holz des einstigen Piers platziert worden. Das Einzige, dessen Henley sich sicher sein konnte, war, dass sie es mit einem weißen Mann zu tun hatten, der offensichtlich eine Vorliebe für Manga- und Anime-Tattoos gehabt hatte. Die Beine waren am Oberschenkelhals abgetrennt worden, die Arme am Bizeps. Die Schnitte waren allerdings nicht so sauber wie die, die Henley vor ein paar Jahren gesehen hatte, ebenfalls an abgetrennten Gliedmaßen. Als sie die abgetrennten Arme, Beine, den Kopf und den Torso zum ersten Mal gesehen hatte, die man unter eine Eisenbahnbrücke in Lewisham geworfen hatte, da war sie wie erstarrt gewesen. Seitdem hatte sie gelernt, härter zu sein und ihre Gefühle abzuschotten. Henley hockte sich hin. Der Kopf war unmittelbar über dem Adamsapfel abgeschnitten worden. Kleine Knochenstücke steckten in der Luftröhre, die aus dem geronnenen Blut an dem zerfetzten Muskel ragte. Und da war gelbes Fett und Bindegewebe, das an ein rohes Hühnchen erinnerte, das man zu lange an der frischen Luft gelassen hatte.
Kapitel 2
»Wie lange haben wir noch, bis die Flut kommt?« Henley blickte zum Fluss und betrachtete die kleinen Wellen, die sich an dem alten Pier brachen, der mit seinen gelben Warnschildern gut drei Meter aus dem flachen Wasser ragte. Sie schaute auf die Uhr. Seit dem ersten Notruf waren zwei Stunden vergangen. Ramouter drehte den Kopf in Richtung eines vorbeifahrenden Polizeiboots, doch für Henley war er nicht schnell genug. Deutlich sah sie das Unbehagen in seinen Augen. Der Anblick von blutigen Körperteilen hatte ihn zutiefst erschüttert.
»Ich habe online nachgesehen. Die Flut kommt um 09:55 Uhr«, antwortete Ramouter und trat um einen halb versunkenen Autoreifen herum. »Ebbe war um 03:15 Uhr, Sonnenaufgang um 06:32 Uhr. Das bedeutet ein Drei-Stunden-Fenster für jemanden … wer auch immer das hier abgelegt und darauf gehofft hat, dass es jemand findet, bevor die Flut kommt. Korrekt?«
»Vielleicht«, räumte Henley ein. »Aber soweit wir wissen, könnte der Torso auch nach Sonnenaufgang hier abgelegt worden sein, oder er ist weiter flussaufwärts ins Wasser geworfen worden und hier gelandet.« Vorsichtig trat sie einen Schritt zurück und schaute die sanierte Glasfassade des Borthwick-Kais hinauf. Die Geschäftsräume, die sich zur Terrasse hin öffneten und den Fluss überblickten, waren leer. Nirgends waren Menschen oder Überwachungskameras zu sehen, und Henley bezweifelte, dass die lokalen Behörden die Verkehrsüberwachung bereits bis hierhin ausgedehnt hatten.
»Hat jemand den Torso angefasst?«, fragte sie Anthony, der gerade neben sie trat.
»Soweit ich weiß, ist alles noch genau so, wie er gefunden wurde. Die Frau, die ihn gefunden hat, hat ihn jedenfalls nicht berührt. Matei, dein Bauarbeiter, hat ja auch gesagt, dass er die Beine nicht angefasst hat, aber unglücklicherweise hat er daraufgekotzt. Ich habe auch mal einen kurzen Blick auf die Arme geworfen, die weiter flussabwärts gefunden worden sind, bevor ich hierhergekommen bin. So wie es aussieht, haben Schatzsucher ein wenig daran herumgestochert.«
»Schatzsucher«, seufzte Henley. »Die gibt es hier wohl überall.«
»Wir müssen schnell sein«, sagte Anthony und zupfte seine Handschuhe zurecht. »Wir versuchen, eine Beweiskette von der Gasse bis zum Torso aufzubauen. Ich bezweifle allerdings, dass unser Täter sich nach der Tat erst einmal hingesetzt und einen Kaffee getrunken hat.«
»Kaffee vielleicht nicht, aber wenn wir Ramouters Theorie ernst nehmen und die Leichenteile gezielt hier abgelegt worden sind, dann kennen der oder die Täter den Fluss ziemlich gut«, erwiderte Henley. »Wir lassen dich jetzt weitermachen. Ramouter und ich werden mal ein wenig spazieren gehen.«
»Wo gehen wir denn hin?«, fragte Ramouter.
»Wir werden uns mit Eastwood treffen.«
»Und so weit sollen wir zu Fuß gehen?« Ramouter holte sein Handy aus der Innentasche. »Laut Google Maps ist der Greenwich Pier eine Meile entfernt von hier.«
»Dein Leichenteilentsorger ist offenbar nicht der Einzige, der den Fluss gut kennt!«, rief Anthony Henley hinterher, als sie sich auf den Weg den Fluss entlang nach Greenwich machte.
Die Zwillingskuppeln des Old Royal Naval College mit ihren goldenen Spitzen ragten in den wolkenlosen blauen Himmel, und die kahlen Masten der Cutty Sark vervollständigten das historische Panorama, für das Greenwich weltberühmt war. Es war eine prachtvolle, weiß getünchte Version der Geschichte, die in krassem Gegensatz zu dem fauligen Dreck stand, den der Fluss ans Ufer spülte. Als sie bemerkte, dass sie das Geräusch von Ramouters Lederschuhen auf dem nassen Kies nicht mehr hören konnte, blieb Henley stehen.
»Wo kommen Sie eigentlich her?«, fragte sie, während sie darauf wartete, dass Ramouter sich das Jackett auszog und die Krawatte lockerte. Sie ging näher ans Wasser heran. Die Flut kam langsam.
»Ich bin in West Bromwich geboren und mit zwölf nach Bradford gezogen.« Ramouter beugte sich vor und klopfte sich den Dreck von den Hosenbeinen. Oder zumindest versuchte er es, denn als er erkannte, dass er es damit nur noch schlimmer machte, verzog er das Gesicht. »Da gibt es jede Menge Moor, aber keine Flüsse. Mit dem Wagen wären wir doch sicher schneller gewesen.«
»Nein. Das hier ist schneller. Es sei denn, Sie sitzen gerne eine halbe Stunde im Stau, wenn die Creek Road Bridge hochgezogen wird.«
»Kennen Sie die Gegend gut?«
Henley ignorierte die Frage. Sie sah keinen Sinn darin, Ramouter zu verraten, dass sie den Weg auch blind gefunden hätte. »Wer auch immer den Torso da hinten abgelegt hat, er muss diesen Weg genommen haben. Es ergibt einfach keinen Sinn, hier runterzukommen, wieder zur Straße zu gehen und dann die Watergate Street raufzufahren. Besonders, da die Lichtverhältnisse zu dieser Zeit nicht sonderlich gut gewesen sein dürften.«
»Aber Leichenteile sind schwer.« Ramouter beschleunigte seinen Schritt, um Henley einzuholen. »Ein menschlicher Kopf wiegt mindestens acht Pfund.«
»Ich weiß.« Henley holte ihr Handy heraus, das zu klingeln begonnen hatte. Sie wusste, zu wem der Klingelton gehörte, und so legte sie einfach auf.
»Kopf, Torso, Arme, Beine. Das sind sechs Körperteile.«
»Auch das weiß ich, Ramouter. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus?«
»Ich will damit nur sagen, das ist eine Menge Gewicht, was da jemand um drei Uhr morgens durch die Gegend geschleppt hat.«
Henley zeigte nicht offen, dass sie dem zustimmte. Stattdessen holte sie ein schwarzes Haarband aus der Jackentasche und band ihre schwarzen Locken zu einem Pferdeschwanz. Sie hatte ganz vergessen, wie viel Kraft es kostete, das schräge Ufer entlangzuwandern. Als sie nach vorne blickte, sah sie, dass eine kleine Menschenmenge, eine Mischung aus touristischen Frühaufstehern und Studenten, sich oben versammelt hatte und auf die Szene unten blickte. Die Einheimischen auf dem Weg zur Arbeit waren den Anblick von Leichen gewohnt, die man aus dem Wasser zog. Die Sonne spiegelte sich auf den Handys, während die Gaffer versuchten, möglichst gute Bilder von den Männern in den blauen Anzügen zu schießen, die Beweise sammelten.
»Das ist schon ein bisschen gruselig«, rief DC Roxanne Eastwood, als Henley endlich den ersten Tatort erreichte. »Morgen, Ramouter. Nicht schlecht für Ihren ersten Tag, was?«
Henley hatte schon immer gedacht, dass Eastwood genauso aussah und sich auch so bewegte, wie man sich einen Detective vorstellte. Auch jetzt sah sie so aus. Sie hatte die Jackenärmel hochgekrempelt und hatte ein Notebook in der Hand. Sie war gut vorbereitet zum Fluss gekommen, und sie trug eine Jeans sowie Turnschuhe, die schon bessere Tage gesehen hatten.
»Morgen, Eastie. Na? Wie fühlt es sich so an, mal nicht im Büro zu sein?«, fragte Henley, während ihr Blick zu dem Kriminaltechniker wanderte, der gerade einen Arm in einen schwarzen Sack steckte.
»Das sollte ich dich fragen«, erwiderte Eastwood, und ein Hauch von Sorge erschien in ihren Augen.
Henley wusste Eastwoods Mitgefühl zu schätzen, als sie ihr freundschaftlich die Hand auf die Schulter legte.
»Aber da du schon fragst … Furchtbar. Ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand.« Eastwood rieb mit der Hand über die leicht gerötete Stirn. »Die Kriminaltechniker sind gleich fertig. Nicht, dass sie viel zu tun hätten. Einfach eintüten und weg damit.«
»Wo ist Mr. Thomas?«
»Ah, unser illustrer Schatzjäger. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er auf dem Weg zu den Läden. Er hat gesagt, er bräuchte Wasser für seinen Hund. Einer meiner Beamten hat ein Auge auf ihn. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Kerl schon Bilder von seinem Fund auf Instagram hochgeladen hat.«
»Ich will, dass er aufs Revier gebracht wird. Ramouter kann noch mal eine Aussage von ihm aufnehmen. Wenn er ein typischer Schlammkriecher ist, dann war er schon ganz früh hier und hat auf die Ebbe gewartet. Wo genau sind die Arme gefunden worden?«
»Da drüben.« Eastwood zog ihre Sonnenbrille herunter und deutete hinter Henley und zu den Wellen im Kielwasser einer vorbeifahrenden Fähre. Die Flut hatte die Stelle bereits überspült.
»Hat er sonst noch was gesagt?«
»Nur, dass er den zweiten Arm knapp einen Meter vom ersten entfernt gefunden hat.«
»Das ist eine wirklich eklige Spur von Brotkrumen«, bemerkte Henley.
»Das musst du mir nicht sagen, und bevor du nach den Verkehrskameras fragst: Davon gibt es hier zwar jede Menge, aber keine von ihnen ist auf den Fluss gerichtet. Private Kameras sind unsere einzige Chance, aber ich bezweifle, dass wir da Glück haben.«
»Wir wissen ja noch nicht einmal, an welchem Ende des Flusses der Täter begonnen hat.« Henley trat einen Schritt zurück, als die nächste Welle bis fast an ihre Füße rollte. »Vielleicht hat er sich von der Watergate Street bis hierher vorgearbeitet, vielleicht aber auch andersrum, oder …« Sie hielt kurz inne, als ihr Handy klingelte. Sie holte es heraus und ging dran. Nach ein paar Sekunden war der Anruf beendet.
»Das war Anthony. Der Pathologe ist gerade gekommen«, berichtete sie und wischte sich den Schweiß aus dem Nacken.
»Wir haben also zwei Arme, beide Beine und einen Torso«, sagte Ramouter, warf sich das Jackett über den Arm und strich die Falten heraus. »Aber wo ist der Kopf?«
Gute Frage. Henley drehte sich um und ging in Gedanken die Strecke zwischen den Fundorten durch. Da gab es eine Grundschule, zwei Kindergärten und einen Abenteuerspielplatz zwischen den Wohnungen und Häusern. Das Letzte, was sie jetzt brauchen konnten, war ein Kopf in einem Sandkasten.
»Kann ich mal schnell sehen?«, fragte sie die Kriminaltechnikerin, die die Arme gerade weggepackt hatte und jetzt in ihr Notizbuch schrieb.
»Sicher«, antwortete die Frau und legte das Notizbuch auf den Kies.
»Scheiße«, knurrte Henley, als die Kriminaltechnikerin den Sack öffnete und das Plastik auseinanderzog.
»Oh«, sagte Ramouter, als er Henley über die Schulter schaute. Beide blickten sie auf die Arme. Ein Arm war voller Schotter, und Tang klebte an alten Narben. Und der zweite Arm: schmales Handgelenk, der Ringfinger ein wenig länger als der Zeigefinger und gebrochene Fingernägel. Schwarze Haut. Henley erinnerte sich an Pellacias erste Worte.
Es ist allerdings noch zu früh, um zu sagen, ob sie alle zum selben Opfer gehören oder ob wir es mit mehr als einem zu tun haben.
»Rufen Sie DSI Pellacia an«, befahl Henley Ramouter, »und sagen Sie ihm, dass wir es mit mindestens zwei Mordopfern zu tun haben.«
Kapitel 3
Jeder Passant ging ganz natürlich davon aus, dass das Revier von Greenwich geschlossen war. Die blauen Rollläden an der Vorderseite waren seit drei Jahren nicht mehr hochgezogen worden, und zwei einsame orangefarbene Straßenkegel versperrten die Einfahrt zu dem leeren Parkplatz. Ein ausgeblichenes Poster auf einem blauen Notizbrett vor dem weißen Geländer am Fuß der Rollstuhlrampe lenkte alle potenziellen Besucher zum Revier von Lewisham um oder verwies auf die Telefonnummer 101, falls es sich nicht um einen Notfall handeln sollte. Die Einheimischen, die hier vorbeigingen, fragten sich immer, wann man das Gebäude wohl abreißen würde, damit man hier einen Apartmentblock mit Pförtnerdienst für die Reichen und einer Hintertür für die wenigen Glücklichen errichten würde, denen man hier eine Sozialwohnung zugewiesen hatte. Würden die Leute jedoch nach oben schauen, dann würde ihnen auffallen, dass im dritten Stock drei Fenster offen standen, aus denen Zigarettenrauch quoll.
Die Serial Crime Unit, das Dezernat für Serienmorde oder SCU, war vorübergehend im dritten Stock untergebracht, wobei »vorübergehend« hieß, dass die Beamten schon seit sechs Jahren hier saßen. Als die Metropolitan Police noch flüssiger gewesen war, hatte man DCSI Harry Rhimes mit diesem Dezernat belohnt, nachdem sein Team eine Bezirkskrankenschwester mit Namen Abigail Burnley verhaftet hatte, die fünfzehn Menschen auf dem Gewissen hatte, um die sie sich eigentlich hätte kümmern sollen. Serienmörder tauchten jedoch nicht mit schöner Regelmäßigkeit auf, und so beschäftigte sich das Dezernat vornehmlich mit Vergewaltigungsfällen, Einbrüchen, Entführungen und Fällen, die viel zu extrem für die sechsundzwanzig Mordkommissionen waren, die in ganz London verstreut operierten. Sechs Jahre später saß Burnley eine lebenslange Freiheitsstrafe ab, Rhimes war seit acht Monaten tot, Pellacia hatte das Kommando über ein unterfinanziertes Dezernat übernommen, und Henley marschierte mit einem Gesicht wie Donnergrollen auf ihn zu.
»Wie kannst du es wagen …?« Henley hielt Pellacias Bürotür nicht davon ab, mit lautem Knall ins Schloss zu fallen.
»Denkst du nicht, ein wenig Respekt wäre angebracht? Wie wäre es zum Beispiel mit: Wie kannst du es wagen, Chef?«
DSI Stephen Pellacia stand am Fenster. Er drückte seine Zigarette an der Wand aus und warf sie hinaus. Der Stress des Kommandos über die SCU begann sich in seinem Gesicht zu zeigen. Immer mehr graue Strähnen erschienen in seinen braunen Haaren, und die Ringe unter den Augen wurden dunkler und dunkler. Die Euphorie, den Chef spielen zu dürfen, war schon lange verflogen, und Rhimes’ Fehlen hing noch immer schwer in der Luft. Die Blätter des Schreibtischventilators drehten sich träge, schafften es jedoch kaum, durch die schwüle Luft zu schneiden. Henleys Wut trug ihr Übriges zu der Hitze bei. Ihr verschwitztes Baumwoll-Top klebte am Rücken.
»Du hättest mich ruhig vorwarnen können, bevor du mich da rausgeschickt hast, und dann hast du mir auch noch einen verdammten Azubi aufs Auge gedrückt!«, knurrte sie.
»Warum ist das ein Problem? Du hast jetzt fast ein Jahr lang Innendienst gemacht. Ich dachte, du wärst …«
»Das war nie ein Problem.« Henley spie das letzte Wort förmlich aus. »Du bist derjenige, der es für das Beste gehalten hat, mich hinter einen Schreibtisch zu stecken.«
»Und darüber hast du dich jeden Tag beschwert.«
Pellacia kniff die grünen Augen zusammen, und die kleinen Muskeln in seinem Kiefer zuckten vor Anspannung. »Schau mal … Wir drehen uns hier im Kreis, und ich habe keine Zeit, mit dir zu streiten. Wir sind ja jetzt schon spät mit diesem Briefing dran. Es gibt viel zu besprechen, und ich werde im Yard erwartet.«
»Bevor wir anfangen …« Henley atmete tief durch und zählte im Kopf bis drei. »Hast du schon eine Ahnung, wer der leitende Ermittler in diesem Fall sein wird? Je schneller ich den CRIS-Bericht updaten und die Übergabe vorbereiten kann, desto besser.«
»Ja, ja … was das betrifft …«, begann Pellacia, trat um sie herum und griff nach der Tür. »Da gibt es nichts zu übergeben.«
»Was meinst du damit, wir behalten den Fall?«
Die aufgeregte Stimme gehörte DC Roxanne Eastwood. Sie strich sich eine blonde Strähne aus der Stirn und beugte sich auf ihrem Stuhl vor. »Ich dachte, das sei nur eine einmalige Angelegenheit gewesen.«
»Ist es nicht«, erwiderte Pellacia mit fester Stimme und mied Henleys Blick.
Die Angehörigen des Dezernats hatten sich in einem Raum versammelt, der viel zu groß war für das Team. Einst hatten sich die Beamten ihre Arbeitsumgebung mit der Kriminal- und Schutzpolizei geteilt. Das Gebäude hatte vom Hämmern der Verdächtigen widergehallt, die in ihren Zellen auf die Rohre klopften. Jetzt war das Einzige, was man gelegentlich in den Zellen fand, Stanford, der ein Nickerchen hielt. Das gesamte Team bestand nur noch aus Eastwood, Henley, DS Paul Stanford, der gerade auf dem Weg vom Old Bailey war, wo er in einem Vergewaltigungsfall als Zeuge diente, und jetzt auch Salim Ramouter. Das Sagen hatte Pellacia, und der verließ sein Büro heutzutage nur noch selten, es sei denn, er musste sich bei seinen Vorgesetzten in New Scotland Yard melden. Die SCU wurde überdies noch von einem Verwaltungsteam unterstützt, bestehend aus Ezra, einem dreiundzwanzigjährigen Ex-Knacki und Computergenie, den Pellacia unter seine Fittiche genommen hatte, und Joanna. Niemand wusste, wie lange Joanna sich schon in den Polizeirevieren von Südost-London herumtrieb, und es wusste auch niemand, wie alt sie war, doch es herrschte Konsens darüber, dass sie ganz genau wusste, wie viele Leichen die Metropolitan Police im Keller hatte und wo.
»Wir sind ohnehin schon unterbesetzt«, beschwerte sich Eastwood. »Ich arbeite jetzt seit elf Tagen ohne Unterbrechung. Ich hatte nicht einen Tag frei, nicht einen. Und diese Woche müssen wir auch noch auf Stanford verzichten.«
»Das ist mir durchaus bewusst, Eastie.«
»Und als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, da hatten wir sechs laufende Ermittlungen …«
»Sieben«, korrigierte Joanna sie, als sie hereinkam. Sie brachte einen großen Pappkarton mit verschiedenen Frühstücksbestellungen aus dem Café auf der anderen Straßenseite. Sie stellte den Karton auf Eastwoods Schreibtisch. »Es sind sieben, wenn du den Job im Flusstal mitrechnest, bei dem wir …«, sie hob die Hände und machte Anführungszeichen in der Luft, »… bei dem wir beratend tätig sind.«
Henley sah, wie Pellacia sich auf die Zunge biss und Eastwood mit den Augen rollte.
»Schau mal«, sagte Pellacia und klappte den Laptop auf. »Es gefällt dir ja vielleicht nicht, aber die anderen Morddezernate haben keine Kapazitäten mehr frei. Die Ermittlungen bleiben hier. Ist das klar?«
»Jaja.« Eastwood schüttelte den Kopf.
Pellacia drehte sich zu Henley um und forderte sie heraus, ihm zu widersprechen. »Da Stanford im Gericht festsitzt, habe ich beschlossen, dass Ramouter Henley mit diesen Körperteilen unterstützt.«
»Du willst die Zwillinge trennen?«, rief Joanna in gespieltem Entsetzen.
»Ich hatte eigentlich gedacht, es würde Stanford nichts ausmachen, nicht länger Ramouters Mentor und eine Zeit lang von Henley getrennt zu sein.«
»Das glaubst du auch nur«, erwiderte Joanna und fischte ein Wurstsandwich aus dem Karton auf Eastwoods Schreibtisch. »Aber ich weiß ja nicht, was Stanford davon halten wird. Nur um Sie mal aufzuklären, Ramouter: Die beiden sind echt dicke. Stanford ist Henleys Bruder aus einem anderen …«
»Wir haben schon verstanden, Joanna«, fiel Pellacia ihm ins Wort. »Okay … Machen wir weiter.«
Während Pellacia seine Aufgabenliste herunterleierte und die anderen immer wieder müde seufzten, ging Henley im Geiste ihre eigene Checkliste durch. Als Pellacia sie angerufen und auf diesen Umweg geschickt hatte, da hatte sie auf Autopilot geschaltet. Ihr Muskelgedächtnis hatte das Kommando übernommen, als sie am Tatort eingetroffen war. Beobachte die Umgebung. Achte auf Vertrautes und Unvertrautes. Behandle alles als Beweis. Entwickle ein Narrativ. Sichere und schütze. Nach außen wirkte sie ruhig und beherrscht, innerlich hatte sie jedoch das Gefühl, als würde ihr Herz gleich platzen, und ihr drehte sich der Magen um. Ihr Handy vibrierte auf dem Schreibtisch. Sofort machte sich Sorge in ihr breit, als sie die SMS von ihrem Bruder las: War gerade bei Dad. Wollte mich nicht reinlassen. Rufe dich an, wenn ich von der Arbeit komme.
»Nun zu diesem Fall am Fluss …«, sagte Pellacia. »Wir haben es potenziell mit zwei Opfern zu tun?«
»Nicht potenziell, es sind zwei Opfer«, antwortete Henley, während sie ihrem Bruder eine Antwort schrieb. »Torso, Beine und ein Arm gehören zu einem weißen Mann. Der zweite Arm ist jedoch schwarz, und auch wenn ich es noch nicht definitiv sagen kann, würde ich behaupten, er gehört einer Frau.«
Henleys Handy vibrierte wieder. Sie griff danach.
»Und sonst sind keine Teile gefunden worden?«
»Soco hat einen weißen Männerkopf aus einem Container vor 15 Nelson Mews geborgen«, erklärte Henley. »Die SMS gerade kam übrigens von Linh. Die Teile sind in der Leichenhalle.«
»Zwei verdammte Opfer«, sinnierte Pellacia. »Aber man weiß ja nie. Vielleicht wird das ja ein netter, schneller Fall.«
Henley erwiderte nichts darauf. Sie griff einfach nur nach ihrer Tasche, denn sie wusste ganz genau, dass Pellacia das sogar noch weniger glaubte als sie.
Kapitel 4
Das Gebäude, das die Toten beherbergte, war vom Revier aus gut zu Fuß zu erreichen. Es lag direkt an der Hauptstraße, wo Cafés, Pubs und Immobilienmakler langsam funkelnden, neuen Hotels, Apartmentblocks, die sich niemand leisten konnte, und einem Fitnessstudio wichen, das vierundzwanzig Stunden geöffnet hatte. Unauffällig verschmolz es mit den anderen Häusern im georgianischen Stil, die sich die Straße mit den Neubauten teilten. Nun, da sie ihre Uniform trug, fühlte Henley sich schon nicht mehr ganz so fehl am Platze. Die Uniform strahlte Autorität aus. Nur die schwarzen Adidas-Schuhe hatte sie anbehalten. Morgen würde sie sich schon anders kleiden, wenn sie das Haus verließ.
Sie parkte neben einem VW Golf, der hinten einen Kindersitz hatte und dringend mal gewaschen werden musste. Genau wie Henleys A3 war er mit dem feinen braunen Staub bedeckt, der in London zur Sommerzeit stets vom Himmel regnete.
»Greenwich Public Mortuary, die öffentliche Leichenhalle«, las Ramouter das Schild vor und trank seinen letzten Schluck Kaffee. »Das klingt wie eine Bibliothek. Als könnte man da einfach reingehen, seinen Mitgliedsausweis vorzeigen, sich einen Stuhl holen und bei einer Autopsie zuschauen.«
»Wie lange haben Sie noch?«, fragte Henley und ignorierte Ramouters Versuch, seine Nervosität zu verbergen. Sie schaltete den Motor aus und fuhr die Fenster hoch.
»Wie lange habe ich noch für was?«, entgegnete Ramouter, während er darauf wartete, dass Henley die Kindersicherung abschaltete.
»Wie lange haben Sie noch, bis Sie kein Azubi mehr sind?«
»Was Sie wohl wirklich wissen wollen, ist, wie lange Sie mich noch am Hals haben.«
Das Grinsen auf Ramouters glattem braunem Gesicht verschwand rasch, als er sah, dass Henley es nicht erwiderte. »Vier Monate.« Er rieb sich den Bart. »Ich habe noch vier Monate. Ich habe schon sechs Monate in der Mordkommission gearbeitet. Es war gute, solide Arbeit, aber ich wollte etwas mehr Herausforderung, und so etwas wie die SCU gibt es in West Yorkshire nicht.«
»Nun, für gewöhnlich läuft es in der SCU ein wenig anders als in einer normalen Mordkommission oder bei der Kriminalpolizei im Allgemeinen. Es ist sehr selten, dass wir wie jetzt vor die Tür gehen. Für gewöhnlich werden Fälle an uns weitergereicht, wenn es sich vermutlich um einen Serienmörder oder -vergewaltiger handelt. Wenn wir mit unserer Arbeit anfangen, sind die ersten Ermittlungen meist schon abgeschlossen.«
»Aber das ist nicht alles, was die Einheit tut«, sagte Ramouter, während er Henley zu dem Gebäude folgte. »Da war dieser Fall vor ein paar Jahren mit den Serienentführungen, den Menschenhändlern, Operation Willow und auch der Jigsaw-Killer.«
Henley zuckte unwillkürlich zusammen. Der Jigsaw-Killer. Der Fall hatte alles verändert. Sie hatte viel Lob von ihren Kollegen bekommen und eine Belobigung vom Commissioner. Sie war zum Detective Inspector befördert worden, doch wie das Skalpell eines Chirurgen hatte der Fall ihr ein Stück von sich genommen. Es war eine seltsame Mischung aus Stolz und Scham, die dazu geführt hatte, dass alles um sie herum wie Dominosteine umgefallen war.
»Daran zu arbeiten, muss fantastisch gewesen sein«, fuhr Ramouter fort. »Deshalb habe ich mich zur SCU versetzen lassen. Das war der Grund … na ja, einer der Gründe, warum ich nach London gekommen bin.«
Henley drehte sich um und schaute Ramouter an. Sie wusste zwar, dass er nervös war, aber in seinen Augen sah sie auch diese vertraute Aufregung. Drei Monate, schätzte sie, drei Monate, und die Aufregung würde verflogen sein, komplett.
»Lassen Sie sich nicht von den Medien und den Presseerklärungen unserer geschätzten Vorgesetzten täuschen. Die SCU ist unterbesetzt und schlecht finanziert. Tatsächlich bin ich überrascht, dass man Sie überhaupt zu uns versetzt hat. In einer durchschnittlichen Mordkommission wäre es nicht ungewöhnlich, wenn bis zu hundert Leute an einem Fall arbeiten, vom DSI bis hin zu den zivilen Mitarbeitern, aber die SCU, das sind nur wir, und wir verbringen viel Zeit damit, Gefallen einzufordern. Was wir hier tun, ist alles andere als glamourös, und Ruhm ist schnell vergessen.«
Henley drehte sich wieder weg, gab den Zugangscode ein, den sie eigentlich gar nicht haben sollte, und öffnete die Tür.
Chefpathologin Dr. Linh Choi saß an ihrem Schreibtisch mit dem Rücken zur Tür und kauerte über ihrem Mittagessen. Das lange schwarze Haar hatte sie auf dem Kopf zu einem Dutt zusammengesteckt und ihn locker mit einem Stift gesichert. Dabei wippte sie mit dem Kopf im Takt der Bässe, die aus den Bluetooth-Lautsprechern auf ihrem Schreibtisch dröhnten. Henley hatte nun schon seit über fünfzehn Jahren immer wieder mit Linh zu tun. Damals hatten sie beide gerade erst ihre Karriere begonnen und das stete Gefühl gehabt, sich hoffnungslos übernommen zu haben. Im Laufe der Zeit war ihre Freundschaft ganz natürlich immer enger geworden.
»Himmel!«, rief Linh erschrocken. Der Hähnchenschenkel in ihrer Hand fiel in die Box zurück. »Willst du etwa, dass ich einen Herzinfarkt bekomme?«
»Dich packt wohl gerade die Nostalgie. Noch einmal raven so wie früher, hm?«, bemerkte Henley mit einem Lächeln.
»Sag jetzt nicht, dass das nichts für dich wäre. Du liebst das doch genauso wie ich. Ich habe zu Hause einen echt geilen Mix gefunden. Den muss ich dir unbedingt schicken.« Linh regelte die Lautstärke am Laptop herunter. »Du hast mir ja gar nicht erzählt, dass du wieder da bist. Ich musste es von Anthony erfahren.«
»Darüber können wir später reden«, erwiderte Henley.
»Hast du einen neuen Partner? Was sagt denn Stanford dazu?«
»Das ist TDC Salim Ramouter, und er ist nicht mein Partner.« Henley trat zur Seite, um Ramouter Platz zu machen. »Ich bin sein Mentor. Er ist von West Yorkshire hierher versetzt worden.«
»Oh. Ich verstehe. Sie hätten keine bessere Lehrmeisterin bekommen können als DI Henley«, sagte Linh und stand auf. Dann zog sie ein antibakterielles Tuch aus einer Box auf dem Schreibtisch und wischte sich damit die Hand ab, bevor sie sie Ramouter entgegenstreckte.
»Schön, Sie kennenzulernen. Dr. Linh Choi.« Linh hatte die Privilegien einer Privatschule und einer Ausbildung in Cambridge genossen, doch mit ihrem starken Süd-London-Akzent wäre man nie darauf gekommen. Sie ließ Ramouters Hand wieder los und zog die Brille vom Kopf herunter.
»Ich habe deinen Namen oben auf dem Einlieferungsschein gesehen«, sagte Linh und drehte sich wieder zu Henley um. »Ich dachte schon, das muss ein Fehler sein, und wollte dich anrufen.«
»Wie gesagt, ich werde dir später alles erzählen«, erwiderte Henley und ignorierte Ramouters fragenden Blick.
»Aber wie immer ist dein Timing gut«, fuhr Linh fort. »Ich habe gerade die erste Untersuchung von unserem John Doe abgeschlossen. Der Arm … Da war nicht viel, vor allem, da uns ja doch eine Menge fehlt. Ein Kopf, Beine, ein Torso und noch ein Arm wären nett.«
»Kannst du uns denn irgendwas über den Arm sagen?«, fragte Henley.
Linh zuckte mit den Schultern. »Er gehörte einer schwarzen Frau, vermutlich in den Zwanzigern. Mehr kann ich erst sagen, wenn ihr auch den Rest von ihr findet.«
Henley und Ramouter folgten Linh aus dem Büro und durch einen kurzen Flur zu einem Untersuchungsraum, der nicht viel anders aussah als ein OP. Die Luft war kalt, als würden sie in einen Kühlschrank gehen. An der Wand der Tür gegenüber boten Metallschränke Platz für die Toten, während auf der anderen Seite drei große, tiefe Stahlspülen mit einem Kühlschrank in der Ecke standen. In der Mitte des Raums befanden sich vier Untersuchungstische aus Metall. Zwei davon waren leer. Linhs Assistentin Theresa arbeitete am dritten an einer Leiche. Sie trug schwarze Beats-Kopfhörer und schien vollkommen in dem Sound dessen aufzugehen, was auch immer da lief. Henley stieg der beißende Geruch von industriellem Antiseptikum in die Nase, doch so stark er auch sein mochte, er war nicht stark genug, um den säuerlichen Gestank von Körperflüssigkeiten zu übertünchen.
Henley glaubte, Ramouter »Verdammte Scheiße« sagen zu hören, doch die Worte wurden von dem Mundschutz gedämpft, den er genau wie Linh und Henley angelegt hatte. Theresa öffnete gerade die Brust eines jungen, sportlichen Mannes, um sie anschließend mit einem Expander auseinanderzudrücken.
»Das war mal ein dreiundzwanzigjähriger Bodybuilder«, erklärte Linh und schüttelte den Kopf. »Herzinfarkt. Er ist einfach im Studio zusammengebrochen. Ich muss nicht erst einen Toxscreen machen, um zu wissen, dass er voller Steroide ist.«
Ein Geräusch, als würde jemand auf zerbrochenes Glas treten, füllte Henleys Ohren, als Teresa den Brustkorb aufbrach. Das Geräusch hallte von den Metallschränken wider und erfüllte den ganzen Raum. Ramouter wich einen Schritt zurück und schaute zur Tür.
»Das Klo ist durch die zweite Tür links«, erklärte Linh amüsiert, und Ramouter wirbelte herum und rannte los.
»Tut mir leid«, sagte er, als er ein paar Minuten später verschämt wieder zurückkam.
»Ist schon okay«, beruhigte ihn Linh. »Sie waren nicht der Erste, und Sie werden auch nicht der Letzte sein. So … Alle bereit?«
Henley nickte, und Linh zog eine Plastikplane zurück. Die Körperteile, die man am Fluss und in der Einfahrt von 15 Nelson Mews gefunden hatte, lagen sorgfältig arrangiert auf dem Untersuchungstisch wie ein blutiges Puzzle, das jedoch noch nicht ganz fertig war.
»Kannst du uns was zum Todeszeitpunkt sagen?«, fragte Henley.
»Grob geschätzt«, antwortete Linh, »würde ich sagen, vor irgendwas zwischen vierundzwanzig und sechsunddreißig Stunden.«
Henley trat einen Schritt auf den Tisch zu und schaute sich die Tätowierung auf dem Torso einmal genauer an.
»Das ist eine Szene aus Fullmetal Alchemist«, erklärte Linh. Sie klang zufrieden. »Das ist eine Anime-Serie, falls ihr das nicht wissen solltet. Natürlich weit vor Ihrer Zeit«, fügte sie für Ramouter hinzu. »Auf dem Rücken hat er Ken aus Fist of the North Star tätowiert.«
»Was kannst du mir über die Zerstückelung sagen? Fand die vor oder nach dem Tod statt?«, fragte Henley und ging langsam um die Körperteile herum. Sie achtete auf jedes Detail und ignorierte das Handy, das in ihrer Tasche vibrierte.
»Sowohl als auch«, antwortete Linh und trat an den Kopf des Tisches. »Der rechte Arm und das linke Bein wurden zuerst entfernt. Wenn ihr mal hierherschaut …« Sie deutete auf die Stelle, wo das linke Bein abgetrennt worden war. »Die Blutgerinnung hatte bereits eingesetzt. Innerhalb von vier Minuten wäre der Mann tot gewesen, aber wenn ihr jetzt mal auf den Torso schaut …«
Linh hob den Torso an und drehte ihn um. »Seht ihr die Verfärbungen im Fleisch?«
Henley nickte. Das Fleisch sah aus, als hätte es jemand in blaue Tinte getaucht.
»Das nennt man Hypostase. Das Blut in den Kapillaren beginnt, sich zehn Stunden nach dem Tod zu verdicken. Es kann nicht mehr fließen, weil die Schwerkraft dafür sorgt, dass es nach unten sackt. Die Leichenstarre setzt für gewöhnlich vier Stunden nach dem Tod ein, und wenn ihr euch den Hals anschaut, dann ist da so gut wie überhaupt nichts mehr von Gerinnung zu sehen. Also hat der Killer vier Stunden nach dem Tod damit begonnen, die Körperteile abzutrennen. In der Brust gibt es außerdem eine interessante Stichwunde, direkt über dem Herzen. Auch die wurde dem armen Kerl post mortem zugefügt. Ich werde mehr wissen, wenn ich nach dem Mittagessen mit der eigentlichen Autopsie beginne. Eines kann ich euch jedoch jetzt schon sagen: Wer auch immer den Körper zerlegt hat, er hat einen richtig miesen Job gemacht. Schaut.« Linh deutete auf die rechte Schulter des Torsos, wo zwei lange, ausgefranste Schnitte zu sehen waren. »Er hat mindestens zwei Anläufe gebraucht, um den Arm abzutrennen. Es ist fast so, als hätte der Täter noch nie eine Black & Decker-Stichsäge in der Hand gehabt.«
»War es eine Black & Decker-Stichsäge?«, fragte Ramouter. Er stand fast drei Schritte entfernt und mit dem Rücken zu den Spülbecken.
»Woher soll ich das wissen? Dafür müsstet ihr in den Baumarkt und nicht in die Leichenhalle.« Linh schaute Ramouter schelmisch an. »Aber wichtiger noch … Schaut euch das mal an.«
Sie nahm den Kopf und drehte ihn zu Henley. Dann öffnete sie den Mund mit ihren Fingern. »Ramouter, holen Sie mal die Taschenlampe da«, sagte sie. »Ich habe nicht genug Hände.«
Ramouter griff nach der kleinen Stabtaschenlampe und trat zum Tisch.
»Kommen Sie schon. Nicht so schüchtern. Leuchten Sie mal hier rein.«
»Oh mein Gott«, keuchte Ramouter. »Wo ist denn die Zunge?«
Henley nahm ihm die Taschenlampe ab und richtete den Lichtstrahl in den Rachen des Opfers. Der Mund war voller getrocknetem Blut, und sie sah die Reste der Muskeln, die einst die Zunge gehalten hatten.
»Was ist das denn?«, fragte sie.
»Sie ist rausgeschnitten worden«, erklärte Linh. »Und der Schnitt ist ziemlich sauber, entweder von einem sehr, sehr scharfen Messer oder von einem Skalpell.«
»Ist es denn so leicht, jemandem die Zunge rauszuschneiden?« Henley bewegte ihre eigene Zunge im Mund und spürte die vielen kleinen Sehnen, die dort für Bewegung sorgten.
»Wenn das Opfer noch lebt? Das wäre verdammt schwer. Deshalb hätte es ja auch Sinn ergeben, die Zunge post mortem zu entfernen, wurde sie aber nicht.«
»Moment mal … Der Kerl war noch am Leben, als ihm die Zunge rausgeschnitten wurde?«
Linh nickte. »Allerdings ist es verdammt schwer, die Zunge zu packen, während die Person noch lebt, und da der Schnitt so klinisch genau ist, nehme ich an, dass euer Opfer zumindest bewusstlos war. Und noch etwas … Fällt euch etwas an den Beinen auf?«
Henley hockte sich an die Tischkante. Ihr Gesicht war nur noch wenige Zentimeter vom rechten Bein entfernt. Die Schenkel waren voller Sand, Seetang und getrockneter Kotze. Sie waren ausgesprochen muskulös und hatten hellbraunes Haar. Das linke Bein sah genauso aus, nur an der Ferse fand sich ein gut zwei Zoll langes Stück Haut, das deutlich blasser war als der Rest.
»Unser Opfer hatte eine Fußfessel?«, fragte Henley.
»Ich glaube schon«, antwortete Linh. »Wenn ihr mal hierherschaut …« Vorsichtig drehte sie das Bein, sodass man sehen konnte, dass der helle Fleck in etwa so groß war wie eine Streichholzschachtel. »Ich würde definitiv sagen, dass er eine Fußfessel getragen hat. Das hat genau die Maße der Standardfußfesseln.«
»Also war unser Opfer auf Kaution draußen, korrekt?«, hakte Ramouter nach. »Das bringt uns doch schon mal weiter. Wir müssten doch herausfinden können, ob irgendjemand in den letzten Tagen gegen seine Kautionsauflagen verstoßen hat.«
»Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viele Leute gerade auf Kaution draußen sind und eine Fußfessel tragen?«, erwiderte Henley. »Wenn es irgendwo einen Verstoß gegen die Kautionsauflagen gibt, dann haben wir das im System, aber ohne Namen … Das ist wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.«
»Viel Glück damit«, sagte Linh. »Ich habe ihm auch Blut und Urin abgenommen, das Übliche, und es heute Morgen ins Labor geschickt. Hoffentlich habe ich bis Ende der Woche was. So … Was ist mit dem Namen? John Doe ist irgendwie despektierlich. Wie wäre es mit Manga Man?«
Henley holte ihr Handy aus der Tasche und las die Nachricht auf dem Display. Sie stammte von Anthony Thomas. Sie hatten die Fingerabdrücke des Arms überprüft und tatsächlich etwas in der Polizeidatenbank gefunden.
»Manga Man ist nicht nötig«, erklärte Henley. »Darf ich euch Daniel Kennedy vorstellen?«
Kapitel 5
Es war fast acht Uhr abends, als Ramouter seinen neuen Schlüssel in eine Tür steckte, die ihm nicht gehörte. Er hörte etwas durch die dünne Trennwand, das wie EastEnders klang, als er die Treppe des umgebauten viktorianischen Reihenhauses hinaufging. Er öffnete seine Wohnungstür, zog die Schuhe aus, an denen noch immer Dreck klebte, und stellte sie auf die Fußmatte. Als er den Blick durch die kleine Wohnung schweifen ließ, seufzte er. Er war erst vor vier Tagen hier eingezogen. Die Wohnung roch noch nicht nach ihm. Sie roch noch immer nach künstlichem Raumspray und Bleiche. Die Frau, der die Wohnung gehörte, hatte ihm gesagt, er könne sie sich ruhig zu eigen machen. Das hatte gut geklungen, als er nach London gefahren war, um sich die Wohnung anzusehen und die zwei Monatsgehälter Kaution zu zahlen, dazu eine Monatsmiete im Voraus. Und das hatte auch noch gut geklungen, als er zwischen den Umzugskisten in Bradford gesessen und den Nachsendeantrag für die Post ausgefüllt hatte. Doch jetzt war er allein hier. Noch immer standen Kisten ungeöffnet in Küche und Wohnzimmer. Ramouter schaltete das Radio an, um zumindest ein wenig Gesellschaft zu haben. Als er ein Fertiggericht aus dem Kühlschrank holte und mit einer Gabel die Plastikfolie durchstach, fühlte er sich wieder wie in seiner Studentenzeit.
Er schob den Rest der faden Spaghetti Carbonara beiseite und griff nach seinem iPhone.
»Oh, wir haben früher mit deinem Anruf gerechnet. Wir wollten gerade essen«, sagte Pamela, trat von der Kamera weg und wischte sich die Hände mit einem Tuch ab, das genauso auberginefarben war wie die neue Küche. Wie immer war ihr Gesicht perfekt, und nicht ein Muskel rührte sich darin. Sie trug teure Yogakleidung, auch wenn Ramouter wusste, dass Pamela nicht die geringste Ahnung hatte, was ein Sonnengruß war, und vermutlich hielt sie Savasana für eine Teesorte.
»Tut mir leid. Ich wusste nicht, wie lange ich vom Revier brauche. Der Verkehr auf dem Südring …«
»Na ja, vielleicht könntest du morgen ja mal pünktlich gehen. Routine ist wichtig.«
Ramouter biss sich auf die Zunge, um nicht zu sagen: Mord ist kein Job von neun bis fünf.
»Wo ist Michelle? Ich wollte ein wenig Facetime mit ihr, aber sie ist nicht drangegangen.«
»Vermutlich hat sie wieder einmal vergessen, ihr Handy aufzuladen, aber sie ist oben. Das sind sie beide. Sie war müde. Ich bin gleich weg, um die Jungs vom Fußballtraining zu holen. Ich bringe ihr mein iPad.«
Ramouter beobachtete, wie Pamela die Kamera an die Decke richtete, während sie die Treppe hinauf zu einer geschlossenen Schlafzimmertür ging. Sie machte sich nicht die Mühe zu klopfen, sondern drückte die Tür einfach auf. Michelle saß auf der Bettkante. Ramouter lachte leise, als er sah, dass das Zimmer genauso aussah wie seins: überall Koffer und Kisten.
»Michelle. Süße. Alles okay, Liebes? Wo ist Ethan? Wie war der erste Schultag? Ich vermisse dich.« Eine Kombination aus Verlust und Liebe ließ die Worte nur so aus Ramouter heraussprudeln.
»Er ist schon im Bett«, antwortete Michelle und platzierte das iPad auf dem Nachttisch. »Sein erster Schultag hat ihn wirklich angestrengt. Ich habe jede Menge Fotos für dich gemacht.«
»Ich weiß. Hast du schon vergessen? Du hast mir die Bilder heute Morgen geschickt.« Ramouter wurde mulmig, als er die Verwirrung in Michelles Gesicht sah. Früh einsetzende Demenz mit sechsunddreißig. Das sei eine äußerst seltene, genetische Form von Alzheimer, hatte der Spezialist gesagt. Michelles Vater war mit achtundfünfzig daran gestorben, doch der Rest der Familie hatte geglaubt, dass die Krankheit vielleicht eine Generation überspringen würde. Ramouter machte sich große Vorwürfe, weil er all die kleinen Dinge ignoriert hatte, die Vorzeichen: dass sie ihre PIN für den Geldautomaten vergessen hatte oder die Essenslieferung, die sie bestellt hatte. Er hatte die Bestätigung für seine Versetzung zur SCU zwei Wochen vor Michelles Diagnose bekommen. Er erinnerte sich noch gut daran, wie aufgeregt er gewesen war, weil sich nun endlich sein Traum erfüllen würde, für eine Eliteeinheit der Met zu arbeiten. Bradford war ihm viel zu klein geworden, und Michelle hatte ihn voll unterstützt. Sie hatten die Wohnung in Forest Hill gefunden wie auch eine Schule für Ethan, und Michelle hatte ein Vorstellungsgespräch vereinbart, doch die Diagnose hatte alles verändert. Michelles ältere Schwester Pamela war eingesprungen und hatte argumentiert, ihre Schwester bräuchte nun Stabilität und keinen Umzug in eine neue Stadt, wo sie von Freunden und Familie abgeschnitten sein würde. Dem hatte Ramouter nicht widersprechen können. Er hatte noch immer den Entwurf der E-Mail gespeichert, in der er seine Versetzung zur SCU ablehnte. Er war bereit gewesen, sie abzuschicken, doch Michelle hatte Nein gesagt. Das sei eine einmalige Gelegenheit, hatte sie argumentiert. Sie wolle nicht, dass er das bereue, oder schlimmer noch: dass er ihr früher oder später die Schuld dafür gebe.
»Wie war dein Tag?«, fragte Ramouter.
»Mein Tag war okay. Pamela hat mich zum Lunch mit ihren Freunden mitgenommen. Du würdest sie hassen. Und wie war dein Tag?«
»Gut. Die SCU ist ein gutes Team, und mich hat man mit Anjelica Henley auf einen Fall angesetzt. Erinnerst du dich noch an sie? Ich habe dir von ihr erzählt.«
»Die DI?«
»Ja, genau. Die DI«, erwiderte Ramouter, und seine Stimmung hellte sich wieder ein wenig auf.
»Wie ist sie so?«
»Sie ist … äh … zäh. Klug. Ich glaube zwar nicht, dass sie gerne mit mir rumhängt, aber wir stehen ja auch noch ganz am Anfang.«
»Hmmm … Ethan wollte noch aufbleiben, um dir von der Schule zu erzählen …«
Ramouter schaute Michelle an, und die Traurigkeit drohte ihn zu überwältigen. Sie war wieder abgelenkt. Er sah es in ihren Augen. Sie starrte ihn an, als habe sie Schwierigkeiten, ihre Erinnerungen zu bewahren.
Kapitel 6
Henley wusste, dass der Restmüll so um elf Uhr morgens abgeholt wurde. Sie stellte die Einkaufstaschen ab und schaute auf ihre Uhr. 20:26 Uhr. Die blaue Mülltonne blockierte das Zauntor. Ihr Dad hatte das Haus vermutlich den ganzen Tag nicht verlassen. Die Vorhänge an den Erkerfenstern waren teilweise zugezogen. Sie wusste, dass ihre Mum regelrecht angewidert gewesen wäre, hätte sie gesehen, wie das Licht durch die vergilbten Gardinen fiel. Henley zog die Mülltonne zur Seite und öffnete das Tor. Als sie über den kurzen Weg im Vorgarten ging, verfingen sich die Dornen des wuchernden Rosenstrauchs in ihrem Jackett. Unkraut hatte sich einen Weg durch die Spalten zwischen den Pflastersteinen gebahnt. Henley holte einen alten Messingschlüssel aus der Tasche und steckte ihn ins Türschloss.
»Was zum …?«, fluchte sie, als der Schlüssel sich weigerte, im Uhrzeigersinn gedreht zu werden. Sie zog den Schlüssel wieder heraus und hielt ihn ins Licht der Straßenlaterne. Es war derselbe Schlüssel, der schon seit fünf Jahren an derselben blauen Tesco-Clubkarte hing. Sie steckte ihn wieder hinein. Er wollte sich noch immer nicht drehen lassen.
»Dad! Verdammt noch mal!«
Henley bückte sich und zog eine dünne Ausgabe der Gelben Seiten aus dem Briefschlitz.
»Dad! Ich bin’s! Anjelica! Mach die Tür auf!«
Sie hockte sich auf die Fersen und hielt den Briefschlitz mit den Fingern offen.
»Dad. Komm schon … Bitte … Ich will doch nur wissen, ob es dir gut geht.«
»Jaja, alles okay. Geh weg.«
»Nicht, bevor du nicht die Tür aufgemacht hast. Ich habe für dich eingekauft.«
»Lass es vor der Tür stehen.«
»Dad. Bitte. Lass mich dich sehen. Ich verspreche dir auch, dass ich nicht reinkommen werde.«
Henley spähte durch den Briefschlitz und sah Beine, die in einem ausgeblichenen grauen Jogginganzug steckten und sich der Tür näherten. Der Briefschlitz klappte zu, als sie aufstand, und die Haustür ging auf.
»Du solltest mal zum Friseur gehen, Dad.« Das war alles, was sie sagen konnte. Sie hatte ihren Dad, Elijah, seit fast drei Wochen nicht mehr gesehen. Er hatte an Gewicht verloren, und die Haut an seinem Hals hing schlaff herab wie ein zerknittertes Taschentuch. Elijah strich sich übers Haar, das inzwischen mehr weiß als grau war. Henley versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erregen, doch er weigerte sich, den Blick zu heben. Er hielt die Tür fest, sein Körper versperrte den schmalen Spalt und hielt Henley so davon ab, das Haus zu betreten.
»Simon ist doch heute Morgen vorbeigekommen.« Henley legte ihre Hand auf die ihres Dads. »Warum wolltest du ihn nicht sehen?«
»Ich will keinen von euch sehen.«
»Dad. Du musst dir helfen lassen.«
»Ich brauche eure Hilfe nicht. Es geht mir gut.«
»Nein, das tut es nicht. Du brauchst unsere Hilfe. Warum hast du das Schloss ausgewechselt?«
»Um dich und deinen Bruder davon abzuhalten, wann immer ihr wollt, hier aufzukreuzen. Ich bin kein Kind mehr.«
»Das hat auch niemand gesagt. Wir machen uns nur Sorgen um dich.«
»Nun, jetzt hast du mich ja gesehen. Es geht mir gut. Dann kannst du ja jetzt gehen.«
»Dad … Sei doch nicht … Kannst du mich nicht wenigstens eine Minute reinlassen?«
»Ich habe Nein gesagt!«
»Jajaja, ist ja schon gut«, erwiderte Henley und packte die Türkante. »Ich komme nicht rein. Nimm das einfach.«





























