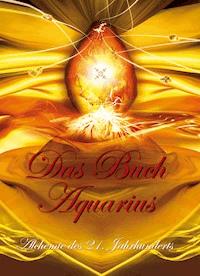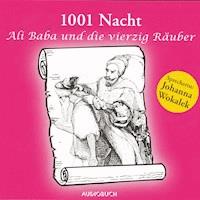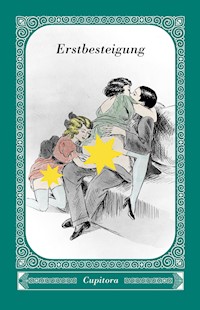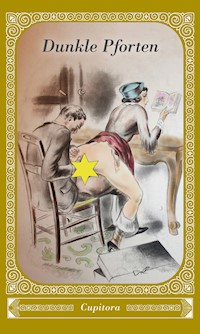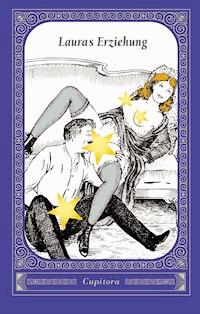Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
In 'Josefine Mutzenbacher: Meine 365 Liebhaber' taucht der Leser tief in die Welt der Erotik des 19. Jahrhunderts ein. Das Buch erzählt die Geschichte von Josefine, einer jungen Frau aus Wien, die in einem Bordell arbeitet und im Laufe eines Jahres 365 Liebhaber hat. Der literarische Stil des Buches ist erotisch, aber gleichzeitig poetisch und ausführlich. Der autor unbekannte Autor schafft es, die verschiedenen sexuellen Erfahrungen von Josefine einfühlsam und detailgetreu darzustellen. Das Buch gilt als Klassiker der Erotikliteratur und bietet einen faszinierenden Einblick in die Welt der Prostitution im 19. Jahrhundert. Der mysteriöse Autor von 'Josefine Mutzenbacher: Meine 365 Liebhaber' bleibt anonym, was die Leser dazu verleitet, über die möglichen Beweggründe für das Schreiben dieses Buches zu spekulieren. Es wird vermutet, dass der Autor ein Insider der Wiener Unterwelt war oder zumindest über genaue Kenntnisse der damaligen erotischen Szene verfügte. Diese Authentizität spiegelt sich in der detaillierten Darstellung der Charaktere und Schauplätze wider. Es bleibt jedoch ein Geheimnis, warum der Autor seine Identität nicht preisgab. 'Josefine Mutzenbacher: Meine 365 Liebhaber' ist ein Buch, das den Leser mit seiner sinnlichen und provokativen Erzählweise fesselt. Für Liebhaber der Erotikliteratur und historischen Romane bietet dieses Werk einen einzigartigen Einblick in die Welt des 19. Jahrhunderts. Trotz seines tabulosen Inhalts hat das Buch auch eine tiefergehende Botschaft über die Freiheit der Liebe und die Vielfalt menschlicher Beziehungen. Es ist ein lesenswertes Werk für all jene, die bereit sind, sich auf die Welt der Josefine Mutzenbacher einzulassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josefine Mutzenbacher: Meine 365 Liebhaber
(Klassiker der Erotik)
Books
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Das Tagebuch, das Josefine Mutzenbacher über ihre Kindheit und die ersten Wochen ihres Dirnenlebens führte, wurde vor einer erklecklichen Reihe von Jahren veröffentlicht. Zeit ihres Lebens hat Josefine Mutzenbacher sich geweigert, ihre weiteren Aufzeichnungen über ihre Erlebnisse zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.
Erst jetzt ist es gelungen, dieses Buch an Reichhaltigkeit des Inhaltes den ersten Teil weit überbietende Tagebuch aus ihrem Nachlaß zur Veröffentlichung freizubekommen und dadurch der interessierten Leserschaft nicht nur ein unverschminktes menschliches Dokument von einmaliger Echtheit und Eindringlichkeit zu bieten, sondern die Lebensgeschichte und Liebesgeschichten der Josefine Mutzenbacher völlig zum Abschluß zu bringen.
Die als Eintänzerin tätige Nichte der Josefine Mutzenbacher hat diesen zweiten versiegelten Teil des Tagebuches aufgefunden, als sie die Briefschaften und schriftlichen Aufzeichnungen der einst so lebenstollen Pepi-Tant’, die als geachtete Bürgerin gestorben war, sichtete. Wohl stand auf dem dickleibigen Päckchen, das die vergilbten Tagebuchaufzeichnungen enthielt, »Nach meinem Tode zu verbrennen«, aber das junge Mädchen war viel zu neugierig, als daß es diesen Wunsch ohne weiteres erfüllt hätte. Und als sie die Schilderung der Erlebnisse von Josefine Mutzenbacher gelesen hatte, schien ihr dieses Manuskript viel zu prickelnd und aufreizend, als daß sie sich von ihm hätte trennen und es dem Feuer überantworten wollen.
Dieses neue Tagebuch, das den unmittelbaren Anschluß an den Lebensabschnitt darstellt, den Josefine Mutzenbacher in ihrem bekannten ersten Tagebuch schilderte, konnte aber nur durch besondere Müheaufwendung zur einmaligen Veröffentlichung gelangen. Denn es gab viele Bedenken der nunmehrigen Besitzerin zu zerstreuen, ehe sie ihr Einverständnis zur Veröffentlichung dieses neuen Tagebuches gab.
Mit der Edierung dieses Werkes legten sich die Herausgeber selbst die Verpflichtung auf, alle Maßnahmen zu treffen, die die Verbreitung des Buches auf den engen und ausgewählten Kreis der Mitglieder beschränken und insbesondere jede Zugänglichmachung an Jugendliche auszuschließen. Auch wurde durch entsprechende Maßnahmen volle Gewähr gegen jeden Mißbrauch dieses dokumentarisch gewiß höchst belangvollen Werkes geschaffen.
Der neue Freund
Es hat mir immer Spaß gemacht, sowas wie ein Tagebuch zu führen. Es macht einem viel Freude, solche Sachen später einmal durchzulesen und sich manches in die Erinnerung zurückzurufen. Man sieht, wie man älter und gescheiter wird — manche werden freilich nie gescheit — und muß manchmal lachen, wenn man an allerhand komische Begebenheiten erinnert wird. Und wenn man von Zeiten liest, wo es einem schlecht gegangen ist, freut man sich, das das längst vorbei ist. Und man sieht immer wieder, daß das alte Wort: »Durch Schaden wird man klug« wahr ist. So hab ich denn von Zeit zu Zeit mich hingesetzt und allerhand aus meinem Leben aufgeschrieben und heut als Alte — jaja, als Alte — les ich ganz gern meine eigene Lebensgeschichte durch. Diese Blätter aber sollen nach meinem Tod verbrannt werden. Ich habs zu meinem eigenen Vergnügen aufgeschrieben und nicht für andere Leute, auch für meine nächsten Verwandten nicht. Ich hab so gelebt, wie meine Natur es mir vorgeschrieben hat und hab mich immer bemüht, keinem Menschen weh zu tun. Eine »Bisgurrn«, wie man in Wien sagt, bin ich glaub ich nicht gewesen und man hat sich mit mir gut vertragen können. Das es in meinem Beruf oft Streitereien und Tratsch und allerhand Schererei gibt, ist ja leider wahr, aber ich war nie nachträglich und bin meist selbst dabei gut gefahren. Die Männer haben sich bei mir gut unterhalten und brav gezahlt und oft hab ichs auch umsonst getan, denn ich hab immer gern gevögelt. Ein paarmal war ich nah dran, mich verhauen, hab mich aber immer noch rechtzeitig »derfangen«, wie man in Wien sagt. Das alles les ich aus meinem Tagebuch heraus. Aber es ist nicht dazu da, damit andere sich daran aufgeilen, meiner Seel, nein. Wenn wer sein Vergnügen haben will, so soll er selbst vögeln. Ich hab für mich gevögelt und hab es schön gemacht. Aber von Vögeln lesen, das hat eine wie ich nicht nötig. Wenn man überstandene Remmeleien liest, das kommt mir immer so vor, wie ein aufgewärmtes Essen. Da ist es mir auch lieber, wenn mein Tagebuch verbrannt wird, es geht keinen was an.
Ich hab schon erzählt, wie ich von unserm Mieter und seiner Geliebten »abgerichtet« und auf den Strich geführt worden bin. Sie haben mich brav angelernt und ich hab mit meiner Freundin viel erlebt. Jeden Tag hab ich was Neues gesehen und sie hat mir alles erklärt und ich hab alles schnell begriffen, denn ich war immer gern eine Dirne, so komisch das vielleicht klingt. Ich glaube, es ist besser, das zuzugeben, als wenn eine weiß Gott wie heilig tut, wie eine Betschwester und im geheimen vögelt sie ärger als unsereine, die schließlich davon leben muß. Leicht ist das Geschäft wirklich nicht und manchmal muß man sich schon zusammennehmen, daß man dem Mann nicht zeigt, wie er einem graust. Fast jeder hat besondere Wünsche und Kleinigkeiten, die er gern hat und wenn eine das vom Anfang an spürt, zahlt er gern recht nobel. Nicht nur in der Fummel, auch in den Fingern und in der Zunge und eigentlich überall muß man des Gefühl dafür haben, was so einem Mannsbild gut tut. Und wenn man sowas macht um sein Brot damit zu verdienen, darf man eben nicht auf sein eigenes Vergnügen schauen. So ein Mannsbild liegt auf einem, stoßt und sticht und bohrt und keucht vor Geilheit und wenn er fertig ist, brummt er manchmal noch. Ich hab mir immer auch was fürs Herz ausgesucht, auch wenn das nur so zwischendurch war. Hab ich ein recht schäbigen, schiechen und ekelhaften Kerl bedient, hab ich womöglich noch am selben Abend mit einem Feschen gepudert, damit ich wieder »auf gleich komm«. Hübsch war ich und jung und nicht auf den Mund gefallen und hab immer dabei noch allerhand Witze gemacht, das haben viele gern. Wenn sie mich haben ausfragen wollen, woher ich bin, was meine Eltern sind und so, bin ich immer ausgewichen. So blöde Schwindelgeschichten, wie die Mädeln sie oft erzählen, hab ich mir nie erfunden. Meinen Vater hab ich unterstützt, so lang es gegangen ist. Wie ich anfing, mehr Geld zu verdienen, hab ich ihm nicht alles gegeben, sondern hab mir langsam nach und nach allerhand hübsche Sachen zum Anziehen gekauft, wie meine Freundin es mir geraten hatte. Auch gutriechende Seife und Parfüm hab ich damals gehabt und wenn mein Vater fragte, woher ichs hab, hab ich gesagt, ich hätt mit einem gevögelt, der ein Geschäft für solche Sachen hat. Und der hätt mirs aus Dankbarkeit geschenkt. Denn mein Vater hätt mir alles weggenommen, er maulte schon, wenn ich ihm im Tag nicht mehr als zwei Gulden gab, dabei hatten wir früher oft nicht einmal zu essen gehabt. Jetzt aber glaubte er, es müßten ihm die gebratenen Tauben ins Maul fliegen und kam immer mehr ins Saufen. Was ich ihm brachte, trug er ins Wirtshaus, Arbeit suchte und fand er keine mehr und kam recht herunter. In den Wirtshäusern frozzelten sie ihn und zogen ihn mit mir auf. Sie sagten, es sei doch schön, wenn die Tochter so für den Vater sorge und hätt mans nicht, so tät mans nicht. Mein Vater war meist angetrunken damals und so wurde er einmal rabiat und haute einen, der wieder was auf mich sagte, mit dem Bierkrügel auf den Kopf. Es entstand eine schreckliche Rauferei, mein Vater kam blutig und zerschunden und mit ganz roten Augen vor Wut nach Hause und machte mir einen Riesenwirbel. Ich hab ihn immer gern gehabt und hab ihm nichts nachgetragen, wenn er sich auch an mir vergangen hatte und mir das Geld abnahm. Aber was zu viel ist, ist zu viel und so bin ich paar Tage darauf ausgezogen und hab mir ein kleines Zimmer am Alsergrund genommen. Dort war ich allein und konnte mit meinem Geld ganz gut leben. Ich hatte die ewigen Sticheleien und Streitereien satt. Mein Vater kam ein paarmal, traf mich aber zum Glück nicht zu Haus und zweimal schrieb er mir und einmal schickte er einen Burschen mit einem Zettel, ich solle doch nach Haus kommen. Das tat ich aber nicht, dafür schickte ich ihm öfters ein paar Gulden. Verhungern lassen konnte ich ihn auch nicht. Ich erfuhr nur hie und da, von Bekannten und früheren Freunden aus unserer Gegend, daß er sich in allen Gasthäusern herumtrieb und auf mich schimpfte und die Leute sich einen Wurstl aus ihm machten und das tat mir doch weh.
Wir waren damals unser sechs, lauter junge, hübsche Hurln, die wohl aufs Geld sahen, aber oft auch allerhand Unsinn trieben, wie die Backfische. Ganze Abende und ganze Nächte lang saßen wir in einem Gasthaus oder in kleinen, billigen Kaffeehäusern, tratschten, richteten die Männer aus, machten sie nach, schimpften, wenn einer eine von und »geblitzt« hatte und halten einander brav aus, wenn eine einmal gar kein Glück gehabt hatte. Wir waren jung und frisch und lustig und billig waren wir auch, für einen oder zwei Gulden nahm uns mancher mit ins Bett, zwei kleine aber saubere Hotels waren gleich in der Nähe. Im Sommer saßen wir vor dem Wirtshaus hinter Oleanderhecken, die der Pikkolo uns immer bequem zusammenrückte. »Schanigarten« heißen diese Efeu-oder Oleandersträucher in Wien und wir hatten unseren eigenen Stammplatz, das wir das »Hofdamen-Salettel« nannten. Dort saßen wir bei einem Viertel Wein oder einem Glas Bier und tratschten Stundenlang. Manchmal gingen Männer vorbei, streckten einen Finger durch das Blattwerk und kitzelten eine von uns oder winkten. Oder sie streckten den Kopf über den Schanigarten zu uns herein und sprachen uns an, oft recht lustig. Einmal fragte einer: »Bittschön, bin i da recht beim Cäcilienverein?« Dann gab es immer ein großes Gelächter und die, die er wollte, stand auf, nahm ihr Tascherl, sagte: »Kinder, i geh mich trauen lassen« und verschwand mit dem Mann. Wir winkten ihr nach und riefen allerhand Frozzeleien, eifersüchtig oder neidig war keine von uns, jeder gönnte der ändern was, wir waren noch jung und lustig, freuten uns an unserer eigenen Hübschheit und ließen den Herrgott einen guten Mann sein. Manchmal begannen wir schon am frühen Nachmittag nach den Männern auszusehen, mußten uns aber dann mehr in den stillen Seitengassen aufhalten, um nicht aufgeschrieben zu werden. Und manchen schnell verdienten Gulden haben wir denn in den Kaffeehäusern und beim Zuckerbäcker vernascht. Oft lud eine alle andern zur Jause ein. Wenn eine mit einem Mann ging, war sie bald wieder da, kaum daß es eine halbe Stunde dauerte. Wir trugen alle nur ein dünnes Hemd unter unseren lichten, bunten Kleidern, nackt waren wir also bald und der Mann, der meist vom Geschäft nach Haus ging, kam bald zu seinen Schätzen. Sie wollten ein kleines Vergnügen haben, bevor sie zu ihrer Alten heimgingen und zahlten ganz gern eine Kleinigkeit. Oft brachte eine noch Zigaretten mit, die ihr einer geschenkt hatte und dann wurde geraucht. Mir schmeckte das nicht besonders, aber einen Schluck hab ich immer vertragen. In der Beziehung hab ich immer auf mich acht gegeben, denn Rauchen und Saufen und nächtelang aufbleiben und im Rauch herumhocken, ruiniert viel mehr, als das Stoßen und Pudern. Eine war bei uns — Steffi hat sie geheißen — die konnte alle Männer wunderbar nachmachen, besser als eine gelernte Schauspielerin. Sie konnte nachmachen, wie der Wirt blinzelte, wenn eine von uns stier war und »aufschreiben« lassen mußte, sie machte eine bissige Zimmerfrau, sie böhmakelte, konnte so bellen, daß der Wirtshaushund rebellisch wurde und am schönsten machte sie, wie die verschiedenen Männer beim Verkehr keuchten und schnauften und grunzten. Kam eine von uns aus dem Hotel zurück, so fragte sie die Steffi, wie der Mann ausgeschaut habe, mit dem sie gepudert hätte und dann machte sie uns alles vor, jeden Seufzer, jedes betrunkene Wort und die, die gerade von dem Mann kam, quietschte vor Lachen, weil alles so gut stimmte. Die Steffi brauchte einen Mann nur anschauen und wußte schon, wie er im Bett war. Dabei ging sie selbst nicht einmal oft mit, denn sie war ein rassiger, schwarzer Kerl und bekam immer mehr wie wir. Sie verstand es eben. Manchmal, wenn es schon recht spät war und jede von uns genug verdient hatte, gingen wir eingehängt durch die Nebengassen spazieren, sechse in einer Reihe und ließen keinen Mann durch. Wir sperrten ihm den Weg ab, trieben ihn in irgend einen Winkel und machten Blödheiten mit ihm, machten ihn durch allerhand Witze geil, zupften ihn am Schwanz und kitzelten ihn und stellten uns alle miteinander, als ob wir riesig auf ihn fliegen möchten und geil wie die Männer sind, glaubten sie uns meistens und gifteten sich dann schrecklich, wenn wir sie einfach stehenließen. Meist machte die Steffi die Anführerin, sie sprach den Mann an, während wir anderen ihn umringten, sie verdrehte komisch die Augen, stöhnte und seufzte und miaute wie eine Katz: »Schöner Jüngling, gehst schon nach Haus? Mir sind vom Hofopernballet und suchen eine Stellung!« Dann sagte eine andere: »Ja und fesch san mir auch alle, scheuen S’ nur, alles ist da…« Und jeder »schaute« gern und griff und filzte uns alle sechs der Reihe nach ab, es war dann immer schon recht dunkel und wir zeigten ihm unsere jungen, spitzen Tutterln mit den rosige Warzerln. Waren wir recht gut aufgelegt und weit und breit kein Wachmann in der Nähe, dann durfte der Mann auch unten nachschauen und sie bekamen ganz butterige Augen, wenn wir jungen Dinger unsere leichten Kitterln hoben und unsere Fummeln zeigten, schwarze und braune. Die eine von uns, die Fini, hatte sogar ganz blonde Schamhaare und dann sagte die freche Steffi: »Bei der Fini kost’s das Doppelte, das is a Rarität!« Wenn uns die Männer abgriffen, drehten und wanden und schubsten wir uns und quietschten und taten »gschamig« und die Steffi sagte ganz ernst: »Ja, das san no lauter Jungfrauen, die schenieren si halt!« Und war dann der Mann von der Filzerei so geil geworden, daß es ihm fast das Hosentürl aufriß, sagte auf einmal die Steffi: »Jessas, scho so spät, jetzt muß i die Mädeln z’Haus begleiten, sonst schimpft die Mami!« Oder sie sagte: »Alsdann, küss die Hand Herr Doktor, jetzt müssen wir in die Tanzstund!« Dann liefen wir lachend und kreischend davon und ließen ihn mit seinem aufgegeilten Schwanz stehen. Manche schimpften uns nach, dann blieben wir ihnen nichts schuldig, streckten ihnen die Zunge heraus und Steffi hat manchem den Popo gezeigt. Viele Männer traten dann, wenn wir sie so abblitzen ließen, unter ein Haustor, um sich einen herunterzureißen, denn mit so steifen Zumpeln wollten sie doch nicht schlafen gehen. Dann lief manchmal die Steffi zurück, stellte sich neben ihn und sagte: »Erlauben schon Herr Doktor!« Und nahm den starren Schwanz in die Hand und nach ein paar Griffen kam es ihm schon. Die Steffi hatte das so, mit dem schlappsten Schweif konnte sie in einigen Augenblicken fertig werden. Dann kam sie zurückgelaufen, schüttelte mit einer Handbewegung den kalten Bauern von ihrer Hand und sagte: »No alsdann, wieder a Kind weniger! Zu was soll er sich denn so plagen. Die Steffi tut ganz gern wem an G’fallen.« Das war eine lustige Zeit, Geld hatten wir immer ausreichend und waren frech und übermütig. Die eine von uns, die Poldi, konnte dichten und ganz lustige, manchmal recht ordinäre Verserln machen und dichtete uns jeder einen Vers, den wir den Männern aufsagten, wenn sie uns nach unsern Namen fragten. Zum Beispiel: »I bin die fesche Mizi — und wann mi schleckst, so spritz i!« Oder: »I bin die Stefanie — die pudert dir als wie!« Ich hatte das Verserl: »I bin die Josefin — und hab ihn so gern drin!« Mit solchen Verserln vertrieben wir uns auch die Zeit und immer hatte die Poldi neue. Und die Männer, die uns so am Abend ansprachen, wurden durch diese Verse noch mehr aufgegeilt und kamen schon ganz steif beim Hotel an. Einmal hab ich ein merkwürdiges Erlebnis gehabt. An einem schöner Sommervormittag — ein Sonntag war es — ging ich allein in einem netten Kleiderl spazieren. Ich war recht weit die Hernalserhauptstraße hinaufgegangen und auf dem Weg nach Neuwaldegg, als mich einer ansprach. Er war nimmer ganz jung, aber ganz fesch und hatt so merkwürdige, ganz blaue und kalte Augen. Ich wollte ihn erst stehen lassen, dann am Sonntag hatte ich gern meine Ruhe, aber er sagte, es würd mir nicht leid tun und er wolle gar nichts besonderes. Also ging ich halt mit ihm und wir nahmen ein gutes Gabelfrühstück in der »Schwarzenberg-Meierei«. Dann hängte er sich in mich ein und führte mich zärtlich, wie einer seine Braut führt. Die Leute, die uns entgegenkamen, schmunzelten und einer sagte halblaut: »Die gehen a nimmer weit!« Auf einer Waldlichtung machte er halt und fragte: »Willst du meine Jungfer sein?« »Möchten schon,« erwiderte ich lachend, »aber da sind Sie a bissel zu spät kommen!« Er runzelte die Stirn und sagte: »Das will ich aber. Du mußt jetzt da herumgehen und Blumen pflücken. Und ich komm auf einmal und bau dich hin und puder dich. Du mußt dich recht wehren, aber schreien darfst nicht! Hörst du?« Mir erschien diese Komödie blöd und häßlich, aber er redete mir lang zu und gab mir schließlich fünf Gulden im voraus. Also tat ich ihm den Gefallen. Er ging hinter einen Baum und ich ging hin und her, wie wenn ich allein war und Luft schnappen wollt. Dabei hatte ich ein bissel Angst. Auf einmal sprang er auf mich los und packte mich um die Hüften, daß mir alle Rippen krachten und ich glaubte, jetzt werd ich ohnmächtig. Dabei sah ich sein entstelltes Gesicht dicht vor mir, die Augen waren ganz starr und wild, der Speichel tropfte ihm aus dem halboffenen Mund und er stammelte halbverständliche Worte. Ich wußte ja, daß das alles nur Komödie war und daß er dafür zahlte, ein Mädel »vergewaltigen« zu können. Aber er war so grauslich und grob, daß ich einen Riesenschreck bekam und ich schlug ihn mit beiden Fäusten ins Gesicht, so stark ich konnte. Aber es war, wie wenn er nichts gespürst hätte. Er biß sich in meine linke Brust fest und preßte mir, als ich schreien wollte, die Hand vor den Mund, als ob er mir alle Zähne eindrücken wollt. Er hatte eine Riesenkraft in sich und war wie verrückt. Mit dem linken Arm drückte er mich so ins Kreuz, daß mir schwarz vor den Augen wurde und warf mich ins Gras und fiel schwer und hart auf mich. Jetzt wehrte ich mich wirklich und er riß an meinem Rocksaum und zwei Knöpfe sprangen mir von der Bluse ab, so wild war er. Dann rauften wir uns im Gras herum, vielleicht drei Minuten lang. Es war ihm gelungen, meinen Schoß aufzureißen, aber ich preßte die Schenkel mit aller Kraft zusammen und schlug ihm ins Gesicht. Dann hielt er meine Hände wieder fest und zwängte seine Knie zwischen die meinen und alles tat weh. Endlich war er so weit und schwitzend und keuchend lag er auf mir, daß ich fast erstickte. Lange Zeit stieß er in mir herum und es wollte und wollte ihm nicht kommen, weil ich ihn auch in die Eier gestoßen hatte. Das Vögeln tat ihm weh, er stöhnte und wimmerte und wurde ganz blaß, als er endlich ein paar Tropfen spritzte. Seine Stimme war ganz heiser und wild und gemein, als er schadenfroh mir ins Gesicht zischelte: »So du Mistviech, du Flitscherl, du Fetzen, jetzt hast es… ja, das kommt heraus bei den Ausflügen… ja, die Frau Mama wird sich wundern, daß du mit so an Bauch nach Haus kommst. Halt, schön aufpassen … sonst hat das Kleine kan Papa net… aaaaah … mhhh … kchchch!« Dann rollte er von mir herunter und lag da wie tot, ich bekam einen Riesenschreck und rüttelte ihn. Zum Glück waren die ganze Zeit keine Leute vorbeigekommen! Unsere Kleider waren ganz zerdrückt und voller Grasflecken. Als er wieder halbwegs bei sich war, gab er mir zehn Gulden und ging dann nach der andern Richtung davon. Mir war noch immer ganz schlecht und voller Wut war ich auch. Aber dann kaufte ich mir ein »Kracherl« und es wurde mir besser und als ich weiter in den Wiener Wald hineinging, verging auch der Schrecken und der Ekel und ich bemühte mich, alles zu vergessen. Als ich am Abend in einer kleinen Heurigenschank in Dornbach saß, bedachte ich, daß er ekelhafte Kerl — zum Glück gibt es nicht gar zuviele solche — mir immerhin 15 Gulden gegeben hatte. Dafür kaufte ich mir einen hübschen Schirm aus Spitze, ließ mir einen Hut schön herrichten und schaffte mir »Goldkäferschuherln« an, wie man sie damals trug. So sah ich zum Anbeißen aus und ging ein paarmal in den Prater hinunter, wo man in der Hauptallee sehr nette Bekanntschaften machen konnte. Jetzt wollte ich einmal nobel sein, ich ging nicht mit jedem, nur wenn mir einer auch ein bisserl gefiel. Ansprechen ließ ich mich schon, aber immer in stilleren Alleen und wenn er mir nicht paßte, sagte ich an der nächsten Ecke, mein Bräutigam warte auf mich und ließ ihn einfach stehen.
Mein erstes, richtiges längeres Verhältnis hab ich damals kennengelernt. Alexander Feringer hat er geheißen, ein schwerreicher Selchermeister. Er war ein urwüchsiger, echter Wiener vom »Grund«, viel gutes Benehmen hab ich bei ihm nicht lernen können, aber Humor und Witz und Geld hat er gehabt und hat mir nie was abgehen lassen. Er war auch jähzornig, aber ich hab ihn behandeln können und wir haben uns glänzend vertragen. Ich war recht weit übers Lusthaus hinausgegangen und wollte eigentlich keine Bekanntschaft mehr machen. Müd war ich auch und so sah ich mich überall nach einem Wagen um. Da tauchte auf einmal ein leichter, fescher, kleiner »Gummiradler« auf, der Wagen und der Fuchshengst, der ihn zog, spiegelten ordentlich in der Sonne! »Fahr ma, schöns Fräuln?« Der Kutscher lüftete lachend seinen schalrandigen Zylinder, den »Schmalranftler«. Das war eine ganz lustige Art, eine Dame anzusprechen. Natürlich wußte ich gleich, daß das kein Mietsfiaker war, denn wenn der Fiaker auch recht rund und breit und rot war, das sah man gleich, daß er sein eigenes »Zeugl« fuhr. Er sah sehr fesch und »zünftig« aus, mit dem angegrauten Schnurrbart im roten Gesicht. Auch die breite, kurze, gutmütige Nase war rot. Ja, vertragen hat er viel, der Xandl. Wein und das andere auch! Ich stellte mich dumm und sagte ganz fein und doch dabei frech: »Zum Praterstern!« Da war er auch schon vom Bock herunter, packte mich einfach um die Taille und auf eins-zwei war ich am Bock oben. Er breitete eine schöne, schottische Decke über unsere Knie, schnalzte mit der Peitsche und das Roß setzte sich in einen leichten Trab. Ich wollte der Hetz halber noch ein wenig die »Feine« spielen und fragte recht von oben herunter: »Was kriegen Sie denn bis zum Praterstern?« »No, was Sie halt den andern a geben, gnä’ Frau!« Da mußte ich wider Willen lachen, denn diese Redensart der Fiaker war hier recht g’spaßig angebracht. Natürlich hatte er es längst heraus, was ich den andern »gab«. Wir wußten jetzt beide, wie viel es geschlagen hatte. Es hatte aber noch ganz was anders geschlagen, denn als gerade niemand in der Nähe war, griff er auf einmal unter die Decke und zwickte mich! Da holte ich aber aus und gab ihm eine Ohrfeige, daß das Pferd die Ohren spitzte. Er bekam ganz kugelrunde Augen, rückte seinen Zylinder, der auf das linke Ohr gerutscht war zurecht und sagte zum Pferd: »Gelt Schackerl so hauen kannst nat amal du?« Wir lachten beide und waren wieder versöhnt. Dann fing er an zu erzählen. Als er in der Hauptallee vor dem »Zweiten Kaffeehaus« das Pferd mit einem kräftigen »Brrr« zum Stehen brachte, wußte ich schon recht viel von ihm. Er hieß also Alexander Feringer, hatte auf dem Lerchenfeld eine große Selcherei mit zwölf Gehilfen und Lehrbuben im eigenen Haus, war 52 Jahre alt und seit vier Jahren Witwer. Seine Frau war recht bösartig und keifig gewesen, er trauerte ihr nicht sehr nach, wollte aber auch von einer neuen Ehe nichts wissen, denn — »no amal hupft er net eina… der Xandl!« Da hatte ich es ja fein getroffen, von den Selchern ist noch keiner arm gestorben. Er erzählte mir vertrauensvoll und mit einem pfiffigen Blinzeln, daß ihn der Witwerstand gar nicht drückte, er sei gar nicht »aus der Übung gekommen« und könne noch allerhand brauchen. Ich fragte ihn, ob ich jetzt rot werden müßte und er lachte dröhnend. Dann kriegten wir ein kleines Tischerl in einer stillen Ecke und eine sehr feine Jause. Dem Pferd brachte ich ein paar Stückerln Brot hinaus. Es schnoberte an meiner Hand und ich tätschelte ihm seinen schönen, glänzenden Hals und die weiche Schnauze. Daß ich Tiere gern hatte, gefiel dem Feringer ganz besonders und er sagte, wer für Tiere ein Herz hätte, ließe auch den Menschen »was zukommen«. Ich zeigte ihm nur meine Hand, als ob ich ihm wieder eine herunterhauen wolle und er sagte nur: »Uj jessas!« Nach der Jause — er hatte immerfort unterm Tisch probiert, meine Knie zwischen seine einzuzwicken — wollte ich unbedingt, er solle mich wirklich am Praterstern absetzen. Ich wußte natürlich genau, wie weit es war, denn als er mich zum Nachhausfahren auf den Bock hob, streifte ich wie zufällig an sein Hosentürl, das straff war, als wäre dahinter ein Gaskandelaber. Aber zum Spaß sperrte ich mich noch immer ein bisserl und verlangte, während er den Wagen langsam nach Lerchenfeld lenkte, an jeder Straßenecke, er solle mich absetzen. Der Xandl war geil wie ein Stier und bettelte wie ein kleiner Bub: »Nur auf ein Schalerl Kaffee, Herzerl, wirst sehen, i wer brav sein als wie ein Klosterbruder!« Xandls Haus lag ganz still, es war Sonntagnachmittag und alles war weg. Als er die Wohnungstür aufsperrte, tat ich als wolle ich weglaufen, aber er packte mich mit seinen eisernen Pratzen um die Hüfte, drin war ich und die Tür versperrt auch schon! Und er wollte mich jetzt gleich, auf der Stelle, wie ich war, vögeln! Er ließ sich im halbdunklen Vorzimmer auf ein Fauteuil fallen, daß es krachte, preßte mich mit dem Rücken zu ihm zwischen seine Schenkel, riß mir die Schoss hoch und begann, keuchend an meiner Spitzenhose zu basteln. Er war aber ungeduldig und ungeschickt und riß sie mir endlich fluchend herunter. Dann ließ er seinen ungeduldigen Schwanz aus dem Hosentürl springen! So etwas wie Xandls Zebedäus hab ich selten gesehen. Riesig groß und braun-rot und dabei gekrümmt wie ein Kipfl und unerhört dick! Ich wußte gar nicht, wie ich dieses Trumm in mir unterbringen sollte, noch dazu war Xandl so aufgeregt, daß sein Großer schon beim Herausnehmen spritzte! Blitzschnell reckte ich meinen Allerwertesten heraus, Xandl fädelte geschickt ein und so erwischte ich glücklich noch einen Teil seiner Ladung und das war meiner Seel auch nicht wenig. Dann schlug ich die Hände vors Gesicht und tat »g’schamig«. Xandl ließ seinen großen Bruder ruhig draußen, trotzdem er gerade gespritzt hatte, fiel er noch lange nicht zusammen, Xandl mußte rein aus Eisen sein. Er nahm mich von rückwärts an den Brüsten, drängte seine heiße Nudel an mich und schob mich vor sich her durch alle Zimmer. Er zeigte mir alles, filzte und wetzte dabei ununterbrochen an mir herum und als wir an dem Bild seiner »Seligen« vorbeikamen, schob er mich mit einem lauten »Brr« weiter ins Schlafzimmer. Und dort auf dem breiten Ehebett mit der braunen Plüschdecke, bekam ich mein »Schalerl Kaffee«.
Er schmiß mich grob hin, warf sich mit einem einzigen Ruck meine Beine über die Achseln und stieß mir seinen riesigen Halbmond in die Spalte, daß ich aufschrie. Vorhin hatte ich ihn nicht ganz drinnen gehabt, aber jetzt konnte ich alles voll auskosten. Dem Xandl war sein respektabler Bauch zwar hinderlich, aber die Länge und die schöne Krümmung seines Schwanzes kamen uns sehr gut zustatten. Und zwischen den wuchtigen Stößen sagte er schnaufend und abgerissen: »So eine wie du… hab i schon lang braucht… uuuuuh, sakra … mehr Glück als Verstand … wie i dich g’sehn hab, hats mi scho g’rissen … und mei Zebedäus hat si glei aufbamt… du mußt mei G’schpusi wern … herrschaftsaxen, aaaah … dir brich i no das Kreuz … du mußt mei G’schpusi wern … wirst kan Hunger leiden beim Feringer… a Wohnung richt i dir ein … meiner Seel und Gott… aber in der Näh muß i di haben … wia er schön einipaßt in dei Pumperl… jetzten … jetzzzzz… hhhhhh!« Dann fiel er schwer auf mich, in meiner Spalte quatschte und gluckste es, so voll war ich und schwer atmend lagen wir ein paar Minuten da. Nach einer Weile fragte er leise und ganz langsam: »Alsdann gilts?« »I wer mirs no überlegen, Herr von Feringer. Aber, Xandl, du derdruckst mi ja!« »Jessas na, war schad um so a schönes Ascherl!« Und schnell stand er auf und ich brachte notdürftig mein Gewand in Ordnung. Mein Spitzenhoserl und meine seidene Bluse waren nun mehr Fetzen, aber Xandl rumorte in allerhand Schubladen und brachte mir bald eine neue, wunderschöne Bluse aus blauem Samt, die nur ein wenig nach Kampfer roch. Ganz modern war sie nimmer, aber zum Nachhausgehen gut genug, wenn sie mir auch vorne viel zu weit war. Xandl griff meine Bluse und was drin war, mit festen Griffen ab und sagte zufrieden: »Mußt halt no a bisserl hineinwachsen. A Molkerei hats g’habt, mein Reserl, als wie zwa Kürbis!« Dann machten wir uns noch ein Rendezvous für den nächsten Tag aus, an dem ich mein »Engagement« beim Xandl antreten sollte. Als ich aber schon im Vorzimmer war, ganz heiß und müd von der vielen Drückerei und dem Stoßen, und schon die Klinke von der Vorzimmertür in der Hand hatte, war er wieder hinter mir! Und schon war mein armer Popo wieder nackt und schon hatte ich schon wieder seine Nudel von rückwärts drin. Ich schob den Popo weit heraus und wetzte und schaukelte, denn es schmeckte mir von mal zu mal besser. Xandl puderte so kräftig, daß ich hin-und herflog und die Flügeltür schepperte und als es ihm kam, ließ er seine Nudel ruhig drin. Ich wollte ihn herausziehen, aber er preßte seinen Schoß an mich und ließ den Schweif drinnen stehen und nach einer Minute — bestimmt nicht länger — stand der Hallodri schon wieder! Dann kam noch die Schluß- und Glanznummer, Xandls Riesenschlange fiel heraus und hatte für diesen Tag Feierabend. Ich bin gewiß immer eine gewesen, die was aushält, aber ich war doch recht müd und nahm mir zum Nachhausfahren einen Wagen. Meine Ritze brannte wie Feuer und ich mußte die Schenkel zusammendrücken, so lief es mir noch immer heraus. Als ich den Kutscher zahlte, fand ich in meinem Tascherl zwei Zehnguldenzettel. Ich schlief wie erschlagen, aber recht hoffnungsvoll ein!