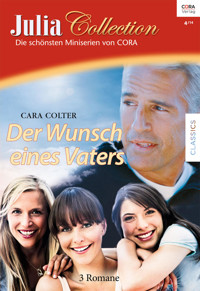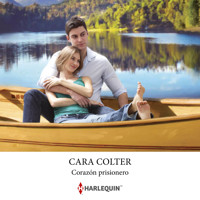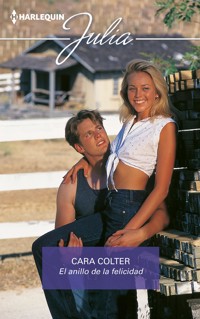5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia Exklusiv
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
FOLGE DEINEM HERZEN von CARA COLTER Ganz neue Gefühle! Leidenschaft, wie Tally sie nie gekannt hat! Und doch will sie auf das Glück mit J.D. verzichten, um den konservativen Herbert zu heiraten. Die falsche Entscheidung? TRAUMURLAUB MIT DOMINIC von MARY LYONS Traumhafte Ferientage in den französischen Alpen erlebt Olivia mit Dominic, dem Earl of Tenterden. Darf sie seinen Liebesschwüren wirklich vertrauen? EIN MANN, DEN MAN NIE VERGISST von DAY LECLAIRE Tess braucht dringend einen Begleiter für den Wohltätigkeitsball! Wie gut, dass ihr Bruder bei einer Partnervermittlung arbeitet. Schnell ist ein passender Mann gefunden. Als Tess Shayne das erste Mal gegenübersteht, beindrucken sie zwar seine guten Manieren, seine enorme erotische Ausstrahlung beunruhigt sie jedoch ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Ähnliche
Cara Colter, Mary Lyons, Day Leclaire
JULIA EXKLUSIV BAND 354
IMPRESSUM
JULIA EXKLUSIV erscheint in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe JULIA EXKLUSIV, Band 354 09/2022
© 2003 by Cara Colter Originaltitel: „What a Woman Should Know“ erschienen bei: Silhouette Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Jochen Gaida Deutsche Erstausgabe 2004 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe Julia Extra, Band 228
© 1999 by Mary Lyons Originaltitel: „The Society Groom“ erschienen bei: Mills & Boon Ltd., London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Alexa Christ Deutsche Erstausgabe 2005 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe Julia Extra, Band 237
© 2001 by Day Totton Smith Originaltitel: „The Provocative Proposal“ erschienen bei: Mills & Boon Ltd., London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Marion Koppelmann Deutsche Erstausgabe 2003 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe Julia, Band 1575
Abbildungen: Hitoshi Nishimura / Getty Images, alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 09/2022 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783751511995
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, ROMANA, HISTORICAL, TIFFANY
Folge deinem Herzen
1. KAPITEL
John David Turner war ein begeisterter Sänger. Je lauter, desto besser. Er liebte es, wenn sein Gesang das Gebälk über ihm in Schwingungen versetzte und die Wände um ihn herum vibrierten. Er sang immer dann, wenn er zufrieden war, und heute war ein verdammt guter Tag gewesen, auch wenn er sich die Schulter verrenkt hatte, als er den Motor aus Clyde Walters’ 72er Mustang gehoben hatte.
Angesichts seines rauen, verstimmten und dröhnenden Organs gab es allerdings nur einen Ort, an dem er nach Herzenslust singen konnte, und das war unter der Dusche. Dort befand sich J. D. gerade.
Während er spürte, wie das heiße Wasser, das auf seinen Körper prasselte, die Zerrung in seiner Schulter löste, schmetterte er sein Lieblingslied.
„Annabella die Kuh war für ein Rindvieh eine außergewöhnliche Schönheit …“
Er hielt den letzten Ton, bis seine Stimme sich überschlug, ähnlich dem Heulen der Kojoten, das in den Wäldern und Tälern westlich von seinem Anwesen zu hören war. Manchmal, wie jetzt im Frühsommer, antworteten ihm die Kojoten sogar, wenn er diese letzte markerschütternde Silbe sang.
J. D. horchte, ob die Kojoten auch heute reagieren würden.
Alle Fenster seines kleinen Hauses waren geöffnet, um nach der Hitze des Tages die kühle Abendluft hereinzulassen. Seine Autowerkstatt und das Haus befanden sich am Stadtrand von Dancer im Bundesstaat North Dakota, gerade so weit außerhalb, dass nur die Tiere in der Nachbarschaft ihn hören konnten, wenn ihn die Sangeslust ergriff.
Aber anstelle der Kojoten vernahm J. D. in der Stille, die durch die Unterbrechung seiner Darbietung entstanden war, ein energisches Klopfen an der Haustür.
Sein Gesicht verfinsterte sich. Niemand wusste von seinen Gesangsübungen. Niemand. Nur einmal, vor langer Zeit, hatte er in einem Anfall von Wahnsinn einer Frau ein Liebeslied gesungen.
Aber obwohl er sich alle Mühe gab, es zu ignorieren, hörte das Klopfen nicht auf.
Schließlich drehte J. D. das Wasser ab und griff nach einem Handtuch. Seine gute Laune war von einem auf den anderen Augenblick verflogen.
Ob es daran lag, dass er sich an den Vorfall mit dem Liebeslied erinnerte, oder daran, dass man ihm beim Singen erwischt hatte – oder ob die Hartnäckigkeit des Störenfrieds der Grund war, auf jeden Fall war J. D. gereizt, als er mit dem Handtuch um die Hüften durch sein Schlafzimmer stapfte, wo er lauter kleine Pfützen auf dem Teppich hinterließ. Wer zum Teufel wagte es, ihn zu dieser Stunde zu stören?
Vermutlich sein Kumpel Stan, ebenfalls Junggeselle und das zweite Gründungsmitglied des „Wir heiraten nicht, nie und nimmer“-Klubs, auch bekannt unter der Abkürzung WHNNUNK. Stan kam manchmal abends auf ein Bier vorbei, und dann bastelten sie in der Werkstatt bis spät in die Nacht an irgendwelchen alten Autos herum. Wenn Stan der Störenfried war, würde morgen die ganze Stadt wissen, dass J. D. Turner unter der Dusche von schönen Kühen sang.
Nun würde eine solche Nachricht an den meisten Orten für wenig Aufsehen sorgen. In Dancer allerdings gab es einen solchen Mangel an Neuigkeiten, wie unspektakulär sie auch sein mochten, dass auch die trivialste Information über das Privatleben eines Bewohners sich wie ein Buschfeuer verbreitete.
J. D. hatte das Gefühl, dass er sich für eine lange Zeit auf Kuh-Witze einstellen musste. Missmutig riss er die Tür seines Schlafzimmers auf und marschierte in die Diele.
Er hatte Stan erwartet, und so blieb er ruckartig im Dunkeln seines Hausflurs stehen, als er durch die Glasscheibe seiner Haustür die Silhouette einer Frau erblickte, die sich gegen das Licht der untergehenden Sonne abzeichnete.
Die Frau hatte der Tür ihren Rücken zugewandt und blickte über die Flieder-Hecke hinweg in Richtung Stadt. Ihre Arme waren um den Oberkörper geschlungen, um sich vor der kühlen Abendbrise zu schützen. Sie trug einen Rock, der an einer anderen Frau geschäftsmäßig hätte aussehen können. An ihr allerdings betonte der Rock die verführerische Rundung ihrer Hüften und die vollkommene Form ihrer langen Beine.
Auch wenn er sie nur von hinten sehen konnte, wusste J. D., wer sie war.
Ihr blondes Haar schimmerte in den letzten Strahlen der Sonne. Es war zwar zu einem Knoten zusammengesteckt, doch der Wind hatte einige Haarsträhnen befreit, die ihren schlanken Hals umspielten.
Für einen kurzen Augenblick bekam J. D. einen trockenen Mund. Dann band er das Handtuch fester um seine Hüften und trat auf die Tür zu.
Mit jedem Schritt wurde seine Wut größer.
Fünf Jahre. Nicht einmal verabschiedet hatte sie sich. Kein Brief, kein Anruf, keinerlei Erklärung. Und dann erschien sie einfach so wieder in seinem Leben?
Sein Plan sah vor, die Tür zu verriegeln und die Frau klopfen zu lassen, so lange sie wollte. Er war einmal in seinem Leben von Elana Smith verzaubert worden, und das war mehr als genug.
Doch zu seiner eigenen Überraschung ließ ihn seine Wut die Tür öffnen und auf die Veranda stürmen.
Entsetzt über seinen eigenen Zorn, der sich über jede Vernunft hinwegsetzte, packte er die Frau an der Schulter, wirbelte sie herum und drückte sie, ohne den Schreck auf ihrem Gesicht zu bemerken, an sich und küsste sie.
Es war kein Begrüßungskuss, es war ein strafender, ein wilder Kuss. Er schmeckte nach betrogener Liebe, nach dem Schmerz, den ihm fünf Jahre zugefügt hatten, in denen er immer wieder nach einer Antwort gesucht hatte. Es war der Kuss eines Mannes, der auf dem Schlachtfeld der Liebe verwundet und durch seine Verletzungen stärker, aber auch kälter geworden war.
Verzweifelt versuchte die Frau, sich aus seinem Griff und von seinen Lippen zu befreien. Er verspürte eine leichte Befriedigung, dass sie gegen seine Kraft nichts ausrichten konnte.
Dann aber drang die Erkenntnis zu ihm durch, dass irgendetwas nicht stimmte. Elana und sich seinen Lippen entziehen? Diese Begrüßung wäre ganz nach ihrem Geschmack gewesen. Sie hätte einen solchen Kuss begierig erwidert, und wahrscheinlich wäre er nunmehr derjenige, der versuchen würde, sie abzuwehren.
Als er so weit mit seinen Überlegungen gekommen war, spürte er den Widerstand der Frau auf einmal dahinschmelzen. Der Kampf war vorüber.
Während er sich noch über diese neuartige Entwicklung der Dinge wunderte, riss die Frau sich von ihm los und schleuderte ihm ihre Handtasche gegen den Schädel.
J. D. taumelte rückwärts und betrachtete sein Gegenüber mit zusammengekniffenen Augen.
„Was fällt Ihnen ein!“ Die Frau vor ihm warf ihm einen wütenden Blick zu und begann dann, ihre Bluse an der Stelle trockenzureiben, an der seine noch feuchte Haut einen Abdruck hinterlassen hatte.
Sie hatte Elanas Gesicht. Herzförmig, feminin und leicht exotisch. Wie gut er sich an diese vertrauten Gesichtszüge erinnerte, die hohen Wangenknochen, die vorwitzige Nase, das leicht spitze Kinn.
Aber dieses „Was fällt Ihnen ein!“ in diesem strengen, kühlen Tonfall, das war nicht Elana. Die Frau, die vor ihm stand, war einfach nicht Elana.
J. D. bemerkte, dass ihre Augen unter den dichten, geschwungenen Wimpern eine andere Farbe hatten. Elanas Augen waren blau gewesen. Diese Augen aber waren beinahe violett, wie die Blüte eines Veilchens.
Mit Kontaktlinsen, so wusste J. D., war heutzutage alles möglich, und er betrachtete die Frau eingehender.
Die Wut und Furcht in ihren schönen Augen waren echt. Doch dahinter konnte er die gleiche Sanftheit erkennen, die er an ihren Lippen verspürt hatte.
Und auch die waren bei näherer Betrachtung nicht die von Elana. Deren Mund war groß und sinnlich gewesen. Der Mund dieser Frau war hingegen eher klein, die Lippen waren leicht gewölbt und durch den ausgiebigen Kuss etwas angeschwollen.
J. D. fluchte leise. Er hatte soeben eine vollkommen Fremde bis zur Besinnungslosigkeit geküsst. Und das nur, weil sie im falschen Moment aufgetaucht war.
Die Tatsache, dass er nur mit einem Handtuch bekleidet war, missfiel der Frau vor ihm ganz offensichtlich. Pikiert betrachtete sie zuerst ihn, dann ihre Bluse.
„Sie haben sie ruiniert!“ Ihrer Stimme war anzuhören, dass sie um Fassung rang. „Das ist eine Seidenbluse.“
„Hab ich mir schon gedacht.“
Die Frau warf ihm einen Blick zu, der zu sagen schien: Was versteht jemand wie Sie schon von Seide? J. D. beeilte sich, den ersten Eindruck, den er auf sie gemacht haben musste, noch zu vertiefen.
„Seide ist immer durchsichtig, wenn sie nass wird“, erklärte er leichthin.
Ihre Augen weiteten sich, und ihr Mund formte ein empörtes O. Dann verschränkte sie errötend die Arme vor der Brust.
„Zu spät. Ich habe schon alles gesehen. Spitzenbesetzt.“
„Oh!“ rief sie entrüstet.
„Versuchen Sie nicht, mich wieder mit der Handtasche zu schlagen!“ warnte er sie.
„Dann hören Sie gefälligst auf, mich so anzuschauen!“
„Wie schaue ich denn?“
Sie suchte nach Worten: „Wie … wie eine Eidechse!“
Obwohl eingeschworener Junggeselle, genoss J. D. es, dass sein Charme seine Wirkung auf das andere Geschlecht üblicherweise nicht verfehlte. Aber eine Eidechse? Am liebsten hätte er sie noch einmal geküsst, auch wenn sie ihn dann bestimmt wieder attackiert hätte.
Stattdessen musterte er sie genauer.
Kein Wunder, dass diese Frau immun gegen seinen Charme war. Durch ihre starke äußere Ähnlichkeit mit Elana war er davon ausgegangen, dass sie auch sonst wie Elana war.
Aber bei näherer Betrachtung war sie das genaue Gegenteil: Ihre Bluse war bis oben hin zugeknöpft, das Haar zu einem strengen Knoten zurückgebunden. Sie trug nur leichtes Make-up, und auf ihren gewölbten Lippen lag ein Ausdruck des Missfallens, der geradezu gouvernantenhaft war.
„Was kann ich für Sie tun?“ fragte J. D. unfreundlich. Diese Frau war zwar nicht Elana, aber sie hatte etwas mit Elana zu tun. Sie musste eine Verwandte sein, vielleicht eine Zwillingsschwester. Nein, eher doch eine jüngere Schwester. Aber wer auch immer sie war, der Grund, aus dem sie hier vor ihm stand, hatte mit Elana zu tun, und das konnte nichts Gutes bedeuteten. Dessen war er sich ganz sicher.
Die Fremde fuhr sich unterdessen mit ihrem Ärmel über den Mund, so als wolle sie die letzten Spuren des Kusses verwischen. Dann sah sie sich um, und J. D. konnte ihrem Blick ansehen, was ihr in diesem Augenblick durch den Kopf ging: Sie befand sich auf der Veranda eines fremden Hauses, vor ihr stand ein halbnackter Mann, der sie soeben geküsst hatte, und es gab weit und breit keine Nachbarn, die ihre Hilferufe hätten hören können.
Normalerweise würde J. D. in einem solchen Augenblick versuchen, sein Gegenüber zu beruhigen. Doch diese Dame hier bedeutete Gefahr.
Auch wenn sie wie der harmloseste Mensch der Welt aussah, hatte er in ihrem Kuss doch etwas verspürt, das nicht annähernd so unschuldig war, wie sie sich gab.
Ihr Haar, das die Farbe reifen Weizens hatte, umrahmte ein Gesicht, das so schön war, dass man sie für einen Engel halten konnte. Allerdings hatte man auch Elana für einen Engel halten können.
J. D. bemerkte als Nächstes, wie schlank seine Besucherin war. Elana war zwar auch schlank gewesen, hatte jedoch über stärkere Rundungen verfügt. Immer sexy gekleidet, hatte sie Miniröcke und schwarzes Leder bevorzugt. Die Kleidung, die die Frau vor ihm trug, verstärkte ihre gouvernantenhafte Erscheinung noch. Das Pastellblau erinnerte J. D. an etwas, das OP-Schwestern trugen. Alles an ihr war wie aus dem Ei gepellt.
Elana hatte niemals wie aus dem Ei gepellt gewirkt. Doch auch wenn es sich bei seinem Gegenüber nur um eine schlechte Kopie handelte, umgab sie dennoch ein Hauch von Gefahr.
„Was kann ich für Sie tun?“ wiederholte J. D. seine Frage, diesmal noch etwas kühler.
„Nichts“, antwortete die Frau, „ich habe mich geirrt.“ Damit trat sie unsicher einen Schritt zurück und kehrte ihm dann den Rücken zu, um die Flucht zu ergreifen.
J. D. wusste nicht, ob er erleichtert oder enttäuscht sein sollte, dass er den Grund für ihren Besuch nun nie erfahren würde.
Er nahm an, dass er wohl eher enttäuscht war, zumal er das „Warten Sie!“, das ihm auf der Zunge lag, nur mühsam zurückhalten konnte.
In ihrer Eile stolperte die Blondine davon und geriet auf der Treppe ins Straucheln. Und obwohl J. D. noch reflexartig nach ihr griff, war es zu spät. Sie verlor das Gleichgewicht und schlug mit dem Kopf auf den Stufen auf.
Sofort war er bei ihr. Alle Feindseligkeit, die er empfunden hatte, war verflogen.
Sie dagegen sah ihn benommen an und befahl dann in mattem Tonfall: „Fassen Sie mich nicht an!“
An ihrer Stirn war etwas Haut abgeschürft, und rund um die Wunde schwoll mit beängstigender Geschwindigkeit eine Beule an.
„Lassen Sie mich runter!“ verlangte sie, als er sie hochhob. Sie war so leicht, dass er in seiner lädierten Schulter keinerlei Schmerz verspürte. Warm und angenehm lag sie in seinen Armen.
J. D. ignorierte ihren Protest ebenso wie die Tatsache, dass das Handtuch um seine Hüften gefährlich rutschte, als er sie die Stufen hinauftrug, die Haustür mit dem Fuß aufstieß und in die Küche trat. Dort setzte er sie auf einen Stuhl.
Sofort versuchte sie, wieder aufzustehen.
„Hinsetzen!“ befahl er und korrigierte den Sitz seines Handtuchs.
Sie warf ihm einen trotzigen Blick zu und unternahm einen wackligen Schritt in Richtung Tür, ließ sich dann jedoch widerwillig zurück auf den Stuhl fallen. Daraufhin sah sie sich in der Küche um, die alles in allem nicht den Anschein machte, als würde sie in einer der nächsten Ausgaben von „Schöner wohnen“ erscheinen.
Der Raum war nur spärlich möbliert: ein Tisch mit Resopal-Oberfläche, Stühle mit Metallrahmen und weinroten Kunststoff-Polstern. Das Geschirr der letzten drei oder vier Tage war in der Spüle gestapelt. Missbilligend blieb ihr Blick an dem Motor hängen, den J. D. auf der Arbeitsplatte auseinander genommen hatte.
Beauford, sein Hund, eine freundliche Mischung aus Jagdhund und Basset, hatte bis zu diesem Zeitpunkt unter dem Tisch geschlafen. Er nutzte nun die Gelegenheit, um sich auf seine kurzen Beinen zu erheben, den kräftigen, schwarz, weiß und braun gefleckten Körper zu strecken und anschließend seinen riesigen Kopf in den Schoß der Besucherin plumpsen zu lassen. Dort schnüffelte er unhöflich und blinzelte dann ergeben mit seinen traurigen braunen Augen.
Erschrocken nahm die Frau die Arme von ihrer Bluse und schubste den Kopf des Hundes von ihrem Schoß. „Mistvieh!“ stieß sie hervor.
Nun war J. D. ein geduldiger Mensch, und er wusste, dass Beauford zu Mundgeruch neigte, aber deshalb war er noch lange kein Mistvieh. Allmählich hatte er die Nase voll.
Er hielt eine Hand mit drei ausgestreckten Fingern vor ihr Gesicht: „Wie viele?“ Sobald er sichergestellt hatte, dass ihr nichts fehlte, würde er Fräulein Etepetete hinauswerfen. Selber Mistvieh!
„Drei.“ Sie warf ihm einen ungnädigen Blick zu und bedeckte mit den Armen wieder die durchsichtige Stelle auf ihrer Bluse.
„Welches Datum ist heute?“
„Der 28. Juni.“
„Wann ist Ihr Geburtstag?“
„Und woher wollen Sie wissen, ob die Antwort stimmt?“
Da hatte sie recht. Und die Tatsache, dass sie zu einer solchen Überlegung fähig war, zeigte, dass mit ihrem Kopf offenbar alles in Ordnung war. Er konnte sie also beruhigt nach Hause schicken.
Andererseits schien sie ihm genau der Typ zu sein, der einen wegen einer Gehirnerschütterung oder ähnlichem verklagte, und so ging er widerstrebend zum Kühlschrank, nahm einen Beutel mit tiefgefrorenen Erbsen aus dem Tiefkühlfach und hielt ihn auf die Beule an ihrer Stirn. Sie schloss kurz die Augen, dann versuchte sie wieder aufzustehen.
„Immer mit der Ruhe“, ermahnte er sie und drückte ihre Schulter mit einem Finger wieder nach unten, „ich tue Ihnen doch nichts.“
„Und warum haben Sie das vorhin getan?“ wollte sie wissen.
Einen Augenblick lang glaubte er, sie beschuldigte ihn, sie die Stufen hinuntergestoßen zu haben. „Was habe ich denn getan?“ fragte er spitz.
„Sie haben mich geküsst!“
„Ach so, das.“ Er zuckte die Schultern, so als habe der Vorfall nichts zu bedeuten, obwohl er in Wahrheit noch immer den süßen Geschmack ihrer Lippen in seinem Mund schmeckte. „Ich dachte, Sie seien jemand anders.“
Sie schwieg, und in den Tiefen ihrer veilchenblauen Augen war abzulesen, dass sie in diesem Augenblick erkannte, welche leidenschaftliche Beziehung zwischen ihm und ihrer Doppelgängerin bestanden haben musste.
„Sie sind Jed Turner, oder?“
Er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Nur Elana hatte ihn Jed genannt. Ansonsten war er für alle J. D.
„John“, verbesserte er sie. „Oder J. D. – J. D. Turner.“
„Ich bin Tally Smith. Ich glaube, Sie haben meine ältere Schwester gekannt. Elana.“
J. D. schwieg, während er den Beutel mit Erbsen weiterhin an ihre Schläfe hielt. Er hatte nicht die Absicht, ihr die Angelegenheit besonders leicht zu machen.
„Ich kannte sie flüchtig“, antwortete er schließlich knapp. Seine Stimme verriet keine Gefühlsregung.
Die Frau vor ihm holte tief Luft, zögerte erneut und zwang sich dann zu sagen: „Sie ist tot.“
Nur drei Worte. Langsam wurde er sich ihrer Bedeutung bewusst. Und erkannte zugleich, dass Elana für ihn schon vor langer Zeit gestorben war.
Er wusste nicht, was er sagen sollte. Dass es ihm leid tat? Er war sich nicht einmal sicher, ob das der Wahrheit entsprach. J. D. war erleichtert, als das Telefon klingelte und ihm Zeit gab, darüber nachzudenken. Er ergriff Tally Smiths Hand, die klein, zart und warm war, und legte sie um den Beutel mit Tiefkühlerbsen. Dann ging er zum Telefon.
„Mrs. Saddlechild? Ja, den habe ich fertig. Zehn Dollar. Ich bringe ihn Ihnen morgen vorbei. Keine Ursache.“ Er legte den Hörer auf und wünschte, es sei ein längerer Anruf gewesen, Clyde zum Beispiel, der sich nach dem Mustang erkundigen wollte.
Er wandte sich wieder der Frau in seiner Küche zu. Tally Smith, Elanas kleine Schwester. Sie sah aus wie Mitte zwanzig. Elana war so alt gewesen wie er, und er war mittlerweile dreißig.
Sie war aufgestanden und bewegte sich mit unsicheren Schritten auf die Tür zu. Die Erbsen hielt sie immer noch gehorsam an die Stirn gedrückt.
„Wann ist sie gestorben?“ fragte er zögernd.
Ihre Augen waren blind vor Schmerz, und er spürte, dass dieser Schmerz nichts mit der Beule auf ihrer Stirn zu tun hatte.
„Vor fast einem Jahr.“
„Und warum erzählen Sie mir das? Warum jetzt?“
„Ich weiß nicht“, antwortete sie.
Irgendetwas in ihrer Stimme ließ ihn aufhorchen. Es erinnerte ihn an Elanas Stimme, die etwas Geheimnisvolles gehabt hatte.
„Sind Sie aus Saskatchewan?“ fragte er.
Sie nickte.
„Sie haben einen weiten Weg gemacht, um mir die Nachricht zu überbringen.“
Tally sah ihn scharf an, und J. D. erkannte, dass sie ihm etwas verheimlichte. Ein flaues Gefühl regte sich in seinem Magen.
„Ja, ich habe einen weiten Weg gemacht“, antwortete sie steif, doch unter ihrer Angespanntheit konnte J. D. zugleich Erschöpfung erkennen. Der Hund trottete unterdessen hinter ihr her, als sei sie seine beste Freundin. Sie betrachtete Beauford mit Abscheu, und das bisschen Sympathie, das J. D. für sie empfunden hatte, verflog auf der Stelle wieder. Was für ein kaltherziger Mensch musste man eigentlich sein, um Beauford nicht zu mögen?
J. D. folgte ihr nach draußen und hielt den Hund vor der Treppe zurück. Diesmal bewältigte die Blondine die Stufen ohne weitere Zwischenfälle. J. D. bemerkte den kleinen grauen Nissan mit dem kanadischen Nummernschild, der vor dem Haus auf sie wartete.
„Sie hätten anrufen sollen“, sagte er frostig.
Niemand legt einen so langen Weg zurück, nur um eine schlechte Nachricht zu überbringen, dachte J. D. Er hatte sich vor fünf Jahren mit einer Smith eingelassen und konnte von Glück reden, dass er lebend aus der Angelegenheit herausgekommen war. Noch einmal würde ihm das nicht passieren, auch wenn dieses Exemplar vom Temperament her das genaue Gegenteil von Elana zu sein schien. Egal, weshalb sie gekommen war, sie würde es nicht kriegen.
Bevor sie das Tor öffnete, das sich am Fuß der Treppe befand, zögerte die junge Frau, blieb stehen und sah sich nach J. D. um. Er konnte sehen, wie es in ihr arbeitete. Offensichtlich wollte sie ihm noch etwas sagen.
Aber was auch immer sie ihm mitzuteilen hatte, er wollte es nicht hören.
„Danke für den Besuch“, sagte er in beißendem Tonfall, „verletzen Sie sich nicht, wenn Sie das Tor hinter sich schließen.“
Sie verstand den Wink. Aber anstatt sich über seine Unhöflichkeit zu ärgern, sah sie nicht beinahe erleichtert aus? Als ob sie sich gewünscht habe, dass er grob und ungehobelt sein würde?
J. D. runzelte die Stirn.
Mit stolz gestrafften Schultern ging die Frau den Pfad zu ihrem Wagen hinunter. Sie setzte sich hinter das Lenkrad und sah ihn an. Regungslos erwiderte er den Blick. Schließlich wandte sie sich ab, ließ den Motor an und legte den Rückwärtsgang ein.
J. D. blieb auf der Veranda stehen, die Arme vor der Brust verschränkt, bis ihr Wagen außer Sichtweite war. Er hoffte, dass er von nun an seine Ruhe vor den weiblichen Angehörigen der Familie Smith haben würde, hatte dabei aber das unbestimmte Gefühl, dass dieser Wunsch sich nicht erfüllen würde.
Ihm wurde bewusst, dass er immer noch die erfrischende Süße ihrer Lippen schmecken konnte. Heftig wischte er sich über den Mund, bevor er zurück ins Haus ging.
Die Lust am Singen war ihm vergangen.
„Du solltest froh sein“, sagte sich Tally Smith während der kurzen Autofahrt zurück nach Dancer. „Der Mann ist nicht geeignet für die Aufgabe. Nicht im Entferntesten.“
Trotz der Entschlossenheit, mit der sie diese Beurteilung abgab, schwirrte ihr der Kopf, und sie hoffte, dass die Beule an ihrer Stirn der einzige Grund dafür war.
Aber sie wusste, dass das nicht stimmte.
Es lag an der Heftigkeit, mit der er sie geküsst hatte. An der unverfälschten und ungezügelten Leidenschaft dieses Kusses.
„Grrr…“, schauderte sie, kam sich dabei jedoch wie eine schlechte Schauspielerin vor, die leidenschaftslos Sätze aus einem Bühnenstück aufsagt. J. D. Turners Lippen hatten auf beängstigende Weise köstlich geschmeckt. Sie war sich nicht sicher, was geschehen wäre, wenn sie nicht rechtzeitig zu sich gekommen wäre und ihn mit ihrer Handtasche geschlagen hätte.
Tally hatte das erschreckende Gefühl, dass etwas Wildes von ihr Besitz ergriffen und sein Drängen und seine Leidenschaft erwidert haben könnte.
„Grrr…“, machte sie, mit noch weniger Überzeugung als zuvor. „Er ist nicht geeignet für die Aufgabe!“
Nervös trommelte sie mit ihren Fingerspitzen auf das Lenkrad und hob dann den Daumen: „Erstens. Er kam nur mit einem Handtuch um die Hüften an die Tür.“
Anstelle dieses Verhalten als Charakterschwäche zu werten, bestand der besagte Teil von ihr jedoch darauf, sich das Bild in all seinen unschicklichen Einzelheiten vor Augen zu rufen.
Mit einem leichten Schaudern, von dem sie sich vergeblich einzureden versuchte, dass es sich um Abscheu handelte, erinnerte sie sich an das dichte dunkle Haar, feucht und leicht gelockt, die durchdringenden braunen Augen und den energischen Zug um seinen Mund. Seine nackte Haut war gebräunt und makellos, die Schultern breit und die Brust wie in Stein gemeißelt.
Nichts an der zerknitterten Fotografie, die sie gefunden hatte, nachdem sie endlich die Kraft aufgebracht hatte, Elanas Sachen durchzusehen, hatte sie auf ein Treffen mit dem Mann vorbereitet.
Das Bild hatte J. D. zwar auch gut aussehend gezeigt, aber seine Energie, sein Wesen nicht wiedergegeben. Auf dem Foto trug er verwaschene Jeans und ein weißes Hemd mit offenem Kragen. Er stand mit dem Rücken vor der Motorhaube eines Wagens, ein Bein angewinkelt und auf der Stoßstange aufgestützt, die Arme vor der Brust verschränkt. Das dunkelbraune Haar fiel ihm lässig in die Stirn, und seine Augen blickten ungezwungen in die Kamera. Sein offenes Grinsen wirkte jungenhaft und leicht verwegen.
Als sie den Gesang gehört hatte, der kraftvoll und rau durch die geöffneten Fenster des kleinen Hauses dröhnte, hatte sie geglaubt, den Mann auf dem Foto gefunden zu haben.
Aber an dem wütenden Flegel, der, nur mit einem Handtuch bekleidet, an der Tür erschienen war und dem seine Nacktheit auf befremdliche Weise gleichgültig zu sein schien, war nichts Offenes oder Jungenhaftes gewesen. Kein Lachen hatte in seinen dunklen Augen gelegen und kein Anflug von Grinsen um seine angespannten Mundwinkel.
Sie erschauerte bei dem Gedanken an das Wasser, das von seinem athletischen Oberkörper geperlt war, an den flachen Bauch und die muskulösen nackten Beine. Als er die Arme vor der Brust verschränkt hatte, war sein Bizeps angeschwollen, und das Spiel der Muskeln in seinem Unterarm hatte von solcher männlichen Kraft gezeugt, dass ihr die Knie ganz weich geworden waren. Kein Wunder, dass sie auf der Treppe gestolpert war.
Und ebenfalls kein Wunder, dass Elana diesem Mann erlegen war, auch wenn sie, Tally, nicht näher darüber nachdenken wollte.
„Hör auf!“ befahl sie sich selbst. „Er kommt nicht in Frage. Es war schon schlimm genug, dass er halbnackt an die Tür kam, aber seine Küche war eine Katastrophe, und sein Hund ist schlecht erzogen und stinkt. J. D. Turner kommt nicht in Frage. Nie und nimmer.“
Tief einatmend, versuchte Tally, die Erinnerung an ihn aus ihrem Kopf zu verbannen. Langsam und besonnen fuhr sie die Strecke nach Dancer zurück. Der Ort lag wie eine grüne Oase inmitten der goldenen Prärie.
„Was für ein verschlafenes Nest“, murmelte sie, als sie an den eintönigen kleinen Häusern vorbeikam, die unter gigantischen Bäumen vor sich hinschlummerten. Das einzige lebendige Wesen schien ein altersschwacher Hund zu sein, der ihr müde nachblickte.
Schließlich erreichte sie ihr Motel und parkte den Wagen. Das Gebäude, das aus irgendeinem Grund „Palmtree Court“ hieß, obwohl die nächste Palme wahrscheinlich Hunderte von Kilometern entfernt war, bestand aus einer Anzahl kleiner und bescheiden eingerichteter Zimmer. Es handelte sich um die einzig verfügbare Unterkunft in Dancer, und Tally hatte den Portier wecken müssen, als sie am frühen Abend angekommen war. Nachdem der alte Mann im Schaukelstuhl jedoch einmal wach war, hatte er ein hartnäckiges Interesse an ihrer Lebensgeschichte gezeigt, und Tally war es nur mit Mühe geglückt, die Zimmertür hinter sich zu schließen, ohne alle ihre Geheimnisse preisgegeben zu haben.
Erleichtert hatte sie festgestellt, dass ihr Zimmer trotz des kargen Eindrucks, den das Motel von außen machte, sauber und gemütlich war.
Erschöpft ließ Tally sich nun auf ihr Bett fallen. Absurderweise hielt sie immer noch die Erbsen von J. D. Turner in der Hand und presste sie auf die Beule an ihrem Kopf.
Ich sollte auf der Stelle Herbert anrufen, dachte sie, machte aber keine Anstalten, das Telefon zu benutzen.
Herbert Henley war schließlich der aussichtsreichste Kandidat für die Aufgabe. An ihrem Geburtstag vor drei Monaten hatte er ihr einen geschmackvollen Diamantring – nichts Protziges – an den Finger gesteckt. Aber das war, bevor Tally das verwünschte Foto mit dem lachenden J. D. Turner gefunden hatte.
Herbert war Besitzer eines Eisenwarenladens. Er lief nie mit einem Handtuch um die Hüften herum. Er besaß ein blitzsauberes Haus in der Altstadt von Dogwood Hollow. Selbst zu Hause trug er immer ein adrettes Hemd und diese entzückende Fliege, die ihr zuerst an ihm aufgefallen war. Und er würde nie im Leben einen Motor in seiner Küche auseinander nehmen. Er war besonders stolz auf seine Küche und insbesondere auf die Edelstahl-Geräte darin. Er teilte Tallys Abneigung gegen Hunde und besaß eine preisgekrönte Perserkatze namens Bitsy-Mitsy.
Ihr fiel ein, dass J. D. keinen Ehering getragen hatte. Bedeutete die Tatsache, dass ihr das Fehlen eines Rings aufgefallen war, dass sie J. D. immer noch als möglichen Kandidaten betrachtete?
Wie konnte sie nur so töricht sein? Dabei hatte sie immer geglaubt, die am wenigsten törichte Person auf der Welt zu sein. Und eine Torheit war das Letzte, was sie sich erlauben konnte, nun, da sie mit dieser überaus bedeutenden Aufgabe betraut war.
„Das ist das Wichtigste, was ich je getan habe“, erinnerte sie sich. Vielleicht durfte sie J. D. doch noch nicht von ihrer Liste streichen, nur weil sie ihn auf dem falschen Fuß erwischt hatte.
Er hatte zwar eine vollkommen Fremde geküsst, aber schließlich hatte er sie für ihre Schwester gehalten. Und dass er nur in einem Handtuch an der Tür erschienen war, lag wahrscheinlich daran, dass er gedacht hatte, einer seiner Kumpel käme ihn besuchen.
Er hatte zwar einen ölverschmierten Motor in seiner Küche liegen, aber vielleicht war auch das verzeihlich. Und der Hund war zwar hässlich, aber wenigstens freundlich, und das war mehr, als man über Bitsy-Mitsy sagen konnte.
Jetzt, wo sie den weiten Weg hierher gekommen war, durfte sie nicht zulassen, dass ihre Gefühle ihren Verstand benebelten. Dieser Mann war der leibliche Vater ihres Neffen, und es war ihre Pflicht, ihre Lebensaufgabe, einen Daddy für Jed zu finden.
Sie hatte sofort gewusst, wer J. D. war, als sie sein Foto unter den Sachen ihrer Schwester gefunden hatte. Er war der Vater von Elanas Sohn Jed.
Und nun, nach Elanas Tod, war sie, Tally, der gesetzliche Vormund von Jed. Ihr Leben war seitdem von der Aufgabe bestimmt, das Richtige für dieses Kind zu tun. Für ihr Kind. Als Jed damals zu ihr gekommen war, hatte sie sich gründlich informiert, wie man ein Kind zu einem glücklichen und ausgeglichenen Menschen großzieht. Und sie hatte mit Bestürzung festgestellt, dass glückliche und ausgeglichene Kinder in der Regel aus glücklichen und ausgeglichenen Familien stammten, aus Familien mit zwei Elternteilen. Weiterhin hatte sie erfahren, dass der Elternteil gleichen Geschlechts einen besonders wichtigen Anteil an der Entwicklung des Kindes hatte.
Daraufhin hatte sie eine inoffizielle Suchaktion nach einem passenden Kandidaten in und außerhalb von Dogwood Hollow gestartet. Ihr Plan war einfach: Sie würde den geeigneten Vater für ihren Neffen finden, ihn heiraten, und gemeinsam würden sie eine perfekte Familie bilden. Sie sah es als positiv an, dass ihr Verstand dabei nicht von Gefühlen beeinträchtigt wurde. Sie hatte gesehen, was Gefühle in einem Leben alles anzurichten vermochten, insbesondere in Elanas Leben.
Herbert Henley, solide, praktisch und unendlich verlässlich, war ihre erste Wahl.
Bis sie das Foto gefunden hatte. Ihr Gerechtigkeitssinn hatte ihr gesagt, dass der Mann auf dem Bild eine Chance verdient hatte, sich als Vater eines Kindes zu versuchen, von dem er offensichtlich keine Ahnung hatte, dass er es gezeugt hatte.
Und so war sie nach Dancer gekommen. Zwar hatte J. D. Turner einen schlechten Eindruck auf sie gemacht, aber was war, wenn dieser erste Eindruck täuschte? Später, wenn ihr Neffe Jed einmal älter wäre, würde sie sich für alle Entscheidungen, die sie gegenwärtig traf, rechtfertigen müssen.
Ihr Urteil musste daher nüchtern und sachlich sein und durfte sich nicht auf Gefühle, sondern nur auf Tatsachen stützen. Sie würde morgen also trotz ihrer anfänglichen Abneigung die Freunde und Nachbarn von J. D. Turner befragen. Tally hoffte, dass sie dabei herausfinden würde, dass der Mann ein versoffener Unhold mit drei Ex-Frauen und einem Vorstrafenregister war. In diesem Fall konnte sie mit ruhigem Gewissen nach Hause fahren und Herbert heiraten.
Noch lieber wäre ihr allerdings, so schoss es ihr plötzlich durch den Kopf, sie könnte den Moment ungeschehen machen, in dem ihr das Foto in die Hände gefallen war, auf dessen Rückseite ihre Schwester den Namen Jed Turner geschrieben hatte.
2. KAPITEL
J. D., der ächzend unter einem Wagen lag, ignorierte den Schmerz in seiner Schulter und zerrte an dem rostigen Bolzen, bis dieser sich schließlich löste. Mit einer Wucht, die für diesen Vorgang keineswegs notwendig war, riss J. D. ihn heraus und schleuderte ihn von sich. Dann klingelte das Telefon.
Laut vor sich hin fluchend, rutschte er unter dem Auto hervor, stieß sich dabei seinen Kopf an der Ölpfanne und hastete zum Telefon.
„J. D.“, meldete er sich, den Hörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt, während er sich das Öl von den Händen wischte.
„Hier ist Stan.“
„Was willst du?“
„Also, das ist ja eine freundliche Begrüßung!“
„Ich habe einen schlechten Tag.“
„Aber es ist doch erst fünf nach acht!“
„Ich weiß.“
„Na, vielleicht wird dich das ja aufheitern: Heute Morgen war da diese Frau im ‚Chalet‘ frühstücken. Eine Fremde. Ganz niedlich, wenn man auf den Typ Bibliothekarin steht. Weißt du, so eine, der man als Mann am liebsten die Nadeln aus dem Haar ziehen möchte …“
„Und was daran sollte mich aufheitern?“ unterbrach J. D. seinen Freund, bevor dieser sich zu ausführlich dem Thema „Frauen, denen man am liebsten die Nadeln aus dem Haar ziehen möchte“ widmete. Ein Thema, das einem Mann schlaflose Nächte bereiten konnte. Ebenso wie der Gedanke an Spitzenwäsche, die sich unter einer feuchten Seidenbluse abzeichnete, und Augen, die von einem unwirklichen Indigoblau waren, dazu führten, dass man sich morgens den Kopf an einer Ölpfanne stieß.
„Nun“, fuhr Stan genüsslich fort, „rate mal, nach wem sich die sexy Bibliothekarin erkundigt hat …“
„Fred Basil?“ fragte J. D. hoffnungsvoll. Fred war ein weiterer Junggeselle des Städtchens. Er war zweiundsechzig und hatte die Figur eines Wasserballs. Fred hatte die Aufnahme in den WHNNUNK höflich abgelehnt und erklärt, dass er einer Heirat nicht abgeneigt sei, sobald ihm die Richtige über den Weg liefe.
„Ich gebe dir einen Tipp“, verkündete Stan. „Du solltest dich darauf einstellen, deine Mitgliedschaft im WHNNUNK aufzugeben.“
J. D. stieß einen Fluch aus, der einen Seemann zum Erröten gebracht hätte. „Was für Fragen sind das, die sie stellt?“
Fünf Minuten später legte er auf, außer sich vor Wut. Was zu viel war, war zu viel. Nicht genug damit, dass sie ihn gestern beim Singen überrascht hatte, jetzt musste sie sich auch noch öffentlich nach ihm erkundigen und den Leuten im Dorf Anlass für allen möglichen Klatsch geben. Sie blamierte ihn und verletzte seine Privatsphäre.
Die vernünftige Reaktion auf Stans Anruf wäre, die Frau und den Klatsch, den sie auslöste, einfach zu ignorieren.
Die unvernünftige Reaktion bestand darin, sie zur Rede zu stellen und ihr wie der Sheriff in einem Western zu erklären, dass diese Stadt nicht groß genug sei für sie beide. Natürlich entschied J. D. sich für die unvernünftige Variante und brauste wutschnaubend ins Dorf.
Die Frau hatte Nerven, seinen Freunden und Nachbarn neugierige Fragen über ihn zu stellen!
Ihr Wagen stand nicht mehr vor dem Palmtree und auch nicht vor dem Chalet. Für einen Augenblick hoffte J. D., Tally Smith könne die Stadt verlassen haben, aber er wusste, dass er keine Ruhe finden würde, bis er sich nicht davon überzeugt hatte. Und vielleicht würden ihn selbst dann noch die Gedanken an ihre Haarnadeln verfolgen.
J. D. machte sich daran, die acht Straßen, aus denen das Wohngebiet von Dancer bestand, abzufahren. Es dauerte nicht lange, bis er den grauen Nissan vor dem Haus von Mrs. Saddlechild entdeckte. Er war sich sicher, dass es sich dabei um keinen Zufall handelte, schließlich hatte er den Namen der alten Dame gestern Abend während des Telefongesprächs erwähnt, als die kleine Spionin sich in seiner Küche eingenistet hatte.
Er ging zur Haustür und klopfte. Mrs. Saddlechild, die die Tür einen Spalt öffnete, sah mindestens so altertümlich aus wie ihr Rasenmäher, den er für sie repariert hatte. Sie trug eine geblümte Schürze, ihre Haare hatten vom Färben einen Blauschimmer, und ihre verschmierte Brille rutschte ihr beinahe von der Nase.
„Stell ihn einfach in den Schuppen, J. D., danke“, sagte sie durch den Spalt und schloss die Tür vor seiner Nase.
Skeptisch blickte er durch eine der runden Glasscheiben, die in die Haustür eingelassen waren.
Er konnte einen großen Teller mit Plätzchen erkennen. Mrs. Saddlechild hielt immer Gebäck für ihn bereit, wenn er den Rasenmäher vorbeibrachte. Als Nächstes konnte er sehen, wie eine schlanke Hand nach einem der Kekse griff. Zusätzlich erhaschte er für einen winzigen Moment den Anblick hellblonden Haars.
Genau wie er es erwartet hatte: Tally Smith aß seine Plätzchen und unterhielt sich mit einer Frau, die ihn schon kannte, als er noch ein Baby war, und die peinliche und vertrauliche Informationen über ihn besaß.
Er klopfte erneut. Mrs. Saddlechild öffnete die Tür wieder nur einen schmalen Spalt und sah ihn irritiert an: „Du bist immer noch da, J. D.? Ach so, dein Geld!“
Als ob er hier vor ihrem Haus stehen und auf zehn Dollar warten würde!
„Es geht nicht um Ihren Rasenmäher“, sagte er und konnte seine Ungeduld nur unzureichend verbergen, „ich möchte mit Ihrer Besucherin reden.“
Mrs. Saddlechild sah ihn argwöhnisch an und schloss die Tür wieder, ohne ihn hereingebeten zu haben. Es erschien ihm eine unerträglich lange Zeit, bevor sie zurückkam.
„Es ist ihr gerade nicht recht“, erklärte sie.
„Es sollte ihr aber verdammt noch mal recht sein“, ereiferte sich J. D. „Sagen Sie ihr …“
„J. D. Turner! Als die junge Dame mir berichtete, du habest dich ihr gegenüber nicht wie ein Gentleman verhalten, wollte ich es kaum glauben. Und jetzt stehst du hier vor meiner Tür und fluchst!“ Kopfschüttelnd gab Mrs. Saddlechild eine Reihe missbilligender Laute von sich.
Vor seinem inneren Auge entfalteten sich trübe Zukunftsaussichten: Alle älteren Bewohner von Dancer würden ihn von nun an meiden, und er würde ein Jahr lang kostenlos Rasenmäher warten müssen, um diesen Makel von seinem guten Ruf zu entfernen.
Diese Frau dort drinnen ruinierte mühelos sein ganzes Leben!
„Wären Sie so freundlich, ihr auszurichten, dass ich auf sie warte“, brachte er mit Mühe hervor.
Mrs. Saddlechild seufzte theatralisch und schloss die Tür.
J. D. nahm an, dass er mindestens eine Stunde lang zu warten hätte, und so war er erleichtert, als Tally Smith nach kurzer Zeit erschien.
„Was gibt es?“ fragte sie, als sie vor die Tür trat. Ihr Haar war erneut zu einem strengen Knoten gebunden. Sie trug eine makellose weiße Bluse, die diesmal nicht aus Seide war, und dunkelblaue Shorts, die bis zum Knie reichten. Ihr Aufzug erinnerte ihn an eine Nonne im Freizeit-Look.
Wenn man nichts von der Spitzenwäsche wusste, die sich darunter verbarg, strahlte diese Kleidung nichts als Vertrauenswürdigkeit aus.
„Tun Sie bloß nicht so unschuldig“, warnte er sie. Er sah ihr in die Augen und dachte, dass vermutlich das Abendlicht ihnen gestern ihre ungewöhnliche Farbe verliehen hatte. Aber nein, sie waren tatsächlich mehr violett als blau. Erstaunlich.
„Leona sagte, sie würde die Polizei rufen, wenn Sie sich nicht benehmen.“
Leona. Na großartig, dachte er, jetzt duzen sie sich schon. Und war da tatsächlich ein Anflug von Belustigung in ihren Augen? Wie konnte sie es wagen, sich über ihn lustig zu machen?
„Was zum Teufel tun Sie hier eigentlich?“ fragte er schroff. Er konnte sehen, wie Mrs. Saddlechild hinter einem Vorhang hervorlugte und sie beobachtete. Er warf ihr ein gezwungenes Lächeln zu.
„Ich trinke Tee“, erwiderte Tally, „und esse Ingwerplätzchen.“
J. D. funkelte sie an. „Warum tun Sie das?“ fragte er. „Warum erkundigen Sie sich nach mir? Warum haben Sie es mit aller Macht darauf abgesehen, mir das Leben schwer zu machen?“
Sie sah nun schuldbewusst aus wie ein Kind, das man mit der Hand im Süßigkeiten-Glas erwischt hat, aber ihr Ton war würdevoll, als sie erklärte: „Ich wüsste nicht, wie ein paar harmlose Fragen Ihnen das Leben schwer machen könnten.“
„Wirklich nicht? Dann lassen Sie es mich Ihnen erklären: Wenn eine Fremde in Dancer auftaucht und sich erkundigt, ob J. D. Turner seine Rechnungen pünktlich bezahlt, wird am nächsten Tag in den Cafés über nichts anderes geredet, als dass er vermutlich sein Hab und Gut in Las Vegas verspielt hat.“
Das schlechte Gewissen verdunkelte ihre Augen noch mehr, und so setzte er hinzu: „Und wenn jemand fragt, ob er irgendwo ein oder zwei Ex-Frauen hat, wird in den nächsten drei Wochen beim Friseur darüber spekuliert, ob er ein Heiratsschwindler ist. Die Leute werden beginnen, sich an kleine Begebenheiten zu ‚erinnern‘, die diese Behauptung stützen. Es wird Zeugen geben, die J. D. Turner in sämtlichen Nachbarstädten mit seinen verschiedenen Frauen gesehen haben wollen.“
„Sie übertreiben doch“, sagte sie unsicher und sah dabei schuldbewusster aus denn je.
„Und betrinkt sich J. D. Turner am Freitagabend? Oder womöglich unter der Woche? Ich kann Ihnen versichern, dass es Beobachtungsposten vor der Dorfkirche geben wird, wo sich die Anonymen Alkoholiker zweimal die Woche treffen, um zu sehen, ob ich dort auftauche.“ Genüsslich beobachtete er, wie sie reumütig den Blick senkte und ihre Turnschuhe betrachtete, die so aberwitzig weiß waren, als seien sie bei 100 Grad gewaschen worden.
„Kommen wir zum wichtigsten Punkt: Ist J. D. Turner kinderlieb? Um Himmels willen, diese Frage und die Tatsache, dass ich Ihnen hierher gefolgt bin, werden Mrs. Saddlechild veranlassen, das Hochzeitsaufgebot für uns zu bestellen!“
Plötzlich bemerkte er, dass sie ihren Blick wohl doch nicht nur aus Verlegenheit gesenkt hatte. Ihre Schultern zitterten verräterisch.
„Finden Sie das etwa komisch?“
Sie sah zu ihm auf und schüttelte heftig den Kopf, aber es war zu spät. Er hatte das Zucken in ihren Mundwinkeln gesehen und das amüsierte Funkeln in ihren Augen.
„Ich befürchte, ich kann nichts Lustiges daran finden“, erklärte er mit ernster Stimme. Glücklicherweise hörte sie auf zu lächeln. Dieses Lächeln könnte ihn vergessen lassen, dass sie eine echte Bedrohung darstellte und dass es seine Aufgabe war, sie aus dem Ort zu vertreiben.
Tally sah ihm direkt in die Augen. „Sie scheinen mir nicht der Typ zu sein, der sich darum schert, was die Leute über ihn denken.“
„Nur weil Sie sich den Dorfklatsch über mich angehört haben, glauben Sie ja nicht, dass Sie auch nur das Geringste über mich wissen!“
„Eigentlich gab es gar keinen Klatsch“, gab sie widerwillig zu. „Sie scheinen ein durchaus anerkanntes Mitglied dieser Gemeinde zu sein.“
„Sie sagen das, als wollten Sie damit andeuten, dass es mir wohl irgendwie gelungen sei, ein ganzes Dorf zum Narren zu halten.“
„Den meisten Bewohnern ist es offensichtlich erspart geblieben, Sie nur mit einem Handtuch bekleidet zu sehen. Und außerdem“, fuhr sie fort, „erscheint es mir für ein Mitglied des ‚Wir heiraten nicht, nie und nimmer‘-Klubs doch ungewöhnlich, eine wildfremde Frau, die vor der Haustür steht, zu küssen.“
Stan hatte geplaudert! Der Klub war streng geheim!
„Küssen und Heiraten sind zwei verschiedene Dinge. Im Übrigen ist das ja alles hochinteressant, aber Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet. Warum interessieren Sie sich so für mich?“
Erneut sah sie auf ihre Schuhspitzen.
„Haben Sie die Sprache verloren?“ fragte er. „Ich möchte wissen, warum Sie sich im ganzen Dorf nach mir erkundigt haben.“
„In Ordnung“, sagte sie. „Meine Schwester hat Ihnen eine kleine Erbschaft hinterlassen, und ich wollte wissen, ob Sie sie überhaupt verdient haben. Ich werde Ihnen einen Scheck schicken.“
Fasziniert beobachtete er, wie sich zunächst ihre Nasespitze rot färbte, dann ihre Ohrläppchen und schließlich ihr Hals.
Er vermutete, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie gelogen hatte.
„Versuchen Sie es noch einmal“, sagte er, verschränkte die Arme vor der Brust und bedachte sie mit einem der Blicke, die Stan beim gemeinsamen Billard-Spiel immer dazu brachten, die Kugel zu verfehlen.
Sie atmete tief ein und vermied es, ihn anzusehen. Ihre Hände berührten den obersten Knopf ihrer Bluse, um zu überprüfen, ob er auch wirklich geschlossen war. „Ich habe ein Foto von Ihnen unter den Sachen meiner Schwester gefunden“, sagte sie schließlich.
„Und?“
„Ich war neugierig. Ich wollte Sie kennen lernen.“ Ihre leuchtend roten Ohrläppchen nahmen die Farbe von Roter Bete an.
„Versuchen Sie gar nicht erst, mir zu schmeicheln“, sagte J. D. „Sie sind doch wohl nicht den ganzen Weg hierher gekommen, weil Sie ein Bild von mir gesehen haben und mich unwiderstehlich attraktiv fanden. Sie könnten da, wo Sie herkommen, jeden Mann haben, den Sie mit Ihren großen Augen ansehen. Sie haben es nicht nötig, deshalb durch das ganze Land zu fahren.“
„Ich habe keineswegs versucht, Ihnen zu schmeicheln“, entgegnete sie. „Und ich habe in der Tat zu Hause einen Mann, den ich mit größter Wahrscheinlichkeit noch vor Ende des Jahres heiraten werde.“
Ihre Begeisterung, als sie von ihrer bevorstehenden Hochzeit sprach, war kaum zu unterbieten. Sie klang wie eine viktorianische Jungfer, die gegen ihren Willen verheiratet wurde.
Nicht dass J. D. sich für die Einzelheiten ihres beklagenswerten Liebenslebens interessiert hätte. Er wollte nicht einmal darüber nachdenken, warum ihre leidenschaftslose Erklärung ihm einen Stich versetzte, in dem sich Mitleid mit dem Wunsch vermischte, sie noch einmal zu küssen.
„Sagen Sie mir die Wahrheit. Ich weiß, dass Sie und Ihre Schwester nicht viel davon verstehen, aber ich werde nicht locker lassen, bis Sie mir die Wahrheit gesagt haben.“
„Bitte sprechen Sie nicht so über meine Schwester.“ Der plötzliche Schmerz in ihrer Stimme, die Zärtlichkeit, mit der sie von ihrer Schwester sprach, berührten ihn noch mehr als die nüchterne Ankündigung ihrer Heirat. „Elana war krank“, sagte sie leise.
Die Wahrheit, endlich. „Nun, als Sie gesagt haben, dass sie gestorben ist, da habe ich bereits angenommen, dass sie krank war.“
„Nein. Sie starb bei einem Autounfall. Sie war schon ihr ganzes Leben krank. Eine psychische Störung.“
„Elana?“ fragte er ungläubig.
„Sie tat manchmal den Menschen weh, die sie liebten. Sie konnte nicht anders.“
„Elana?“ fragte er erneut.
Tally nickte. „Sie haben sie wahrscheinlich in einer Phase kennen gelernt, als es ihr gut ging. Voller Energie? Voller Begeisterung und scheinbar unerschöpflicher Lebenslust?“
Er starrte sie mit offenem Mund an.
„Alle liebten sie, wenn sie so war“, sagte Tally sanft.
„Ich habe nie gesagt, dass ich sie geliebt habe“, wandte er düster ein.
„Ich glaube, das haben Sie.“
„Lächerlich! Wie kommen Sie darauf?“
„Wegen des Bildes, das ich gefunden habe.“ Sie zögerte. „Und wegen der Art, wie Sie mich geküsst haben, als Sie dachten, ich sei Elana.“
Hätte er doch nur nach Stans Anruf heute Morgen das „Geschlossen“-Schild an die Tür seiner Werkstatt gehängt und wäre für ein oder zwei Wochen zum Angeln gefahren!
„Sie reden immer noch um den heißen Brei herum. Lassen Sie mich die Frage ganz einfach stellen: Was macht Tally Smith in North Dakota?“
„Ich wollte etwas über den Mann erfahren, den meine Schwester geliebt hat.“
J. D. schnaubte verächtlich. „Sie hat mich nicht geliebt.“
„Doch, das hat sie. Deshalb hat sie Sie wahrscheinlich auch verlassen. Sie spürte, dass es bergab mit ihr ging, und wollte nicht, dass Sie sie so sehen.“
Er beobachtete sie aufmerksam. Tränen glänzten in ihren Augenwinkeln. Er war nicht der Einzige, dem Elana wehgetan hatte. Tally hatte gesagt, dass alle ihre Schwester geliebt hatten, wenn es ihr gut ging. Er vermutete, dass nur wenige sie geliebt hatten, wenn es ihr schlecht ging.
Plötzlich empfand er Mitleid mit ihr. „Es tut mir leid … Wirklich.“
Tally blinzelte und verkündete dann, eine Spur zu munter: „Wie dem auch sei, ich habe erfahren, was ich wissen wollte, und es wird Sie freuen zu hören, dass ich gleich morgen früh zurück nach Hause fahre.“
„Schön“, antwortete er, aber er fühlte sich weder übermäßig zufrieden noch vollkommen überzeugt.
„Auf Wiedersehen, J. D.“, sagte sie und hielt ihm ihre Hand hin.
Er machte den Fehler, sie zu nehmen. Ein Schauer des Verlangens überkam ihn, als er sie berührte, und ein Bedauern, dass ihre Bekanntschaft bereits vorbei war, bevor sie überhaupt begonnen hatte.
J. D. zog seine Hand zurück und lief langsam Mrs. Saddlechilds Einfahrt hinunter. Als er in seinen Wagen stieg, war er verstörter als bei seiner Ankunft. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Immerhin hatte er erreicht, was er wollte: Tally hatte ihm versichert, dass sie die Stadt verlassen würde. Er fuhr nach Hause und machte sich wieder an die Arbeit. Danach aß er zu Abend und duschte, diesmal ohne zu singen. Dann legte er sich schlafen. Ein unbehagliches Gefühl hatte sich in seinem Hinterkopf eingenistet. Ihm war, als habe Tally ihm nicht den wahren Grund für ihren Aufenthalt verraten, aber als könne er dahinterkommen, wenn er nur scharf genug nachdachte.
Mitten in der Nacht erwachte er. Das Mondlicht malte einen hellen Streifen auf seinen Fußboden, und der einsame Ruf eines Kojoten hing noch in der Luft. J. D. lag ganz still und lauschte seinem eigenen Herzschlag.
Warum war Tally Smith wirklich hier? Dieses ganze Gerede davon, dass sie den Mann sehen wollte, den ihre Schwester geliebt hatte, oder dass sie von seinem Bild fasziniert gewesen sei, ergab keinen Sinn. Elana hätte so gehandelt, aber ihre Schwester schien eher der vorsichtige, bedächtige, vernünftige Typ zu sein. Der Typ, der alles andere war als impulsiv.
Aus irgendeinem Grund log Tally Smith oder sagte ihm zumindest nicht die volle Wahrheit.
Der Kojote heulte erneut, und ein Schauer lief J. D. kalt den Rücken hinunter.
Und dann wusste er es. Mit der Klarheit, die einen manchmal mitten in der Nacht erreicht, in den Momenten zwischen Schlafen und Wachen, wusste er es.
Er setzte sich auf. Sein Herz klopfte wie verrückt.
Immer wieder versuchte er sich zu sagen, dass es nicht wahr sein konnte, aber es gelang ihm nicht, sich zu überzeugen. Schließlich schlug er die Decke zurück, stand auf und schlüpfte fluchend in seine Jeans, dann in seine Schuhe. Während er zu seinem Wagen lief, zog er sich ein Hemd über.
Was war, wenn sie nicht bis zum Morgen gewartet hatte und schon fort war? Er wusste nichts über sie, nur dass sie Elanas Schwester war und aus Saskatchewan stammte. Wie viele Smiths würde es wohl jenseits der Grenze geben?
Egal. Er würde jeden einzelnen Smith in Kanada aufsuchen, bis er sich von der Wahrheit überzeugt hatte, die sich vor wenigen Minuten in seinem Herzen und in seinem Kopf festgesetzt hatte.
Ohne das Hemd zuzuknöpfen, sprang er in den Transporter und brauste in Richtung Stadt. In dieser Gegend gab es für gewöhnlich wenig Polizeikontrollen, und es würde mit Sicherheit keine geben um – er sah auf seine Uhr – halb vier Uhr morgens.
Als er den Parkplatz des Palmtree erreichte und den grauen Nissan entdeckte, fühlte er eine grenzenlose Erleichterung in sich aufsteigen. Es war der einzige Wagen, der dort stand. Das war gut: Er würde also nicht alle Gäste aus dem Bett holen müssen, um sie zu finden.
J. D. stieg aus dem Wagen und hämmerte mit der Faust gegen die Tür des Zimmers, das ihrem Auto am nächsten war, wartete und hämmerte erneut.
Nach einer Weile sah er, wie sich der Vorhang des Fensters einen winzigen Spalt öffnete und wieder schloss. Dann war wieder alles ruhig.
„Tally Smith, ich weiß, dass Sie wach sind.“ Es war nicht so leicht, die richtige Lautstärke zu finden, eine, die sie zwar hören konnte, aber nicht der Rest der Stadt.
Stille.
„Machen Sie die Tür auf, oder ich breche sie auf!“ Diesmal hatte er schon etwas lauter gesprochen.
Erneut Stille. Nach all den Erkundigungen, die sie über ihn eingeholt hatte, hätte sie wissen müssen, dass es besser war, ihn nicht herauszufordern.
„Ich zähle bis drei!“ schrie er nun fast.
„Eins.“
Er glaubte, ein raschelndes Geräusch auf der anderen Seite der Tür zu hören.
„Zwei.“
Der Riegel wurde zurückgeschoben.
„Dr…“
Die Tür öffnete sich einen Spalt, und er erspähte Tally, die ihn verärgert musterte.
„Was soll denn das?“ flüsterte sie. „Sie werden ja noch das ganze Dorf wecken!“
Das Haar fiel ihr weich auf die Schultern, ein verführerischer Anblick, der so gar nicht zu dem langärmligen, hochgeschlossenen Nachthemd passte, das ihn an die Fernseh-Serie „Unsere kleine Farm“ erinnerte.
„Lassen Sie mich rein“, verlangte er.
„Nein! Es ist mitten in der Nacht! Sind Sie betrunken?“
Betrunken? „Nein, ich bin nicht betrunken. Aber wenn ich mich betrinken wollte, wären Sie tatsächlich ein guter Grund!“
„Ich habe nicht vor, mich hier mitten in der Nacht von Ihnen beleidigen zu lassen“, erklärte sie und versuchte, die Tür zu schließen. Schnell schob er seinen Fuß dazwischen.
„Wir müssen uns unterhalten“, sagte er.
„Das wird bis morgen warten müssen.“
Ihm war schon zuvor aufgefallen, wie bestimmt sie war. Nun nahm diese Beobachtung eine ganz neue Bedeutung an, da er wusste, dass sein Leben für immer mit dem ihren verbunden war. „Es ist schon morgen“, sagte er.
Zögernd öffnete sie die Tür und sah so lange vorwurfsvoll auf seinen Fuß, bis er ihn wieder zurückzog.
„Also“, sagte sie ungeduldig, „unterhalten wir uns.“ An ihrem Handgelenk trug sie eine Uhr. Demonstrativ warf sie einen Blick darauf, um zu zeigen, dass ihre Zeit auch um diese Uhrzeit kostbar war.
Langsam und deutlich sagte er: „Sie sind nicht hierher gekommen, um eine verflossene Liebschaft Ihrer Schwester aufzuspüren.“ Es war eine Feststellung, keine Frage.
Tallys Gesichtsausdruck wechselte von müde zu argwöhnisch: „Und wie sieht Ihre Theorie dazu aus?“ fragte sie spitz.
„Sie hat ein Kind bekommen.“ Auch das war keine Frage. „Von mir.“
Die Farbe war so schnell aus ihrem Gesicht gewichen, dass er befürchtete, sie könne in Ohnmacht fallen. Sie stand wie angewurzelt in der Tür und sah ihn mit großen Augen an.
Als verzögerte Reaktion auf seine frühere Lautstärke ging nun im Büro des Motels das Licht an. J. D. nahm Tally an der Schulter und führte sie ins Zimmer. Dann schloss er die Tür und lehnte sich dagegen.
„Junge oder Mädchen?“ fragte er mit eisiger Stimme.
„Ein Junge“, flüsterte Tally.
„Ich will meinen Sohn sehen. Ziehen Sie sich an, wir reisen sofort ab.“
3. KAPITEL
„Wir gehen nirgendwohin!“ protestierte Tally, nachdem sie ihre Stimme wiedergefunden hatte.
J. D. funkelte sie herausfordernd an. Sie konnte die Stärke und Entschlossenheit in seinem Blick erkennen und wusste plötzlich, dass es keinen Zweck hatte, sich mit diesem Mann anzulegen.
„Ziehen Sie sich an“, brummte er, „und packen Sie Ihre Sachen zusammen!“
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Ihr Herz schlug heftig, aber sie durfte ihn nicht wissen lassen, dass sie diese Entwicklung der Ereignisse gleichzeitig beängstigend und aufregend fand.
„Nein“, sagte sie und beglückwünschte sich insgeheim für ihren ruhigen Tonfall. „Es sei denn, Sie schleifen mich nach draußen, während ich schreie und um mich trete.“ Er schien von dieser Drohung nicht beeindruckt zu sein, und so fuhr sie fort: „Das würde sicherlich für einigen Aufruhr in Dancer sorgen.“
J. D. beugte sich vor, und sein Gesicht war so dicht an ihrem, dass sie seinen Atem spüren konnte. In seinen Augen lag ein entschlossener Ausdruck, der sie nichts Gutes ahnen ließ.
„Fordern Sie mich besser nicht heraus“, warnte er sie. „Ich würde Sie ohne zu zögern über die Schulter werfen und hinaustragen. Sie sehen nicht so aus, als würden Sie mehr wiegen als ein Sack Kartoffeln. Und über den Aufruhr, den das verursachen würde, mache ich mir keine Gedanken.“
„Gestern Morgen haben Sie aber ganz anders geklungen“, erinnerte sie ihn.
„Da war ich auch noch ein ganz anderer Mann. Seitdem hat sich alles verändert.“
Tally milderte ihren Tonfall und berührte J. D. am Arm: „Lassen Sie uns doch vernünftig sein. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht bis morgen warten können.“
Ihre sanfte Stimme schien ihn nicht im Geringsten zu beeindrucken, und er starrte ungnädig auf ihre Hand, bis sie sie von seinem Arm nahm. „Vielleicht wissen Sie es nicht, aber Ihre Schwester hat mich damals glauben lassen, dass sie mich liebt, und ist dann eines Nachts ohne ein Wort des Abschieds verschwunden. Ich habe also schon einmal erlebt, wie eine Smith sich in Luft auflöst, und ich werde es nicht ein zweites Mal so weit kommen lassen.“
„Nur weil ich Elanas Schwester bin, haben Sie kein Recht, mir die gleichen Fehler vorzuwerfen! Ich habe Ihnen keinen Anlass gegeben, mir nicht zu trauen.“
Nach all den Jahren, in denen sie sich einen guten Ruf erworben hatte, lebte immer noch die Angst in ihr, die Leute könnten sie ansehen und ihre Schwester erblicken, jemanden, der ihres Vertrauens nicht würdig war.
„Sie haben mir verschwiegen, dass ich einen Sohn habe. Das scheint mir ein ziemlich guter Grund zu sein, Ihnen nicht zu vertrauen. Übrigens: Wann hatten Sie vor, mir von ihm zu erzählen?“
Als sie darauf schwieg, fuhr er fort: „Oder vielleicht wollten Sie das gar nicht. Vielleicht habe ich den Anforderungstest, den Sie hier mit Ihren Interviews durchgeführt haben, nicht bestanden.“
„Ich wollte es Ihnen ganz bestimmt sagen“, versicherte Tally – auch wenn sie in Wahrheit die ganze Nacht darüber nachgedacht hatte, was sie in der Angelegenheit J. D. Turner unternehmen sollte. Ihr war, als sei die Entscheidung, ob sie ihm von seinem Sohn erzählen solle, untrennbar mit der Farbe seiner Augen verbunden und mit dem Geschmack seiner Lippen, und dabei wollte sie doch vor allen Dingen vernünftig handeln.
„Ich schätze, Sie lügen nicht häufig. Deshalb färbt sich Ihre Nasenspitze auch jedes Mal rot, wenn Sie flunkern. Und Ihre Ohren und Ihr Hals.“
Er berührte sanft mit dem Finger ihren Hals.
„Ich … ich habe nur auf den richtigen Augenblick gewartet“, stammelte sie verlegen.
„Der richtige Augenblick wäre gewesen, als Sie vor meiner Haustür standen.“
„Nachdem Sie sich wie ein Wilder benommen haben?“ entgegnete sie. Seine Hand lag immer noch auf ihrem Hals und fühlte sich merkwürdig angenehm an. Wenn man bedachte, dass er sie ansah, als wolle er sie erwürgen …
In diesem Augenblick schien auch er zu bemerken, dass er sie immer noch berührte. Hastig zog er die Hand weg. „Ich hatte also recht! Sie wollten erst in aller Ruhe über meine Vater-Qualitäten entscheiden.“
„Ich wollte nur das Beste für meinen Neffen“, verteidigte Tally sich.
„Wissen Sie was? Sie können aufhören, Schicksal zu spielen. Ich übernehme von jetzt an.“ Er verschränkte die Arme vor seiner Brust und sah sie herausfordernd an.
„Wenn Sie mich zwingen, mit Ihnen zu gehen, ist das Kidnapping!“ sagte sie in einem Tonfall, der sich in ihrem Beruf als Lehrerin schon des Öfteren bewährt hatte.
Er lächelte, ein spöttisches Lächeln, das ihn gefährlich und zugleich unverschämt gut aussehen ließ.
„Außerdem kann ich nachts nicht Auto fahren“, erklärte sie hochmütig, „ich bin nachtblind.“
Er schnaubte nur verächtlich. „Glauben Sie etwa, ich wollte Sie fahren lassen?“
„Die Fahrt mit einer schlecht gelaunten Frau würde Ihnen keine Freude machen“, gab sie zu bedenken.
„Wissen Sie was? Ich würde bis ans Ende der Welt gehen, um meinen Sohn zu sehen. Sie und Ihre schlechte Laune stellen also ein relativ geringes Hindernis dar.“
Gegen ihren Willen empfand Tally bei diesen Worten so etwas wie Respekt für den Eifer, mit dem dieser Mann sich für einen Jungen einsetzte, den er gar nicht kannte.
Sie war nach Dancer gekommen, um zu sehen, ob der Mann auf dem Foto ein geeigneter Vater für Jed sein könnte. Ein besserer als Herbert. Sie erkannte nun, dass sie den Plan nicht vollständig durchdacht hatte. Auf die Idee, dass J. D. ihr die Entscheidung aus der Hand nehmen könnte, war sie nie gekommen.
„Was mein Neffe vor allen Dingen braucht, ist ein geregeltes Leben“, warnte sie ihn. Als er sich davon nicht beeindruckt zeigte, fügte sie hinzu: „Das habe ich gelesen.“
„Sehen Sie, Sie scheinen einer dieser Menschen zu sein, die mit einer Gebrauchsanweisung durchs Leben gehen. Aber manchmal muss man seine Pläne ändern und spontan der Situation anpassen.“
Wenn er sein ganzes Leben mit Elana verbracht hätte, würde er so etwas nicht sagen, dachte Tally. Spontanes Handeln barg viel zu viele Risiken.
„Sie sollen wissen, dass ich einen Vater für Jed suche“, sagte sie. Sie schloss die Augen, nahm ihren ganzen Mut zusammen und fuhr fort: „Er soll in einer ganz normalen und glücklichen Familie aufwachsen.“ Für den Fall, dass sie sich nicht deutlich genug ausgedrückt hatte, setzte sie noch hinzu: „Mit einer Mutter und einem Vater.“
„Jed“, wiederholte J. D. abwesend. Dann erst drang der Rest ihrer Äußerung zu ihm durch. Sein Mund öffnete und schloss sich wieder. Er atmete tief ein und sah ihr fest in die Augen: „Ich bin zwar sein Vater, aber das ändert nichts an meiner Einstellung zum Thema Heiraten.“
„Ich habe Ihnen auch keineswegs einen Antrag gemacht! Im Gegenteil, ich habe bereits einen Mann ausgewählt.“