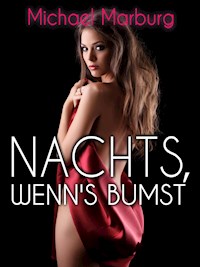Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Erotik
- Serie: Vier-Sterne-Reihe
- Sprache: Deutsch
Martin Hoffmann befindet sich tief in einem Wald. Er hat schon seit einer Stunde die Orientierung verloren. Er ist nass und dreckig, aber zum Glück kommt ein Auto und nimmt ihn mit. Der Fahrer fährt ihn zu einem wunderschönen Schloss und plötzlich steht er in einem sehr schönen Raum, der mit alten Möbeln ausgestattet ist. Hinter einer Tür findet Martin ein Schlafzimmer, in dem ein Himmelbett steht. Dort trifft er Marion, die außerordentlich nett zu ihm ist. Sie ist jung mit blondem langem Haar und einem hübschen Gesicht mit vollen Lippen. Das schwarze Kleid ist so kurz, dass es nur etwa die Hälfte der Oberschenkel bedeckt und unter dem Kleid wölben sich zwei volle Brüste. Sofort fällt ihm auf, dass Marion keinen Slip trägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jungfrauen-Schloß
Michael Marburg
Jungfrauen-Schloß
Copyright © 2017 Zettner Verlag und Michael Marburg
All rights reserved
ISBN: 9788711718049
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Zettner Verlag und Autors nicht gestattet.
1
Das Geheimnis einer Nacht
Es war eine Baumwurzel, die Martin Hoffmann zum Straucheln brachte. Er stolperte, ruderte mit den Armen durch die Luft, fand keinen Halt und schlug lang hin. Mitten in eine schlammige Regenpfütze hinein.
Fluchend kam Martin wieder hoch. Jetzt war er nicht nur durchgeweicht vom Regen, sondern auch noch starrend vor Schmutz.
Die Blitze zuckten, und der Donner krachte. Rollend schwang sein Echo über die dicht bewaldeten Kuppen der Berge hinweg. Schlag folgte auf Schlag, und wenn die rasch aufeinanderfolgenden Blitze nicht gewesen wären, dann hätte Martin Hoffmann kaum die Hand vor seinen Augen sehen können.
Es goß in Strömen, es war Nacht, und Martin Hoffmann hatte schon seit einer Stunde die Orientierung verloren. Im fahlen Aufflammen der Blitze sahen die Bäume ringsum wie Gespenster aus. Der Weg sah aus wie eine Flut, die mitten in die Hölle führte. Und Martin Hoffmann tappte weiter, naß und wütend, schlotternd vor Kälte. Er mußte weiter, es gab für ihn keine Wahl. Irgendwann mußte doch dieser Weg — verdammt noch mal! — ihn zu einem Ziel bringen. Zu einem Dorf. Zu einer Straße. Oder wenigstens zu einer Hütte, in der er Schutz finden konnte vor dem ewig prasselnden Regen.
Der Weg führte im Moment bergab, er kam von einem kleinen Bergsattel herunter, den Martin Hoffmann rutschend und strauchelnd und fluchend überwunden hatte — vergeblich, wie er jetzt wußte, denn auch hier hinter diesem Sattel gab es nichts als Wald und Regen und Dreck und gottverlassene Einsamkeit.
Wieder geriet Martin Hoffmann ins Rutschen, aber diesmal konnte er sich an einem Baumstamm festhalten. Weiter, nur weiter!
Bei jedem Schritt quatschte das Wasser in den Schuhen. Die Kleidung klebte auf Martins frierendem Körper, kein trockener Faden war mehr an ihm.
Dieser Wald schien keinen Anfang zu haben und kein Ende. Daß es derart riesige Waldflächen überhaupt noch gab! Martin Hoffmann vermutete zu Recht, daß er in gewaltigen Umwegen durch die schmalen Wege irrte, daß er eigentlich schon längst aus dem Wald hätte heraus sein müssen, wenn es ihm gelungen wäre, eine einmal eingeschlagene Richtung beizubehalten.
Freckendorf — dort hätte er eigentlich schon längst angekommen sein müssen. Dort wartete im einzigen Gasthof des Ortes ein Zimmer auf ihn, trocken und halbwegs gemütlich, dort hatte er trockenes Zeug, dort konnte er eine deftige Mahlzeit bekommen, aber er mußte eben erst einmal hinfinden.
Verfluchte Einsamkeit! Verdammter Regen! Diese beschissene Finsternis, die sich wie ein undurchdringlicher Wall vor Martin auftürmte, die ihn verschluckte und nicht mehr aus ihren unheimlichen Fängen freigeben wollte.
Dabei hatte alles so schön und so herrlich und so harmlos begonnen.
Nach dem Mittagessen hatte Martin den Gasthof verlassen und war in den Wald gewandert, weil er allein sein wollte, weil er die unberührte Natur erleben, weil er nachdenken wollte.
Gegen sieben Uhr abends war er müde gewesen, er hatte sich einfach ins Gras gelegt und war eingeschlafen. Nein, nicht sofort, erst hatte er sich noch einen heruntergeholt. Nur so, weil ihm danach zumute war. Und wohl auch, weil er allmählich wieder etwas brauchte. Trotz seiner Enttäuschung mit Hilde.
Hilde war nämlich vor auf den Tag genau drei Wochen aus seinem Bett gestiegen und hatte ihm klipp und klar eröffnet, daß dies der letzte Fick gewesen sei.
„Ich heirate nämlich übermorgen“, hatte Hilde nüchtern gesagt.
Sie heiratete einen Kaufhausbesitzer. Außer seinem Laden besaß er einen dicken Bauch, war kurzatmig und hatte eine ansehnliche Glatze. Vor allem aber hatte er viel Geld, und das war für Hilde ausschlaggebend.
Martin hatte Hilde gern gevögelt, daher schmerzte es ihn, daß sie so plötzlich davonlief. Zwei Wochen lang hatte Martin Hoffmann versucht, seine Enttäuschung durch Arbeit zu überwinden, aber es war ihm nicht gelungen. Deswegen war er seit einer Woche in dieser entlegenen Gegend. Er wollte Abstand gewinnen, in sich gehen, zu vergessen versuchen.
Seit drei Wochen hatte er nicht mehr gefickt, und so war es kein Wunder, daß er jetzt, allmählich wieder zu sich selbst zurückfindend, sich im Handbetrieb Erleichterung verschaffen mußte.
Er hatte also onaniert und anschließend tief geschlafen, und als der rollende Donner ihn geweckt hatte, war es plötzlich dunkel gewesen, der Regen hatte eingesetzt, und nach ein paar Minuten hatte Martin bereits jegliche Orientierung verloren.
Ein neuer Blitz zuckte auf.
Martin Hoffmann glaubte, etwa zwanzig Meter voraus eine Querschneise erkennen zu können. Vielleicht stieß er gleich auf einen etwas breiteren, leichter zu begehenden Weg.
Hastig stolperte Martin voran.
Plötzlich hatte er keinen Boden mehr unter den Füßen. Mit einem Schrei stürzte Martin in einen knietiefen Graben, schwer schlug er auf, mit dem Gesicht mitten in nasses, schmutziges Gras. Keuchend und schimpfend raffte Martin sich wieder auf — und hatte auf einmal festen Boden unter den Füßen.
Glatten Boden. Den Boden einer Straße.
„Wenigstens etwas …“, knurrte Martin, versuchte, den Schmutz aus seinem Gesicht zu wischen, aber seine Hände sahen genau so schlimm aus wie sein Gesicht, es nutzte nichts.
Wohin jetzt? Nach rechts, nach links?
Weil die Straße sich nach links talwärts senkte, wählte Martin diese Richtung. Orte liegen meistens in Tälern, dachte er.
Nach knapp vierzig Schritten blieb Martin stehen. Von vorn kam ihm Scheinwerferlicht entgegen. Motorengeräusch klang auf. Ein Auto, ein Mensch!
Eigentlich hätte Martin jetzt winken müssen. Aber er tat es nicht, trat nur zur Seite, starrte dem Wagen aus brennenden Augen entgegen. Denn in dem Zustand, in dem er sich jetzt befand, mußte er wirken wie ein aus dem Zuchthaus entwichener Schwerverbrecher. Es war sinnlos, jemand bitten zu wollen, daß er ihn in seinem Wagen mitnahm.
Der Wagen kam näher, die Scheinwerfer erfaßten Martin. Sekunden später verringerte der Wagen seine Geschwindigkeit. Und als er genau auf Martins Höhe war, hielt er an.
„Was ist denn mit Ihnen los?“ rief eine Männerstimme. „Ich habe mich verirrt“, erwiderte Martin. Seine Stimme war heiser. „In welcher Richtung komme ich am schnellsten in einen Ort?“
Die Antwort ließ ein paar Augenblicke lang auf sich warten. Martin glaubte im Innern des Wagens die Umrisse zweier Menschen zu erkennen. Und er meinte zu hören, daß die beiden Menschen da drinnen im Wagen miteinander sprachen.
„Kommen Sie her“, klang die Männerstimme nun wieder auf. „Wir nehmen Sie mit.“
Mit steifen Knien ging Martin Hoffmann hinüber, bis er neben dem Fahrerfenster angekommen war.
„Das ist sehr nett von Ihnen“, sagte er, „aber ich bin total durchnäßt. Ich ruiniere Ihnen bestimmt die Polster.“
„Da hinten liegt eine Decke, darauf können Sie sich setzen“, antwortete der Fahrer und entriegelte eine der beiden hinteren Türen.
Das Innenlicht flammte auf. Martin erkannte einenMann von vielleicht fünfunddreißig Jahren am Lenkrad, neben ihm eine junge Frau, von der Martin nicht viel sehen konnte, denn sie hatte ein seidenes Kopftuch umgeschlungen, das ihr Gesicht fast völlig verdeckte.
„Danke“, murmelte Martin und kroch in den Wagen.
Der Schlag klappte zu, der Wagen rollte an. Weiche Polster, wohlige Wärme, Trockenheit, der Duft eines feinen Parfüms.
„Ich glaube, Sie haben mir eben das Leben gerettet“, versuchte Martin zu scherzen.
„Bis zum nächsten Dorf sind es etwa acht Kilometer“, sagte der Fahrer und nahm gekonnt eine enge Kurve. „Und in der Richtung, in der Sie gingen, sind es elf Kilometer.“
„Also haben Sie mir tatsächlich das Leben gerettet“, erwiderte Martin. „Denn bis dorthin wäre ich im Leben nicht mehr gekommen.“
„Das haben wir uns auch gedacht“, meinte der Fahrer. Martin tastete nach seinen Zigaretten. Er fand sie, aber sie nutzten ihm nichts, denn sie waren total durchnäßt. Der Fahrer verringerte die Geschwindigkeit. Im Lichte der Scheinwerfer, hinter den surrenden Scheibenwischern, tauchte die Abzweigung einer schmalen Nebenstraße auf. Der Wagen bog ein.
Es ging bergauf, die schmale Straße wand sich durch den dichten Wald. Einzelne Felsgruppen ragten rechts und links von der Straße auf.
„Liegt hier oben überhaupt ein Dorf?“ fragte Martin. „Wir sind gleich da“, erwiderte der Fahrer.
Sie waren wirklich da, denn hinter einer sehr engen Kurve tauchte plötzlich eine Zugbrücke aus der Finsternis, und sie führte in eine Burg hinein.
Der Wagen rollte über die Zugbrücke, passierte die torbogenähnliche Einfahrt und erreichte den Burghof. Er war von drei Seiten mit Baulichkeiten umgeben, auf der vierten Seite gab es nur eine Wehrmauer.
Links stand ein Tor offen. Der Wagen fuhr hinein. Kein Regen prasselte mehr auf das Wagendach. Das Geräusch des Motors erstarb.
„Bitte, steigen Sie aus“, sagte der Fahrer und tat es selbst. Licht flammte auf.
Während Martin aus dem Wagen kletterte, sah er, daß in der gewölbeartigen Garage noch drei andere Wagen standen. Ein Jaguar, ein Mercedes und ein schnittiger Sportwagen.
„Hier entlang, bitte“, sagte der Fahrer und winkte Martin, ihm zu folgen.
Während die Frau rasch ausschritt und einer eisenbeschlagenen alten Tür zustrebte, folgten der Fahrer und Martin ihr. Hinter der Tür lag ein sehr schöner Raum mit schwarzer Balkendecke, schweren alten Möbeln und zahllosen Jagdtrophäen an den Wänden. Über einem Kamin hing der mächtige Kopf eines Elches. Eine Art Jagdzimmer, dachte Martin beeindruckt.
Noch ehe er sich richtig umgesehen hatte, war die Frau schon verschwunden. Der Fahrer stand drüben, nahm seine graue Mütze ab und betrachtete Martin lächelnd. „Sie sehen ja schlimm aus“, sagte er.
Martin blickte an sich hinunter. Dieser Bemerkung war nichts hinzuzufügen.
„Ich weiß nicht, wie lange ich durch den Regen geirrt bin“, sagte Martin kläglich. „Ich weiß aber genau, daß ich zweimal auf Gottes Erdboden gelandet bin. Zuletzt im Straßengraben.“
„Kommen Sie bitte“, sagte der Fahrer.
Martin war alles egal. Er folgte dem anderen. Hinter dem Jagdzimmer erreichten sie eine große Halle, zwei Stockwerke hoch. An den Wänden standen Ritterrüstungen, altersdunkle Gemälde hingen zwischen ihnen, in den Ecken des Raumes schwangen sich zwei breite, hölzerne Wendeltreppen in die Höhe. Auf dem Boden lag ein riesiger alter Perserteppich.
Der Fahrer stieg eine der beiden Treppen hinauf. Auf dem roten Läufer, der über die Stufen gespannt war, hinterließen Martins Schuhe unschöne Flecken.
Oben gab es eine Galerie, nach rechts und nach links zweigten Korridore ab. Gobelins waren hier der Wandschmuck. Der Fahrer wählte den linken Korridor und stieß nach etwa sieben oder acht Metern eine Tür auf. „Hier können Sie aus sich wieder einen Menschen machen“, sagte der Fahrer und wies in den Raum, der dahinter lag. „Ich bringe Ihnen einen Hausmantel, damit Sie aus Ihren nassen Sachen herauskönnen.“
„Sehr liebenswürdig“, murmelte Martin. „Sie sind für mich der reinste Engel, wissen Sie das?“
„Freut mich“, grinste der Fahrer. „Vermutlich haben Sie Hunger, nicht wahr?“
„Ich könnte die Zähne in die Wand schlagen“, entgegnete Martin Hoffmann.
„Wenn Sie fertig sind, kommen Sie herunter in die Halle. Ich werde dafür sorgen, daß Sie etwas zwischen die Zähne bekommen“, erklärte der Fahrer. „Selbstverständlich können Sie über Nacht hierbleiben.“
„Ich weiß nicht, ob ich das annehmen darf …“
„Sie können es ruhig annehmen, denn wenn Sie nicht bleiben wollen, muß ich noch einmal den Wagen aus dem Stall holen, und dazu habe ich keine Lust mehr. Ich habe einen langen Tag hinter mir, verstehen Sie? Ich komme gerade aus München.“
„Ich verstehe. Und vielen Dank auch für alles. Bei wem habe ich eigentlich die Ehre?“
„Sie befinden sich auf dem Sitz der Komteß von Bregg. Es war die Dame, die mit mir im Wagen saß. Ich bin Peter, Mädchen für alles, unter anderem Fahrer und Menschenretter.“
„Sie scheinen eine wahre Perle zu sein“, grinste Martin. Peter grinste zurück und ging. Martin schaute sich um. Er stand in einem sehr schönen, salonähnlichen Raum, der mit alten Möbeln stilvoll ausgestattet war. Hinter einer Tür fand Martin ein Schlafzimmer, in dem ein Himmelbett stand. Tatsächlich, eines mit gedrechselten Pfosten und einem gelben Baldachin, bestickt mit bunten Blumen und phantastischen Tieren. Neben dem Schlafzimmer fand Martin ein hochmodernes Bad, in dem es an nichts fehlte. Die Armaturen waren vergoldet, die Spiegel waren riesig.
Martin riß sich die nassen Kleider vom Leibe. Eine Minute später stand er unter der Dusche und wurde wieder ein Mensch.
Angetan mit einem dunkelroten Hausmantel, den der Fahrer inzwischen gebracht hatte, stieg Martin über die Wendeltreppe in die Halle hinunter.
Der Fahrer stand unten.
„Na, wie fühlen Sie sich?“ fragte er freundlich.
„Wie im Himmel“, sagte Martin.
„Kommen Sie bitte.“
Wieder ging es durch eine Tür. Diesmal gelangte Martin in einen kleinen Speiseraum. Auch hier herrliche alte Möbel, in der Mitte ein runder Tisch mit ein paar Stühlen. Auf dem Tisch lag ein Gedeck.
„Ich nehme an“, sagte der Fahrer, „daß Sie was Scharfes gut vertragen können.“ Er zauberte eine Cognacflasche herbei und goß zwei Gläser voll.
„Auf Ihr zweites Leben“, grinste der Fahrer.
„Auf meine Retter“, sagte Martin und kippte das Zeug hinunter. Es rann wie Feuer durch seine Kehle. „Übrigens, ich heiße Hoffmann, Martin Hoffmann.“
„Angenehm. Ich für meinen Teil ziehe mich jetzt zurück. Marion wird von jetzt an für Sie sorgen. Sie muß jeden Moment hereinkommen.“
„Dann gibt es also noch mehr solche Engel wie Sie in dieser Burg?“ fragte Martin.
Der Fahrer, der Peter hieß und müde war, wurde einer Antwort enthoben, denn Marion kam herein.
Sie war jung, zweiundzwanzig vielleicht, hatte blondes langes Haar, ein hübsches, pikantes Gesicht mit vollen Lippen. Sie trug ein schwarzes Kleid mit einer weißen Schürze. Das Kleid war kurz, es bedeckte etwa die Hälfte der Oberschenkel. Unter dem Kleid wölbten sich zwei volle Brüste.
Marion lächelte freundlich und brachte ein Tablett mit. Spiegeleier mit Schinken, kaltes Fleisch, Wurst, Käse. „Guten Abend“, sagte Marion höflich. „Hoffentlich schmeckt es Ihnen, ich konnte in der Eile leider nicht mehr auf die Beine stellen.“
„Ich sagte bereits, hier gibt es offenbar nur Engel“, sagte Martin und spürte den Donner in seinem Magen.
Der Fahrer zog sich zurück, Martin stürzte sich über das Essen. Er war hungrig wie ein Wolf. Marion war wieder verschwunden. In jeder anderen Situation hätte Martin seine Blicke viel länger auf dem hübschen Mädchen ruhen lassen, jetzt aber mußte er erst einmal etwas zwischen die Rippen bekommen.
Zehn Minuten später war Martin Hoffmann gesättigt wie ein Negerstamm nach einem gut gegrillten Watussi. „Uff!“ machte Martin, satt und zufrieden, stand auf und griff nach der Cognacflasche. Er goß sich noch einen ein und kippte ihn weg, der besseren Verdauung wegen. Marion war wieder da.
„Hat’s geschmeckt?“ fragte sie mit ihrem hübschen Lächeln.
„Ich kann’s Ihnen gar nicht beschreiben“, entgegnete Marion und ließ seine Blicke nun doch auf dem hübschen rundlichen Körper des Mädchens ruhen.
Marion kramte das Geschirr zusammen. Sie beugte sich dabei etwas über den Tisch. Der kurze Rock rutschte noch höher und ließ zwei gut gewachsene Schenkel erkennen. Auch die fein geschwungenen Waden konnten sich sehen lassen.
„Darf ich Ihnen noch etwas bringen?“ fragte Marion, als sie alles auf dem Tablett versammelt hatte.
„Danke, ich bin wunschlos glücklich“, entgegnete Martin.
„Hoffentlich stört Sie mein Aufzug nicht.“ Martin wies auf seine behaarte Brust, die aus dem Hausmantel herausschaute, und auf seine nackten Füße.
„Das macht gar nichts“, erwiderte Marion freundlich. „Wenn Sie sich nur wohlfühlen, dann können Sie hier tun und lassen, was Sie wollen, Herr Hoffmann.“
„Sie sind phantastisch, Marion“, sagte er aus ehrlicher Überzeugung. „Hoffentlich habe ich Ihnen nicht zu viele Umstände gemacht.“
„Gar nicht. Ich war sowieso noch auf. Möchten Sie jetzt zu Bett gehen, Herr Hoffmann?“
„Auch wenn’s unhöflich und undankbar klingt — ja.“
„Das verstehe ich sehr gut, Herr Hoffmann. Sie haben ja auch schlimm ausgesehen.“
Marion nahm das Tablett auf und verließ den Raum. Martin genehmigte sich noch einen Cognac, dann machte er sich ebenfalls auf den Weg. Kaum war er oben in seinem Zimmer, da klopfte es an die Tür.
Marion stand draußen. Sie hatte einen Schlafanzug über dem Arm hängen.
„Bitte“, sagte sie. „Es ist einer von Peter, sicherlich paßt er Ihnen. Darf ich Ihr Bett richten?“
„Das kann ich auch selbst …“
„Aber es ist meine Aufgabe“, lächelte Marion und ging an ihm vorbei ins Schlafzimmer, schlug das Bett auf und zog die Kissen zurecht.
Martin lehnte am Türrahmen und sah ihr zu. Seine Augen wurden groß, als er entdeckte, daß Marion keinen Slip trug. Er sah, als sie sich am Bett zu schaffen machte, ihren nackten, prallen Hintern. Zwischen den Beinen sah er einen schönen Busch blonden Schamhaares.
Trotz Martins Erschöpfung begann sein Penis sich zu regen. Der hatte nämlich für Fotzen eine Schwäche, und für hübsche Arschbacken auch, vor allem dann, wenn diese guten Stücke so nett dargeboten wurden.
„So, das wäre es“, lächelte Marion, richtete sich auf, entzog ihren schicken Hintern Martins Blicken und zupfte ihr kurzes Kleid zurecht. „Kann ich noch etwas für Sie tun?“
„Eine ganze Menge“, grinste Martin, „aber das kann ich Ihnen heute abend nicht mehr zumuten. Danke für alles.“
„Nicht die geringste Ursache“, lächelte Marion und ging mit wiegenden Hüften zur Tür. „Schlafen Sie gut, Herr Hoffmann.“
„Sie auch. Ich werde bestimmt von Ihnen träumen.“ Unter der Tür blieb Marion stehen. „Darf ich Sie fragen, woher Sie eigentlich kommen?“
„Ich wohne in Freckendorf im dortigen Gasthof. Kleine Ferien vom Ich.“
„Sind Sie allein dort, oder wäre es gut, wenn wir jemand benachrichtigen, der vielleicht auf Sie wartet?“
„Auf mich wartet niemand, vielen Dank.“
Marion ging.
Martin seufzte, warf den Bademantel ab, faltete den Schlafanzug auseinander, ließ ihn dann aber doch liegen. Er schlief ja immer nackt, weshalb sollte er jetzt so ein Ding anziehen, das nur den Pimmel einzwängte, wenn der während des Schlafens mal stehen wollte.
Martin stieg ins Bett, knipste das Licht aus und war im nächsten Moment fest eingeschlafen.
Er träumte, er läge auf einer Wiese und hörte den Blümchen beim Bimmeln zu. Weil die Sonne so schön schien, war er nackt. Er lag auf dem Rücken und ließ die Sonne den Schwanz und den Sack küssen.
Tatsächlich, er spürte recht deutlich, wie die Sonne seine Eichel leckte. Die Eichel schwoll und schwoll, der Schwanz wurde dick und lang.
Jetzt begann die Sonne, seinen steif gewordenen Schwanz zu wichsen. Ihre Strahlen fuhren an der Nille auf und ab, sehr geschickt machte sie das. Es war ein fabelhaftes Gefühl, sich von der Sonne den Schwanz reiben zu lassen.
Weil die Sonne nicht aufhörte und weil sie es so gekonnt machte, gerieten Martins Eier ins Brodeln. Gleich kommt es mir, dachte Martin — und wurde langsam wach.
Verwirrt und benommen schlug er allmählich die Augen auf. War da nicht ein huschender Schatten neben dem Bett? War da nicht eine reale Berührung an seinem Geschlechtsteil?
Martins Blick klärte sich. Seine Sinne begannen zu arbeiten.
War da nicht ein leises Geräusch?
Martin fuhr hoch.
Nein, da war nichts. Im schwachen Licht, das durch die Fenstervorhänge hereinsickerte, konnte Martin genau feststellen, daß er allein war.
Aber sein Schwanz stand in voller Pracht, und als Martin hingriff, spürte er einen feuchten Tropfen an der Eichelspitze.
So hart hatte er seinen Schwanz eigentlich noch nie geträumt. Gewiß, der Riemen stand ihm des öfteren während des Schlafens, beim Aufwachen so gut wie immer, aber noch nie zuvor war die Nille so gereizt gewesen, so kurz vor dem Spritzen.
Jemand hat mir am Schwanz gespielt, dachte Martin, obwohl er genau wußte, daß dies unmöglich war, denn erstens war er allein, und zweitens — wer hätte auf eine solche Idee kommen können?
„Ich spinne“, sagte Martin halblaut, stieg aus dem Bett und ging mit steifem Schwanz zu dem Fenster, riß die Vorhänge auf.
Sonne, nichts als Sonne. Kein Regen mehr, keine Blitze. Der Blick schweifte frei über sattgrünen Wald, über sanft geschwungene Berge, schattige Täler. Ganz rechts, ziemlich weit weg auf einer Lichtung, lag ein Dorf.
Martin schüttelte den Kopf und suchte seine Uhr. Er bekam einen Schrecken. Gleich elf. Da hatte er doch tatsächlich fast den ganzen Vormittag verpennt. Was sollten die Leute in der Burg von ihm halten? So was gehörte sich doch nicht.
Schnell unter die Dusche. Martin fand eine nagelneue Zahnbürste und einen Rasierapparat. Kaum war Martin fertig, da summte drüben im Salon das Telefon. Schnell lief Martin hin und hob ab.
„Hier ist Peter“, ließ der Fahrer sich vernehmen. „Haben Sie gut geschlafen, Herr Hoffmann?“
„Erstklassig. Es ist mir nur peinlich, daß ich nicht eher zu mir gekommen bin.“
„Das macht gar nichts, Herr Hoffmann. Ist es Ihnen recht, wenn ich Ihnen eine Hose und ein Hemd schicke? Die Sachen müßten Ihnen ungefähr passen.“
„Sie sorgen für mich wie ein Wärter für seinen Affen“, sagte Martin dankbar.
Nach einer Minute klopfte es.
„Herein!“ rief Martin.
Die Tür öffnete sich, Marion stand draußen. Sie lächelte süß, ihr Blick glitt an Martin hinab, und ihre Augen wurden groß, als sie seinen steifen Bolzen erblickte.
Martin erschrak. „Entschuldigen Sie!“ rief er verwirrt. Er sprang hinter einen hochlehnigen Stuhl, um seinen Schwanz zu verbergen.
„Das macht gar nichts“, sagte Marion, lächelte unverändert und kam herein, legte die Sachen auf den Tisch.
„Ich hatte schon immer eine Schwäche für die Natur“, fügte sie hinzu. „Noch dazu, wenn sie so schön ist …“
Husch — weg war sie. Verdutzt stand Martin mit seinem harten Riemen da und starrte auf die sich schließende Tür. Was hatte sie eben gesagt, die hübsche kleine Marion? Sie hätte eine Schwäche für die Natur, vor allem für die schöne? Damit konnte sie doch nur Martins Geschlechtsteil gemeint haben.
„He, vielleicht läßt sie sich ficken!“ murmelte Martin. Er drückte seinen steifen Schwanz, während er nach den Kleidungsstücken griff. „Aber mach dir keine falschen Hoffnungen, hier bekommst du nichts, denn bald müssen wir wieder weg.“
Martin kleidete sich rasch an, der Schwanz wollte nicht in die Hose, aber er mußte gehorchen. Martin hatte einige Mühe, den widerspenstigen Bolzen zu zähmen, zumal er keinen Slip zur Verfügung hatte. Das Ding da unten beulte die Hose ganz schön aus.
Martin konnte nicht warten, bis der Schwanz sich wieder beruhigt hatte. Das würde noch ziemlich lange dauern, ausgehungert und angewichst, wie er war. Also verließ Martin seine Behausung und stieg die Wendeltreppe hinab.
Marion stand in der Tür zum kleinen Speiseraum, in dem Martin sich gestern abend bereits den Bauch vollgeschlagen hatte.
„Bitte, kommen Sie“, sagte sie mit einem süßen Lächeln. Ein Frühstück stand auf dem Tisch. Spiegeleier und Speck, Toast, Wurst und Butter, Käse und Obst.
„Bitte, bedienen Sie sich“, sagte Marion und schob für Martin den Stuhl zurecht. „Entschuldigen Sie, daß wir Sie allein frühstücken lassen, aber wir sind natürlich längst damit fertig.“
„Ich kann’s mir denken“, nickte Martin schuldbewußt und ließ sich nieder. „Nichts als Umstände mache ich Ihnen.“
„Wir tun es sehr gern“, erwiderte das hübsche Mädchen und goß Kaffee in Martins Tasse. Sehr dicht stand sie neben ihm, er spürte ihr Parfum und die Berührung ihres Armes. Er sah die pralle Wölbung ihrer Brüste unter dem schwarzen Kleid.
„Sie sind sehr süß, Marion, wissen Sie das?“ fragte Martin in dem Bestreben, der hübschen Kleinen etwas Nettes zu sagen.
„Es freut mich, daß ich Ihnen gefalle“, antwortete sie und schenkte Martin abermals ein Lächeln. Sie stand neben ihm, stützte die Hände auf die Lehne des Nachbarstuhles und schaute lächelnd zu, wie Martin zu essen begann.
„Schade, daß ich gleich weg muß“, fuhr Martin fort, „sonst würde ich mich bei Ihnen in aller Form für Ihre Freundlichkeit bedanken.“
„Ja, das wäre schön“, seufzte Marion und leckte sich mit flinker Zungenspitze über die Lippen.
„Ich meine eine bestimmte Art von Dank“, erklärte Martin.
„Ich auch“, lächelte Marion. Ihr Lächeln war zweideutig, Martin war fest davon überzeugt.
Deswegen wurde er kühner. Denn es reizte ihn, Marion etwas herauszufordern. Und außerdem stand der Schwanz immer noch und schnupperte nach der ach so nahen Mädchenfotze.
„Auf welche Art und Weise ich Ihnen danken möchte“, sagte Martin, „das haben Sie vorhin gesehen, als Sie in mein Zimmer kamen.“
„Ich weiß“, nickte sie und lächelte unverdrossen weiter, „genau das meine ich nämlich auch.“
„Sie sind noch viel süßer, als ich bisher dachte“, grinste Martin Hoffmann. „Können wir uns mal wo treffen?“
„Wozu?“
„Damit ich mich bei Ihnen bedanke.“
„Weshalb müssen wir uns dazu treffen? Sie sind doch hier, und ich bin auch hier.“
„Aber wir können doch nicht …“
„Ich muß sowieso gleich Ihr Zimmer richten“, sagte Marion, als sei das ganz selbstverständlich. „Kommen Sie nur hinauf, wenn Sie fertig sind.“
„Aber ich fürchte, ich kann das von Ihnen nicht verlangen“, meinte Martin unsicher. „Wenn man es merkt, daß Sie …“
„Sie ahnen gar nicht, Herr Hoffmann, was Sie von mir alles verlangen können“, unterbrach sie ihn. „Und Sie ahnen auch nicht, in was für einem Hause Sie sich befinden.“
„In der Burg der Komteß von Bregg“, sagte Martin. „Richtig. Aber da ist noch viel mehr. Doch das erkläre ich Ihnen später. Wenn Sie sich bei mir bedankt haben.“ Sie nickte ihm zu und ging hüfteschwenkend hinaus. Das heißt, sie blieb unter der Tür stehen, drehte sich um und sagte:
„Schauen Sie mal, Herr Hoffmann, was ich für Sie habe!“ Martin blickte hin. Marion nahm mit zierlichen Fingern ihren kurzen Rock und zog ihn langsam höher. Ihre hübschen Schenkel entblößten sich, ihr blondes Dreieck kam zum Vorschein. Hübsch und lockend und gekräuselt.
Martin mußte schwer schlucken. „Eine Pracht ist das“, sagte er mit belegter Stimme.
„Gefällt es Ihnen?“ fragte Marion und ließ das Röckchen wieder fallen.
„Und wie! Tragen Sie denn nie einen Slip, Marion?“
„Grundsätzlich nicht. Er ist so umständlich. Und außerdem braucht man so etwas in diesem Hause nicht.“
Weg war sie, ließ Martin mit seinem Staunen, seiner Ratlosigkeit und seinem steinhart gewordenen Schwanz allein.
Verdammt — sie wollte tatsächlich mit ihm ficken! Jetzt gleich, sie ging schon hinauf, wartete nur, daß er nachkam. Und sie sagte so komische Sachen. Hier braucht man keinen Slip unter dem Kleid — wieso?
Martin schlang sein Essen hinunter, goß Kaffee nach und sprang auf. Ja, er brauchte jetzt einen Fick, einen anständigen. Und die kleine blonde Marion war sehr attraktiv …
2
Die Tür zum Himmelreich
Sie war gerade dabei, seine nassen Sachen vom Boden aufzuheben, als Martin Hoffmann oben eintraf.
„Ich fürchte“, sagte sie, „daß Sie allein schon deswegen vorerst nicht wegkönnen. Das Zeug ist ja immer noch klatschnaß.“
„Im Gasthof habe ich andere Anzüge“, erwiderte Martin hilflos. „Vielleicht kann man mir von dort etwas schikken …“
„Jetzt brauchen Sie keinen Anzug“, lächelte Marion, legte die Sachen auf einen Stuhl und betrachtete den jungen Mann.
Martin Hoffmann war ziemlich groß, er hatte breite Schultern und schmale Hüften. Sein Haar war dunkel und kräftig, das Gesicht war sympathisch und offen, es hatte eine starke Ausstrahlung. Die Hände waren durchaus männlich, wiesen aber auffallend lange, empfindsame Finger auf.
Das alles interessierte Marion jedoch im Moment nicht. Ihr Blick ruhte auf der Beule zwischen seinen Beinen. Martin ging langsam auf sie zu.
„Sollen wir nicht abschließen?“ fragte er.
„Das ist nicht nötig.“
„Wenn aber jemand zufällig hereinkommt …“
„Niemand wird hereinkommen.“
Er war bei ihr angekommen und blickte auf sie nieder. Sie war fast einen Kopf kleiner als er. Ihr Atem ging rasch, Martin sah deutlich, daß ihre großen Brüste sich hoben und senkten.
„Damit es ganz klar zwischen uns ist“, sagte Martin, „ich möchte jetzt mit Ihnen ins Bett,“
„Darauf warte ich schon die ganze Zeit“, entgegnete sie. „Schon seit gestern abend.“
„Schon seit gestern?“ staunte er.
„Ich habe Sie ja gefragt, ob ich noch etwas für Sie tun kann. Dabei habe ich das gemeint.“
„Das konnte ich nicht wissen.“