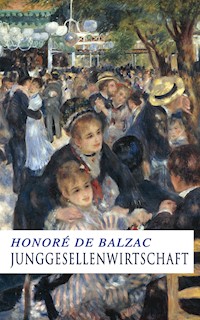
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Junggesellenwirtschaft" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Ein paar Tage später kam die Kunde von dem unglücklichen russischen Rückzug. Napoleon kehrte zurück, um neue Streitkräfte mobil zu machen und von Frankreich neue Opfer zu fordern. Da war die arme Mutter noch ganz andern Ängsten ausgeliefert. Philipp, dem es auf dem Lyzeum nicht behagte, wollte absolut in des Kaisers Dienste treten. Er wohnte einer Truppenschau in den Tuilerien bei, der letzten, die Napoleon dort abnahm, und die machte ihn ganz fanatisch. Damals übte die Soldatenpracht, der Glanz der Uniformen, die Würde der Epauletten einen unwiderstehlichen Reiz auf junge Leute aus." Honoré de Balzac (1799-1850) war ein französischer Schriftsteller. In den Literaturgeschichten wird er, obwohl er eigentlich zur Generation der Romantiker zählt, mit dem 17 Jahre älteren Stendhal und dem 22 Jahre jüngeren Flaubert als Dreigestirn der großen Realisten gesehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Junggesellenwirtschaft
Junggesellenwirtschaft
Im Jahre 1792 besaß die Bürgerschaft von Issoudun einen Arzt namens Rouget, der im Rufe großer Bosheit stand. Einige behaupteten dreist, er quäle seine Frau, obwohl sie die Schönste in der ganzen Stadt war. Sie wird wohl etwas dumm gewesen sein. Trotz aller Neugier der Freunde, allem Geschwätz der Gleichgültigen und aller üblen Nachrede der Neidischen wußte man nicht recht, wie es im Hause Rouget zuging. Der Doktor gehörte zu den Menschen, von denen man sagt: »Mit dem ist nicht gut Kirschen essen.« Solange er lebte, hielt man den Mund und zeigte ihm eine freundliche Miene. Seine Frau, eine geborene Descoings, war schon als junges Mädchen recht schwächlich gewesen, und das soll den Arzt mit veranlaßt haben, sie zu heiraten. Sie bekam erst einen Sohn und dann, seltsamerweise zehn Jahre später, eine Tochter. Die hatte, wie alle Leute meinten, der Doktor, obwohl er Arzt war, gar nicht mehr erwartet. Dieses späte Kind hieß Agathe. Bei solchen einfachen und nicht ungewöhnlichen Einzelheiten brauchte der Erzähler sich nicht gleich zu Beginn seiner Geschichte aufzuhalten, wenn ihre Kenntnis nicht notwendig wäre, um einen Mann vom Schlage des Doktors zu verstehen und ihn nicht schlechthin für ein Ungeheuer, einen unnatürlichen Vater zu halten, während er doch nur den üblen Neigungen nachgab, die sich gewöhnlich mit dem Grundsatze rechtfertigen: »Ein Mann muß Charakter haben!« Diese Männermaxime hat schon manche Frau unglücklich gemacht.
Rougets Schwiegereltern waren Wollagenten. Sie verkauften für die Viehzüchter und kauften für die Händler das goldene Vließ aus dem Lande Berry und bekamen von beiden Seiten ihre Provision. Dabei wurden sie reich und geizig, was bei vielen Existenzen zusammentrifft. Ihr Sohn, Descoings junior, der Bruder der Frau Rouget, mochte nicht in Issoudun bleiben. Er ging auf gut Glück nach Paris und ließ sich als Kaufmann in der Rue Saint-Honoré nieder. Und das war sein Verderben. Den Krämer zieht es nun einmal zum Handel mit der gleichen Stärke, mit der es den Künstler davon abstößt. Man hat noch nicht genügend erforscht, welche sozialen Kräfte die Menschen in die verschiedenen Berufe treiben. Seit der Sohn nicht mehr des Vaters Handwerk ergreifen muß, wie bei den Ägyptern, muß man sich fragen: Warum wird einer lieber Papierhändler als Bäcker? Bei der Berufswahl des jungen Descoings hatte dann noch die Liebe mitgesprochen. »Ich will auch Krämer werden!« sagte er sich und sagte sich noch mehr beim Anblick der Frau Krämerin, einer prachtvollen Person, in die er sich als Gehilfe sterblich verliebte. Und mit viel Geduld und ein wenig Geld, das ihm seine Eltern schickten, hat er dann wirklich die Witwe seines Vorgängers, des Herren Bixiou, geheiratet. Im Jahre 1792 galt Descoings für einen glücklichen Geschäftsmann.
Damals lebten die alten Descoings noch. Mit Wolle gaben sie sich nicht mehr ab, sie legten ihr Geld in Nationalgütern an: der Ankauf dieser staatlich aufgeteilten Ländereien war auch ein goldenes Vließ! In der sicheren Hoffnung, bald den Verlust seiner Frau beweinen zu dürfen, schickte ihr Schwiegersohn Rouget seine Tochter nach Paris zum Schwager, einmal, damit sie die Hauptstadt kennen lernte, und dann noch aus einer besonderen Hinterlist: Der Schwager Descoings war kinderlos. Seine Frau war zwar sehr gesund, aber fett wie eine Wachtel nach der Weinlese; als erfahrener Arzt sah der schlaue Rouget voraus, daß dies Ehepaar immer glücklich sein, aber, im Widerspruch zu der Märchenmoral, keine Kinder haben würde. Dann konnten also die beiden seine Agathe ins Herz schließen. Er hatte ja die Absicht, seine Tochter zu enterben, und hoffte, wenn er sie verpflanzte, dieses Ziel zu erreichen. Das junge Geschöpf, damals das schönste Mädchen von Issoudun, sah weder dem Vater noch der Mutter ähnlich. Agathes Geburt hatte den Doktor Rouget lebenslänglich entzweit mit seinem intimen Freund, dem früheren Subdelegierten Lousteau, der Issoudun gerade verlassen hatte. Wenn eine Familie aus einem so wohnlichen Orte, wie Issoudun einer ist, auswandert, haben die Bewohner das gute Recht, nach den Ursachen dieses ungewöhnlichen Entschlusses zu forschen. Böse Zungen behaupteten, Herr Rouget habe geschworen, daß Lousteau nur von seiner Hand sterben werde. Wenn das ein Arzt sagt, hat solch ein Wort Gewicht. Als die Nationalversammlung die Subdelegationen aufhob, verließ Lousteau die Stadt Issoudun auf Nimmerwiedersehn. Seit die Lousteaus fort waren, verbrachte Frau Rouget ihre ganze Zeit bei der Schwester des früheren Subdelegierten, einer Frau Hochon, diese war Patin ihrer Tochter Agathe und das einzige Wesen, dem sie ihr Herz ausschüttete. Das Wenige, was die Stadt Issoudun über die schöne Frau Rouget erfahren hat. stammt von dieser guten Dame her und erst aus der Zeit nach dem Tode des Doktors.
Als ihr Mann davon sprach, daß er Agathe nach Paris schicken wolle, war Frau Rougets erstes Wort: »Ich werde mein Kind nicht wieder sehen!« – »Und leider hat sie richtig geahnt«, pflegte die vortreffliche Frau Hochon zu sagen.
Nun wurde die arme Mutter quittengelb, und die da behaupteten, Rouget martere seine Frau langsam zu Tode, schienen recht zu behalten. Das tölpelhafte Benehmen ihres Sohnes trug auch sein Teil dazu bei, blöde Bursche, dessen Rücksichtslosigkeiten der Vater diese unschuldig beschuldigte Frau zu quälen. Der vielleicht noch ermutigte, war unaufmerksam und respektlos gegen seine Mutter. Jean-Jacques hatte des Vaters üble Eigenschaften geerbt, und viel war schon der Alte an Leib und Seele nicht wert.
Die Ankunft der entzückenden Agathe Rouget in Paris brachte ihrem Onkel Descoings kein Glück. In der Woche oder republikanisch richtiger in der Dekade, in welcher sie eintraf, warf ihn ein Wort Robespierres zu Fouquier-Tinville ins Gefängnis. Descoings war nämlich so unvorsichtig gewesen, die berühmte Teurung für künstlich zu halten, und dazu töricht genug, diese Meinung – er glaubte an Meinungsfreiheit – gegen mehrere Kunden und Kundinnen beim Bedienen zu äußern. Das Unglück wollte es, daß die Bürgerin Duplay, Ehefrau des Tischlers, bei dem Robespierre wohnte, und Wirtschafterin des großen Bürgers, Descoings' Laden mit ihrer Kundschaft beehrte. Die Bürgerin Duplay erblickte in der Ansicht des Krämers eine Beleidigung der Majestät Maximilians I. Die berühmte Aufwärterin des Jakobinerklubs war schon unzufrieden mit dem Geist im Hause Descoings und sah in der Schönheit der Bürgerin Descoings eine heimliche Aristokratie. Sie vergiftete, ehe sie sie ihrem guten, milden Meister wiederholte, Descoings' Worte. Der Krämer wurde unter der üblichen Anklage des Wucheraufkaufs verhaftet. Als Descoings ins Gefängnis kam, bemühte sich seine Frau um seine Befreiung; aber sie benahm sich dabei sehr ungeschickt; die Art, wie sie mit den Richtern über Descoings' Schicksal sprach, konnte den Glauben erwecken, sie wolle auf ehrenvolle Weise ihren Gatten loswerden. Sie kannte den einen der Sekretäre Rolands, des Ministers des Innern, Namens Bridau, welcher zugleich die rechte Hand all derer war, die nacheinander diesen Ministerposten bekleideten. Diesen Bridau setzte sie in Bewegung, um Descoings zu retten. Aber den unbestechlichen Bürovorsteher verhinderte seine törichte und bewundernswerte Tugendhaftigkeit, die Leute, von denen Descoings' Schicksal abhing, zu bestechen; er versuchte, sie aufzuklären! Leute von damals aufklären! – da hätte er sie ebensogut bitten können, die Bourbonen zurückzurufen. Der Minister Roland, der gerade als Führer der Gironde Robespierre bekämpfte, sagte zu Bridau: »Worein mischst du dich?« Alle, die der redliche Sekretär aufsuchte, wiederholten ihm das bittere Wort: »Worein mischst du dich?« Nun gab Bridau der Frau Descoings den guten Rat, sich still zu verhalten; allein, statt sich um die Gunst der Aufwärterin Robespierres zu bemühen, wetterte sie gegen die Verleumderin; sie suchte ein Konventmitglied auf, einen, der für sich selbst zu zittern hatte; der sagte ihr: »Ich werde mit Robespierre darüber sprechen.« Damit beruhigte sich die schöne Krämersfrau, und ihr Beschützer sagte natürlich kein Wort zu Robespierre. Hätte sie lieber der Bürgerin Duplay ein paar Zuckerhüte und etliche Flaschen guten Schnapses geschenkt, sie hätte Descoings retten können. In Revolutionszeiten ist es ebenso gefährlich, sein Heil den Redlichen anzuvertrauen wie den Halunken; rechnen kann man nur auf sich selbst. Im Tode genoß Descoings immerhin die Auszeichnung, zusammen mit André de Chénier das Schaffot zu besteigen. Da umarmten sich zum erstenmal Poesie und Krämerei; sie hatten ja immer heimliche Beziehungen und werden sie immer haben. Descoings' Tod machte übrigens viel mehr Aufsehen als der André de Chéniers. Es mußten dreißig Jahre vergehen, bis man erkannte, daß Frankreich an Chénier mehr als an Descoings verloren hatte. Einen guten Erfolg hat Robespierres Maßregel gehabt: bis zum Jahre 1830 haben sich die eingeschüchterten Krämer nicht mehr mit der Politik befaßt. Descoings' Laden lag nur hundert Schritt von Robespierres Wohnung. Und des Krämers Nachfolger machte schlechte Geschäfte. Das war der berühmte Parfümeriefabrikant Cäsar Birotteau. Übertrug diese unheimliche Nachbarschaft das Unglück und ruinierte den Erfinder der ›Sultaninnenpaste‹ und des ›Eau carminative‹? Diese Frage mögen die okkulten Wissenschaften lösen. Dem Bürovorsteher Bridau hatte, so oft er die Frau des unglücklichen Descoings besuchte, Agathe Rougets stille, kühle, klare Schönheit großen Eindruck gemacht. Nun kam er, die Witwe, die in ihrer Trostlosigkeit das Geschäft ihres zweiten Verstorbenen liegen ließ, zu trösten, und heiratete schließlich noch in der gleichen Dekade das reizende junge Mädchen. Er brauchte nur die Ankunft des Doktors Rouget abzuwarten, der unverzüglich eintraf. Der Arzt war entzückt, daß die Folge der Ereignisse seine Wünsche überholte, denn jetzt wurde seine Frau die einzige Erbin der alten Descoings; er eilte nach Paris, weniger, um der Hochzeit seiner Tochter Agathe beizuwohnen, als um den Ehevertrag in seinem Sinne abfassen zu lassen. Die Selbstlosigkeit und übergroße Liebe des Bürgers Bridau ließen der Gemeinheit des Arztes freie Hand, und der weitere Verlauf dieser Geschichte wird zeigen, wie Rouget die Verblendung seines Schwiegersohnes auszunutzen verstand. Frau Rouget oder genauer der Doktor erbte also den ganzen beweglichen und unbeweglichen Besitz von Vater und Mutter Descoings, die bald danach in einem Abstand von zwei Jahren starben. Zuguterletzt kam Rouget dann mit seiner Frau zum Ziel, die zu Anfang des Jahres 1799 starb. Und er bekam Weinberge, kaufte Gutshöfe, erwarb Eisenhämmer, und sein Wollhandel blühte. Sein lieber Sohn verstand nichts, und der Vater beschloß, ihn Grundbesitzer werden zu lassen, und ließ ihn aufwachsen in Reichtum und Dummheit. Dabei werde sein Kind das bißchen Leben und Sterben so gut lernen wie die Gelehrten, meinte er. Seit 1799 schätzten die Rechner von Issoudun den alten Rouget auf bereits dreißigtausend Franken Rente. Nach dem Tode seiner Frau ergab sich der Doktor seinen Ausschweifungen, aber sie waren sozusagen geregelt und unter Ausschluß der Öffentlichkeit auf das eigene Heim beschränkt. Dieser Mann von Charakter starb im Jahre 1805. Nun wußten die Bürger von Issoudun Gott weiß was alles von ihm zu berichten, und über sein Privatleben waren die schaurigsten Anekdoten in Umlauf. Jean-Jacques Rouget, den der Vater schließlich in Anbetracht seiner Dummheit strenger behandelt hatte, blieb aus Gründen, die im Verlauf dieser Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen werden, Junggeselle. Und daran war zum Teil der Doktor schuld.
Wir müssen nun betrachten, wie die Rache wirkte, die Rache des Vaters an der Tochter, die er nicht für sein Kind hielt, und die es doch rechtmäßig war. In Issoudun hatte niemand einen jener wunderlichen Zufälle bemerkt, die aus der Zeugung und Abstammung einen Abgrund machen, in dem die Wissenschaft sich verliert. Agathe sah der Mutter des Doktors Rouget ähnlich. Das Überspringen einer Generation und die Vererbung von Großvater auf Enkel, die man häufig bei der Gicht beobachtet hat, läßt sich nicht selten bei der Familienähnlichkeit nachweisen. So glich Agathes erstes Kind von Ansehen der Mutter, aber den Charakter erbte es vom Großvater Rouget. Doch wir wollen die Lösung auch dieses Problems dem zwanzigsten Jahrhundert nebst einigen Fachausdrücken vermachen, und unsere Nachfahren mögen über diese dunkle Frage weiter soviel Törichtes schreiben wie unsere gelehrten Körperschaften es bereits getan haben.
Agathe Rouget gewann die allgemeine Bewunderung durch ein Gesicht, das gleich dem Marias, der Mutter des Heilands, immer jungfräulich blieb, auch nach der Heirat. Ihr Porträt, das im Atelier ihres Sohnes noch zu sehen ist, zeigt ein vollkommenes Oval und ein makelloses Weiß trotz ihres rötlich goldenen Haares. Häufig fragen andre Künstler unsern berühmten Bridau, wenn sie die reine Stirn, den verhaltenen Mund, die feine Nase, die zierlichen Ohren, die langen Wimpern, dunkelblauen, tief zärtlichen Augen, die ganze Innigkeit dieses Gesichtes betrachten: »Ist das eine Kopie nach Raffael?« Nie hatte jemand eine glücklichere Eingebung als der Bürovorsteher Bridau, als er das junge Mädchen heiratete. Agathe verwirklichte das Ideal der Hausfrau, die in der Provinz groß geworden und nie von der Mutter fortgekommen ist. Sie war fromm ohne Frömmelei und besaß nur die Bildung, welche die Kirche den Frauen gibt. Sie war eine musterhafte Gattin im einfachen Sinne des Wortes, und ihre Lebensunkenntnis brachte ihr manches Unglück. Die Grabschrift der berühmten Römerin: ›Sie wob und hütete das Haus‹, gibt am besten die stille Reinheit dieses einfachen Daseins wieder.
Seit dem Konsulat war Bridau ein begeisterter Anhänger Napoleons, der ihn 1804, ein Jahr vor Rougets Tode, zum Sektionschef ernannte. Er bezog zwölftausend Franken Gehalt und stattliche Gratifikationen, und so blieb er gleichgültig gegenüber den schmählichen Ergebnissen der Testamentsvollstreckung in Issoudun, bei der Agathe leer ausging. Sechs Monate vor seinem Tode hatte der alte Rouget seinem Sohne einen Teil seines Besitzes käuflich überlassen, und der Rest wurde dann Jean-Jacques mehr als eine Art Schenkung denn als Erbschaft zugesprochen. Agathes ganzer Anteil an der Hinterlassenschaft ihrer Eltern waren die hunderttausend Franken, die sie als Vorschuß auf ihre Erbschaft in ihrem Ehevertrag erhalten hatte. Ein wahrer Anbeter des Kaisers, diente Bridau mit fanatischer Ergebenheit den gewaltigen Entwürfen des modernen Halbgottes, der alles in Frankreich zerstört fand und alles neu schaffen wollte. Nie versuchte der Sektionschef zu bremsen. Pläne, Denkschriften, Rapporte, Studien, die lastendsten Aufgaben übernahm er; dem Kaiser zu folgen war sein höchstes Glück; er liebte den Menschen, er vergötterte den Herrscher Napoleon, er duldete nicht die kleinste Kritik an seinen Taten oder Absichten. Von 1804 bis 1808 hatte er eine große schöne Wohnung am Quai Voltaire, ein paar Schritte von seinem Ministerium und den Tuilerien. In ihrer Glanzzeit verwaltete Frau Bridau ihren ganzen Haushalt mit einer Köchin und einem Diener. Agathe stand stets als erste auf und ging mit ihrer Köchin in die Hallen einkaufen. Während der Diener die Zimmer machte, überwachte sie das Frühstück. Bridau begab sich immer erst gegen elf Uhr in sein Ministerium. Und solange sie zusammen waren, bereitete ihm seine Frau mit immer neuer Freude ein schmackhaftes Frühstück, die einzige Mahlzeit, an der Bridau ein wirkliches Vergnügen hatte. Zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter sah Agathe ihrem Manne aus dem Fenster nach, wenn er ins Ministerium ging, und zog den Kopf erst zurück, wenn er in die Rue du Bac einbog. Dann räumte sie selbst ab, ging noch einmal ordnend durch die Zimmer, zog sich an, spielte mit ihren Kindern, ging mit ihnen aus oder empfing Besuche, bis Bridau nach Hause kam. Brachte der Sektionschef dringende Arbeiten mit, so setzte sie sich zu ihm in seinem Arbeitszimmer neben seinen Schreibtisch und sah ihm strickend und stumm wie ein Standbild bei der Arbeit zu. Sie blieb wach solange wie er und ging erst einige Augenblicke vor ihm zu Bett. Bisweilen besuchte das Ehepaar das Theater in der Ministerloge. Dann pflegten sie im Gasthaus zu speisen; und das Gasthaus war für Frau Bridau auch ein Schauspiel, das sie genoß wie alle, die fremd in Paris sind. Oft mußte Bridau als Sektionschef und leitende Persönlichkeit in einem Teil des Ministeriums des Innern Einladungen zu großen Diners annehmen und entsprechend erwidern; bei solchen Gelegenheiten paßte sich seine Frau dem damaligen Toilettenluxus an, aber sie war froh, wenn sie zu Hause die Pracht wieder abwerfen und ihr schlichtes Hauskleid anziehen konnte. Einmal in der Woche, am Donnerstag, empfing Bridau seine Bekannten, und am Fastnachtsdienstag gab er einen großen Ball. Diese wenigen Worte enthalten die ganze Geschichte dieser Ehe, in der sich nur drei große Ereignisse abspielten: die Geburt zweier Kinder im Abstand von drei Jahren und Bridaus Tod, Im Jahre 1808 erlag er den Folgen seiner Nachtwachen, gerade in dem Augenblick, als der Kaiser ihn zum Generaldirektor, Grafen und Staatsrat ernennen wollte. In dieser Zeit befaßte sich Napoleon insbesondere mit den innern Angelegenheiten, überhäufte Bridau mit Arbeiten und untergrub schließlich die Gesundheit des unermüdlichen Beamten. Der Kaiser hatte sich nach dem Leben und Vermögen dieses Mannes, der ihn nie um etwas bat, erkundigt und erfahren, daß dieser Getreue nichts besaß als sein Amt. Dabei gewann er Einblick in eine der unbestechlichen Seelen, die seiner Verwaltung Wirksamkeit und Würde gaben und wollte nun Bridau mit glänzenden Auszeichnungen überraschen. Der Eifer, eine ungeheure Arbeit vor dem Aufbruch des Kaisers nach Spanien zu Ende zu bringen, tötete den Sektionschef in der Form eines Nervenfiebers. Als der Kaiser aus ein paar Tage nach Paris zurückkam, um den Feldzug von 1809 vorzubereiten, und von diesem Verlust hörte, sagte er: »Es gibt Männer, die man nie ersetzen kann«. Unter dem Eindruck einer Ergebenheit, die nicht auf die glänzenden, dem Heere vorbehaltenen Ehrenbezeugungen aus war, beschloß der Kaiser einen hohen Zivilorden zu stiften, welcher der Ehrenlegion des Militärs entsprechen sollte. Von diesem Orden, dessen Gedanken Bridaus Tod eingegeben und dessen Verwirklichung aus Zeitmangel unterblieb, werden die meisten Leser nichts mehr wissen. Sein Abzeichen war ein blaues Band, und der Kaiser nannte ihn ›Réunion‹, weil er das goldene Vließ des spanischen und das des österreichischen Hofes zu vereinigen gedachte. ›Diese Profanation‹, sagte ein preußischer Diplomat, ›hat die Vorsehung verhindert‹. Der Kaiser ließ sich über Frau Bridaus Lage Bericht erstatten. Die beiden Kinder bekamen jedes ein volles Stipendium am kaiserlichen Lyzeum und der Kaiser bestritt die ganzen Kosten ihrer Erziehung aus seiner Privatschatulle. Sodann verschrieb er Frau Bridau eine Pension von viertausend Franken und behielt sich zweifellos zugleich die Sorge für die Zukunft ihrer Söhne vor. Vom Tage ihrer Hochzeit bis zum Tode ihres Mannes blieb Frau Bridau ohne alle Beziehungen zu Issoudun. Als sie ihre Mutter verlor, sah sie der Geburt ihres zweiten Sohnes entgegen. Als dann der Vater, von dem sie sich wenig geliebt wußte, starb, stand die Salbung des Kaisers bevor, und die Krönung machte ihrem Gatten so viel Arbeit, daß sie ihn nicht verlassen wollte. Ihr Bruder Jean-Jacques Rouget hatte ihr seit ihrer Abreise von Issoudun kein Wort geschrieben. Anfangs litt Agathe unter dieser unausgesprochenen Verstoßung aus ihrer Familie, aber schließlich dachte sie nicht mehr an die, welche an sie nie dachten. Einmal im Jahre bekam sie einen Brief von ihrer Patin, der Frau Hochon, und beantwortete ihn mit Alltäglichkeiten, ohne auf die Fingerzeige zu achten, die ihr diese vortreffliche und fromme Freundin zwischen den Zeilen gab. Kurz vor dem Tode des Doktors Rouget schrieb Frau Hochon ihrer Patentochter, sie habe nichts von ihrem Vater zu erwarten, wenn sie nicht Herrn Hochon Vollmacht erteilte. Es widerstrebte Agathe, ihrem Bruder Ungelegenheiten zu machen. Ob nun Bridau die Erbausschließung dem Recht und der Sitte des Landes Berry entsprechend fand, oder ob dieser Reine und Gerechte Seelengröße und Gleichgültigkeit seiner Frau gegen Geldangelegenheiten teilte, kurz, er wollte nicht auf seinen Notar Roguin hören, der ihm riet, seine Stellung zu benutzen, um die Maßnahmen anzufechten, durch die der Vater die Tochter ihres rechtmäßigen Anteils beraubte. Das Ehepaar Bridau billigte, was damals in Issoudun geschah. Immerhin benutzte der Notar Roguin die Gelegenheit, um den Sektionschef auf die gefährdeten Interessen seiner Frau hinzuweisen. Der edle Mann bedachte, daß Agathe bei seinem Tode ohne Vermögen dastehen werde. Er machte sich daran, seinen Besitzstand nachzuprüfen, stellte fest, daß seine Frau und er von fünfzigtausend Franken, die der alte Rouget seiner Tochter mitgegeben hatte, ungefähr dreißigtausend hatten aufnehmen müssen, und legte nun die übrigen zwanzigtausend in Staatspapieren an. Konsols standen damals vierzig. Agathe bezog also ungefähr zweitausend Franken Rente. Mit einem Einkommen von sechstausend Franken konnte Frau Bridau als Witwe standesgemäß leben. Sie war Provinzialin geblieben, sie wollte Bridaus Diener entlassen, nur ihre Köchin behalten und eine kleinere Wohnungbeziehen; aber ihre gute Freundin, Frau Descoings, die darauf bestand, Tante genannt zu werden, verkaufte ihre Möbel, gab ihre Wohnung auf, zog zu Agathe und richtete sich im Arbeitszimmer des verstorbenen Bridau ihr Schlafzimmer ein. Beide Witwen warfen ihre Einkünfte zusammen und sahen sich im Besitz von zwölftausend Franken Rente. Das erscheint einfach und natürlich. Aber nichts verlangt genauere Beachtung, als was natürlich aussieht. Das Außergewöhnliche macht alle Welt bedenklich. Wenn aber Männer von Erfahrung, Anwälte, Ärzte, Richter, Priester, den einfachen Dingen eine hohe Bedeutung beimessen, so findet man sie ängstlich pedantisch. Und oft kann man unbedachte Leute, die ihre Torheiten vor sich und andern entschuldigen wollen, sagen hören: »Es war so einfach, jeder andere wäre auch darauf hereingefallen!«
Im Jahre 1809 war Frau Descoings, die ihr Alter nie eingestand, fünfundsechzig Jahre alt. Sie hatte zu ihrer Zeit »die schöne Krämerin« geheißen und war noch jetzt eine der seltenen Frauen, denen die Zeit nichts anhat. Ihrer ausgezeichneten Konstitution verdankte sie die glückliche Bewahrung einer Schönheit, die einer genauen Prüfung allerdings nicht mehr standhielt. Sie war mittelgroß, üppig und frisch, hatte schöne Schultern und rosigen Teint. Ihr blondes Haar, das ins Kastanienbraune spielte, hatte trotz ihres Gatten furchtbarem Schicksal nichts von seiner Farbe eingebüßt. Sehr lecker war sie und bereitete sich gern gute kleine Gerichte; aber neben der Küche schwärmte sie auch für das Theater, und dann hatte sie noch ganz im geheimen ein besonderes Laster: sie spielte in der Lotterie! Sollte das Danaidenfaß der Mythologie uns vielleicht diesen Abgrund versinnbildlicht haben? Die Descoings war übrigens bis aus eine gewisse Toiletteneitelkeit, wie sie Frauen, die das Glück haben, lange jung zu bleiben, eigen ist, eine recht umgängliche Person. Sie war immer derselben Meinung wie die andern, ärgerte niemanden durch Widerspruch und machte sich durch eine gelinde gesellige Heiterkeit beliebt. Als gute Pariserin verstand sie Spaß, und das haben die alten Kaufleute und Kleinrentner gern. Nur die Zeitumstände waren schuld daran, daß sie sich nicht zum drittenmal verheiratete. Während der Kriege des Kaiserreichs fanden die Heiratslustigen leicht schöne reiche junge Mädchen und brauchten sich um die Frauen von sechzig Jahren nicht zu kümmern. Frau Descoings bemühte sich, Frau Bridau aufzuheitern; sie nahm sie oft ins Theater und auf Spazierfahrten mit und stellte vortreffliche kleine Diners für sie zusammen; sie versuchte sie sogar mit ihrem Sohne aus erster Ehe, Herrn Bixiou, zu verheiraten. Ach, sie gestand ihr das schreckliche Geheimnis, um das nur sie, der selige Descoings und ihr Notar gewußt hatten. Die junge, elegante Descoings, die sich für eine Dame von sechsunddreißig Jahren ausgab, hatte einen Sohn von fünfunddreißig Jahren, namens Bixiou, der schon Witwer war und Major im einundzwanzigsten Linienregiment. Er ist dann als Oberst in Dresden gestorben und hat einen einzigen Sohn hinterlassen. Diesen Enkel, den die Descoings nur heimlich sah, gab sie als einen Sohn ihres Mannes aus erster Ehe aus. Ihr Geständnis war ein Akt der Klugheit: der Sohn des Obersten wurde mit den beiden jungen Bridaus im kaiserlichen Lyzeum erzogen und bezog ein halbes Stipendium. Es war ein gewandter und verschlagener Bursche, der sich später als Zeichner und feiner Kopf einen großen Namen gemacht hat.
Agathe liebte auf der Welt nur ihre Kinder, wollte nur noch für die Kinder leben und schlug sowohl aus Vernunft wie aus Treue jede zweite Ehe aus. Aber es wird den Frauen leichter, eine gute Gattin zu sein als eine gute Mutter. Eine Witwe hat zwei Aufgaben, die sich widersprechen: sie ist Mutter und muß zugleich die väterliche Gewalt ausüben. Wenige Frauen haben die Kraft, diese Doppelrolle zu verstehen und zu spielen. So wurde die arme Agathe bei all ihren Tugenden die unschuldige Ursache vielen Unglücks. Mit wenig Geist und dem großen Vertrauen der schönen Seelen wurde sie das Opfer der Frau Descoings, die sie tief ins Unglück stürzte. Die Descoings hielt die Ternen, und die Lotterie gab ihren Aktionären keinen Kredit. Da sie das Hauswesen leitete, konnte sie das Haushaltungsgeld in ihre Einsätze stecken und so geriet sie, immer in der Hoffnung, ihren Enkel Bixiou, ihre liebe Agathe und die kleinen Bridaus reich zu machen, tiefer und tiefer in Schulden. Als die Schulden die Höhe von zehntausend Franken erreicht hatten, erhöhte sie ihren Einsatz, indem sie darauf rechnete, daß ihre Lieblingsterne, die seit neun Jahren nicht gezogen worden war, den Schlund des Defizits füllen würde. Von da an stieg die Schuld schneller. Als sie zwanzigtausend Franken erreicht hatte, verlor die Descoings den Kopf, aber die Terne gewann sie nicht. Sie wollte nunmehr ihr Vermögen verpfänden, um ihre Nichte zu entschädigen, aber ihr Notar Roguin bewies ihr die Unausführbarkeit dieses redlichen Vorsatzes. Der verstorbene Rouget hatte beim Tode seines Schwagers Descoings dessen Erbschaft angetreten und Frau Descoings mit einer Nutznießungsrente abgefunden, die auf dem Besitz von Jean-Jacques Rouget lastete. Auf eine Leibrente von ungefähr viertausend Franken würde kein Wucherer einer Frau von siebenundsechzig Jahren zwanzigtausend Franken leihen, zumal in einer Zeit, in der man sein Geld gut und gern zu zehn Prozent anlegen konnte. Eines Morgens warf sich die Descoings ihrer Nichte zu Füßen und gestand ihr unter Schluchzen, wie es um sie stand. Frau Bridau machte ihr keinen Vorwurf, sie entließ den Diener und die Köchin, verkaufte alle entbehrlichen Möbel, dazu noch drei Viertel ihrer Staatspapiere, bezahlte alles und kündigte ihre Wohnung.
Einer der schrecklichsten Winkel von Paris ist das Stück der Rue Mazarine von der Rue Guénégaud bis zu der Stelle, wo sie hinter dem Institut mit der Rue de Seine zusammenstößt. Die hohen grauen Mauern des Kollegiums und der Bibliothek, welche der Kardinal Mazarin der Stadt Paris stiftete, und in der dann später die französische Akademie tagen sollte, werfen eisige Schatten auf den Straßenwinkel; der Nordwind bläst hinein und selten zeigt sich die Sonne. Im dritten Stockwerk eines Hauses an dieser feuchten schwarzen kalten Ecke fand die arme ruinierte Witwe Unterkunft. Vor dem Hause steigen die Gebäude des Instituts empor, in denen sich damals die Zellen jener wilden Tiere befanden, die bei den Bürgern Kunstmaler und in den Ateliers ›Rapins‹ genannt werden. Als Rapin kam der Kunstschüler hinein, mit dem Stipendium für Rom konnte er herauskommen. Das geschah unter großem Lärm zu bestimmten Zeiten des Jahres, in denen die Wettbewerber in diese Zellen eingeschlossen wurden, um in gegebener Zeit als Bildhauer ein Tonmodell, als Maler ein Bild, als Architekt den Plan eines Gebäudes, als Musiker eine Kantate zu vollenden und preisgekrönt zu werden. Heute befindet sich diese Menagerie nicht mehr hinter diesen düsterkalten Mauern, sie ist ein paar Schritte weiter in das Palais der schönen Künste überführt worden. Aus den Fenstern der Frau Bridau hatte man die tieftraurige Aussicht auf diese vergitterten Zellen. Gegen Norden war der Horizont begrenzt durch die Kuppel des Institutes. Die Straße aufwärts fanden die Augen als einzige Aufmunterung die Fiakerreihe auf der Höhe der Rue Mazarine. Die Witwe stellte in ihre Fenster drei Kästen mit Blumenerde und bestellte einen jener hängenden Gärten, die, beständig von den polizeilichen Vorschriften bedroht, den Zimmern Lust und Licht rauben. Da das Nachbarhaus auf die Rue de Seine geht, hat dieses Haus nur sehr wenig Tiefe und eine schmale Wendeltreppe. Das dritte Stockwerk ist das oberste. Drei Fenster, drei Zimmer: Eßzimmer, kleines Wohnzimmer, Schlafzimmer; auf der andern Seite des Treppenabsatzes eine kleine Küche, darüber zwei Kammern und ein großer Boden. Aus dreierlei Gründen wählte Frau Bridau diese Wohnung: erstens Billigkeit; sie zahlte vierhundert Franken und konnte einen neunjährigen Vertrag schließen; dann die Nähe des kaiserlichen Lyzeums, und drittens blieb die Familie in einem Stadtviertel, das ihr vertraut war. Das Innere der Wohnung entsprach dem Charakter des Hauses. Das Eßzimmer mit seiner gelben, grüngeblümten Tapete und seinem roten Steinfußboden enthielt nur das Notwendigste: einen Tisch, zwei Anrichten und sechs Stühle, alles noch aus dem verlassenen Appartement stammend. Das Wohnzimmer schmückte ein Aubussonteppich, den Bridau bei einer Erneuerung des Mobiliars im Ministerium geschenkt bekommen hatte. Die Witwe stellte billige Mahagonimöbel mit ägyptischen Aufsätzen hinein, wie sie Jakob Desmalter um 1806 in Massen fabrizierte. Die waren mit grüner, weißgeblümter Seide bezogen. Über dem Kanapee hing ein Pastellporträt von Bridau, von Freundeshand gemalt, das sofort den Blick auf sich zog. Ein Kunstkenner hätte manches daran auszusetzen gehabt. Aber immerhin war die feste Stirn, war die Klarheit der zugleich sanften und stolzen Augen des großen vergessenen Bürgers gut getroffen. Die Lippen, die von Scharfsinn zeugten, das freimütige Lächeln, der ganze Ausdruck des Mannes, den der Kaiser: »justum et tenacem« genannt hatte, waren, wenn nicht mit Talent, so doch mit Treue wiedergegeben. Beim Anblick des Porträts mußte man sich sagen, dieser Mann hatte immer seine Pflicht erfüllt. In seiner Miene lebte die Unbestechlichkeit, die man den besten Republikanern nachsagt. Über dem Spieltisch gegenüber strahlte eine Kopie des Kaiserbildes von Vernet, aus dem Napoleon an der Spitze seines Gefolges rasch vorüberreitet. Agathe leistete sich zwei große Vogelbauer, einen mit Kanarienvögeln, den anderen mit Sittichen. Eine Spielerei, die sie in ihrem unersetzlichen Verlust ergötzte. Ihr Witwenzimmer war schon nach drei Monaten so, wie es bis zu dem verhängnisvollen Tage bleiben sollte, an dem sie es verlassen mußte: ein Durcheinander, das keine Beschreibung ordnen könnte. Da hausten die Katzen auf den Sesseln, manchmal flogen die Kanarienvögel frei herum und ließen ihre Spuren in Kommagestalt auf allen Möbeln. An mehreren Plätzen stellte die gute Witwe Hirse und Vogelfutter für sie aus. Die Katzen fanden Leckereien in abgestoßenen Untertassen. Plunder lag herum. Das ganze Zimmer roch nach Kleinstadt und Treue.
Alles, was dem seligen Bridau gehört hatte, wurde sorgfältig aufgehoben. Seine Schreibtischutensilien erfuhren die Pflege, die ehedem die Witwe eines Paladins den Waffen ihres Verstorbenen gewidmet haben mag. Ein Beispiel für den rührenden Kult dieser Frau: Eine Schreibfeder hatte sie eingewickelt und auf die versiegelte Hülle die Inschrift gesetzt: »Letzte Feder, die mein teurer Gatte benutzt hat.« Auf dem Kaminsims stand unter Glas die Tasse, aus der er seinen letzten Schluck getrunken hatte. Nachtmützen und Perücken thronten später auf den Glasstürzen, die diese kostbaren Reliquien deckten. Seit Bridaus Tode kannte die junge Witwe von fünfunddreißig Jahren keine Spur von Koketterie oder weiblicher Sorgfalt mehr. Verlassen von dem einzigen, den sie gekannt, verehrt, geliebt und der ihr nie den geringsten Kummer bereitet hatte, fühlte sie sich nicht mehr Frau, ließ alles stehn und gehn und vernachlässigte ihre Kleidung. Sie gehörte zu denen, die in der Liebe ihr Ich ganz auf den andern übertragen können, und denen mit seinem Verlust das Leben unmöglich wird. Da sie nun nur noch für die Kinder leben konnte, machte es sie unsagbar traurig, mitansehen zu müssen, wieviel Entbehrungen ihr Ruin diesen auferlegen werde. Seit dem Einzug in die Rue Mazarine bekamen ihre Züge einen ergreifenden Schimmer von Melancholie. Sie rechnete wohl noch auf den Kaiser, aber der Kaiser konnte jetzt auch nicht mehr tun als er tat: Aus seiner Privatschatulle wurden für jedes Kind außer dem Stipendium jährlich sechshundert Franken gezahlt.
Die schöne alte Descoings bewohnte im zweiten Stock dieselben Räume wie ihre Nichte im dritten. Sie ließ Frau Bridau jährlich tausend Taler aus ihrer Rente überweisen. Auf diese Weise regelte der Notar Roguin die Einkünfte der Frau Bridau, aber es erforderte ungefähr sieben Jahre, um in langsamer Rückzahlung den Schaden auszugleichen. Der Descoings blieben nur noch zwölfhundert Franken, von denen sie ärmlich mit ihrer Nichte lebte. Die beiden ehrsamen, aber schwachen Geschöpfe nahmen nur morgens eine Aufwärterin ins Haus. Die Descoings, die gern küchelte, bereitete die Mahlzeiten. Abends kamen einige Bekannte, Ministerialbeamte, die ihre Stellen Bridau verdankten, mit den beiden Witwen Karten zu spielen. Die Descoings hielt immer noch ihre Terne, die sich's, wie sie sagte, in den Kopf gesetzt hatte, nicht herauszukommen. Sie gab die Hoffnung nicht auf, mit einem Schlage der Nichte die alte Schuld zurückzahlen zu können. Die beiden kleinen Bridaus liebte sie mehr als ihren Enkel Bixiou; so sehr fühlte sie sich ihnen gegenüber im Unrecht, so sehr bewunderte sie die Güte ihrer Nichte, die ihr im größten Leid nie den geringsten Vorwurf gemacht hatte. Man kann sich vorstellen, wie Joseph und Philipp von der Descoings verwöhnt wurden! Die alte Aktionärin der kaiserlichen Lotterie von Frankreich suchte ihr Laster dadurch abzubüßen, daß sie den Knaben besondere Leckerbissen zu essen gab. Und später bekamen beide, ohne viel bitten zu müssen, aus der Tasche der Alten das nötige Kleingeld, Joseph, der Jüngere, für Kohle, Bleistifte, Papier und Zeichenwischer, Philipp, der Ältere, für Apfelkuchen, Murmeln, Bindfaden und Messer. Ihre Spielleidenschaft ging so weit, daß sie ihre ganzen Ausgaben auf fünfzig Franken im Monat beschränkte und den Rest auf die Lotterie trug.
Frau Bridau ließ ihrerseits die Ausgaben aus Mutterliebe nicht höher anwachsen. Zur Strafe für ihre Vertrauensseligkeit schränkte sie heldenhaft ihre kleinen Freuden ein. Das einmal verletzte Gefühl, das einmal erweckte Mißtrauen brachte sie gleich vielen ängstlichen und beschränkten Gemütern dahin, das Laster der Knauserei so weit zu treiben, daß es schon wie eine Tugend aussah. Der Kaiser konnte vergessen, sagte sie sich, er konnte in einer Schlacht fallen, und ihre Pension würde mit ihr erlöschen. Sie zitterte vor der Möglichkeit, daß ihre Kinder ohne Vermögen auf der Welt zurückblieben. Wenn Roguin ihr klar zu machen suchte, daß eine Abgabe von dreitausend Franken aus Frau Descoings' Rente innerhalb sieben Jahren ihr verkauftes Kapital wiederherstellen werde, so vermochte sie seinen Berechnungen nicht zu folgen, sie traute weder dem Notar, noch der Tante, noch dem Staat, sie zählte nur noch auf sich selbst und auf das, was sie sich absparte. Konnte sie jedes Jahr tausend Taler von ihrer Pension zurücklegen, so würde sie in zehn Jahren dreißigtausend Franken und somit schon fünfzehnhundert Franken Einkommen für ihre Kinder haben. Mit ihren sechsunddreißig Jahren konnte sie noch auf zwanzig Lebensjahre rechnen und dann würden die beiden Söhne, wenn sie an ihrem System festhielt, einmal wenigstens das Notwendigste haben. So waren die beiden Witwen aus falschem Reichtum in freiwilliges Elend geraten, die eine unter dem Druck eines Lasters, die andere im Zeichen der reinsten Tugend. Diese Einzelheiten, unentbehrlich für den Zusammenhang dieser Geschichte, sind aus dem Alltäglichen gegriffen, aber um so größer ist vielleicht ihre Tragweite. Der Anblick der Malerzellen, das Getriebe der Rapins auf der Straße, der Aufblick zum Himmel, der über die garstigen Umrisse dieses feuchten Gassenwinkels hinweghelfen mußte, das Bild des Vaters, das trotz der dilettantischen Mache des Verfertigers Seelengröße atmete, die reichen, harmonisch gealterten Farben des stillen Heims, die Gewächse der hängenden Gärten, die Armseligkeit des Haushalts, die Vorliebe der Mutter für den älteren Bruder, ihre Strenge gegen die Neigungen des jüngeren, all diese Tatsachen und Umstände haben vielleicht den fruchtbaren Boden gebildet, dem wir Joseph Bridau, einen der großen Maler der lebenden französischen Schule verdanken.
*
Philipp, der ältere von Bridaus beiden Söhnen glich auffallend seiner Mutter. Obgleich er blond und blauäugig war, hatte er etwas lärmend Ungestümes im Wesen, das man leicht für Lebhaftigkeit und Mut halten konnte. Der alte Claparon, der mit Bridau zugleich in das Ministerium eingetreten war, einer der Getreuen, die abends zu den beiden Witwen Karten spielen kamen, klopfte alle paar Wochen einmal dem Philipp auf die Backen und sagte: »Das ist ein strammer kleiner Bursche! Der wird sich nicht bange machen lassen!« Das stachelte den Knaben an, er bekam eine prahlerische Entschlossenheit, und diese Richtung seines Charakters machte ihn geschickt zu allen körperlichen Übungen. Von seinen vielen Schlägereien auf dem Lyzeum bekam er die Kühnheit und Schmerzverachtung, die zum Soldaten ertüchtigt, aber zugleich eine große natürliche Abneigung gegen das Lernen; nie wird die öffentliche Erziehung das schwierige Problem der gleichzeitigen Ausbildung von Leib und Geist lösen. Agathe schloß von ihrer physischen Ähnlichkeit mit Philipp auf seelische Zusammenhänge und glaubte zuversichtlich, eines Tages in ihm ihr Zartgefühl durch Mannhaftigkeit verstärkt wiederzufinden. Fünfzehn Jahre war Philipp alt, als seine Mutter die traurige Wohnung in der Rue Mazarine bezog, und die Anmut dieses Alters bestärkte die mütterlichen Hoffnungen. Joseph, der drei Jahre jünger war, glich seinem Vater, aber zu seinem Nachteil. Sein dichtes schwarzes Haar war immer schlecht gekämmt, was man auch damit anstellte, während der Bruder trotz seiner Lebhaftigkeit immer hübsch blieb. Dann wollte es das Unglück – und beständiges Unglück wird zur Gewohnheit –, daß Joseph keinen Anzug sauber halten konnte; aus seinen neuen Kleidern machte er schnell alte. Der ältere Bruder hielt seine Sachen aus Eitelkeit instand. Unmerklich gewöhnte sich die Mutter daran, Joseph zu schelten und ihm den Bruder als Muster hinzustellen. So zeigte sie ihren Kindern nicht immer beiden das gleiche Gesicht. »Wie wird er mir wieder die Sachen zugerichtet haben?« pflegte sie von Joseph zu sagen, wenn sie die Knaben aus der Schule abholte. Diese Kleinigkeiten bildeten in ihrem Herzen eine gefährliche Vorliebe für den Älteren aus.
Keines von den recht gewöhnlichen Wesen, welche die Gesellschaft der beiden Witwen bildeten, weder der brave Dubruel, noch der alte Claparon, noch Desroches senior, nicht einmal der Abbé Loraux, Agathes Beichtvater, bemerkte Josephs Hang zur Beobachtung. Von seinem Triebe beherrscht gab der künftige Maler auf nichts, was ihn selbst anging, acht. Während seiner Kindheit glich diese Veranlagung einer Art Starrheit und beunruhigte den Vater. Der ungewöhnliche Umfang des Kopfes und die Ausdehnung der Stirn ließen einen Wasserkopf befürchten. Sein bewegtes Gesicht, dessen Eigenart in den Augen von Leuten, die den geistigen Gehalt einer Physiognomie nicht erkennen, Häßlichkeit bedeuten kann, sah in der Jugend ziemlich mürrisch drein. Die Züge, die sich später entfalteten, schienen gekrampft, und die tiefe Aufmerksamkeit des Kindes für die Außenwelt zog sie noch krauser zusammen. Während Philipp der Eitelkeit seiner Mutter schmeichelte, wurde ihr über Joseph nie ein Kompliment gemacht. Dem Philipp entschlüpften die hübschen Wendungen und schlagfertigen Antworten, bei denen sich Eltern einreden, daß ihre Kinder einmal bedeutende Männer werden. Joseph blieb schweigsam und versonnen. Die Mutter hoffte Wunderdinge von Philipp, von Joseph versprach sie sich nichts.
Josephs Vorbestimmung für die Kunst kam durch ein sehr einfaches Ereignis zum Durchbruch: In den Osterferien des Jahres 1812 kam er von einem Spaziergang in den Tuileriengärten mit seinem Bruder und Frau Descoings zurück. Da sah er einen Schüler die Karikatur eines Lehrers auf die Mauer zeichnen und blieb vor Bewunderung wie festgenagelt stehen vor diesen Kreidestrichen, die von Schalkheit sprühten. Am nächsten Tag ging das Kind an das Fenster und sah die Kunstschüler durch das Tor der Rue Mazarine eintreten; heimlich schlich sich der Knabe hinunter und in den langen Hof des Instituts, wo er die Statuen, Büsten, angefangenen Marmorskulpturen, Terrakotten und Gipsabgüsse bemerkte und fiebernd betrachtete; sein Instinkt wurde wach, seine Berufung regte sich. Er trat in einen Saal des Erdgeschosses, dessen Tür halb aufstand und sah dort eine Schar junger Leute eine Statue abzeichnen. Die machten ihn alsbald zur Zielscheibe von tausend Späßen.
»Put, Put!« rief der erste, der ihn sah, nahm eine Brotkrume und bröckelte sie ihm hin.
»Wem gehört das Kind?«
»Gott, wie häßlich der ist!«
Eine Viertelstunde lang hagelten die derben Witze aus dem Atelier des großen Bildhauers Chaudet auf den kleinen Joseph; als sich die Schüler dann genug über ihn lustig gemacht hatten, waren sie am Ende doch von seiner Beharrlichkeit und seinem Gesichtsausdruck betroffen und fragten ihn, was er wollte. Joseph antwortete, er hätte große Lust, zeichnen zu können; worauf ihn alle gleich ermutigten. Das Kind wurde durch den freundschaftlichen Ton vertraulich und gab zum Besten, daß er der Sohn der Frau Bridau wäre.
»Ja dann, wenn du der Sohn der Frau Bridau bist,« rief es aus allen Ecken des Ateliers, »dann kannst du schon eine große Nummer werden. Hoch lebe der Frau Bridau ihr Sohn! Ist sie hübsch, die Mutter? Nach deinem Klotzkopf zu schließen, muß sie recht schick sein!«
»Also, du willst Künstler werden,« sagte der älteste Schüler, verließ seinen Platz und kam zu Joseph, um sich mit ihm zu necken, »weißt du auch, daß man dazu verwegen sein und allerhand Elend auf sich nehmen muß? Da gibt es Dinge durchzumachen, daß einem Hören und Sehen vergeht. All die Kröten, die du hier siehst – da ist nicht ein einziger drunter, der nicht so was durchgemacht hätte. Der da, zum Beispiel, hat einmal sieben Tage lang gehungert! Laß mal sehn, ob du das Zeug zum Künstler hast!«
Er nahm Josephs linken Arm und hob ihn senkrecht empor, dann gab er dem rechten eine Lage, als sollte Joseph zum Faustschlag ausholen.
»Wir nennen das die Telegraphenprobe,« fuhr er fort, »kannst du eine Viertelstunde so stehenbleiben, ohne zu wackeln oder die Arme sinken zu lassen, ja, dann hast du bewiesen, daß du ein Kerl bist.«
»Vorwärts, Kleiner, nur Mut! Ja, ja, wenn man Künstler werden will, muß man leiden«, riefen die andern.
Treuherzig blieb Joseph fünf Minuten lang unbeweglich stehen, und alle Kunstschüler betrachteten ihn mit ernster Miene.
»Hallo! du wackelst«, rief einer.
»Sapperlot! Nicht sinken lassen!« sagte ein andrer.
»Der Kaiser Napoleon ist einen ganzen Monat so geblieben, wie du ihn da siehst«, meinte ein dritter und zeigte auf Chaudets schöne Statue, dieselbe, die im Jahre 1814 von der Säule, die sie so herrlich krönte, heruntergestürzt wurde. Aufrecht stand der Herrscher da und hielt sein kaiserliches Szepter.
Nach zehn Minuten schimmerten Schweißperlen auf Josephs Stirn. Da trat ein kleiner kahlköpfiger Mann von blassem, kränklichem Aussehen ein, und sogleich herrschte ehrfürchtiges Schweigen im Raum.
»Was treibt ihr denn da, Burschen?« fragte er beim Anblick des kleinen Märtyrers.
»Das Kerlchen steht uns Modell«, antwortete der älteste Schüler, der Joseph so hingestellt hatte.
»Schämt ihr euch nicht, ein armes Kind zu quälen?« sagte Chaudet und nahm dem Knaben die Arme herunter. »Seit wann bist du denn da?« fragte er Joseph und gab ihm einen freundlichen Klaps auf die Backe.
»Seit einer Viertelstunde.«
»Und was willst du hier?«
»Ich möchte Künstler werden.«
»Woher bist du denn? Wo kommst du her?«
»Von Mama.«
»Ach! Mama!« riefen die Schüler.
»Ruhe hinter der Pappe!« rief Chaudet. »Was tut denn deine Mama?«
»Die Mama ist Frau Bridau. Mein Papa, der ist tot; der war ein Freund des Kaisers. Der Kaiser wird bezahlen, was Sie wollen, wenn Sie mich zeichnen lehren.«
»Sein Vater war ja Sektionschef im Ministerium des Innern«, rief Chaudet, der sich des Namens erinnerte.
»Und du willst schon Künstler werden?«
»Ja, Herr Lehrer.«
»Komm nur her, so oft du magst. Wir werden dich amüsieren! Gebt ihm doch Bleistift und Papier und laßt ihn gewähren. Wißt ihr, Jungens, ich bin seinem Vater verpflichtet. Du, hol uns Kuchen und Bonbons.« Und er gab dem, der Joseph geneckt hatte, Geld. Dann streichelte er dem Kleinen das Kinn und meinte: »Ob du ein Künstler bist, das werden wir jetzt sehen an der Art, wie du das Zeug kaust.«
Dann sah er die Arbeiten der Schüler der Reihe nach an, und der Knabe ging mit ihm, schaute, horchte und versuchte zu verstehen. Die Süßigkeiten kamen. Und das ganze Atelier, der Bildhauer selbst und der Knabe griffen zu. So viel er zuvor geplagt worden war, so gut wurde Joseph jetzt behandelt. An dieser Szene lernte er instinktiv Witz und Herz der Künstler begreifen, sie machte ihm einen gewaltigen Eindruck. Die Erscheinung des Bildhauers Chaudet, des Frühverstorbenen, den die Gunst des Kaisers verherrlichte, war für Joseph eine Art Vision. Der Mutter sagte der Knabe nichts von seinem Abenteuer; aber nun verbrachte er jeden Sonntag und Donnerstag drei Stunden in Chaudets Atelier. Die Descoings, die alle Launen ihrer beiden Herzensburschen begünstigte, schenkte von jetzt ab dem Joseph Kreide, Rötel, Zeichenwischer und Zeichenpapier. Im Lyzeum zeichnete der künftige Maler Lehrer, Kameraden und Schlafräume ab und war im Zeichenunterricht von erstaunlichem Fleiße. Professor Lemire war überrascht von Josephs Fähigkeiten und Fortschritten und ging zu Frau Bridau, um sie auf die Begabung ihres Sohnes aufmerksam zu machen. Soviel sie vom Haushalt verstand, so wenig verstand die gute Kleinstädterin Agathe von den Künsten.
Sie bekam einen Schreck, und als Lemire fort war, fing sie an zu weinen.
»Ach, sagte sie zu der Descoings, die hinzukam, »aus Joseph wollte ich doch einen Beamten machen, seine Karriere im Ministerium des Innern war ihm schon ganz vorgezeichnet, im Schutz von seines Vaters Schatten wäre er mit fünfundzwanzig Jahren Bürovorsteher geworden, und nun will er Maler werden. Dabei kann er ja verhungern. Ich hab's gewußt, daß mir dies Kind nur Kummer machen würde!«
Frau Descoings gestand, daß sie seit Monaten Josephs Passion ermutigt und seine Sonntags- und Donnerstagsausflüge in das Institut verheimlicht habe. Und als sie einmal mit ihm in der Ausstellung gewesen sei, da habe der Kleine die Bilder angesehn mit einer Andacht: ein wahres Wunder!
»Wenn er schon mit dreizehn Jahren die Malerei versteht,« sagte sie, »dann wird dein Joseph noch einmal ein Genie.«
»Du hast doch gesehn, wohin das Genie seinen Vater gebracht hat! Zu sterben, von Arbeit aufgerieben, mit vierzig Jahren.«
Im Herbst, kurz vor Josephs vierzehntem Geburtstag, ging Agathe, trotz Frau Descoings' Beschwörungen zu Chaudet hinüber, um Einspruch dagegen zu erheben, daß man ihr ihren Sohn abspenstig machte. Sie traf Chaudet in seinem blauen Kittel an seinem letzten Werk modellierend. Recht unfreundlich empfing er die Witwe des Mannes, der ihn einst aus einer ziemlich gefährlichen Lage gerettet hatte. Aber schon war sein Leben bedroht, und er rang um sein Werk mit der Begeisterung, die in wenigen Augenblicken vollenden hilft, was sonst schwere Monate der Ausführung verlangt; an etwas lange Gesuchtes war er geraten und handhabte nun Meißel und Ton mit zuckenden Bewegungen, die der ahnungslosen Agathe als die eines Besessenen erschienen. In andrer Verfassung hätte Chaudet diese Mutter ausgelacht; aber als er jetzt anhören mußte, wie sie die Künste verfluchte, sich über das Schicksal beklagte, das man ihrem Sohn bereiten wollte, und verlangte, man solle ihn nicht mehr in das Atelier lassen, da geriet er in einen heiligen Zorn.
»Ich bin Ihrem verstorbenen Gatten zu Dank verpflichtet; den wollte ich abtragen, indem ich seinen Sohn ermutigte und die ersten Schritte Ihres kleinen Joseph in der größten aller Laufbahnen überwachte«, rief er. »Ja, Madame, lassen Sie es sich sagen, wenn Sie es noch nicht wissen: Der große Künstler ist ein König, mehr als ein König; er ist glücklich, er ist unabhängig, er lebt nach seinem Sinn; und Herrscher ist er in der Welt der Phantasie. Ihr Sohn hat eine schöne Zukunft! Anlagen wie die seinen sind selten; sie haben sich so früh nur bei einem Giotto, einem Raffael, Tizian, Rubens, Murillo enthüllt; er scheint mir nämlich eher Maler als Bildhauer zu werden. Heiliger Gott! Wenn ich solch einen Sohn hätte, ich' wäre so glücklich, wie es der Kaiser ist über seinen kleinen König von Rom! Sie haben zu bestimmen über das Los Ihres Kindes. Nur zu, Madame! machen Sie einen Trottel aus ihm, einen, der nur im Geleise laufen kann, einen elenden Federfuchser. Einen Mord begehen Sie! Ich hoffe bestimmt, er wird all Ihrer Mühe zum Trotz immer Künstler bleiben. Beruf ist stärker als alle Hindernisse, die man ihm entgegenstellt! Beruf, das heißt Ruf! das heißt: Gott hat gerufen, hat erwählt. Sie werden Ihr Kind unglücklich machen!« Heftig warf er den Rest Ton in einen Kübel und sagte zu seinem Modell: »Genug für heute.«
Agathe sah auf und bemerkte in einer Ecke des Ateliers, die sie noch nicht beachtet hatte, aus einem Schemel eine nackte Frau; vor diesem Anblick lief sie schaudernd fort.
»Ihr werdet also den kleinen Bridau nicht mehr hier hereinlassen«, sagte Chaudet zu seinen Schülern. »Seiner Frau Mutter paßt es nicht.«
»Huh! Huh!« johlten die Schüler, als Agathe die Tür schloß.
»Und da ist mein Joseph gewesen!« sagte sich die arme Mutter, ganz erschüttert von dem, was sie gehört und gesehen hatte.
Seit die Schüler der Bildhauer- und Malerklassen wußten, daß Frau Bridau ihren Sohn nicht Künstler werden lassen wollte, war es ihr Hauptvergnügen, Joseph zu sich zu locken. Wohl mußte der Knabe der Mutter versprechen, nicht mehr in das Institut zu gehen, aber er schlich sich doch oft in das Atelier des Malers Regnauld und ließ sich ermutigen, Leinwände vollzumalen. Als die Witwe sich beklagen wollte, sagten Chaudets Schüler zu ihr, Herr Regnauld sei nicht Chaudet; auch habe sie ihnen ihren Herrn Sohn nicht in Hut gegeben, und tausend andre Späße. Die schrecklichen Rapins verfaßten und sangen ein Lied auf Frau Bridau, hundertsiebenunddreißig Verse lang.
Am Abend jenes traurigen Tages mochte Agathe nicht mitspielen; ganz niedergeschlagen, blieb sie in ihrem Sessel und bisweilen traten Tränen in ihre schönen Augen.
»Was ist Ihnen, Frau Bridau?« fragte der alte Claparon.
»Sie glaubt, ihr Sohn wird einmal betteln müssen, weil er Anlage zum Maler hat,« sagte die Descoings, »mein Stiefsohn, der kleine Bixiou, ist auch ein wilder Zeichner, aber das macht mir keine Sorge für seine Zukunft. Die Männer haben das Zeug dazu, sich durchzusetzen.«
»Madame hat ganz recht«, sagte der dürre strenge Desroches, der es bei all seinen Talenten nicht zum Vizedirektor gebracht hatte. »Ich habe zum Glück nur einen Sohn, was wäre wohl mit meinen achtzehnhundert Franken und einer Frau, die mit ihrem Postverschleiß kaum zwölfhundert Franken verdient, aus mir geworden? Ich habe meinen Jungen zu einem Advokaten getan als Hilfsschreiber, da hat er seine fünfundzwanzig Franken im Monat und sein Frühstück, ich gebe ihm auch fünfundzwanzig, er ißt und schläft zu Hause. Der wird schon seinen Weg machen! Bei mir kriegt er mehr Arbeit, als wenn er auf der hohen Schule wäre; eines schönen Tages wird er Advokat werden. Wenn ich ihm einmal ein Theaterbillett bezahle, dann ist er froh wie ein König, er fällt mir um den Hals. Oh, ich halte ihn kurz! er muß mir über jeden Pfennig Rechenschaft geben. Wenn Ihr Sohn am Hungertuche nagen will, so lassen Sie ihn nur! Er wird es weit bringen.«
»Meiner ist erst sechzehn Jahre alt,« sagte Du Bruel, ein alter, eben pensionierter Sektionschef, »seine Mutter vergöttert ihn; aber ich halte nichts von einer Begabung, die sich so frühzeitig äußert. Das ist Spielerei, eine Neigung, die sich bald wieder gibt. Ich meine, Knaben müssen angeleitet werden.«
»Sie sind reich, Sie sind ein Mann, Herr Du Bruel, und Sie haben nur einen Sohn«, sagte Agathe.
»Ach ja,« begann Claparon wieder, »die Kinder sind unsere Tyrannen – Coeur! Meiner macht mich rasend, er hat mich an den Bettelstab gebracht, ich habe mich schließlich überhaupt nicht mehr um ihn gekümmert – Solo! Na, und seitdem ist er glücklicher, und ich bin's auch. Der Bursche ist mit schuld am Tod seiner armen Mutter. Nun ist er Reisender geworden, und das ist das Richtige für ihn; denn so oft er zu Hause war, gleich wollte er wieder fort, nirgends konnte er bleiben, nichts wollte er lernen. Ich bitte den lieben Gott nur noch um eine Gnade: daß ich sterbe, ehe der Junge meinem Namen Schande macht! Wer keine Kinder hat, der lernt viele Freuden nicht kennen, aber es bleibt ihm auch mancher Kummer erspart.«
›So sind die Väter!‹ dachte Agathe und fing wieder zu weinen an.
»Ich will damit nur sagen, meine liebe Frau Bridau, daß Sie Ihren Jungen Maler werden lassen müssen, sonst verlieren Sie Ihre Zeit ...«
»Wenn Sie imstande wären, ihm die Leviten zu lesen,« fing der gestrenge Desroches wieder an, »dann würde ich Ihnen raten, seinen Neigungen entgegenzutreten, aber schwach, wie ich Sie mit Ihren Kindern kenne, lassen Sie ihn nur pinseln und kritzeln.«
»Verloren!« sagte Claparon.
»Was denn? Verloren?« rief die arme Mutter.
»Ach, nur mein Coeur-Solo; Desroches, diese alte Hopfenstange, legt mich immer herein.«
»Nur Mut, Agathe,« sagte die Descoings, »Joseph wird noch einmal ein berühmter Mann.«
Nach dieser Debatte, die allen Debatten glich, einigten sich die Freunde der Witwe auf einen Rat, und dieser Rat half ihr nicht aus der Verlegenheit. Man riet ihr, Joseph seiner Begabung nachgehen zu lassen.
»Wenn er kein Genie wird,« sagte Du Bruel, der Agathe den Hof machte, »so können Sie ihn immer noch in die Verwaltung tun.«
Auf der Treppe beim Hinausbegleiten nannte die Descoings die drei alten Beamten die »Weisen Griechenlands«.
»Sie macht sich zu viel Sorgen«, meinte Du Bruel.
»Sie ist nur zu froh, daß ihr Sohn überhaupt etwas will«, behauptete Claparon.
»Wenn Gott uns den Kaiser erhält,« sagte Desroches, »wird Joseph seine Protektion haben. Also, wozu beunruhigt sie sich?«
»Wenn sich's um ihre Kinder handelt, macht ihr alles Angst«, antwortete die Descoings; und als sie wieder bei Frau Bridau oben war, tröstete sie sie: »Du siehst, mein Herzchen, sie sind alle einer Meinung, was hast du noch zu weinen?«
»Ach, wenn es sich um Philipp handelte, da hätte ich weiter keine Furcht. Wenn du wüßtest, wie es in diesen Ateliers zugeht! Da haben die Künstler nackte Frauen.«
»Na, wenn sie nur gut einheizen!« meinte die Descoings.
*
Ein paar Tage später kam die Kunde von dem unglücklichen russischen Rückzug. Napoleon kehrte zurück, um neue Streitkräfte mobil zu machen und von Frankreich neue Opfer zu fordern. Da war die arme Mutter noch ganz andern Ängsten ausgeliefert. Philipp, dem es auf dem Lyzeum nicht behagte, wollte absolut in des Kaisers Dienste treten. Er wohnte einer Truppenschau in den Tuilerien bei, der letzten, die Napoleon dort abnahm, und die machte ihn ganz fanatisch. Damals übte die Soldatenpracht, der Glanz der Uniformen, die Würde der Epauletten einen unwiderstehlichen Reiz auf junge Leute aus. Philipp glaubte sich für den Militärdienst ebenso berufen wie sein Bruder für die Kunst. Hinter dem Rücken seiner Mutter verfaßte er folgende Bittschrift an den Kaiser:
»Sire, ich bin der Sohn Ihres Bridau, ich bin achtzehn Jahre alt, messe fünf Fuß sechs Zoll, habe gute Beine, guten Wuchs und den Wunsch, einer Ihrer Soldaten zu werden. Ich rufe Ihre Gunst an, um in die Armee einzutreten usw.«
Innerhalb vierundzwanzig Stunden schickte der Kaiser Philipp vom kaiserlichen Lyzeum nach Saint-Cyr und sechs Monate später, im November 1813, als Unterleutnant in ein Kavallerieregiment. Einen Teil des Winters blieb Philipp im Ersatzbataillon, aber sobald er reiten konnte, zog er voll Eifer ins Feld. Während des französischen Feldzuges wurde er Leutnant und zwar bei einem Vorpostengefecht, in dem er durch sein Ungestüm seinen Obersten rettete. In der Schlacht bei La Fère-Champenoise ernannte der Kaiser Philipp zum Hauptmann und bestimmte ihn zum Ordonnanzoffizier. Diese Beförderung feuerte ihn noch mehr an und bei Montereau bekam er das Kreuz. Der Hauptmann Philipp war Zeuge des Abschieds Napoleons zu Fontainebleau, und dies Schauspiel fanatisierte ihn: er verweigerte den Bourbonen den Dienst.
Als er im Juni 1814 zu seiner Mutter heimkam, fand er sie zugrunde gerichtet. In den Ferien wurde Josephs Stipendium aufgehoben, und Frau Bridau, deren Pension aus der Privatschatulle des Kaisers gezahlt worden war, bemühte sich vergeblich, sie auf das Ministerium des Innern überschrieben zu bekommen. Jetzt wollte Joseph nur noch Maler sein, die Ereignisse begeisterten ihn, und er bat seine Mutter, ihn zu Herrn Regnauld zu lassen, dort versprach er sich, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Er fühlte sich als Sekundaner stark genug, um sich die Prima schenken zu können. Es schmeichelte der Mutter über die Maßen, daß ihr Philipp mit neunzehn Jahren Hauptmann war, das Kreuz trug und auf zwei Schlachtfeldern des Kaisers Adjutant gewesen war, obwohl er sich roh und großspurig benahm und eigentlich nur die übliche Tapferkeit eines Draufgängers besaß, war er für sie der bedeutende Mann, während sie von dem kleinen magern, kränklichen Joseph mit seiner krausen Stirn, seiner sanftmütigen friedlichen Art und seinen Künstlerträumen nichts als Kummer und Sorgen erwartete. Der Winter von 1814 auf 1815 war für Joseph günstig: Im heimlichen Schutz der Descoings und des jungen Bixiou, der ein Schüler von Gros war, arbeitete er in dem berühmten Atelier dieses großen Künstlers, in der Pflanzstätte so vieler verschiedener Talente, und schloß dort innige Freundschaft mit Schinner. Dann kam der zwanzigste März. Hauptmann Bridau stieß in Lyon zum Kaiser, begleitete ihn in die Tuilerien und wurde zum Schwadronkommandanten bei den Gardedragonern ernannt. Bei Waterloo wurde er leicht verwundet und erhielt das Offizierskreuz der Ehrenlegion. Nach der Schlacht geriet er bei Saint-Denis zum Marschall Davoust und schloß sich nicht der Loirearmee an; Davoust sorgte dann auch dafür, daß er sein Offizierskreuz und seinen Rang behielt, aber er wurde auf Wartegeld gesetzt. Indessen studierte Joseph in Sorgen um die Zukunft mit einem Eifer, der ihn im Wirbel der Ereignisse wiederholt aufs Krankenbett warf.
»Das macht der Farbengeruch,« sagte Agathe zu Frau Descoings, »er sollte einen Beruf, der seiner Gesundheit so schädlich ist, aufgeben.« Sie grämte sich viel mehr um ihren andern Sohn, den Oberstleutnant; als sie ihn im Jahre 1816 wiedersah, war aus seinem Dragonermajorgehalt von ungefähr neuntausend Franken ein Wartegeld von monatlich dreihundert Franken geworden; sie verwandte einen Teil ihrer Ersparnisse dazu, ihm eine Dachkammer über der Küche einzurichten. Philipp wurde einer der wildesten Bonapartisten des Café Lemblin und nahm Gewohnheiten, Manieren und Lebensstil der pensionierten Offiziere an. Wie es bei seinen einundzwanzig Jahren natürlich war, übertrieb er sie noch, weihte den Bourbonen einen tödlichen Haß, dachte nicht daran, sich ihnen anzuschließen und ging allen Gelegenheiten aus dem Wege, als Oberstleutnant in die Linie eingestellt zu werden. Das war in den Augen seiner Mutter Seelengröße. »Sein Vater hätte nicht besser gehandelt«, sagte sie.





























