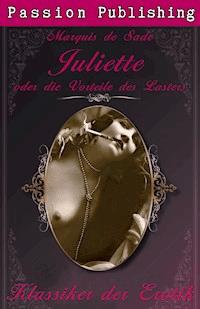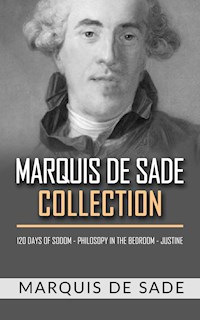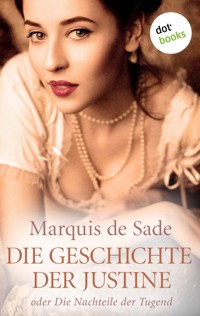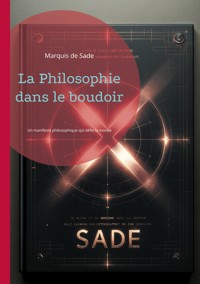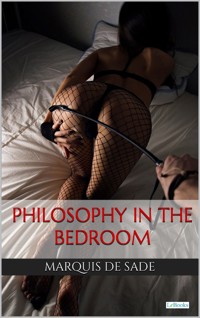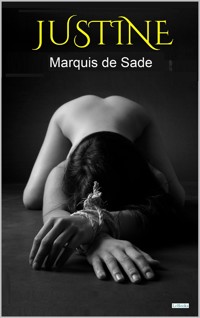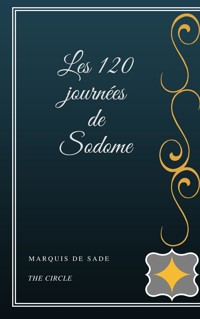1,49 €
Mehr erfahren.
Der zweite Band des Marquis de Sade. Justine gerät mehr und mehr in den Strudel des Lasters. Philosophie der Dominanz der Untugend über die Tugend. Dieses Buch ist für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Justine 2
Band 2
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenKapitel 1
Ein anderes Wesen als die zitternde Justine hätte sich wenig um diese Drohung geschert; sobald es ihr möglich war, zu beweisen, daß, was sie erduldet, über sie von keinem Gerichte verhängt worden war, was hatte sie zu fürchten? Aber ihre Schwäche, ihre natürliche Furchtsamkeit, alles dies betäubte sie, erschreckte sie. Sie dachte nur mehr an Flucht. Außer dieser beschämenden Marke, einigen Spuren der Rute, welche Dank der Reinheit ihres Blutes bald verschwinden würden, und einiger sodomitischer Angriffe, welche, von gewöhnlichen Gliedern ausgeführt, sie nicht verunstalteten, hatte unsere Heldin, als sie achtzehn Jahre alt, von Rodin fortging, nichts verloren, weder von ihrer Tugend, noch Von ihrer Frische, noch von ihren Kräften. Sie trat in jenes Alter, wo die Natur eine letzte Anstrengung zu machen scheint, um die zu verschönern, welche ihre Hand für die Lust der Männer bestimmt hat. Ihre Taille hatte bessere Formen, ihre Haare waren dichter und länger und ihre Haut frischer und appetitlicher. Ihr Busen, geschont von diesen Leuten, welche für diesen Körperteil wenig Interesse hatten, war wohlgeformter und runder. Sie war ein entzückendes Wesen, wohlgeeignet, bei einem Wüstling die heftigsten, außergewöhnlichsten und schamlosesten Begierden zu erregen.
So machte sich Justine, mehr aufgeregt und bekümmert als körperlich mißhandelt, denselben Abend auf den Weg. Aber ohne Führer und da sie niemanden fragte, kam sie immer wieder um Paris herum. Am vierten Tage ihrer Reise war sie erst nach Lieursaint gekommen. Da sie wußte, daß diese Straße sie nach dem Süden führte, beschloß sie, ihr zu folgen und so diese entlegenen Länder zu erreichen, überzeugt, daß sie nur an den Grenzen Frankreichs den Frieden und die Ruhe erlangen würde. Welcher Irrtum! Wie viel Kummer stand ihr noch bevor!
Was sie auch immer bist jetzt ausgestanden, ihre Tugend wenigstens war ihr geblieben; einzig das Opfer zweier oder dreier Wüstlinge, konnte sie sich, da es entgegen ihrem Willen geschehen, noch immer unter die anständigen Mädchen zählen; sie hatte sich nichts vorzuwerfen, ihr Herz war rein, sie war darauf stolz: und dafür erreichte sie die Strafe. Sie trug ihr ganzes Vermögen bei sich, ungefähr fünfhundert Francs, ihr Verdienst bei Bressac und bei Rodin. Sie war froh, wenigstens dies sich noch gerettet zu haben und hoffte, mit Sparsamkeit und Einfachheit so lange auszulangen, bis sie eine Stelle gefunden; die schreckliche Marke war nicht zu sehen, sie hoffte, sie immer verbergen zu können, und trotzdem ihr Brod zu verdienen. Voll Hoffnung und Mut verfolgte sie ihre Straße bis Sens, wo sie sich einige Tage ausruhte. Vielleicht hätte sie in dieser Stadt etwas Passendes gefunden, aber gezwungen, sich möglichst zu entfernen, machte sie sich wieder auf den Weg, um in der Dauphiné ihr Glück zu versuchen. Sie hatte viel von diesem Land sprechen gehört und glaubte dort ihr Glück zu finden. Wir werden sehen, was für eines ihr aufgespart war.
Am Abend des ersten Tages, sechs oder sieben. Meilen von Sens, ging Justine ein wenig abseits des Weges und setzte sich einen Moment an den Rand eines großen Teiches, dessen Umgebung ihr Schatten zu spenden schien. Die Nacht begann ihre Schleier zu senken und unsere Heldin, die wußte, daß sie nur mehr eine kleine Strecke zu ihrem Nachtquartier hatte, beeilte sich nicht, die süße Einsamkeit ihres Nachdenkens zu unterbrechen, als sie plötzlich zehn Schritte von ihr einen größeren Gegenstand ins Wasser fallen hörte. Sie wendete ihre Augen und bemerkte, daß dieser Gegenstand mitten unter dichtem Gestrüpp lag, zu dessen Fuß die Wasser des Teiches fluteten; weder sie noch der Täter konnten sich sehen. Ihre erste Bewegung war, zu dem sinkenden Gegenstand; sie bemerkte, daß er nicht sofort sank, sondern langsam, und glaubte Schreie zu hören; überzeugt, daß sich in dieser Art Korb ein lebendes Wesen befinde, folgt sie dem Triebe der Natur. Ohne Rücksicht auf die Gefahr, stürzt sie sich in den Teich und es gelingt ihr, ohne den Boden zu verlieren, den Gegenstand, den der Wind zu ihr hintreibt, zu erfassen. Sie kehrt ans Ufer zurück und zieht die kostbare Last nach; eilig packt sie aus. Großer Gott, es ist ein Kind, ein entzückendes Mädchen von achtzehn Monaten, nackt, geknebelt, welches ihr Henker wahrscheinlich hoffte zugleich mit seinem Verbrechen in den Fluten des Teiches zu begraben. Justine beeilt sich, die Banale zu zerreissen, sie läßt das kleine Mädchen atmen, und es streckt seine kleinen, furchtsamen Hände gegen seine Wohltäterin aus, wie um sich bei ihr zu bedanken. Gerührt umarmte Justine die reizende Unglückliche. »Armes Kind,« sagt sie, »bist du auf die Welt gekommen gerade, so wie die unglückliche Justine, nur um den Kummer, niemals die Freude kennen zu lernen? Vielleicht wäre der Tod das beste für dich gewesen. Ich leiste dir vielleicht einen schlechten Dienst, indem ich dich aus dem Schöße der Vergessenheit ziehe und dich wieder ins Unglück und in die Verzweiflung zurückführe; wohlan, ich werde diesen Fehler gutmachen und dich nie verlassen, wir werden zusammen die Dornen dieses Lebens pflücken; sie werden uns zu zweit weniger spitzig vorkommen und mit vereinten Kräften werden wir sie zu zweit leichter vermeiden. Gütiger Himmel, ich danke dir für dieses Geschenk, es ist eine heilige Gabe, für das mein Gefühl dir immer dankt; glücklich, es gerettet zu haben, werde ich für sein weiteres Leben, seine Erziehung, seine Sitten sorgen. Ich werde für sie arbeiten, jünger als ich, wird sie mir es im Alter heimzahlen.; es ist eine Freundin, welche mir Gott geschickt. Auf welche Weise kann ich dir danken?«
»Das soll meine Sorge sein, du Hure!« schrie ein Mann mit Stentorstimme, und indem er die unglückliche Justine beim Kragen faßte, warf er sie auf den Rasen. »Ja, ich werde dich dafür strafen, dich in Angelegenheiten zu mischen, die dich nichts angehen.« Daraufhin ergreift der Unbekannte das kleine Mädchen, steckt es wieder in den Korb und wirft es wieder ins Wasser. »Du verdienst dasselbe Los, Mistmensch,« sagte der Kerl, »wie dieses Kind, und ich würde nicht zögern, es dir zuteil werden zu lassen, wenn ich dich nicht für grausamere Strafen aufbewahren würde, die mir mehr Vergnügen machen. Folge mir ohne ein Wort; sieh diesen Dolch: bei der ersten Bewegung steckt er in deinem Busen.«
Wir sind nicht imstande, die Ueberraschung und das Erschrecken Justines zu beschreiben. Sie wagte es nicht, zu antworten und folgt zitternd ihrem Henker; nach zwei Wegstunden kamen sie zu dem Schloß, welches am Ende eines Tales gelegen, von Hochwald umgeben, ein wildes, düsteres Aussehen hatte. Die Tür zu diesem Hause war so von Gehölz und Gestrüpp verdeckt, daß es unmöglich war, sie zu erraten. Hier trat gegen zehn Uhr nachts, vom Herrn des Hauses geführt, Justine ein. Während das arme Mädchen, in einem Zimmer verschlossen, ein wenig Ruhe sucht vor diesem neuen Schrecken, wollen wir Alles das vorausschicken, was zum Verständnis des Folgenden notwendig ist. Monsieur de Bandole, ein reicher Mann, einst in hoher Stellung, war der Besitzer des Schlosses. Zurückgezogen von der Welt seit fünfzehn Jahren, gab sich Bandole in dieser Einsamkeit ganz seiner absonderlichen Geschmacksrichtung hin. Wenige Menschen waren kräftiger als Bandole; obwohl er vierzig Jahre alt war, machte er täglich seine vier Nummern, ja in seiner Jugend hatte ers auf zehn gebracht. Groß, mager, von galligem Temperament, besaß er einen schwarzen und widerspenstigen Schwanz von neun Zoll Länge und sechs Zoll Dicke; behaart war er am ganzen Körper wie ein Bär. Bandole, so wie wir ihn jetzt beschrieben haben, liebte die Frauen nur zu seiner Lust; wenn er gesättigt war, konnte sie niemand mehr verachten. Noch merkwürdiger war, daß er sich ihrer nur dazu bediente, um Kinder zu erzeugen und niemals verfehlte er; aber noch merkwürdiger war der Gebrauch, den er von diesen Früchten machte; er zog sie auf bis achtzehn Monate und hierauf wurde der finstere Teich, in welches wir eines ihn haben versenken sehen, ihr gemeinsames Grab.
Diesen bizarren Wahn zu befriedigen, hatte Bandole dreißig Mädchen in seinem Schloß eingeschlossen im Alter von achtzehn bis zu fünfundzwanzig Jahren, alle von der größten Schönheit. Vier alte Frauen waren beauftragt, dieses Serail zu betreuen, eine Köchin und zwei Küchenmädchen vervollständigten den Haushalt dieses Wüstlings; ein großer Feind aller Schwelgereien im Sinne Epicurs, war er der Ansicht, daß man, um seine Kraft zu erhalten, wenig essen und nur Wasser trinken dürfe, und daß eine Frau, um fruchtbar zu sein, nur gesunde und leichte Nahrung zu sich nehmen dürfe. Deshalb nahm Bandole nur immer eine Mahlzeit, bestehend aus einigen Gemüsen ein, und auch die Frauen erhielten nichts als Gemüse und Früchte; wirklich erfreute sich auch Bandole infolgedessen einer glänzenden Gesundheit und seine Weiber waren entzückend frisch; sie legten wie die Hennen und in jedem Jahr gebar ihm jede wenigstens ein Kind. Der Schweinkerl ging auf folgende Weise vor: In einem eigens dazu hergerichteten Boudoir stand eine Maschine, auf welcher das Weib so festgebunden wurde, daß sie dem Wüstling den Tempel der Venus so weit als möglich öffnete; er begann zu vögeln und sie konnte sich nicht rühren. Dies war nach der Behauptung Bandoles das Wichtigste zur Befruchtung, und nur deshalb ließ er sie binden. Drei oder viermal im Tag wurde dasselbe Weib auf die Maschine gebunden; hierauf kam sie ins Bett, die Füße in die Höhe, den Kopf tief gelegt. Sei es, daß das Mittel Bandoles wirklich gut war oder daß sein Same eine seltene Fruchtbarkeit besaß, immer hatte er denselben Erfolg. Nach neun Monaten erschien pünktlich das Kind, er zog es bis zu achtzehn Monaten auf, dann ertränkte er es, und es war immer Bandole selbst, welcher dies besorgte; dies verschaffte ihm nämlich den nötigen Ständer, um sich neue Opfer zu zeugen. Nach jeder Geburt wechselte man die Frauen, so daß nur die unfruchtbaren blieben. Dadurch waren sie in der schrecklichen Zwangslage, entweder dem Ungeheuer ein Kind zu gebären oder ewig bei ihm zu bleiben. Da sie nicht wußten, was mit ihrer Nachkommenschaft geschah, so konnte Bandole ihnen leicht ihre Freiheit wieder geben, und man brachte sie zurück, woher sie kamen und jede erhielt tausend Francs Schadenersatz. Was Justine anbelangt, konnte er aber nicht daran denken, ihr die Freiheit wieder zu geben, so viel Kinder sie ihm auch gebären würde, denn sie hatte ihn belauscht und konnte ihn daher verraten. Im Hause selbst konnte Justine, eingeschlossen wie die anderen Frauen, jede für sich nichts ausplauschen. Daher bot nur ihre Freiheit ihm Gefahr und Bandole dachte nicht daran, sie ihr jemals zu schenken; man wird sich leicht vorstellen, daß die Art, seine Wollust zu befriedigen, bei einem solchen Manne viel von der Wildheit seines Charakters an sich trug. Nur an die Befriedigung seiner Wollust denkend, hatte Bandole niemals die Liebe gekannt. Eine der Alten band gerade das Tagesopfer auf die Maschine. Man verständigte ihn hievon, er ging ins Boudoir, onanierte ein wenig vor ihrer Scheide, fluchte, schimpfte, begann dann zu vögeln, stieß Verzückungsschreie aus und begann im Momente der Ejakulation wie ein Stier zu brüllen, dann ging er hinaus, ohne nur das Weib anzuschauen und wiederholte dies noch drei bis viermal an demselben Tage mit derselben. Am nächsten Tage kam eine andere an die Reihe und so ging das fort, immer dasselbe: ein langer Coitus, Schreie, Flüche, Samenerguß, immer dasselbe.
Dies war also der Mann, welcher eine Rose pflücken wollte, die zwar durch die grausamen Angriffe des Saint-Florent etwas entblättert, aber durch, die, lang andauernde Keuschheit wieder erfrischt, sich geschlossen hatte und daher recht wohl noch als die Blume der Jungfernschaf gelten konnte. Bandole gab nämlich sehr viel darauf; seine Agenten hatten den Auftrag, ihm nur Jungfern zuzuführen, sonst wurden sie nicht angenommen Im übrigen war Bandole für jedermann unsichtbar; ihm behagte nur das zurückgezogenste Leben, einige Bücher und Spaziergänge waren das einzige, womit er seine Lust unterbrach. Er besaß Verstand, einen festen Charakter, keinerlei Vorurteile, keine Religion. Despot in seinem Serail, ohne Schamgefühl und Menschlichkeit, verherrlichte er sein Laster. Dies war Bandole, das Grab, welches die Vorsehung für Justine als Belohnung dafür, daß sie dem Scheusal ein Opfer hatte entreissen wollen, gegraben hatte. Vierzehn Tage verflossen, ohne daß unsere Unglückliche von ihren Verfolgern etwas gehört hätte. Eine der Alten brachte ihr die Nahrung und antwortete ihr, wenn Justine sie befragte, kaltblütig–. »Du wirst bald das Vergnügen haben, den Herrn zu sehen, dann wirst du das nähere erfahren.« – »Aber, meine Liebe, wozu bin ich denn da?« – »Zum Vergnügen des Herrn.« – »O Himmel, er wird mich doch nicht zu Dingen zwingen wollen, an die zu denken mich schon schaudern macht?« – »Du wirst machen wie die anderen und du wirst nicht mehr zu beklagten sein wie sie Alle.«
– »Die andern? Es gibt also noch welche hier?« – »Gewiß, du bist nicht allein; nur Mut und Geduld!« Darauf schloß sie die Tür.
Am sechzehnten Tage endlich verständigte man Justine. Die Tür öffnete sich und Bandole, gefolgt von einem alten Weib, kam in das Zimmer. »Lass deine Scheide anschauen,« sagte die Alte, und Justine wurde, ohne daß sie sich wehren konnte, gepackt und entblößt. »Ah,« sagte Bandole gleichgiltig, »ist das nicht die, die mich überrascht hat, und die daher ewig hier blieben muß?« – »Ja,« antwortete man ihm. – »Wenn dem so ist,« sagte er, »braucht man nicht viel Vorbereitungen. Ist sie noch Jungfer?«
– Daraufhin bückte sich die Alte, eine Brille auf der Nase. »Man hat es bereits verletzt,« sagte sie, »aber es ist noch genug eng und frisch, um Vergnügen zu schaffen.« – »Spreize sie auseinander, damit ich selbst sehen kann,« sagte Bandole und das Scheusal, kniend vor der Fut, steckt nacheinander seine Finger, seine Nase und seine Zunge hinein. »Greife ihr an die Hüften,« sagte er zur Alten, aufstehend, »und sage mir, ob du glaubst, daß sie trächtig werden wird?« – »Ja,« sagte die Alte, »sie ist sehr gut gebaut, du kannst mit Bestimmtheit in neun Monaten ein Kind erwarten.«
– »Himmel!« rief Justine aus, »man behandelt mich ja wie ein Tier, und womit habe ich das verdient, daß Ihr mich so mißhandelt, welche Gewalt habt Ihr über mich?« – »Hier ist es,« sagte Bandole und zeigte sein Glied; »es steht mir und ich will vögeln.« – »Wie verträgt sich Ihr Verlangen mit der Menschlichkeit?« – »Ja, was ist denn die Menschlichkeit, meine Tochter?« – »Die Tugend, welche dir Hilfe bringen wird, wenn du einmal im Unglück bist.« – »Das ist man nie mit meiner Gesundheit, meinen Prinzipien und einer halben Million Rente.« – »Man ist es immer, wenn man andere unglücklich macht.« – »Sieh einmal,« sagte Bandole, »die raisonniert ja!« Er zog seine Hose wieder an. »Ich will mit dir ein wenig plauschen; zieht euch zurück!« sagt er zu der Alten. »Woher nimmst du, mein Kind,« fragte Bandole, »mir gegenüber, der ich doch körperlich und durch meine Ansichten stärker bin, den Mut, zu solcher Rede?« – »Diese Gaben,« antwortete Justine, »sollten erst recht für sie der Grund dazu sein, die Tugend zu achten und das Unglück zu unterstützen. Ihr seid ihrer unwürdig, wenn Ihr sie nicht so verwendet.« – »Ich will dir sagen, mein liebes Kind, daß diese Denkungsart mir ganz fern liegt; um mit dir so leben zu wollen, müßte ich in deinem Geiste Spuren meiner Neigungen und meines Geschmackes finden, und das ist ja unmöglich. Ich kann dich nur als fremd fühlen und dich nur soweit schätzen, als du mir nützlich bist. Da ich der Stärkere bin, besteht diese Nützlichkeit in der vollständigen Unterwerfung unter meinen Willen. Der Natur der Dinge folgend, büße ich an dir meine Lust und du hast sie zu ertragen. Die Menschlichkeit, von der du sprichst, ist die Philosophie des Schwachen; die Menschlichkeit besteht nicht darin, andern zu helfen, sondern sich, soweit es geht, auf Kosten anderer zu ergötzen; verwechsle daher nie die Zivilisation mit der Menschlichkeit; die eine ist die Tochter der Natur, übe sie daher aus ohne Vorurteil und du tust das Rechte; die andere ist Menschenwerk und daher ein Gemengsel aller Leidenschaften und Interessen. Die Natur gibt uns nur das Nützliche und ihr Gefällige ein; immer, wenn wir ihr folgen und ein Hindernis finden, ist es Menschenwerk. Wozu diese Hindernisse beachten? Das kann nur Furcht und Schwäche uns eingeben, niemals aber die Vernunft, denn diese nimmt alle Hindernisse. Wäre es denn, vernünftig, daß die Natur uns eine Begierde eingibt und zugleich die Möglichkeit schafft, sie durch dieselbe zu verletzen? Nichts ist so außergewöhnlich wie mein Geschmack; ich liebe nicht die Frauen, die Wollust allein ist mein Ziel; sie zu schwängern und die Frucht, die ich gesät, zu vernichten, ist mein Entzücken. Es gibt nichts, was mich in den Augen meiner Mitmenschen schuldiger machen könnte. Ist das ein Grund mich zu bessern? Keines falls! Was scheert mich die Achtung und die Meinung der Menschen, was ist diese Chimäre gegen meine Passionen? Was ich verliere ist ihr Egoismus, was ich gewinne, die höchste Wollust.« – »Die höchste, mein Herr?« – »Gewiß, die süßeste; sie ist umso süßer, je mehr sie sich von der gewöhnlichen Sitte entfernt. Nur in der Zerstörung aller dieser Schranken besteht die höchste Wollust.« – »Aber, mein Herr, das ist ja Verbrechen!« – »Welch leeres Wort, mein Kind, es gibt kein Verbrechen in der Natur; die Menschen glauben daran, denn sie haben alles dazu stempeln müssen, was ihren Frieden stört; deshalb kann ein Mann dem andern Unrecht tun, niemals aber der Natur.« Hier wiederholte Bandole mit verschiedenen Worten Alles, was Rodin über den Kindesmord gesagt; er bewies ihr dabei, daß nichts Schlechtem dabei sei, über die Frucht, die man gepflanzt, zu entscheiden, und daß wir über nichts gegründetere Rechte haben. »Der Wille der Natur ist erfüllt, sobald die Frau schwanger ist; was kümmert es sie, ob die Frucht reif wird oder noch grün gepflückt wird.« – »O, mein Herr, niemals werden Sie eine Sache mit einem beseelten Wesen richtig vergleichen können.« – »Beseelt!« lachte Bandole, »sag mir, meine Liebe, was verstehst du darunter?« – »Die Seele gibt mir eine Ahnung von dem belebenden ewigen Prinzip, sie ist die irdische Ausstrahlung der Gottheit, welche uns ihr nähert und durch welche wir uns von den Tieren unterscheiden.« – Hier brach Bandole ein zweitesmal in Lachen aus. »Höre, mein Kind, ich merke, es verlohnt sich, dich aufzuklären: