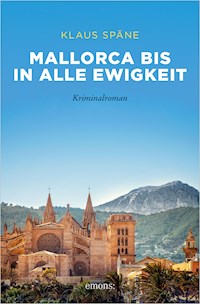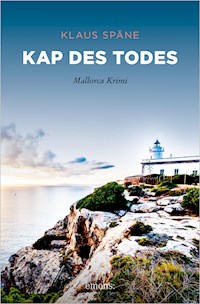
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Skrupellose Raubüberfälle und ein Mord auf einer Finca erschüttern das Lieblingsreiseziel der Deutschen. Auf Mallorca hat das Verbrechen Hochsaison: Brutale Übergriffe, aufsässige Hausbesetzer und gleich drei mysteriöse Todesfälle halten die Insel und Chefinspektor Pau Ribera von der spanischen Nationalpolizei in Atem. Auf den ersten Blick gibt es keinerlei Zusammenhänge, doch je tiefer Ribera in die Ermittlungen eintaucht, desto finsterer werden die Abgründe des Urlaubsparadieses ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Klaus Späne arbeitet als Redakteur der Tageszeitung »Frankfurter Neue Presse«. Mit Mallorca und den Balearen verbindet ihn eine lange und persönliche Geschichte. Er hat auf Mallorca gelebt und gearbeitet und kennt die Reize und Eigenheiten, aber auch die Schattenseiten der Insel.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang befindet sich ein Glossar.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: lookphotos/Anastasia Petrakova
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Karte: shutterstock.com/Axel_kock (bearbeitet)
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-744-6
Mallorca Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Prolog
Der Spinnenmann
Dass Kriminelle unter einer Happy Hour etwas anderes verstehen als er und der große restliche Teil der Menschheit, sollte Bartomeu del Amo am eigenen Leib erfahren. Als er gegen neunzehn Uhr dreißig seinen Arbeitsplatz, einen wuchtigen Altstadtpalast im Zentrum Palmas, verließ, deutete allerdings noch nichts darauf hin.
Der Abend war perfekt, um die Seele baumeln zu lassen. Das klare Licht des mallorquinischen Frühlings beschien die Palmen und Platanen, die sich auf der Plaça del Mercat erhoben und den Platz wie eine grüne Oase inmitten des Meeres aus Häusern und Straßen der Balearenmetropole wirken ließen. Eine sanfte Brise umwehte del Amo. Er war unschlüssig, welche Richtung er einschlagen sollte. Schnurstracks zu seiner Lieblings-Vermuteria, die ganz in der Nähe seines Büros lag und in der er sporadisch auf dem Heimweg einen Absacker zu sich nahm? Oder vorher ein wenig flanieren und die entspannte Atmosphäre genießen, die um diese Zeit in der Stadt herrschte?
Del Amo schaute auf die Uhr, dann öffnete er das Jackett seines dunkelblauen Anzugs, lockerte den Knoten seiner Krawatte und sog die warme Luft ein. Ein zarter Hauch von Zitrusduft lag darin. Er entströmte einem Orangenbaum voller weißer Blüten, der am Straßenrand wuchs. Das sinnliche Geruchserlebnis gab den Ausschlag, er würde sich vor dem Besuch der Bar durch die Stadt treiben lassen.
Hinter den verspielten Jugendstilfassaden der Edifici Casasayas bog er in die Plaça de Weyler ab. Die Außenterrassen der Cafés waren voller Menschen, fröhliches Stimmengewirr waberte über die Straße. Er schlenderte weiter zur Rambla, Palmas Mini-Pendant zur Promenade von Barcelona.
Del Amo war ausgelassener Stimmung, fühlte sich trotz seiner sechsundfünfzig Jahre jung und unternehmungslustig wie lange nicht mehr. Bewegung kann außerdem nicht schaden, dachte er, während er seinen Bauchansatz betrachtete, der in den Wintermonaten gewachsen war und über den sich seine Frau schon lustig gemacht hatte.
Er setzte seinen Spaziergang ziellos fort, bis er in der schmalen Gasse Carrer de les Caputxines landete. Im Gegensatz zu der quirligen Ausgehmeile, die er zuvor passiert hatte, befand er sich hier allein auf weiter Flur. Fast, denn er hatte nicht bemerkt, dass ihm mit einigem Abstand ein junger Mann gefolgt war. Der sprach ihn nun unvermittelt an.
»Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie ich zur Plaça de la Mercé komme?«
Überrascht blieb del Amo stehen und musterte sein Gegenüber. Er war deutlich kleiner und schlanker als er, hatte halblange dunkelbraune Haare, trug eine grüne Bomberjacke und abgewetzte dunkelgraue Jeans mit modischen Löchern an den Knien. Das Auffällige an ihm waren ein Spinnennetz-Tattoo am Hals und sein, wie del Amo fand, flackernder Blick, mit dem er ihn musterte. Er fühlte sich seltsam unwohl in der Gegenwart des Mannes. Dennoch bemühte er sich, höflich zu sein, überlegte kurz und gab dann eine präzise Wegbeschreibung – als Einwohner Palmas kannte er sich schließlich bestens aus. Er wollte weitergehen, doch der Spinnenmann war offenbar zum Plaudern aufgelegt.
»Vielen Dank, das ist ja nicht weit. Da komme ich gut zu Fuß hin. Wissen Sie, ich will Freunde treffen. Die warten sicher schon auf mich. Ach, können Sie mir noch sagen, wie spät es ist?«
Del Amo wunderte sich zwar, dass der Mann keine Uhr oder, wie das heutzutage üblich war, ein Handy bei sich hatte, schob aber dennoch den Ärmel seines Sakkos zurück und schaute auf seine Armbanduhr, die er am rechten Handgelenk trug.
»Was für eine schöne Uhr.« Der Mann schnalzte anerkennend mit der Zunge.
»Ja, ganz hübsch. Ein Geschenk von …«
Del Amo kam nicht mehr dazu, den Satz zu vollenden. Ohne jegliche Vorwarnung packte der Fremde seinen Arm, zerrte an dem silbernen Stahlband, um die Uhr herunterzureißen. Del Amo war völlig überrumpelt von dem Angriff und setzte sich zunächst nicht zur Wehr. Nach einer Schrecksekunde schrie er laut: »Hey, was soll denn das?«, und versuchte, sich aus der Umklammerung zu befreien.
Es entwickelte sich ein heftiges Handgemenge, bei dem der zwar ältere, aber wesentlich größere und kräftigere del Amo bessere Karten zu haben schien. Das lag auch daran, dass der Angreifer mit einer Hand am Uhrband zog und mit der anderen einen Faustschlag del Amos abblockte. Schließlich ließ der Mann von seinem Opfer ab, aber nur um etwas aus der Tasche seiner Bomberjacke zu holen: ein Messer mit einer bedrohlich aussehenden spitzen Klinge, mit dem er auf del Amo zukam.
Der wich ein Stück zurück. Aber er war ein Alphatier, jemand, der es gewohnt war, dominant zu sein und Anweisungen zu geben. Und so ging er auch in dieser Situation in die Offensive, um dem in seinen Augen impertinenten Widerling die Waffe aus der Hand zu schlagen. Das misslang gründlich. Plötzlich spürte er einen höllischen Schmerz in der Seite und fiel zu Boden. Danach bekam er noch mit, wie erneut an seinem Arm gerissen wurde, bevor er das Bewusstsein verlor.
Knapp eine Stunde später lag er auf einer Liege in der Notaufnahme des Krankenhauses Son Espases. Die Uhr, die er zuvor am rechten Handgelenk getragen hatte, war verschwunden.
1
Höhenangst
Mit jedem Schritt in Richtung Abgrund hatte Pau Ribera das Gefühl, dass ihm die Kontrolle über seinen Körper und seinen Geist entglitt. Seine Knie fühlten sich weich an, als hätten sich Knochen, Knorpel und Sehnen in eine amorphe Gummimasse verwandelt, ihm war schwindelig, das Herz raste, im Ohr rauschte es, Schweiß bildete sich auf der Stirn. Er hatte das Bedürfnis, sich hinzusetzen, um wie ein Kleinkind auf dem Po weiterzurobben. Noch lieber wäre es ihm jedoch gewesen, auf dem Absatz kehrtzumachen, aber das ging nicht, denn gleichzeitig entwickelte die Tiefe eine eigenartige Sogwirkung. Schier unwiderstehlich zog sie ihn nach vorn wie ein Traktorstrahl in einem Science-Fiction-Film, als hätte sich eine dunkle Macht seiner bemächtigt, um ihn ins Verderben zu stürzen.
Zentimeter um Zentimeter näherte sich Ribera der bedrohlichen Linie, an der die Steilküste nahtlos in den Horizont überging. Dazwischen erstreckte sich das milchig graue Meer, auf dem ein einsames Segelboot kreuzte. Darüber zogen zwei Möwen ihre Bahnen am wolkenverhangenen Himmel.
»Was treiben Sie da?« Wie durch eine Nebelwand erreichte ihn die Frage und riss ihn aus seinen inneren Kämpfen.
Ribera zuckte zusammen. Etwa zwanzig Meter von ihm entfernt stand vor einem bunkerartigen Betonbau ein untersetzter Mann. Er trug die dunkelblaue Uniform der Lokalpolizei nebst einer Schirmmütze, wie auch sein Kollege, der ihn begleitete. Dieser schien etwas jünger zu sein, war aber ein ganzes Stück größer und schlanker. Der unterschiedlichen Statur wegen erinnerten die beiden Ribera stark an Don Quijote und Sancho Panza.
»Wir haben schon befürchtet, Sie wollten sich hinunterstürzen, nicht wahr, Vicente«, sagte der Sancho-Panza-Verschnitt mit einem spöttischen Gesichtsausdruck und stieß seinem Kollegen mit dem Ellbogen in die Seite.
»Wäre nicht das erste Mal, dass hier so etwas passiert«, entgegnete »Don Quijote« und schien nur mühsam ein Lachen zu unterdrücken.
Ribera beschloss, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. »Bei all dem, was uns jedes Jahr an zusätzlichen Aufgaben von den Bürokraten im Innenministerium in Madrid aufgebürdet wird, hätte ich manchmal die größte Lust dazu. Aber ich glaube, für heute reicht der eine Fall.« Er wies mit einer Kopfbewegung auf die Klippen. »Zumindest soll hier einer vorliegen.« Er zückte seinen Dienstausweis und wechselte ins Kollegen-Du: »Chefinspektor Pau Ribera von der Policía Nacional in Palma. Habt ihr uns verständigt, dass es einen Toten geben soll?«
Die Lokalpolizisten stellten das Feixen abrupt ein. Ein Ruck ging durch ihre Körper, als würden sie Habachtstellung einnehmen.
»Sí, Señor. Sergente Fulano und Sergente Zutano von der Policía Local in Llucmajor«, sagte »Sancho Panza« alias Fulano, offensichtlich der Wortführer der beiden. »Unser Dienststellenleiter hat Urlaub, und wir wussten nicht genau, wer im Kommissariat zuständig ist. Wir haben einen Anruf von einem deutschen Touristenpaar bekommen, das hier am Cap Blanc beim Spazierengehen einen Wagen auf den Felsen unterhalb der Steilküste entdeckt hat. Wir sind der Sache sofort nachgegangen. Zumal es, wie mein Kollege richtig bemerkt hat, nicht der erste Vorfall dieser Art wäre. Das Cap Blanc gilt nicht umsonst als Selbstmörder-Kap.«
Ribera winkte mit beiden Händen ab. »Nur mal langsam. Ob ein Suizid vorliegt, steht noch nicht fest. Oder wisst ihr Näheres?«
»Nein, bisher nicht, Chefinspektor«, antwortete Fulano. »Das Einzige, was bislang feststeht, ist, dass dort unten ein Auto mit einer Leiche liegt. Das haben die Kollegen bestätigt, die das Wrack vom Wasser aus erreicht haben. Aber sieh selbst.« Er und sein Kollege machten Anstalten, an den Rand des weitläufigen, mit gelben Flechten bedeckten Plateaus vorzutreten, das sich zwischen Küste und einem niedrigen Wäldchen aus Kiefern und wilden Olivenbäumen erstreckte.
Ribera folgte ihnen widerstrebend. Er wollte sich trotz seiner Höhenangst, die sich gerade gemeldet hatte, keine weitere Blöße geben.
Er hatte Glück. Unterhalb des Felsrandes befand sich eine weitere Ebene, ein rund einen Meter breiter Vorsprung, den ein gnädiger Schöpfer extra für ihn als Sicherheitszone geschaffen haben musste.
Die Beamten beugten sich vor, Ribera tat es ihnen zögerlich gleich. In etwa vierzig Meter Tiefe waren hellgraue Felsen zu sehen, an denen sich die Wellen brachen und einen Gischtschaum hinterließen. Zwischen ihnen war ein weißes Auto zu erkennen oder vielmehr das, was davon übrig geblieben war.
Die Trümmer weckten bei Ribera die Assoziation mit einer Schrottpresse, mit denen auf Autofriedhöfen entsorgte Fahrzeuge malträtiert wurden.
In welchem Zustand mag sich der Fahrer oder die Fahrerin nach diesem verheerenden Aufprall erst befinden?, dachte Ribera und trat zurück. Er hatte genug gesehen.
»Okay, Kollegen, die Bergung des Toten wird bei den schwierigen Orts- und Wetterverhältnissen wohl noch eine Weile dauern, vermute ich. In der Zwischenzeit ist das Gebiet hier oben Sperrzone, bis die Spurensicherung mit ihrer Arbeit fertig ist. Schon Hinweise darauf, auf welchem Weg der Wagen bis zur Küste gekommen ist? Ich nehme an, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt.«
Die Lokalpolizisten schüttelten unisono den Kopf.
»Nicht, nachdem der Inselrat eine Leitplanke und einen Zaun bauen ließ«, sagte Fulano. »Gebracht hat es aber wenig. Dieser Ort zieht den Tod geradezu an, Absperrung hin oder her.«
Wie zur Bekräftigung spuckte Zutano auf den Boden und sagte mit grimmiger Miene: »Das ist ein böser Ort, ein mal lloc. Die Einheimischen gehen hier nicht mal tagsüber hin. Selbst das Meer vor der Küste ist verflucht. In alten Seekarten werden die Tiefen als Tor zur Hölle bezeichnet. Nicht umsonst verunglücken dort immer wieder Schiffe. Wenn ich dran denke, wie oft in den letzten Jahren die Seenotrettung ausrücken musste.«
Nachdem Ribera mit der Spurensicherung telefoniert hatte, machte er sich auf den Rückweg zu seinem Auto, das er bei einem alten Leuchtturm geparkt hatte, der etwa einen halben Kilometer entfernt emporragte. Mit jedem Meter, den er zwischen sich und der Absturzstelle zurücklegte, fühlte er sich besser, kam sich weniger als Spielball seiner Ängste vor.
Dass er Probleme mit Höhen hatte, war ihm bewusst gewesen. Zum ersten Mal waren sie in der Jugend aufgetreten, als er mit seinen Freunden regelmäßig ins Schwimmbad gegangen war und jämmerlich versagt hatte, als es darum ging, vom Sprungturm ins Becken zu springen. Auch mit zunehmendem Alter war die Höhenangst nicht verschwunden. Aber dass sie ihn derart aus dem inneren Gleichgewicht bringen konnte, das hatte er noch nie erlebt.
Was für ein schauriger Ort, welch bedrückende Einsamkeit, ja fatale Endzeitstimmung von dem Küstenabschnitt doch ausgeht, dachte er. Und das auf einer Insel wie Mallorca, einem Synonym für Massentourismus und überbordende Vergnügungssucht schlechthin. Angesichts dieser Erfahrung empfand er es sogar als wohltuend, dass er sich mit einer Arbeit ablenken konnte, zu der ihn Polizeichef Mariano G. Moix verdonnert hatte. Gleichwohl war er im Grunde alles andere als begeistert davon.
***
Kaum war Ribera gegen sechzehn Uhr in seinem Büro in der Jefatura Superior de Policía Baleares angekommen, dem Hauptquartier der spanischen Nationalpolizei in Palma, klingelte das Telefon auf seinem Schreibtisch.
»Ribera, wo stecken Sie denn?«
Er stöhnte innerlich. Die vorwurfsvolle Stimme am anderen Ende der Leitung gehörte dem Polizeichef, von dem er im Moment mehr mitbekam, als ihm lieb war. Normalerweise hatte er im Arbeitsalltag der Mordkommission eher wenig mit seinem Vorgesetzten zu tun. Aber vor Kurzem hatte Moix ein Projekt angestoßen, mit dem er die Jefatura in Aufruhr versetzte – inklusive Ribera und seiner Abteilung.
»Kommen Sie bei mir vorbei, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen, den Sie unbedingt kennenlernen müssen«, sagte Moix.
Augenblicke später klopfte Ribera an die Tür eines Büros im vierten Stock. Moix war wie erwartet nicht allein, ein schlanker Mann in einem dunkelblauen Slim-Fit-Anzug und gleichfarbiger Krawatte saß auf einem der Besucherstühle vor dem riesigen Schreibtisch. Das Möbelstück aus dunklem Holz nahm einen Großteil des Raumes ein und stand, wie Ribera fand, im Gegensatz zum üblichen Arbeitspensum seines Vorgesetzten.
»Ah, Ribera, da sind Sie ja endlich!«, rief Moix und bedeutete ihm, näherzutreten. Er wies auf seinen Gast. »Das ist Señor Pelayo Grande, mein neuer persönlicher Assistent. Er tritt seine Stelle diese Woche an. Ich wollte, dass Sie beide sich kennenlernen, bevor ich Señor Grande offiziell vorstelle.«
Grande war bei Moix’ Worten aufgestanden. Er streckte Ribera lächelnd die Hand zur Begrüßung entgegen. »Sie können ruhig Pelayo zu mir sagen, wir werden ja in Zukunft öfter miteinander zu tun haben.«
Was für ein weicher Händedruck, als ob man einen toten Fisch anfassen würde, dachte Ribera und verzog die Mundwinkel zu einem halbwegs freundlichen Lächeln.
Er schätzte sein Gegenüber auf Mitte bis Ende dreißig. Grande war einen halben Kopf kleiner als er selbst und hatte eine jugendliche Ausstrahlung, was nicht zuletzt an seiner Frisur und seinem gepflegten Dreitagebart lag. Die Haare trug er auf den Seiten raspelkurz geschnitten, das dunkle Deckhaar dafür länger und ordentlich gescheitelt – ein Undercut, wie er bei vielen jüngeren oder sich für jung haltenden Männern auch in Spanien üblich war.
»Señor Grande wird als eine seiner ersten Aufgaben die Koordination der Ermittlungen in Sachen Rolex-Banden übernehmen. Ich denke, Sie werden gut zusammenarbeiten«, fuhr Moix fort.
Genauso gut hätte ihn der Polizeichef zurück ans Cap Blanc beordern können, dachte Ribera, ließ sich aber nichts anmerken.
Da war es wieder, das Projekt, mit dem Moix Gott und die Welt nervte. Hintergrund waren die Diebstähle von Luxusuhren, die sich in den letzten Wochen auf Mallorca stark gehäuft hatten. Dabei gingen die Banden teilweise äußerst rabiat vor, schlugen am helllichten Tag auf der Straße oder an Strandpromenaden zu. Und mit einem wiederkehrenden Muster: Einer der Täter näherte sich dem Opfer unter irgendeinem Vorwand, verwickelte sein Gegenüber in ein Gespräch und riss ihm dann die teure Uhr vom Handgelenk. Danach floh er mit einem Komplizen, der in der Nähe auf einem Motorrad oder einem Motorroller gewartet hatte.
Nachdem kürzlich ein hoher Beamter auf dem Nachhauseweg mitten in Palma beraubt und durch einen Messerstich schwer verletzt worden war, war bei Moix das Fass übergelaufen. Kurz entschlossen hatte er eine Sonderkommission ins Leben gerufen, um dem Treiben ein Ende zu setzen.
»Eine Urlaubsdestination wie Mallorca kann sich solch ein Krebsgeschwür nicht leisten«, hatte er zur Begründung gesagt. Natürlich wussten alle in der Jefatura, dass es ihm auch darum ging, die Nationalpolizei und damit sich selbst in ein gutes Licht zu rücken.
Auch Ribera und seine Mitarbeiter sollten sich an den Ermittlungen beteiligen. Das Argument dafür war, dass es zwar noch keine Toten gegeben habe, dies aber nur eine Frage der Zeit sei. Außerdem sollten sie ihre Fühler ins Ausland ausstrecken, um Gerüchten über eine Verbindung zur italienischen Mafia nachzugehen.
Ribera sah grundsätzlich die Notwendigkeit ein, gegen die Banden vorzugehen. Auf der anderen Seite verspürte er aber keine Lust auf eine derart enge Zusammenarbeit mit Moix oder jemandem aus dessen unmittelbarem Umfeld. Um sich dem konfliktfrei zu entziehen, wollte er Moix austricksen. Die Strategie bestand darin, ihm zuerst recht zu geben. Aber nur, um kurz darauf mit einem Gegenargument aus der Deckung zu kommen, dem sich der Polizeichef schwer versagen konnte. Nun sah er in dem Toten vom Cap Blanc eine Chance, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
»Mein Team und ich werden Señor Grande nach besten Kräften unterstützen«, sagte er und rang sich ein weiteres Lächeln ab, das nach wenigen Sekunden einer Sorgenmiene wich. »Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir dafür die nötige Manpower haben.«
Fragende Blicke von Moix und Grande.
Ribera schilderte den Vorfall bei Llucmajor, bei dem es nun intensiv zu ermitteln gelte. Der Einwand stellte sich jedoch als Rohrkrepierer heraus.
Moix winkte ab und entgegnete ungerührt: »Ach Ribera. Das ist doch nur wieder so ein armer Tropf, der sich von den Klippen gestürzt hat. Vergeuden Sie nicht kostbare Zeit und Energie damit und überlassen Sie das den Suizid-Experten. Wir haben im Moment anderes zu tun. Gerade jetzt, da die touristische Hochsaison vor der Tür steht, müssen wir unsere Kräfte bündeln, um diesem Spuk ein Ende zu setzen.«
Riberas säuerliche Miene schien ihm nicht entgangen zu sein. »Machen Sie nicht ein Gesicht, als ob Sie zur Schlachtbank geführt würden. Betrachten Sie es als eine Herausforderung. Wir alle sind viel zu sehr in unserer Routine gefangen. Das macht träge und unbeweglich. Sie werden sehen, wie belebend es sich auch auf den Geist auswirkt, über den Tellerrand zu blicken.«
Ribera erkannte, dass er im Moment nicht weiterkam und wohl in den sauren Apfel beißen musste. Wobei, kampflos aufgeben wollte er noch nicht.
Vielleicht ist die Cap-Blanc-Geschichte doch nicht so eindeutig, wie der Chef glaubt, dachte er, als er kurze Zeit später zurück in sein Büro ging. Er würde sich am nächsten Tag auf jeden Fall über den Verlauf der Bergungsarbeiten informieren.
2
Luftangriff
Es war einer der heißen Junitage auf Mallorca, an denen der nahe Sommer Vorboten der kommenden Hitzeperiode aussandte. Wer es sich erlauben konnte, vermied nach Möglichkeit den Aufenthalt in der gleißenden Nachmittagssonne.
Auch auf der Finca außerhalb von Artà ging es gemächlicher zu als sonst. Die Bewohner zogen, so oft es ging, den Schatten vor – oder suchten die Abkühlung. Frank Zampach wollte gerade seine Hose ausziehen, um nackt eine Runde im hauseigenen Pool zu drehen, als er ein Surren in der Luft vernahm. Zunächst war es nur ein leises Geräusch, das immer lauter wurde, als nähere sich ein Bienenschwarm. Zampach hob den Kopf und suchte den Himmel ab. Da war sie, die Ursache der Störung: ein kleines Flugobjekt mit jeweils zwei kurzen Streben an den Seiten, auf denen sich Propeller wild im Kreis drehten. An der Vorderseite leuchteten zwei helle Punkte, die aussahen wie Augen und die dem Gerät eine Ähnlichkeit mit einem Rieseninsekt gaben, das die Gegend nach Nahrungsquellen absuchte. Mit einem drolligen Auf- und Abwippen veränderte es ständig die Flughöhe, als könnte es sich nicht entscheiden, ob es sich auf das Fressen stürzen oder wieder davonfliegen wollte.
Zampach konnte dem nichts Witziges abgewinnen. »Schon wieder so eine Scheißdrohne, warte, dir zeig ich’s.«
Fluchend zog er die Hose hoch und stapfte zu einem der niedrigen Gebäude, die an der Stirnseite des Schwimmbeckens standen. Kurz darauf kehrte er mit einem Luftgewehr und einer kleinen runden Blechdose zurück und legte auf die Drohne an, die nun direkt über ihm kreiste. Er krümmte den Zeigefinger am Abzug. Ein dumpfes Geräusch ertönte.
»Mist, vorbei.«
Er knickte den vorderen Teil des Gewehrlaufs nach unten, holte eine neue Kugel aus der Dose und legte sie ein. Zu spät, die Drohne flog davon.
»Hau nur ab, das nächste Mal treff ich garantiert!«, schrie er wütend und jagte zur Bekräftigung eine Kugel hinterher.
»He, Zappa, was schreist du so?«
Die Stimme gehörte zu einer jungen Frau mit langen blonden Haaren, die sich auf dem Kiesweg, der zum oberen Teil des weitläufigen Anwesens führte, dem Pool näherte. Neben ihr lief ein großer hellbrauner Hund, der mit dem Schwanz wedelte und lautstark kläffte.
»Ich habe versucht, diese Kackdrohne runterzuholen. Schon das zweite Mal, dass die so ein Ding auf uns losjagen. Ich hab die Schnauze voll«, stieß Zampach erregt hervor, sodass sein Kinnbärtchen zitterte. »Wir sind doch keine Zootiere, die jeder angaffen kann. Und das, ohne Eintritt zu bezahlen.«
»Schon lästig«, entgegnete die Frau und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Andererseits war klar, dass wir Aufsehen erregen, wenn wir die ehemalige Finca von einem Geldsack besetzen. Was glaubst du, von wem die Drohnen stammen?«
Zampach streifte sich ein T-Shirt über. »Bestimmt von den Fernseh-Ärschen, die kürzlich hier waren und eine Homestory von uns machen wollten. Hatte aber keinen Bock auf so ’ne Sülze im Stile von ›So lebt Zappas wilde Hausbesetzer-Kommune auf einer Luxus-Finca‹ oder so ähnlich. Überhaupt geht mir der ganze Rummel auf die Nerven. Vielleicht haben wir schon viel zu viel zugelassen. Wenn die wenigstens ordentlich zahlen würden. Aber dafür haben sie angeblich keine Kohle. Lächerlich.« Er gab ein Knurren von sich. Seine Laune verschlechterte sich zunehmend, was nicht nur an den Drohnen lag.
Grimmig betrachtete er die beiden großen Gebäude aus Naturstein, die auf dem Hügel oberhalb des Swimmingpools standen. »Hier läuft generell einiges gewaltig aus dem Ruder.« Seine Miene verdüsterte sich um eine weitere Stufe.
Die junge Frau sagte kein Wort, der Hund verkroch sich eingeschüchtert hinter ihr.
Plötzlich war lautes Geschrei zu hören. Es kam vom oberen Teil der Finca.
»Auch das noch, jetzt geht der Ärger schon wieder los«, schimpfte Zampach. »Ich verfluche den Tag, an dem wir hergekommen sind. Komm, wir beenden die Sache. Das kann nicht ewig so weitergehen.«
***
Als er gegen neun Uhr dreißig in der Jefatura eintraf, trommelte Pau Ribera seine Mitarbeiter Cristina Blum und Quique Montoya zu einer Teambesprechung zusammen.
»Ihr habt ja bereits mitbekommen, dass unsere Abteilung die Ermittlungen der Sonderkommission unterstützen soll, die unser werter Polizeichef eingerichtet hat. Ich bin davon schwer begeistert, wie ihr euch denken könnt«, sagte er auf seine ironische Art, in die er gewöhnlich Skepsis und Kritik kleidete. »Im Moment haben wir wohl keine andere Wahl, wenn wir keinen internen Konflikt heraufbeschwören wollen. Ihr wisst, wie unser Häuptling reagiert, wenn man ihm den Eindruck vermittelt, ihn nicht ernst zu nehmen. Es sei denn …«
»Was für ein Schwachsinn.« Quique fuhr sich mit der Hand durch seine dunklen Locken. »Das ist nur wieder eine bescheuerte Alibi-Aktion, mit der Moix glänzen möchte. Ist doch allgemein bekannt, dass er seinen Job nur als Karrieresprungbrett betrachtet.« Er reduzierte seine Lautstärke. »Außerdem gibt es bereits eine Gruppe von Kollegen, die seit einiger Zeit an der Sache arbeitet und die personell nicht gerade unterbesetzt ist. Was bringt es, wenn wir zusätzlich mitmischen? Und die Banden treiben auch nicht erst seit gestern ihr Unwesen.«
Ribera saß auf einer Tischkante in dem schmucklosen Raum, den sie in der Mordkommission für interne Besprechungen nutzten, und hörte sich die Wutrede seines Mitarbeiters ruhig an. Er war derlei Eruptionen von Quique gewohnt, der berühmt-berüchtigt war für sein loses Mundwerk. Zuweilen schoss er zwar übers Ziel hinaus, aber oftmals lag er mit seinen impulsiven Ausbrüchen nicht mal daneben. Ribera hatte in der Regel kein Problem damit, und heute sprach er ihm zudem aus dem Herzen. Bevor er etwas entgegnen konnte, meldete sich Cristina Blum zu Wort.
»Ich weiß gar nicht, was ihr habt.«
Die junge Polizistin war das krasse Gegenteil von Quique: kontrolliert, sachlich, unterkühlt. Eigenschaften, die Ribera auf ihren Vater, einen deutschen Mallorca-Einwanderer, zurückführte, auch wenn er wusste, dass das wahrscheinlich ein Klischee war.
»Besonders viele Erfolge konnte die Soko bisher nicht verzeichnen, was ehrlich gesagt ein wenig merkwürdig ist«, fuhr Blum fort. »Was soll daran verkehrt sein, geballt gegen die Banden vorzugehen? Wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, finde ich.«
Quique holte Luft und wollte etwas erwidern, als Ribera intervenierte und den sich anbahnenden Disput im Keim erstickte.
»Halt, stopp!« Er hob abwehrend eine Hand. »Ihr habt beide nicht unrecht. Aber ich hatte noch nicht zu Ende geredet. Möglicherweise müssen wir uns um einen ganz anderen Fall kümmern.«
Fragende Blicke.
Ribera erzählte von dem Toten vom Cap Blanc und dass er überprüfen wolle, ob es sich tatsächlich um einen Suizid handele. Er finde es vorschnell, dass sich die Lokalpolizei und Moix bereits festgelegt hätten.
Blum reagierte als Erste. »Ich will ja deine Hoffnung nicht zerstören, aber meines Wissens waren die zahlreichen Todesfälle, die sich bis heute am Cap Blanc ereignet haben, allesamt Suizide. Das bekannteste Opfer war Miquel Dalmau, der ehemalige Präsident von Real Mallorca. Moment …« Sie tippte etwas in ihr Smartphone ein. »2010 hat er sich mit seinem Auto die Klippen heruntergestürzt. Wenn das keine Parallele zum aktuellen Fall ist.«
Quique hob bedauernd die Hände. »Auch wenn es mir schwerfällt, in diesem Fall muss ich Cristina recht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es etwas anderes ist als ein Selbstmord, ist verschwindend gering.«
Ribera rutschte vom Tisch herunter, lief durch den Raum, blieb stehen und drehte sich zu Blum und Quique um. »Das mag vielleicht sein. Aber die Hoffnung, wenn das Wort im Zusammenhang mit einem Toten überhaupt angebracht ist, stirbt bekanntlich zuletzt. Ihr könnt mich meinetwegen für verrückt erklären, aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass die Sache nicht ganz so eindeutig ist, wie sie erscheint.«
Fast im selben Moment klopfte es an der Tür. Ein Kopf mit kurzen dunklen Haaren, die durchsetzt waren mit gebleichten Strähnen, tauchte in der Öffnung auf. Er gehörte zu einer nicht ganz schlanken, dennoch sportlich wirkenden jungen Frau mit wachen Augen und einem breiten Mund, der Ribera selbstbewusst anlächelte.
»Verzeihung, ich wollte nicht stören, aber man sagte mir, dass ich Sie hier finde, ich kann auch später wiederkommen, wenn es jetzt nicht passt.«
»Kein Problem, wir sind ohnehin am Ende unserer Besprechung, denke ich.« Ribera schaute fragend in die Runde. Bejahendes Nicken. »Wie können wir Ihnen helfen, Señora …?«
Die Frau trat näher. Sie trug enge Jeans und ein rotes T-Shirt mit tiefem V-Ausschnitt, der ihre Oberweite betonte. Darüber einen schwarzen Blazer. An den Füßen trug sie Doc Martens mit gelben Nähten.
»Roca, Penelope Roca. Ich bin die neue Abteilungssekretärin oder besser gesagt die Vertretung für Gabriela, während sie im Mutterschutz ist. Ich soll heute beginnen und wollte mich vorher bei allen Kollegen vorstellen.«
Ribera schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Mierda, das hatte ich ganz vergessen.«
Quique und Cristina Blum zuckten zusammen, Roca machte einen irritierten Eindruck.
»Entschuldigung, galt nicht Ihnen«, versicherte Ribera, dem die E-Mail in den Sinn gekommen war, die er irgendwann von der Personalstelle der Jefatura bekommen hatte. Darin war die neue Sekretärin angekündigt worden. In seiner Zerstreutheit hatte er die Nachricht aber nach oberflächlichem Überfliegen genauso schnell wieder vergessen wie viele andere interne Mails. Die Geschichte am Cap Blanc hatte dann ihr Übriges getan, dass das Ganze irgendwo in einer Art Kuipergürtel seines Gehirns gelandet war, wohin er Informationsbrocken verbannte, denen er keine unmittelbare Relevanz beimaß.
»Schön, Sie an Bord zu haben, Señora Roca«, sagte er und wies auf die vereint strahlenden Gesichter von Quique und Cristina Blum. »Wie Sie sehen, sind Sie hier sehr willkommen.«
***
Nach einem Rundgang mit Penelope Roca durch die Abteilung und einem anschließenden Sprung in seine Stammbar »Bocadillos« gegenüber dem Kommissariat beschloss Ribera, den Nachmittag zu nutzen, um die Cap-Blanc-Geschichte weiterzuverfolgen. Er zog sich in sein Büro zurück, schloss die Tür hinter sich, setzte sich an seinen Schreibtisch und wählte die Nummer der Equipo de Rescate e Intervención en Montaña, kurz EREIM, einer Spezialeinheit der spanischen Guardia Civil. Die beiden Lokalpolizisten hatten ihm erzählt, dass die Einheit für die Bergung von Verunglückten auf Mallorca zuständig sei.
»Ich wusste gar nicht, dass sich die Mordkommission nun auch mit Suiziden beschäftigt. Habt ihr zu wenig zu tun?«, fragte der Kollege namens Joan Buzón, nachdem sich Ribera nach dem Stand der Bergungsarbeiten erkundigt hatte.
»Anordnung von oben«, schwindelte Ribera. Er hatte keine Lust, seine wahren Motive zu offenbaren, besonders da er wusste, dass er außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs wilderte. »Wir haben einen Neuen in der Führungsebene, frisch vom Festland importiert. Der will sich profilieren.«
»Verstehe. Ihr habt’s im Moment nicht leicht.«
Das Eis war gebrochen. Buzón erklärte ihm, dass das Wrack mittlerweile geborgen worden sei. Am Steuer habe ein Mann gesessen oder vielmehr das, was von ihm übrig gewesen sei. »Ich kann dir sagen, ein wahrer Kraftakt. Ohne die Hilfe der Feuerwehr und der Taucher der Guardia Civil hätten wir das nicht stemmen können. Mehr als fünf Stunden hat der Zirkus gedauert. Das Gleiche wie damals bei Miquel Dalmau.«
Buzón schwieg, als wartete er auf eine Äußerung des Mitleids seitens Riberas. Als sie ausblieb, fuhr er fort.
»Ich kann nicht nachvollziehen, wie man sich auf diese Weise umbringen kann. Sich die Kugel geben, okay. Aber ins Auto setzen, auf die Klippen zurasen und dann … Und an die Kosten, die das verursacht, denken die natürlich nicht.«
Ribera schnaubte bestätigend in den Telefonhörer. »Wisst ihr schon Näheres über die Identität des Toten?«
»Wir sind dran. Ein Kollege kümmert sich darum. Der Typ hatte keine Papiere bei sich, aber anhand des Nummernschildes dürfte das kein Problem sein. Die Leiche haben wir, wie das in diesen Fällen üblich ist, in die Rechtsmedizin nach Palma bringen lassen. Sobald wir mehr wissen, melde ich mich. Und lasst euch von eurem Neuen nicht verrückt machen. Wenn der merkt, dass die Uhren hier ein wenig langsamer gehen als auf dem Festland, kommt der von ganz allein runter.«
Nachdem sie das Gespräch beendet hatten, beschloss Ribera, sich doch näher mit dem Fall Miquel Dalmau zu beschäftigen. Wenn ihn schon alle als Referenz heranzogen.
Er suchte im Polizeicomputer und wurde gleich fündig. Es handelte sich um den bisher spektakulärsten Todesfall, der sich am Cap Blanc ereignet hatte. Dalmau war auf der Insel bekannt gewesen wie ein bunter Hund: mehrere Jahre Präsident des Fußballclubs Real Mallorca, Arzt und Leiter einer Privatklinik. Plötzlich, mit neunundsechzig Jahren, hatte er dann seinem Leben ein Ende bereitet.
Ribera betrachtete die Fotos des demolierten grauen VW Touaregs, mit dem Dalmau in den Tod gestürzt war. Und er sah die Bilder, wie die Leiche aus den Trümmern herausgeschnitten und danach unter einer orangefarbenen Plane abtransportiert wurde. Zweifel an einem Selbstmord hatte es keine gegeben, zu viele Indizien hatten dafürgesprochen: Depressionen, hoch verschuldet, Streit mit einem Geschäftspartner, dazu eine Anklage wegen angeblicher Veruntreuung von Geld.
Was mag wohl beim aktuellen Fall alles herauskommen?, fragte sich Ribera. Unabhängig davon gestand er sich aber insgeheim ein, dass auch diesmal alles auf einen Suizid hindeutete. Vielleicht konnte jemand anders Licht in die Angelegenheit bringen.
Obwohl es bereits auf neunzehn Uhr zuging, klemmte er sich erneut ans Telefon.
»Ribera, um diese Zeit noch aktiv?«, meldete sich ein raues Organ. »Die meisten deiner Kollegen dürften längst zu Hause bei Frau und Kindern sein. Ach, ich vergaß, Familie passt nicht zu deinem derzeitigen Egotrip. Sprich, was verschafft mir das Vergnügen?«
Ribera war derlei Frotzeleien von Pep Bosch gewohnt. Der Rechtsmediziner gehörte zu den wenigen Menschen, mit denen er auf Mallorca über die Arbeit hinaus einen persönlichen Kontakt pflegte. Ja noch mehr, zwischen ihnen hatte sich so etwas wie eine Freundschaft entwickelt, die sie vor allem bei Kneipentouren auslebten.
»So sehr kann es dich auch nicht zu deiner Familie ziehen, sonst hätte ich dich kaum erreicht.«
»Touché, mein Lieber«, entgegnete Bosch. »Im Moment ziehe ich wirklich die Arbeit vor. Meine Frau hängt mir gerade in den Ohren, ich würde mich zu fett ernähren und zu viel Alkohol trinken. Nun soll ich auch noch Diät halten, nachdem mein Arzt bei einer Blutuntersuchung erhöhte Leberwerte festgestellt hat. Ich und Diät – so weit kommt’s noch. Mir gehen diese Gesundheitsfanatiker und selbst ernannten Ernährungsapostel eh auf den Geist. Fehlt nur noch, dass ich mich vegan ernähren soll.«
»Möglicherweise solltest du ausnahmsweise auf deine Frau hören. Mit so etwas ist nicht zu spaßen. Ein Onkel von mir hatte das mal. Wollte auf niemanden hören, bis er ein Leberkarzinom bekam. Aber wem erzähle ich das, du bist selbst Arzt – behauptest du jedenfalls.«
Bosch knurrte. »Jetzt fang du nicht auch noch an. Komm lieber endlich zur Sache.«
»Bueno. Ich habe gehört, dass du den Toten vom Cap Blanc hereinbekommen hast. Kannst du schon etwas zur Todesursache sagen?«
»Stürzt du dich in deinem Arbeitswahn, der dich von deinem tristen Alltag ablenken soll, nun auch noch auf Selbstmorde?« Bevor Ribera etwas erwidern konnte, polterte Bosch weiter: »Erspar mir die Antwort, ich möchte all deine Gehirnfürze gar nicht kennen. Mal sehen.« Schweigen in der Leitung, dann ein Rascheln. »Ah, da ist es ja. Nichts Besonderes für Stürze aus großer Höhe. Klassisches Polytrauma. Oder für medizinische Laien: Der Mann hat zahlreiche lebensbedrohliche Verletzungen erlitten: Kopf, Brustkorb, Wirbelsäule, innere Organe, Aorta – alle mehr oder weniger gravierend betroffen –, nettes Gesamtpaket. Um es kurz zu machen: Der Körper wurde beim Aufprall regelrecht zerschmettert. An was er letztendlich gestorben ist, lässt sich schwer sagen. Fremdeinwirkung war nicht festzustellen, falls du auf so etwas hinauswillst. Für mich ein Suizid, wie er im Buche steht – klar, Cap Blanc. Aber wahrscheinlich hat er davon nicht mehr viel mitbekommen. Im Blut konnte ich Phenobarbital feststellen.«
Ribera wurde hellhörig. »Was ist das?«
»Eigentlich ein Betäubungsmittel, das zum Einschläfern von Tieren verwendet wird, dient aber auch als Beruhigungs- oder Schlafmittel. Wobei, als Schlafmittel ist es seit einiger Zeit nicht mehr zugelassen. Und es wird immer wieder zum Suizid missbraucht. Was die Wirkung betrifft: Das Zeug macht dich zunächst müde, dann gehen irgendwann die Lichter aus. Wahrscheinlich hat er sich eine Dosis verpasst, bevor er auf die Klippen zugerast ist, und hat das Ganze nur noch in einer Art Delirium mitbekommen. Gibt schlimmere Arten, um aus dem Leben zu scheiden, aber wenn ich an den Rest denke – puh. Wisst ihr etwas Näheres über den Toten?«
»Nein, bisher nicht. Ist aber nur eine Frage der Zeit.«
»Die du offenbar gerade zur Genüge hast.«
Ribera lachte. »Ein Kneipenbesuch mit dir wäre vielleicht noch drin. Ich lade dich gern auf einen Kamillentee ein – oder auch zwei, falls du dir die Kante geben willst.«
Verächtliches Schnauben. »Du mich auch.« Dann ein Knacken. Bosch hatte aufgelegt.
Ribera wollte seinen PC ausschalten, als eine neue Nachricht in seinem E-Mail-Verzeichnis aufpoppte. Absender war Pelayo Grande. Betreff: »Sitzung Soko Rolex«.
Er stöhnte, überflog die Mitteilung kurz, schloss das Programm und fuhr seinen Computer herunter. Das muss bis morgen warten, sagte er sich und machte sich auf den Heimweg.
3
Der Alptraum
Das Telefonat mit dem Beamten von der Bergungseinheit blieb nicht ohne Folgen. In der Nacht plagten Ribera wilde Alpträume, in der sich Vergangenheit und Gegenwart vermischten. Zunächst stand er als Jugendlicher auf dem Sprungturm im Schwimmbad seiner Heimatstadt Lleida in Katalonien. Zögerlich ging er an den Rand der zehn Meter hohen Plattform und starrte nach unten. Er zitterte vor Angst, ihm war abwechselnd heiß und kalt.
Das Wasser im Becken hatte sich in ein dunkles Monster verwandelt mit einem riesengroßen, geifernden Maul, das von spitzen Zähnen durchsetzt war. Das Ungeheuer gab fürchterliche Geräusche von sich, eine Mischung aus Knurren und Schmatzen. An den Seiten hatte es zudem lange Arme wie die Tentakel eines Tintenfischs. Sie wirbelten wild durch die Luft, reichten bis zu dem Punkt, an dem Ribera stand, und wollten nach ihm greifen. Er entwand sich dem Zugriff, rannte panisch davon und wollte nach unten steigen. Doch die Leiter war verschwunden – er war in der Höhe gefangen.
Im selben Moment hörte er von allen Seiten die höhnischen Rufe seiner Kumpels. »Ribera, cagueta, juegas con muñecas!«
Nein, er war weder ein Angsthase, noch spielte er mit Puppen. Er presste die Hände fest auf die Ohren, um das Geschrei nicht hören zu müssen, aber vergeblich. Der Spottreim dröhnte in seinem Kopf und vermischte sich mit dem Grollen des Monsters in der Tiefe.
Plötzlich schob ihn irgendetwas von hinten unbarmherzig nach vorn. An der Kante angekommen, bekam er einen Stoß, verlor das Gleichgewicht und stürzte schreiend und hektisch mit den Armen rudernd in die Tiefe. Anstatt aber im Schlund des Monsters zu landen, fiel er die Klippen von Cap Blanc hinab.
In der nächsten Szene war er in die Trümmer eines Autos eingeklemmt. Er versuchte verzweifelt, sich zu befreien, konnte sich aber nicht bewegen. Das Blech kam unter Ächzen, Stöhnen und Kratzen unaufhaltsam näher und drohte ihn zu zermalmen. Das Geräusch wurde immer unangenehmer.
Schweißgebadet wachte Ribera auf. Zunächst war er orientierungslos, bis ihm bewusst wurde, dass er in seinem Bett lag. Nur das Kratzgeräusch war komischerweise noch vorhanden, steigerte sich sogar in der Frequenz.
Schnell lokalisierte er die Störung. Sie kam von der geschlossenen Terrassentür seines Zimmers in der »Costa Dorada«, der Pension in der Altstadt von Palma, in der er wohnte, seit er vor knapp einem Jahr nach Mallorca gekommen war. Und vor der stand Lemmy, der Hauskater. Wie so oft war er über eine Dachterrasse und einen Mauervorsprung zu seinem Zimmer gelangt.
Ribera schaute auf die Uhr – erst sechs. Morgenlicht strömte in das Zimmer hinein.
»Hola, Señor, was machst du denn so früh hier? Normalerweise bist du doch später dran.«
Der schwarze Kater marschierte schnurstracks an Ribera vorbei ins Zimmer, setzte sich auf den Fußboden und stierte mit ausdruckslosen Augen vor sich hin.
»Verstehe, du hast dein Frühstück heute etwas vorverlegt. Das ist aber außerhalb meiner Kernarbeitszeit, das weißt du schon? Aber gut. Du sollst nicht glauben, dass das eine Servicewüste ist. Das Gleiche wie immer, nehme ich an.«
Er holte eine Tüte Trockenfutter und füllte einen runden Napf damit. Er war an derlei Besuche mittlerweile gewöhnt, wenn auch normalerweise nicht um diese Uhrzeit, und hatte sich deshalb einen kleinen Vorrat an Katzennahrung zugelegt. Entgegen dem Rat seiner Pensionswirtin Natividad Iglesias. »Wenn du damit anfängst, wirst du den Kater nicht mehr los«, hatte ihn Tita, wie sie von allen genannt wurde, gewarnt, als er ihr von Lemmys Besuchen erzählt hatte. Sie behielt recht.
Etwa zwei Stunden nachdem sich der Kater verabschiedet hatte, verließ Ribera die Pension. Er fühlte sich immer noch gerädert von dem dystopischen Traum und dem frühen Aufstehen. Ein Grund mehr, sich einen Kaffee zu genehmigen, wie er es sich auf dem Weg in die Jefatura angewöhnt hatte. Er betrat das »Café Verde«, eine kleine Bar um die Ecke seiner Pension.
»Hola, Inés, ein café con leche und ein Croissant«, rief er der Kellnerin zu, schnappte sich eine der Zeitungen, die auf dem Tresen auslagen, und setzte sich an einen dunklen Holztisch in dem schmalen Raum. Schon auf der Titelseite hatten ihn die vergangenen zwei Tage eingeholt. Die Schlagzeile des Aufmachers sprang ihm ins Auge.
»Neuer Selbstmord am Cap Blanc«.
Darunter Fotos des zerschellten Wagens und ein Artikel, der eher aus Spekulationen denn aus Informationen bestand. Natürlich verbunden mit dem Hinweis auf die »augenscheinlichen« Parallelen zum Fall Dalmau und das Versagen der Sicherheitsvorkehrungen.
Vielleicht ein Insel-Syndrom, dachte Ribera, dass alle dieselbe Theorie wiederkäuen und andere Möglichkeiten als Selbstmord gar nicht erst in Betracht ziehen. Gerade von kritischen Journalisten hätte er erwartet, dass sie erst alle Fakten zusammentrugen.
Bevor er sich weiter aufregen konnte, stellte ihm die Kellnerin Kaffee und Croissant auf den Tisch.
»Danke, Inés.« Ribera nahm einen Schluck, stopfte sich ein Stück Gebäck in den Mund und vertiefte sich in den Rest der Zeitung.
Dass er sich mehr Zeit ließ als gewöhnlich, lag an einem Termin, den er vormittags in der Jefatura hatte. Für zehn Uhr hatte Pelayo Grande zu einer ersten Besprechung der Soko Rolex geladen.
Vielleicht hat die wenig verlockende Perspektive den nächtlichen Alptraum forciert, sagte er sich. Aber wahrscheinlich hätte er in diesem Moment den Polizeichef-Assistenten auch für den Klimawandel und andere Übel der Welt verantwortlich gemacht.
Mit schleppendem Gang machte er sich nach seiner Ankunft im Kommissariat auf den Weg zu dem Besprechungsraum, in dem ansonsten die Pressekonferenzen abgehalten wurden. Heute waren dort etwa fünfzehn Polizeibeamte versammelt. Auf der Stirnseite saß Pelayo Grande und beobachtete mit einem selbstzufriedenen Lächeln, wie sich die Plätze füllten. Wie beim ersten Zusammentreffen war er wieder elegant gekleidet. Er trug einen eng sitzenden anthrazitfarbenen Anzug mit roter Krawatte. Auf einer Leinwand hinter ihm war in großen Buchstaben die per Beamer projizierte Zeile »Soko Rolex, Sicherheitsoffensive für Mallorca« zu lesen.
»Ah, Ribera, willkommen, ich hatte dich schon vermisst.« Grande breitete beide Arme aus, als wollte er ihn gleich umarmen.
Ribera nickte ihm nur wortlos zu und nahm neben Quique in der letzten Reihe Platz.
»Wo ist Cristina?«, fragte er.
»Sitzt irgendwo ganz vorn.« Quique rollte mit den Augen. »Wundert dich das?«
Grande setzte zum Sprechen an, als die Tür aufging und Penelope Roca hereinkam. Sie deutete auf Ribera. »Anruf«, sagte sie in flüsterndem Ton und ahmte mit der Hand einen Telefonhörer am Ohr nach. »Hörte sich wichtig an.«
Mit einem bedauernden Achselzucken verabschiedete sich Ribera. Niemand, bis auf Roca, konnte das erleichterte Grinsen sehen, das seinen Mund umspielte. »Du hast mich gerettet, mein ewiger Dank ist dir gewiss«, zischte er Penelope Roca draußen zu und eilte in sein Büro.
Zehn Minuten später kehrte er wieder ins Besprechungszimmer zurück und winkte Quique und Blum heraus. »Tut mir wirklich sehr leid«, rief er dem konsterniert wirkenden Grande zu. »Die Pflicht ruft, wir haben einen Mordfall.«
***
»Joder. Das liegt ja mitten in der Pampa. Können die sich nicht, wie es sich gehört, in der Zivilisation abmurksen lassen?« Quique fluchte laut, während er am Steuer des Polizeiwagens saß und genervt nach einer Abzweigung Ausschau hielt, die zum Tatort führen sollte.
»Das muss hier irgendwo sein«, sagte Ribera, der auf dem Beifahrersitz saß.
Seit knapp einer halben Stunde irrten sie auf der Ma-12 herum. Mehrere Male hatten sie einen der schmalen Wege ausprobiert, die von der Landstraße abgingen, aber alle hatten sich als falsch herausgestellt.
Riberas Blick wanderte über die Aleppokiefern, Mastixsträucher und wilden Olivenbäume. Eine Natur, wie sie typisch war für das Inselinnere. »Von Artà aus sei es nur ein Katzensprung, hat der Kollege gesagt. Wir könnten die Abfahrt zur Finca Son Mussol gar nicht verfehlen. Er erwähnte etwas von einem Steinbruch. Daran sollten wir uns orientieren.«
»Männer«, raunte Cristina Blum vom Rücksitz aus. »Das hat doch keinen Zweck, was ihr da treibt. So kommen wir nie ans Ziel. Wozu gibt es Navis?« Sie holte ihr Smartphone hervor und tippte etwas ein. »Da haben wir es schon. So falsch sind wir gar nicht, aber wir müssen ein Stück zurück.« Sie gab Quique Anweisung zum Wenden.
Kurz darauf entdeckten sie einen Steinbruch, der aber wegen einiger hoher Bäume davor kaum von der Straße aus sichtbar war. Ihm gegenüber lag ein unbefestigter Weg, der in einen Wald aus Steineichen und Pinien führte. Über eine holprige Piste gelangten sie zu einem großen Tor. Geschlossen.
»Der Kollege meinte, wir könnten hier durch, müssten es nur wegen der Schafe wieder schließen.« Ribera stieg aus, zog einen Metallhebel aus einer betonierten Bodenplatte, öffnete das Tor, ließ Quique durchfahren und schloss es wieder.
Die Fahrt wurde noch ruckeliger. Quique versuchte, den Wagen um die tiefen Schlaglöcher zu steuern, die sich vor ihnen auftaten. Rechts und links erhoben sich mächtige Steineichen, die mit ihrer zerfurchten, fast schwarzen Rinde für eine urige, märchenhafte Szenerie sorgten.
Schließlich erreichten sie eine hohe Mauer aus Natursteinen mit einem weiteren Tor. Es bestand aus zwei großen Metallplatten, die wirkten, als wären sie aus verschrotteten Panzern recycelt worden. Aus dem oberen Rand ragten spitze Metallstäbe. Daran hing an einem Seil eine rote Plastikfanfare, wie sie in Fußballstadien verwendet wurde.
»Das müsste es sein.« Ribera stieg erneut aus und drückte auf die Hupe. Ein heller, durchdringender Laut ertönte. Kurz darauf näherten sich von innen Schritte, das Tor wurde geöffnet.
»Ihr müsst die Kollegen von der Mordkommission sein.« Vor ihnen stand ein Polizist, der die dunkelgrüne Uniform der Guardia Civil trug und sich als Sargento Santos vorstellte. »Ihr seid spät dran. Wir dachten schon, ihr hättet euch verirrt, es ist für Ortsfremde schließlich nicht einfach, herzufinden. Die Finca liegt ziemlich abgelegen.«
»Kein Problem.« Quique konnte sich die Ironie nicht verbeißen. »Fincas en el quinto coño sind unser Spezialgebiet.«
Wie zur Bekräftigung ertönte in der Nähe ein lang gezogenes, klagendes »I-a-a-a!«.
Santos, der angesichts von Quiques flapsiger Bemerkung über die Fincas am angeblichen Arsch der Welt die Augenbrauen hochgezogen hatte, lachte auf. »Das ist der Esel vom Nachbargrundstück. Ein total verrücktes Vieh.« Er brach wieder ab, drehte sich um und sagte in ernstem Tonfall: »Kommt mit, ich zeige euch, wo wir den Toten gefunden haben.«
Ribera, Quique und Cristina Blum folgten. Nach etwa zweihundert Metern Fußmarsch über einen Kiesweg erreichten sie eine Anhöhe mit zwei größeren Gebäuden. Das kleinere war der Bauweise nach der historische Teil der Finca. Zwanzig, dreißig Meter davon entfernt stand ein neueres Haus, das an den traditionellen Stil der mallorquinischen Landhäuser angelehnt war.
Auf dem mit Steinplatten bedeckten Hof zwischen den Häusern erwartete sie ein weiterer Polizist. Er trug trotz des bewölkten Himmels eine dunkle Sonnenbrille. Vor ihm auf dem Boden lag ein Körper. Als sich die Gruppe näherte, salutierte er. »Sargento Ortiz. Endlich. Wir haben schon gedacht, ihr hättet euch …«
»Schon gut«, unterbrach ihn Ribera, winkte genervt ab und betrachtete den Toten. »Hostia puta!«, entfuhr es ihm.
Der Mann war übel zugerichtet. An der Stirn klaffte eine tiefe Wunde, die Arme waren zur Seite gestreckt, die Beine angewinkelt; schwarze Haarsträhnen, in die sich erstes Grau gemischt hatte, hingen ihm ins Gesicht und hatten sich mit Blut verklebt.
Bekleidet war er mit einer khakifarbenen Hose und einem dunkelblauen Polohemd. Am Handgelenk trug er eine Uhr mit einem Metallarmband. Für den Bruchteil einer Sekunde musste Ribera an Pelayo Grande und die Soko Rolex denken.
»Ich hoffe, ihr habt nichts angerührt. Vor allem nicht diesen Stein«, sagte er zu den Beamten und wies auf den grauen, runden Gesteinsbrocken, der etwa die Größe einer Zitrone hatte. Dunkelrote Flecken zeichneten sich auf ihm ab. Er lag etwa einen Meter neben dem Kopf des Toten wie ein verirrter Asteroid. »Spurensicherung und Rechtsmedizin sind unterwegs. Müssten demnächst eintreffen – falls sie sich nicht verirren.«
»Wir mögen hier zwar nicht der Nabel der Welt sein«, entgegnete Santos und schielte zu Quique, »aber bescheuert sind wir auch auf dem Land nicht. Das sieht doch ein Blinder, dass der Mann erschlagen wurde. Wahrscheinlich mit diesem Stein.«
Ribera hob entschuldigend die Hand. »War nicht so gemeint. Wisst ihr, wer der Tote ist?«
»Das ist Hernán Torres. Der ist hier so eine Art Hausmeister. Stammt aus Artà, hat dort eine Frau. Er kümmert sich um das Anwesen. Im Gegenzug nutzt er das Gelände, um Schafe weiden zu lassen. Aber im Grunde hatte er nicht viel zu tun. Vor allem seit sich diese Besetzer um das Anwesen kümmern.«
»Was für Besetzer?« Ribera betrachtete Santos, dann Quique und Blum. Er verzog die Mundwinkel. So langsam wurde es ihm zu bunt, dass er den Männern sämtliche Würmer aus der Nase ziehen musste.
»Na ja, das ist so eine kleine Gruppe um einen Deutschen namens Frank Zampach«, sagte Santos hastig. »Die sind vor etwa einem halben Jahr plötzlich aufgetaucht und haben sich auf der Finca eingenistet. Hat niemanden in der Gegend gestört.«
Ribera breitete die Arme aus. »Und wo sind die Besetzer jetzt?«
»Keine Ahnung. Wir haben alle Gebäude durchsucht. Sind über alle Berge. Auch ihr Auto ist nicht mehr da. Ebenso das von Torres.«
»Wem gehört die Finca überhaupt?«, fragte Cristina Blum.
»Ursprünglich einem gewissen Raimund Bommer«, antwortete Ortiz. »Einem bekannten deutschen Unternehmer. Der hat aber wegen nicht genehmigter Anbauten Schwierigkeiten mit den Behörden bekommen. Seht selbst.«
Er führte sie an den Rand des Hofs, von wo aus der Blick über das weitläufige Anwesen und die hügelige Landschaft schweifte, in die es idyllisch eingebettet war. Am Horizont ragten die Serres de Llevant heraus, eine Bergkette, die einen Teil des Inselostens durchzog.
Nette Gegend. Bisschen einsam, aber nicht der schlechteste Platz zum Leben, dachte Ribera. Er fühlte sich an seine alte Heimat Lleida erinnert, die nur einen Katzensprung von den Pyrenäen entfernt lag.
»Das meiste da unten ist illegal.« Ortiz wies auf einen Gebäuderiegel an der Stirnseite eines stattlichen Pools.
»Das ist nichts Ungewöhnliches«, sagte Blum. »Es gibt haufenweise Schwarzbauten auf der Insel, ohne dass die Behörden ernsthaft eingegriffen hätten. Jahrelang war das gängige Praxis. Vor einiger Zeit hat der Inselrat härteres Durchgreifen angekündigt mit dem Ziel, Abrissverfügungen nicht nur zu erlassen, sondern auch durchzusetzen.«
Quique nickte. »Habe ich auch gelesen. Wer’s glaubt. Papier ist geduldig.«
»Immerhin soll die Bauaufsichtsbehörde nun Drohnen einsetzen, um Bausünden aufzuspüren«, sagte Blum.
»Pech für Leute wie Bommer.« Ortiz zeigte auf eine Terrassenanlage im Stile eines Mini-Amphitheaters, die sich hinter dem Pool erhob. »Dort wollte der Typ Konzerte mit internationalen Popgrößen veranstalten – Shakira oder U2 sollten auftreten, hieß es.« Er schüttelte den Kopf. »Typischer Fall von Größenwahn. Mittlerweile soll Bommer aber pleitegegangen sein und die Finca an eine Bank verkauft haben. Genaueres weiß man nicht. Rambo ist jedenfalls seit einiger Zeit raus aus dem Spiel.«
»Rambo?«, fragten Ribera, Quique und Blum wie aus einem Mund.
»Das ist der Spitzname, den die Einheimischen Bommer verpasst haben, weil er sämtliche Vorschriften ignoriert und das Anwesen eigenmächtig verändert hat. Überhaupt ein unangenehmer Zeitgenosse, richtiger deutscher Quadratschädel, war nicht sonderlich beliebt in der Gegend. Sehr oft war er aber nicht hier. Es ging das Gerücht um, dass ihn die Finca und Mallorca nie richtig interessiert haben und dass das Ganze nur eine Geldanlage war.«