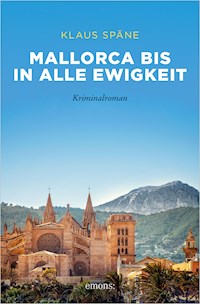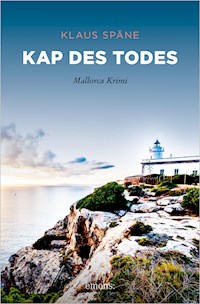Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Urlaubsparadies mit Abgründen: ein brisanter Kriminalroman vor malerischer Inselkulisse. Im mallorquinischen Hinterland kommt eine Radfahrerin bei einem Unfall ums Leben. Vom beteiligten Autofahrer fehlt jede Spur. Als in der Bucht von Palma ein Umweltschützer tot aufgefunden wird und sich Hinweise auf Mord häufen, nimmt Chefinspektor Pau Ribera von der spanischen Nationalpolizei die Ermittlungen in die Hand, um Licht in die merkwürdigen Todesfälle zu bringen. Während Mallorca von sintflutartigem Regen heimgesucht wird, gräbt Ribera immer tiefer – und gerät auf die finstere Seite der Sonneninsel ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Klaus Späne ist als Redakteur der Frankfurter Neuen Presse tätig. Mit Mallorca und den Balearen verbindet ihn eine lange und persönliche Geschichte. Er hat auf Mallorca gelebt und gearbeitet und kennt die Eigenheiten und Schattenseiten der Insel.
https://www.facebook.com/mallorcakrimi
www.klausspaene.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Im Anhang befindet sich ein Glossar.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotive: lookphotos/Lukas Wernicke,
shutterstock.com/kuzmaphoto
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Karte: shutterstock.com/Axel_kock (bearbeitet)
Lektorat: Julia Lorenzer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-141-6
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muss es,
Ewig wechselnd.
»Gesang der Geister über den Wassern«, Johann Wolfgang von Goethe (1779)
Teil 1
Gota fría
1
Serra de Tramuntana. Der Tag sollte perfekt werden. Das hatte sich Charlotte Zemp jedenfalls vorgenommen. Ein letztes Mal den Akku aufladen. Möglichst viel von diesem emotionalen Aggregatzustand mit nach Hause nehmen, der sie die vergangenen zehn Tage über die Insel getragen hatte. Das Gefühl von Freiheit im Sattel genießen. Schmale Bergstraßen mit Steigungen von zehn Prozent und mehr mit purer Körper- und Willenskraft bewältigen. Auf der Schnittstelle zwischen Meer und Hochgebirge dahinrollen. Den Kick halsbrecherischer Abfahrten verspüren. Sich der Schwerkraft trotzend in Haarnadelkurven hineinlegen. Diese Mischung aus Sich-körperlich-Auspowern und Sich-am-mediterranen-Ambiente-Berauschen. Eben das volle Programm, das Mallorca für Hobbyradsportler wie sie zu bieten hatte. Wie schön wäre es, nur einen Bruchteil davon zu konservieren. Wie Oliven im Glas. Einfach bei Bedarf aus dem Regal nehmen.
Vielleicht hatte sie die Messlatte etwas zu hoch gesetzt, dachte Charlotte Zemp, während sie in die Pedale trat. Der Fahrtwind umschmeichelte ihr gebräuntes Gesicht. Andererseits, warum nicht? Es war das Ende ihres Urlaubs. Und das wollte sie noch einmal bis zum Anschlag auskosten. Bereits um sieben Uhr hatte sie sich aus dem Bett ihres auf Radtouristen spezialisierten Hotels in Can Pastilla geschält, war in Trikot, Radlerhose und Rennradschuhe geschlüpft und hatte Ärm- und Beinlinge, Windjacke, Wasserflasche und ein paar Energieriegel in den Rucksack gepackt. Das »Klack, klack, klack« der unter den Sohlen montierten Kunststoffplatten für die Klickpedale hatte durch den Hotelflur wie ein Metronom auf Ecstasy gehallt. Das akustische Erkennungszeichen der Biker-Community. Noch ein schnelles Frühstück. Müsli, café con leche, Orangensaft, ein Brötchen mit Käse für unterwegs eingepackt. Gegen acht Uhr hatte sie sich dann auf die rote Rennmaschine geschwungen. Carpe diem, nur nicht faul am Hotelpool oder am Strand herumliegen wie die anderen aus ihrer Gruppe. Was einige ihrer Begleiter vermutlich nötig hatten nach dem Absturz, der sich bereits beim gemeinsamen Abendessen angedeutet hatte. Sie hatte sich wohlweislich zurückgehalten angesichts der Tour ins Gebirge, die sie für den nächsten Morgen, wie es ihre Art war, minutiös vorbereitet hatte.
Von der Playa de Palma aus hatte Charlotte Zemp zunächst den Weg Richtung Inselmitte eingeschlagen. Algaida, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí – kleine Dörfer, Es Plà, flaches Land, entspanntes Aufwärmen. Sie war schnell auf Betriebstemperatur gekommen, fuhr in einer Trittfrequenz von siebzig bis neunzig Umdrehungen pro Minute, einer Geschwindigkeit um die dreißig Stundenkilometer. Aber meistens schenkte sie dem Tacho am Lenker keine Beachtung. Der gleichmäßige Rhythmus, in dem sich ihre Beine auf und ab bewegten, und die vorbeiziehende Landschaft hatten sie in einen kontemplativen Zustand versetzt, der Raum und Zeit bedeutungslos erscheinen ließ. Irgendwann kehrte sie wieder in die Realität zurück. In Bunyola am Rand des Tramuntana-Gebirges legte sie eine Kaffeepause in einer kleinen Bar im Ortszentrum ein. Auf einem der mit blauem Stoff bespannten Stühle auf der Terrasse nahm sie Platz, bestellte ein Wasser und einen weiteren café con leche. Sie war der einzige Gast, zumindest draußen. Störte sie aber nicht. Im Gegenteil. Sie genoss es, das gemächliche Treiben des Dorflebens zu beobachten. Jetzt im September schien es ihr bereits eine Stufe heruntergedimmt zu sein. Das war ja auch ein Grund, weshalb sie und ihre Freunde den Urlaub um diese Jahreszeit gebucht hatten. Nebensaison, weniger Touristen, dennoch warm genug für Outdoor-Sport. Vor allem aber weniger Verkehr und kein Herumquälen mit Autofahrern, die wie Raubtiere hinter den Radfahrern auf die Gelegenheit zum Überholen lauerten.
Aus dem Inneren der Bar drangen Stimmen nach draußen. Am Tresen unterhielten sich zwei ältere Männer lautstark mit dem Kellner in einer guttural klingenden Sprache, stellte sie fest, als sie zur Toilette ging. Obwohl sie ein paar Brocken Spanisch sprach, verstand sie kein Wort. Muss Mallorquinisch sein, sagte sie sich. Später würde sich der Kellner an die junge Frau erinnern. Die blonden Haare und die Statur, groß gewachsen, drahtig. Sie war außerdem der erste Radfahrer an diesem Morgen und nicht, wie meist üblich, in einer Gruppe, sondern offenbar allein unterwegs.
Eine knappe Viertelstunde später saß Charlotte Zemp wieder im Sattel und setzte ihre Fahrt Richtung Westen fort. Esporles, Torre del Verger, Banyalbufar, Estellencs standen auf der Liste. Ein Sahnestückchen der Insel: pittoreske Küstenlandschaft, Rennradtraum, wenn auch eine anspruchsvolle Route. Sollte aber zu schaffen sein. Sie war zwar keine ausgesprochene Bergziege, aber die vergangenen Tage hatte sie etliche Kilometer runtergeschrubbt und sich zusätzlich zu ihrer vorhandenen Grundfitness reichlich Kondition antrainiert. Hinter Esporles, auf Höhe des Heimatmuseums La Granja, ging es ins Gebirge hinein. Landstraße Ma-1100 nach Banyalbufar. Noch mal runterschalten auf ein kleineres Ritzel. Dann das Missgeschick: Reifenpanne am Hinterrad. Mist. Ausgerechnet heute. Aber Charlotte Zemp ließ sich nicht so leicht aus der Bahn werfen. Schon gar nicht von einem blöden Platten. War schließlich nicht der erste in ihrem Leben und bei Radsportlern eingepreist wie Verspätungen beim Bahnfahren. Wohlweislich gehörte es zu den Automatismen bei Tourvorbereitungen, Ersatzschlauch, Satteltasche mit Werkzeug und eine kleine Handpumpe einzupacken.
Sie fuhr auf einen Parkplatz, der im Kreuzungsbereich lag. Was folgte, war eine Abfolge routinierter Handgriffe: Hinterrad ausbauen, Fahrrad zur Seite legen, Ventil vom Reifen abschrauben, per Reifenheber Mantel von der Felge lösen, defekten Schlauch rausziehen, Außen- und Innenseite des Mantels nach Schäden und eventuellen spitzen Teilen untersuchen. Nichts zu entdecken. Vielleicht beim Überfahren eines Steins beschädigt. Dann etwas Luft in den Ersatzschlauch pumpen, Mantel mit Daumen und Reifenheber aufziehen, Schlauch vollständig aufpumpen, mit dem Daumen den Reifendruck prüfen, okay, Laufrad wieder in den Rahmen montieren – fertig.
Keine zehn Minuten hatte das Ganze gedauert. Dennoch war sie ein bisschen genervt von der unerwarteten Zwangspause. Brachte das Drehbuch durcheinander, das sie im Geiste für den Tag geschrieben hatte. Sie wollte schnell weiter, stieg wieder auf. Der Ärger verflog mit jedem Meter, den sie das Rad den Berg hochtrieb. Ein lautes Geräusch hinter der lang gestreckten Straßenbiegung vor ihr ließ sie aufhorchen. Sie konnte nicht erkennen, was es verursachte, Kurve und Bäume verstellten ihr die Sicht. Klang wie ein tosender Fluss, der auf sie zukam. Vorsichtshalber wich sie ein Stück nach rechts zum Straßenrand hin aus. Sekunden später fegten mehrere junge Frauen auf Rollskiern und mit Skistöcken an ihr vorbei, begleitet von einem fröhlichen »Sorry«, das sie ihr zuriefen. Grund für Letzteres war, dass es manche aus der Gruppe weit nach links hinaustrug, sodass Zemp den Luftzug spürte. Sie regte sich nicht darüber auf. Zu sehr war sie von der Begegnung gefesselt und davon, dass manche der Frauen nur mit Shorts und knappem Bikinioberteil bekleidet waren. Vielleicht Langläuferinnen, die für den kommenden Winter trainierten, dachte sie, nachdem sich die erste Verblüffung gelegt hatte. Sie schüttelte den Kopf und lachte laut auf. Skifahrerinnen auf Mallorca! Charlotte Zemp war zwar einiges gewohnt von ihren Ausfahrten, aber auf eine solche Begegnung war sie nicht eingestellt gewesen.
Immer noch fasziniert blickte sie der sich schnell entfernenden Gruppe hinterher, während sie sich der Kurve näherte. Der Anstieg war steiler geworden, noch mal einen Gang runterschalten. Sie war aus dem Sattel in den Wiegetritt gegangen. Unwillkürlich hatte sie sich dabei in die Mitte der Straße bewegt. Gleichzeitig vernahm sie mit halbem Ohr ein weiteres Geräusch vor ihr, das sich anhörte wie ein Brandungsrauschen. Wahrscheinlich Nachzügler aus der Skigruppe. Da sie noch gedanklich abgelenkt war, schenkte sie der Sache zunächst keine weitere Beachtung, bewegte sich aber erneut ein Stück nach rechts. Nur noch ein paar Meter bis zum Knick. Das Rauschen wurde lauter. Als sie den Kopf wieder nach vorne drehte, sah sie nur noch eine blaue Wand auf sich zurasen wie eine Monsterwelle. Sie hatte keine Chance, auszuweichen.
2
Palma, Paseo Marítimo. Am Freitag gegen neunzehn Uhr schaltete Palma allmählich in den Feierabend- und Wochenendmodus. Blechlawinen auf den Straßen, letzte Scharmützel in den Geschäften, Vorspiel des Nachtlebens in Bars und Cafés. Pau Ribera hatte etwas früher als sonst das Polizeikommissariat der Balearen-Hauptstadt verlassen und sich in der »Costa Dorada« in Sportklamotten geschmissen. Die »Costa Dorada« war eine Pension in der Altstadt, in der er als Dauermieter logierte, seit er vor etwas über einem Jahr auf die Insel gezogen war.
Von seiner Behausung aus hatte er sich zu Fuß zum Paseo Marítimo aufgemacht und konnte nun wie ein Zuschauer auf einem Logenplatz das Stück verfolgen, das die Natur um ihn herum aufführte. Als sich das Unheil ankündigte, war er zwischen Molinar und dem Hafen unterwegs. Eine weitläufige Freifläche mit Sicht auf den Parc de la Mar und die Kathedrale La Seu auf der einen Seite und die Bucht von Palma auf der anderen. Beste Sicht also auf das Drama, das sich in mehreren Akten vollzog. Der Himmel, der sich nach und nach verfinsterte. Der Wind, der durch die Wedel der Palmen am Straßenrand fegte und sie wie die Tentakel von Quallen wild herumschwanken ließ. Das Meer, das sich bedrohlich grau verfärbte, und die Wellen, die aggressiv an die Ufermauer klatschten. Als verbündeten sich die Elemente zu einem kollektiven Tobsuchtsanfall, der kein Ende nehmen wollte. Eine Endzeitstimmung, wie sie Ribera bisher auf Mallorca nicht erlebt hatte. Eigentlich faszinierten ihn solche Untergangsszenarien. Und vielleicht registrierte er die Vorgänge um sich herum auch beiläufig. Dass er dennoch unbeirrt weiterlief, hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass er zu sehr mit sich selbst zu kämpfen hatte, als dass er den Vorzeichen des aufziehenden Unwetters weiter Beachtung geschenkt hätte.
»Lief« war denn auch nicht ganz die korrekte Bezeichnung für die Art, in der er sich fortbewegte. Ribera schleppte sich stotternd dahin wie der Motor seines alten Seat Ibiza, bei dem nur noch drei Zylinder funktionierten. Schweres Atmen, verzerrte Mimik, immer wieder griff er sich in die Seite. Seitenstechen plagte ihn. Sein Debüt als Jogger hatte er sich weniger anstrengend vorgestellt. Wesentlich weniger. Aber so leicht wollte er nicht aufgeben. Er war jemand, der sich schon oft durchgebissen hatte, der sich quälen konnte, wenn es sein musste. Nicht, dass er auf einmal auf dem Sport-Trip gewesen wäre. Vielmehr war es ein Ratschlag seines Arztes. Schlechte Blutwerte. Zu hohes Cholesterin. Übergewicht. Das Ergebnis seines letzten Gesundheitschecks. Die Stimme von Dr. Ruiz dröhnte noch immer in seinen Ohren. »Sitzen ist das neue Rauchen. Dein jetzt schon vorhandener Bauchansatz wird in ein paar Jahren deutlich gewachsen sein. Mit anderen Worten: Du musst dringend etwas tun, sonst bist du irgendwann ein Kandidat für Herzinfarkt oder Schlaganfall.« Ausdauersport, Ernährung umstellen, weniger Alkohol hatte er ihm nahegelegt. Ein Dreiklang des Grauens in seinen Ohren. Ausgerechnet er. Der Laufmuffel. Der vor nicht allzu langer Zeit noch seinen Freund Pep Bosch wegen dessen Fitnesskult auf den Arm genommen hatte. Dabei hatte er sich mit Mühe und Not das Rauchen abgewöhnt. Auch in der Annahme, mit dem Verzicht auf dieses Laster schon eine Menge für seine Gesundheit getan zu haben. Dennoch hatte er sich dazu durchgerungen, auf seinen Arzt zu hören. Ausschlaggebend war letztlich ein Telefonat mit seiner Mutter gewesen. Sie hatte ihm das Schicksal eines seiner Cousins ins Gedächtnis gerufen. Ähnliche Geschichte, wenn der auch ein paar Jahre älter war. Ein Lebemann par excellence, der mit seinem Körper Schindluder getrieben hatte. Herzinfarkt mit Anfang fünfzig. Lebte nun mit drei Bypässen. Am Tag darauf hatte Ribera ein Sportgeschäft aufgesucht, um sich ein Paar Joggingschuhe zuzulegen. Polizeiliche Ermittlungsarbeit war im Vergleich dazu ein Spaziergang. Ein euphorischer Verkäufer hatte ihn mit Informationen über weiches Mesh-Obermaterial mit atmungsaktiven Zonen, smarten Support, softe Dämpfung, Stoßabsorption, reaktionsfähigen Zehenabstoß und andere vermeintliche Qualitäten bombardiert. Ob denn die Schuhe auch von selbst laufen würden, hatte er den Verkäufer gefragt und ein, wie er es interpretierte, maliziöses Lächeln geerntet. Nun, da er sich schnaufend und keuchend wie eine alte Dampflok über den Asphalt schleppte, wusste er, warum. Alles fühlte sich schwer an, Beine, Arme, der ganze Körper. Als stünde jemand auf seinen Schultern und drückte ihn zu Boden. Konnte es sein, dass auf Mallorca eine andere Schwerkraft herrschte als an anderen Orten dieser Erde? Ihm fiel ein, dass er mal davon gehört hatte, dass die Anziehungskraft des Planeten von Ort zu Ort schwankte. Wenn auch nur minimal. Auf dieser verfluchten Insel war es sicher der oberste Bereich der Minimalität.
»Coño!«
Wildes Klingeln hinter ihm ließ Ribera zusammenfahren. Um ein Haar wäre er ins Straucheln geraten und gegen das halbhohe Metallgeländer gekracht, das den Weg von der Uferböschung trennte. Sekunden später fuhr ein Elektroroller lautlos an ihm vorbei. Darauf ein jüngerer Mann in der für diese Gefährte typischen aufrechten Haltung, als würde er einen antiken Streitwagen steuern.
Er rief Ribera zu: »Hey, tío, das ist kein Fußweg, lauf gefälligst da drüben!« Mit einem kurzen Kopfnicken wies er auf den breiten Weg, der zwischen der Straße und einer niedrigen Steinmauer verlief, und sauste an ihm vorbei.
Ribera hielt inne. Tatsächlich, er war auf dem roten Fahrradweg unterwegs. Wie dumm von mir, dachte er. Erst jetzt nahm er bewusst wahr, was sich um ihn herum abspielte. Wolken hatten sich aufgetürmt. Dunkelgrau und bedrohlich. Unheilvolles Grollen, gefolgt von einem Blitz, der draußen ins Meer einschlug. Er befand sich etwa auf Höhe des Almudaina, des Palastes des spanischen Königs oberhalb der Stadtmauer, wenn der Regent Mallorca besuchte.
Erste Regentropfen fielen. Die wenigen Menschen, die außer Ribera zu Fuß unterwegs waren, hasteten davon, um sich irgendwo unterzustellen. Wieder Donnern und ein Blitzstrahl. Der Himmel öffnete seine Schleusen, Sekunden später ging die reinste Sintflut nieder. Die Scheibenwischer der Autos auf dem Paseo Marítimo zuckten auf Höchststufe hin und her wie Stroboskoplichter in einer Disco. Vergeblich angesichts der Wassermassen, die Autos bremsten ab, der Verkehr kam zum Erliegen.
Ribera rannte zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch auf die andere Straßenseite und querte die Rasenfläche vor dem Parc de la Mar mit seinen niedrigen Pinien, vorbei am Seemannsamt, das die Schnittstelle zwischen Altstadt und Hafen dominierte. Hinter dem wuchtigen Gebäude duckte sich ein niedriger Pavillon der Touristeninformation. Gerade noch rechtzeitig konnte er unter dessen Vordach schlüpfen, das sich rund um den Bau zog. Mehrere andere Unwetter-Flüchtlinge drängten sich dort. Sekunden später begann das Inferno.
Stühle von Restaurants und Mülleimer schlitterten vom Sturm getrieben über den Boden wie kleine Formel-1-Boliden. Der Hagel prasselte auf das Plexiglas über ihren Köpfen. Es hörte sich wie ein Trommelfeuer an. Wirkt wenig vertrauenerweckend, dachte Ribera beim Anblick des schmalen Kranzes. Er zog unwillkürlich den Kopf ein, drückte sich eng an die Wand und klopfte prüfend mit dem Finger dagegen. Wenigstens machte der Rest des Pavillons einen stabileren Eindruck. Solides Metall, tiefschwarz und länglich wie ein Schiffsrumpf. Ribera musste an den Film »Titanic« denken, den er vor Jahren gesehen hatte. Ihm kam es ein bisschen vor, als befände er sich auf dem Deck einer Miniatur-Titanic, die wie das große Pendant bei aller vermeintlichen technischen Perfektion doch hilflos den Launen der Schöpfung ausgeliefert war.
Neben ihm hielt sich eine ältere Frau krampfhaft an ihrer Handtasche fest und murmelte etwas vor sich hin. »Santa Bárbara, solange wir leben, fühlen wir uns gefangen in Sorge und Not, in Leid und Sünde. Hilf, dass wir Jesu Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung als Botschaft der Befreiung aus unserer irdischen Gefangenschaft begreifen und in der Todesstunde eingehen dürfen in sein ewiges Erbarmen.«
Es war ein Gebet, das er aus seiner Kindheit kannte und bei seiner Großmutter gehört hatte, stellte Ribera fest. Gerichtet an die heilige Bárbara, die Schutzpatronin, die bei Gewitter, Feuer, Pest und plötzlichem Tod angerufen wurde.
»Schöne Scheiße, was?« Eine Stimme riss Ribera aus seinen Gedanken. Sie gehörte zu einem Mann, der hinter ihm stand und mit sorgenvoller Miene auf die teilweise golfballgroßen Eisklumpen blickte, die wie ein weißer Teppich den Boden bedeckten. Er mochte Ende dreißig, Anfang vierzig sein, kleiner und stämmiger als Ribera, durchnässtes hellblaues Sakko und weißes Hemd, das an die Brust geklatscht war, sodass Haut und Brustbehaarung durchschimmerten. Der Kopf mit dem spärlichen Resthaar hatte hingegen relativ wenig abbekommen. Lag wohl an der braunen Aktentasche, die er unter den Arm geklemmt und, den großen dunklen Flecken auf dem Leder nach zu urteilen, zuvor offenbar als Regenschirm benutzt hatte.
Ribera für seinen Teil triefte vom Scheitel bis zur Sohle. Die Haare klebten an der Stirn, Wassertropfen rannen die Wangen hinunter. Laufshirt, Shorts und selbst die Schuhe waren klatschnass. Er fror angesichts der Temperaturen, die schlagartig gefallen waren. Immerhin hörte der Hagel nach ein paar Minuten auf, ging in einen schleierartigen Regen über, der vom Wind durch die Straßen gepeitscht wurde.
Sein Nachbar redete unterdessen unbeirrt weiter. »Die Natur spielt immer mehr verrückt. Erst regnet es monatelang nicht, dann kommt alles auf einmal runter. Und diese mistige Gota fría ist auch immer früher dran.«
Ribera kannte zwar das Wetterphänomen, das regelmäßig um diese Jahreszeit vor allem die spanische Mittelmeerküste heimsuchte, hatte es aber bisher auf Mallorca nie am eigenen Leib erlebt. Außerdem sah er selten fern und hörte kaum Radio. Von daher hatte er nicht mitbekommen, dass sich etwas zusammenbraute.
»War wohl keine besonders gute Idee, ausgerechnet heute am Meer entlangzujoggen. Vielleicht sollte ich doch ab und zu mal die Wettermeldungen verfolgen.«
»Du bist nicht von hier, was, tío?« Sein Nachbar wartete die Antwort erst gar nicht ab. »Ich kenne niemanden, der nicht süchtig ist nach Wetternachrichten. Wir leben schließlich auf einer Insel.« Er kramte sein Mobiltelefon aus der Hosentasche, wischte darauf herum und hielt es ihm vor die Nase. »Meine neueste Errungenschaft. Eine Wetter-App. Hat aber heute auch nichts genützt.«
Ribera warf einen kurzen Blick auf den blauen Bildschirm, der gespickt war mit kleinen Sonnen, Wolken, Regenschirmen, Blitzen und anderen Symbolen. Begleitet von Temperaturangaben und anderen Informationen, mit denen er nichts anzufangen wusste. Er deutete zum Himmel. »Verstehe, sollte man immer dabeihaben …«
Sein Nachbar verzog das Gesicht und steckte das Gerät wieder ein. »Das Tückische an dieser verdammten Gota fría ist, dass die Wetterfritzen zwar davor warnen, du aber nie genau weißt, wann und wo sie zuschlägt.« Er schnippte mit den Fingern. »Zack, und sie ist da, und du bist gearscht, wenn du unterwegs bist. Da nützt die beste Technik nichts.«
Die Anbeterin der heiligen Bárbara mischte sich ein. »Hoffentlich wird es dieses Mal nicht so schlimm wie vor ein paar Jahren.« Sie bekreuzigte sich. »Dios mío, wenn ich an die Überschwemmungen und vor allem an die Todesopfer denke.«
Allgemeines Nicken in der Pavillonrunde und betretene Gesichter. Bis auf ein junges Paar, das aneinandergeklammert in der Ecke stand und verständnislos guckte. Er in kurzen Hosen, T-Shirt mit Hardrock-Café-Mallorca-Aufdruck und Baseballmütze, sie in einem sommerlichen Kleid, die Sonnenbrille auf den blonden Haaren nach hinten geschoben, am ganzen Leib zitternd.
Sicher Touristen, dachte Ribera. Damit war sein Interesse an den beiden erschöpft. Er musste an die Katastrophe denken, deren Erwähnung allgemeine Betroffenheit neben ihm ausgelöst hatte. Soweit er sich erinnerte, hatte sich das Unwetter im Jahr 2018 abgespielt und in einem Dorf im Osten der Insel mehr als zehn Todesopfer gefordert.
Verdammt schlechtes Timing für seine erste Joggingrunde.
Der Regen wurde allmählich schwächer. Die Autos setzten sich wieder in Bewegung, Wasser spritzte zu beiden Seiten, wenn sie durch die Seenlandschaft fuhren, in die sich die Straßen verwandelt hatten. Rinnsale flossen auf den Gehwegen. Eine junge Frau aus der Notgemeinschaft hob ihren Blouson über den Kopf und verließ im Laufschritt den Unterschlupf. Das Touristenpärchen folgte ihr. Ribera überlegte, ob er es ihnen gleichtun sollte, aber ein Geräusch seines Smartphones ließ ihn innehalten. Umständlich fingerte er das Gerät aus der schmalen Gürteltasche, die er um die Hüfte trug. Eine Whatsapp-Nachricht. Nur zwei Sätze: »Tut mir leid, er ist hinüber. War nichts mehr zu machen.«
Ribera stöhnte. »Joder, das hat gerade noch gefehlt.« Fragende Blicke seines Nachbarn und der älteren Dame, die mit ihm zusammen als Letzte unter der Markise verblieben waren. Er zuckte mit den Schultern, presste ein »Hasta luego« heraus und machte sich mit schnellen Schritten auf den Weg in seine Pension. Jetzt brauchte er erst einmal eine heiße Dusche. Danach Füße hochlegen und ein Bier – mindestens. Diesen Nackenschlag musste er erst einmal verdauen.
3
Palma, Gewerbegebiet Son Valentí. Was für ein Mist, dachte Ivan Peskow, als er den Schaden an dem Lkw betrachtete. Linker Scheinwerfer demoliert, rote Lackspuren auf der Fahrzeugseite. Zum Glück bestand die Frontpartie in diesem Bereich meist aus Plastikteilen, konnte also leicht ausgetauscht werden. Dennoch überkam ihn ein Anflug von Gewissensbissen. Vielleicht hätte er nicht einfach weiterfahren, sondern sich um die Frau kümmern sollen. Aber es war alles so schnell gegangen. Er hatte zunächst nicht gesehen, was ihm in die Quere gekommen war. Zu sehr war er abgelenkt gewesen. Ein Anruf auf seinem Mobiltelefon, der ihn aufs Display hatte schauen lassen. Zu schnell dürfte er auch gewesen sein, sodass es ihn weit in dieser elenden Kurve hinausgetragen hatte. Dann dieser harte Aufprall. Im ersten Reflex hatte er zunächst gedacht, er habe eine Ziege gerammt. Kam schließlich immer wieder vor, dass die wild im Gebirge lebenden Tiere über die Straße liefen. Auch während der Fahrt hatte er welche am Straßenrand beobachtet. War ihm eh schleierhaft, warum die Mallorquiner die Viecher überall tolerierten und den Bestand nicht dezimierten. Als er jedoch nach dem Schreckmoment in die Eisen gestiegen war und in den Rückspiegel geschaut hatte, konnte er das ganze Malheur sehen. Wie in Trance und ohne zu überlegen, hatte er danach gehandelt, war ausgestiegen und hatte das Rad und den leblosen Körper in dem Gebüsch entsorgt wie Müll, den man achtlos wegwarf. Danach hatte er zugesehen, dass er so schnell wie möglich Land gewann. Zum Glück war er auf der Strecke zu dem Zeitpunkt ansonsten keiner Menschenseele begegnet. Keine Zeugen also, die ihn hineinreiten könnten.
Ob die Frau noch gelebt hatte? Kaum, er hatte schon genügend Tote gesehen, um das beurteilen zu können. Und selbst wenn: Er hatte keinerlei Lust auf Scherereien mit der spanischen Polizei. Ausländer von außerhalb der EU. Nur ein paar Brocken Spanisch. Dazu seine Vergangenheit, die mit ein paar Nachforschungen wahrscheinlich ans Tageslicht gekommen wäre und zu lästigen Nachfragen geführt hätte. Nicht zu vergessen der dubiose Hintergrund seines Auftrags. Zu riskant.
Peskow wanderte in der hohen Industriehalle herum, in der er das Fahrzeug abgestellt hatte. Jetzt galt es, so schnell wie möglich die Spuren des Unfalls zu beseitigen. Schließlich standen in den nächsten Tagen weitere Fahrten an. Dumm nur, dass Wochenende war. Da kam man weder an einen Mechaniker noch an Ersatzteile. Außerdem musste er erst noch einen anderen Job erledigen. Geräuschlos und ohne Aufsehen sollte der über die Bühne gehen. Eine Spezialoperation, wie sein Auftraggeber es am Telefon ausgedrückt hatte. Ganz auf ihn zugeschnitten. Er hatte dabei zynisch gelacht. Peskow seufzte. Irgendwie holte ihn seine Vergangenheit immer wieder ein. Andererseits hatte es sich nach leicht verdientem Geld angehört. Und wirkliche Skrupel hatte er nicht. Dafür hatte er schon zu viel Übles erlebt, als dass ihn ein menschliches Schicksal noch berührt hätte.
Er ließ den beschädigten Lkw in der Halle stehen, schloss die Tür hinter sich ab und stieg in einen anthrazitfarbenen Range Rover Evoque, der draußen geparkt war. Aus dem Handschuhfach holte er seine Makarow PB, die er dort in ein Tuch eingewickelt deponiert hatte. Er betrachtete die Pistole mit dem braunen Griffstück, auf dem ein Stern abgebildet war, und wog sie in der Hand. Russische Wertarbeit, aus Stahl gefräst, ein Präzisionswerkzeug, geschaffen, um Menschen zu töten. Fühlte sich nach wie vor vertraut an. Wie eine Geliebte, die man nach längerer Zeit wieder besuchte. Gut, dass er sie damals mitgenommen hatte, als er nach Mallorca ausgewandert war. Er zog das Magazin der Waffe heraus und prüfte es. Geladen, acht Patronen, neun mal achtzehn Millimeter. Auf den Lauf schraubte er einen Schalldämpfer. Man konnte ja nie wissen. Dann legte er die Pistole wieder ins Handschuhfach, fuhr von Son Valentí aus auf die Autobahn Ma-1 und schlug den Weg nach Westen ein. Er musste sich beeilen, denn das Wetter verhieß nichts Gutes. Aber andererseits war genau das Teil des Plans.
4
Palma, Fischereihafen. Als David Ferrer am Montagmorgen gegen neun Uhr die Heckleine der »Tauron Blanc« vom Poller an der Mole löste, deutete kaum mehr etwas auf das tagelange Wüten der Natur hin. Blauer Himmel, durchsetzt von einigen Wolken, Sonnenschein, sanfte Brise, und auch die Temperaturen kletterten langsam wieder auf ein spätsommerliches Niveau. David Ferrer kam es wie ein Spuk vor, dass die Insel noch vor Kurzem wie ein Cocktail durchgeschüttelt worden war. Und nun tuckerten er und sein Kollege José Mestre, der in der Kabine am Steuerrad stand, gemächlich mit ihrer gelb-roten Nussschale durchs Mittelmeer. Vorbei an den mondänen Segelyachten, die nebenan im Club Nautico dicht an dicht vor Anker lagen, als wäre es die Szenerie eines Wimmelbilds. Für David Ferrer ein gewohntes Szenario, dem er keine große Beachtung mehr schenkte, während er an der Reling des flachen Boots weilte. Seine Aufmerksamkeit galt der Wasseroberfläche, von der er nur wenige Zentimeter entfernt war. In der Hand hielt er einen Kescher an einer langen Holzstange, wie ihn Angler benutzten, um gefangene Fische aus dem Wasser zu hieven.
Am Ende des Hafenbeckens ging es vorbei an einer Fähre von Trasmediterranea und einem Frachtdampfer namens »Valle de Granada«. Wie ein Spielzeugmodell wirkte die kleine »Tauron Blanc« gegenüber den beiden Pötten. Eher ein Haifischchen als ein ausgewachsener »weißer Hai«, was der katalanische Name bedeutete. Und im Gegensatz zu dem berühmt-berüchtigten Räuber war die »Tauron Blanc« explizit dazu da, Müll zu schlucken, genauer gesagt all die zivilisatorischen Überreste, die täglich vor der Küste Mallorcas herumtrieben.
David Ferrer entdeckte etwas zu seiner Rechten. Handzeichen an José Mestre, der den Motor drosselte. Er lehnte sich ein Stück über die Reling und fischte mit dem Kescher eine Plastikflasche aus dem Hafenbecken heraus. Sie verschwand in einem Container, der wie ein nach außen gestülpter Magen auf dem Bug stand. Der erste Fang am heutigen Tag für das Müllboot.
Kurze Zeit später passierten sie die Hafenmole Dique del Oeste und schipperten auf das offene Meer hinaus. Die Fahrt ging nun quer durch die weitläufige Bucht von Palma. Vorbei an der alten Festungsanlage Sant Carles mit ihren imposanten Mauern, die sich direkt an den Hafen anschlossen. Vorbei an Marivent, dem Sommerpalast der spanischen Königsfamilie, der eingebettet in einen baumbestandenen Park auf einem weißen Felsen am westlichen Stadtrand von Palma thronte. Vorbei an Cala Major, Cala Nova und wie all die Badebuchten sonst noch hießen, die sich an der Südwestküste aneinanderreihten. Als hätte die Natur der Tourismusindustrie letzte Freiräume in diesem zugebauten Teil der Insel abgetrotzt. Immer wieder näherten sie sich den Uferzonen, soweit der Tiefgang des Boots es zuließ. Plastiktüten, Wasserflaschen, Kanister, kaputte Netze, Taue, kleinere Stücke Treibholz wanderten in den Container. In der Nähe des Luxushotels Maricel legten sie eine kurze Essenspause ein. Dann wendete José Mestre die »Tauron Blanc«. Zurück Richtung Osten: Portopí, Can Pere Antoni, Portixol.
Vor El Molinar zog David Ferrer einen weißen Plastikbeutel aus dem Wasser. Er wollte ihn schon zum restlichen Müll werfen, als er stutzte. Er drehte ihn herum und hielt ihn José entgegen. »Eine Milchtüte.«
José Mestre streckte den Kopf aus der Kabine und winkte ab. »Und? Was soll da Besonderes dran sein?«
»Na ja, die hat einen weiten Weg hinter sich. Stammt garantiert aus Nordafrika.«
»Wie kommst du darauf?«
Ferrer deutete auf die blaue Beschriftung. »Arabisch und Französisch. Könnte das Fundstück des Tages werden.«
»Kannst es dir ja einrahmen lassen, wenn es dir so gut gefällt, hombre.« Mestre lachte. »Bringen wir noch den Rest hinter uns.«
Er zog sich wieder in die Kabine zurück und steuerte das Müllboot Richtung S’Arenal, dem östlichen Ende ihrer täglichen Tour. In Höhe von Ciudad Jardín verlangsamten sie das Tempo. Am Ufer erstreckte sich der mehrere hundert Meter lange weiße Strand des Küstenstadtteils von Palma, der vor allem bei Einheimischen beliebt war. Nach dem unwirtlichen Intermezzo der Gota fría war auch hier das Leben zurückgekehrt. Zahlreiche Menschen flanierten auf der von Palmen und Tamarisken gesäumten Meerespromenade oder saßen in einem der Restaurants. Andere hatten es sich auf den Liegestühlen unter den runden braunen Strohdächern gemütlich gemacht, die wie Riesenpilze aus dem Sand zu wachsen schienen. Kinder tobten herum, im Meer herrschte reger Badebetrieb.
Durch seine Sonnenbrille beobachtete David Ferrer das bunte Treiben. Nur zu gut hätte er sich vorstellen können, am Strand herumzuliegen, ab und zu eine Runde in dem um diese Jahreszeit noch warmen Wasser zu drehen, vielleicht zwischendurch ein kühles Bier in der Strandbar zu genießen. Stattdessen kurvte er stundenlang mit einem Müllboot auf dem Meer herum und entsorgte die Hinterlassenschaften der Freizeitgesellschaft. Andererseits war er froh, dass er diese Beschäftigung gefunden hatte. Sie war relativ krisensicher, und nicht zuletzt empfand er es als eine sinnvolle Aufgabe, etwas für die Umwelt zu tun. Wer weiß, wie viel Abfall am Ende des Tages liegen blieb, vergessen oder gedankenlos weggeworfen, und anschließend im Meer landete.
Er konzentrierte sich wieder auf seine Aufgabe. Ah, da war wieder etwas, ein Gegenstand schwamm im Wasser. Undefinierbar aus der Entfernung. Er drehte den Kopf Richtung Bootskabine, krümmte Daumen und Zeigefinger, steckte sie in den Mund. Ein lauter Pfiff. José Mestre lehnte sich heraus, guckte fragend.
»Wieder ’ne afrikanische Milchtüte?«
»Kaum. Sieht nach etwas Größerem aus, vielleicht brauchen wir James Bond.« Ferrer meinte damit natürlich nicht den britischen Geheimagenten, sondern einen hydraulischen Metallgreifer an der Spitze des Boots. Wie eine überdimensionierte Zange ließ er sich per Knopfdruck öffnen, um Baumstämme oder auch mal einen größeren Tierkadaver zu bergen. Den Namen hatte Ferrer erfunden, weil ihn die Technik an einen alten Bond-Film erinnerte. Darin kaperte ein Verbrechersyndikat im All bemannte Raumkapseln der USA und der damals noch existierenden Sowjetunion mit einem Raumschiff, dessen Front sich ähnlich öffnete wie die der »Tauron Blanc«. »Du hast zu viel Phantasie«, hatte sein Kollege entgegnet, als er den Begriff erstmals verwendet hatte. Dennoch war er in ihren Sprachgebrauch übergegangen.
Das Boot näherte sich dem Objekt mit reduzierter Geschwindigkeit. Mit einem Surren gingen die beiden Greifarme auseinander. David Ferrer sah etwas Orangefarbenes im Wasser schwimmen. Dachte: Nein, das kann unmöglich ein Baumstamm sein. Er hatte ein Grummeln in der Bauchgegend. Ein ungutes Zeichen, dass irgendetwas nicht stimmte. Unsicher blickte er zu seinem Kollegen, hob die Arme und senkte die Schultern. Nur noch knapp zwei Meter. Die »Tauron Blanc« stoppte. Der erste Eindruck hatte nicht getrogen. Der vermeintliche Abfall war ein Mensch in einer orangefarbenen Schwimmweste. David Ferrer starrte entsetzt auf den leblosen Körper, der mit dem Gesicht nach unten sanft im Rhythmus der Wellen schaukelte. Wie die leeren Plastikflaschen, die er mit dem Kescher einfing.
José Mestre riss sich als Erster von dem Anblick los, griff zu seinem Mobiltelefon und rief die Zentrale an. »Wir haben eine Leiche aufgefischt, verständigt die Polizei!«
5
Palma, Stadtteil Arxiduc. Pau Ribera kam sich fast vor wie bei einem Gang zum Friedhof, als er gegen sechzehn Uhr vor einem sandfarbenen vierstöckigen Wohngebäude im Carrer de Julià Alvarez stand. Fehlten nur noch der schwarze Anzug und ein Blumenstrauß fürs Grab. Vielleicht etwas zu melodramatisch, dachte er. Aber ganz abwegig war die Assoziation auch nicht, galt es heute doch, Abschied von einem alten Vertrauten zu nehmen. Jedenfalls hatte er die Whatsapp-Nachricht so gedeutet, die ihn während der Gota fría erreicht hatte.
»Talleres Paco«. Gelbe Schrift auf schwarzem Untergrund. Zu lesen auf einem Schild über einem offenen hohen Rolltor. Der Eingang zur Autowerkstatt, bei der er Stammkunde war. Für ihn an diesem Tag wie die Pforte zur Finsternis, ein Höllenschlund. Dazu passten der Lärm, der aus dem Inneren drang, und der Geruch nach Öl und Abgasen. Er war mies drauf an diesem Tag. Wie das ganze Wochenende davor. Auch wenn Natividad Iglesias, die Wirtin der Pension »Costa Dorada«, vergeblich versucht hatte, ihn aus seinem Tief zu holen.
»Es ist doch nur ein Auto. Ein Stück Blech. Davon geht die Welt nicht unter. Dann kaufst du dir halt ein neues.«
Sie hatte gut reden. Natürlich hatte sie recht, sein alter Seat Ibiza war im Grunde genommen nichts Besonderes. Massenware. Veraltete Technik. Reparaturanfällig. Der einst glänzende gelbe Lack verblichen. Alles nebensächlich in seinen Augen. Knapp zwanzig Jahre hatte ihn der Wagen begleitet – prägende Jahre. Erinnerungen waren damit verbunden. Studium, Polizeiausbildung, Fahrten zu Konzerten und in den Urlaub, Knutschereien, Sex oder zumindest das, was das Sardinenbüchsenniveau seines Gefährts in dieser Richtung gestattete. Von einer Bekannten seines Großvaters Oriol hatte er ihn seinerzeit gekauft, einer älteren Dame, deren Mann gestorben war. Rund sechzigtausend Kilometer hatte er auf dem Tacho, hauptsächlich innerorts gefahren. Garagenwagen, gut gepflegt, alle Inspektionen gemacht. Ein Schnäppchen. Die ganzen Jahre hatte er kein Bedürfnis nach einem anderen Auto verspürt, obwohl ihn seine Frau oder besser seine baldige Ex-Frau immer wieder gedrängt hatte, etwas Modernes, Größeres, Schöneres, Vorzeigbareres zu kaufen anstelle der chatarra, der Schrottkarre, wie sie es ausgedrückt hatte. Er hatte keine Notwendigkeit dafür gesehen, solange es der Wagen tat. Und ein Auto als Statussymbol zu besitzen, hatte er nicht nötig. Auch wenn er sich manchen Spott von Freunden und Kollegen anhören musste. Dazu kam etwas Grundsätzliches, ein Wesenszug Riberas, den er schon in seiner Kindheit entwickelt hatte: Er war jemand, der sich nur schlecht von etwas trennen konnte. Von Menschen wie von Dingen. Auch wenn es sich um etwas so Profanes wie einen Seat Ibiza handelte, dessen Halbwertszeit erkennbar erschöpft war. Er schnaufte zweimal tief durch, gab sich einen Ruck und trat ein.
Die Werkstatt war ein langer Schlauch mit niedriger Decke, der sich durch das Gebäude zog wie die Gänge eines Höhlensystems. Vollgestopft mit Autos, was Ribera an das Gewimmel in einem Ameisenhaufen erinnerte. Hochbetrieb, eingetaucht in kaltes Neonlicht. Ein Kfz-Mechaniker war dabei, mit einem Schlagschrauber die Reifenmuttern eines silbernen Mercedes zu lösen. In Riberas Ohren klang es wie Schüsse aus einer Waffe. Nebenan montierte ein Kollege einen neuen Auspuff an einen Renault, der auf einer Hebebühne aufgebockt war. Ein Dritter hatte den Kopf unter die offene Motorhaube eines Audi gesteckt, während sein Gehilfe auf dem Fahrersitz das Gaspedal durchtrat.
»Bon dia, Pau.« Ein schlanker Typ mit halblanger Lockenpracht, Vollbart und Brille trat zu ihm. Wischte seine schwarz verschmierten Hände an einem Tuch ab. »Ich hatte dich schon erwartet.« Der Mann strahlte die Selbstsicherheit eines Menschen aus, der sich auf einer festen Spur durchs Leben bewegte wie ein Planet auf seiner Umlaufbahn um einen Stern. Für Paco Jimenez war dieses Zentralgestirn die Autowerkstatt, die er mit viel Herzblut über die Jahre aufgebaut und mit der er sich einen guten Ruf in der Kfz-Szene erarbeitet hatte. Auch für Ribera war der Betrieb ein Referenzpunkt, seit er auf Mallorca lebte. Dafür gab es eine ganze Reihe von Gründen: Allen voran schien es kein Problem zu geben, für das Paco keine Lösung fand – auch dort, wo andere erst gar nicht den Schraubschlüssel in die Hand nahmen. Das hatte ihm den Spitznamen »el brujo« eingebracht. Völlig zu Recht, wie Ribera meinte, denn ohne »den Hexer« Paco wäre sein Seat Ibiza garantiert schon längst auf dem Autofriedhof gelandet. Dazu lag die Werkstatt günstig zwischen seiner Pension und dem Kommissariat. Nicht zuletzt hatte ihr Verhältnis im Laufe der Monate über die üblichen geschäftlichen Benzingespräche hinaus freundschaftliche Züge angenommen.
Der Werkstattbesitzer kniff die Augen zusammen. »Du weißt, amigo, Paco wirft nicht so schnell die Flinte ins Korn. Aber dieses Mal war alles zu spät. Kolbenfresser.« Er strich sich über den Bart. »Höchststrafe für einen Motor. Oder, um es in eurer Sprache zu formulieren: Exitus.« Er malte mit dem Zeigefinger das Zeichen eines Kreuzes in die Luft. »Und nein, einen neuen reinzumachen lohnt sich nicht bei dem Alter und vor allem dem Gesamtzustand. Die Kiste ist ein Fass ohne Boden, hombre.«
Ribera guckte betreten zu Boden. Auch wenn es ihm in diesem Fall schwerfiel, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen – Pacos Worte waren für ihn Naturgesetz. Sie hatten das letzte Fünkchen Hoffnung ausgeblasen, die er zuvor noch gehabt hatte.
Er holte tief Luft. »Na prima. Nach der Gota fría eine weitere kalte Dusche. Wie –«
Zu mehr kam er nicht. Sein Mobiltelefon würgte die Unterhaltung ab. Ein Anruf aus der Jefatura, stellte er fest, dem Hauptquartier der spanischen Nationalpolizei in Palma. Er stammte von Cristina Blum, einer jungen Kollegin, die zu seinem Team in der Mordkommission gehörte. Sie berichtete von einer Leiche am Fischereihafen von Palma und dass sie sich auf den Weg machen werde. Er bat sie darum, ihn vor der Werkstatt abzuholen. Mit einem finsteren Seitenblick auf Paco fügte er hinzu: »Noch ein Todesfall. Scheint heute mein Glückstag zu sein.« Schweigen am anderen Ende der Leitung.
Palma, Fischereihafen. Nach knapp einer Viertelstunde Fahrt standen Ribera und Blum vor dem hohen weißen Metallzaun, der das Gelände von der Außenwelt abschirmte. Eingezwängt zwischen dem Yachthafen Moll Vell und dem Sportboothafen des Club Nautico wirkte der Fischereihafen von Palma wie ein exotisches Überbleibsel des alten Mallorca. Eine Reminiszenz an die Zeit, als die Gewässer der Balearen noch nicht die Spielwiese von milliardenschweren Ölscheichs, profilierungssüchtigen Internetmillionären und zwielichtigen Oligarchen waren, die sich mit immer größeren Yachten gegenseitig zu übertrumpfen suchten.
Ribera und Blum passierten das offene Tor, wo sich ihnen ein Kontrastprogramm zur mondänen Welt der Reichen und Superreichen bot. In die Jahre gekommene Fischkutter dümpelten im Hafenbecken vor sich hin. Manche von ihnen waren mit Winden für Schleppnetze ausgestattet. Der Platz vor dem lang gestreckten terrakottafarbenen Gebäude der Fischbörse war zugemüllt mit einem Sammelsurium aus dicken Tauen, Stapeln von grünen und braunen Fangnetzen, Plastiktonnen, Aufbewahrungskisten und Europaletten. Keine hippe Location, an der gestyltes Partyvolk in Loungesesseln dem Sonnenuntergang entgegenchillte, sondern ein Ort, an dem eine nüchterne Arbeitsatmosphäre herrschte und der Geruch von Schiffsdiesel, Meer und Fisch in der Luft lag.
Schon von Weitem sahen Ribera und Blum die Menschentraube, die sich am Kai gebildet hatte. Aufgeregte Stimmen. Hälse reckten sich neugierig in Richtung eines kleinen rot-gelben Boots, das parallel zum Kai angelegt hatte. Als würde direkt vor Ort der Fang des Tages verkauft werden. Ribera und Blum waren inzwischen bis zur Fischereibörse Sa Llotja del Peix gelangt und versuchten, sich mühsam einen Weg durch die Menge zu bahnen.
Sie kamen aber nicht weit. Ein Polizeibeamter stellte sich ihnen breitbeinig in den Weg, stemmte die Arme in die Hüften und bellte in barschem Ton: »Ihr Pressefuzzis habt hier gerade noch gefehlt. Hier gibt’s nichts für euch. Macht, dass ihr verschwindet!«
Ribera musterte den Mann. Noch jung, Mitte bis Ende zwanzig, schätzte er, muskulös, Tattoos auf den Armen. Der nassforschen Art nach am Anfang der Karriere. Auf der dunkelblauen Uniform las er die Aufschrift »Policía Portuaria«. Hafenpolizei. Es war das erste Mal, dass er mit der Abteilung zu tun hatte. Er wollte schon zu einem »Wie kommen Sie darauf, dass …?« ansetzen, als Blum den kleinen Schreibblock in ihren Händen hob, in dem sie sich bei Ermittlungen Notizen zu machen pflegte. Statt einer Erklärung zückte Ribera seinen Dienstausweis und ging wort- und grußlos an dem nun stammelnden Kollegen vorbei.
Am Rand der Kaimauer machte er zwei Männer aus, die mit einem weiteren Beamten der Hafenpolizei sprachen. Auffällig an ihnen war, dass sie einheitliche marineblaue Polohemden trugen. Darauf zu lesen: »Govern Illes Balears«. Aufgeregt deuteten sie mehrmals wahlweise auf das Boot oder aufs Meer hinaus. Offenbar Angestellte der Balearen-Regierung, schlussfolgerte Ribera.
Er sparte sich sämtliche Höflichkeitsfloskeln und grätschte rüde in die Unterhaltung hinein. »Chefinspektor Pau Ribera von der Policía Nacional, und das ist meine Kollegin Cristina Blum.« Drei Köpfe wendeten sich ihnen zu. »Uns wurde berichtet, dass hier eine Leiche sein soll.«
Der jüngere der beiden Polohemdträger wies stumm auf den Bug des Boots. Ribera und Blum traten ein Stück vor an den Rand der Mauer. Knapp dreißig Zentimeter unterhalb von ihnen sahen sie einen leblosen Körper zwischen den beiden mächtigen Metallarmen liegen. Der Tote hatte die Augen geschlossen, sein Antlitz wirkte friedlich, als würde er schlafen. Der Anblick löste bei Ribera einen Gefühlscocktail aus Entsetzen und Faszination aus. Nicht, dass es die erste Wasserleiche in seiner langen Polizeikarriere gewesen wäre. Schließlich war auch in seiner alten Heimat Lleida der eine oder andere Tote aus dem Río Segre gezogen worden, der durch die Stadt in Katalonien floss. Aber dieser Fall wirkte anders. Allein optisch. Die Szenerie erinnerte Ribera an eine überdimensionierte Fischkonserve, von der der Deckel abgezogen worden war. Er spann den Gedanken weiter. Eine Angewohnheit, die er seit Langem kultivierte, auch um verstörende Situationen wie diese nicht zu nahe an sich herankommen zu lassen. Vielleicht, so seine Überlegung, sähe es so aus, wenn der Mensch kein Spitzenprädator wäre, sondern ganz unten in der Nahrungskette stünde und von überlegenen Wesen in Dosen verpackt würde. Ihn schauderte bei der Vorstellung.
»Kennt jemand den Toten?« Cristina Blum ließ mit ihrer Frage Riberas Kopfkino jäh abreißen.
Betretenes Schweigen. »Das ist Toni.« Ein kräftiger Mann mit Dreitagebart trat aus der Gruppe am Kai hervor.
»Und wie noch?«
»Toni Castro.«
Der Mann, der sich als Joan Pastor vorstellte, erzählte, dass Castro wie er seit vielen Jahren Hobbyfischer gewesen und oft mit seinem Llaüt rausgefahren sei. Gerade jetzt im September sei die Fangsaison für Raor. »Auf den ist Toni ganz scharf.« Pastor presste nach der letzten Bemerkung die Lippen zusammen und schwieg dann peinlich berührt von seinem Fauxpas.
Einer der beiden Hafenpolizisten unterbrach die Stille, die eingetreten war. »Der arme Kerl ist wahrscheinlich beim Fischen von der Gota fría überrascht worden und über Bord gegangen. Oder sein Boot ist gekentert. Das hat ganz schön gepustet. Selbst in den Häfen sind einige Boote beschädigt worden.«
Ein paar der Umstehenden nickten bestätigend.
Von einem Fisch namens Raor hatte Ribera zwar noch nie gehört, dafür sagte ihm der Begriff »Llaüt« etwas. Rechtsmediziner Pep Bosch, mit dem er befreundet war, besaß selbst eines dieser klassischen mallorquinischen Holzboote. Er erinnerte sich an eine gemeinsame Ausfahrt und daran, wie er dabei festgestellt hatte, dass er nicht fürs Meer geboren war. Noch Monate danach hatte ihn Bosch damit aufgezogen, dass er bei der Schaukelei seekrank geworden war.
»Liegt die Llaüt von Castro hier im Hafen?«
Pastor schüttelte den Kopf. »Hier nicht, aber in der Cala Gamba. Ist nicht weit. Kann ich euch zeigen. Ich war ein paarmal mit Toni dort. Haben an Bord seiner ›Pilar‹ ein paar Bierchen gezischt.« Er schluckte. »Ist gar nicht so lange her, dass wir zusammengesessen haben.«
Ribera schaute auf seine Uhr. »Wo bleibt eigentlich die Rechtsmedizin? Ist die überhaupt verständigt?«
Blum nickte bestätigend. Danach gab Ribera den Hafenpolizisten Anweisung, die Zone rund um den Kai abzusperren. Blum sollte noch einmal die beiden Männer vom Müllboot nach Details befragen.
Er selbst machte sich mit Pastor auf den Weg zur Cala Gamba. Ihm kam seine kürzliche unselige Joggingrunde in den Sinn. Skeptischer Blick zum Himmel. Keine bedrohlichen Wolken zu sehen. Noch etwas anderes beschäftigte ihn. Ob der Tote im Müllboot wirklich ein Opfer der Gota fría war? Gut möglich. Andererseits konnte er sich nicht vorstellen, dass ein erfahrener Fischer, auch wenn er das Fischen nur als Hobby betrieb, die Vorzeichen eines Unwetters nicht mitbekam, geschweige denn die Warnungen des Wetterdienstes missachtete und dann nicht schnell den nächsten Hafen ansteuerte oder überhaupt auslief.
6
Palma, Stadtteil El Camp d’en Serralta. Quique Montoyas Laune war im Keller. Eigentlich den ganzen Nachmittag schon, nachdem ihm seine Kollegin die Geschichte mit der Leiche im Hafen vor der Nase weggeschnappt hatte. Und das nur, weil er zu dem Zeitpunkt, als die Nachricht eintrudelte, auf einen Sprung in der Bar gegenüber der Jefatura gewesen war. Danach hatte er nur noch im Büro herumgesessen und sich bei öder Schreibtischarbeit gelangweilt. Nun wollte er wenigstens etwas früher in den Feierabend gehen, um einmal rechtzeitig zur Probe seiner Band zu kommen, als das Telefon klingelte. Wenige Minuten später knallte er wütend den Hörer auf die Gabel und fluchte laut vor sich hin. Und das so vernehmbar, dass die Sekretärin der Mordkommission aus dem Sekretariat auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs herüberkam, um nach dem Rechten zu sehen.
Mit sorgenvoller Miene stand Penelope Roca nun im Türrahmen des Büros, das sich Quique mit seiner Kollegin Cristina Blum teilte. »Ist was passiert?«
Quique winkte genervt ab. »Disculpa, Penelope. Nur ein lästiger Anruf. Irgendeine Verkehrstote, die in der Pampa im Gebüsch gefunden wurde. Und wer darf wieder mal hinfahren, nur um festzustellen, dass es sich um einen normalen Verkehrsunfall handelt? Dreimal darfst du raten. Wer zieht überhaupt immer die Arschkarte in dieser Abteilung?« Er klopfte mit einem Kugelschreiber auf die Schreibtischoberfläche. »Das kann doch alles kein Zufall sein.« Er blickte zum Fenster hinaus Richtung Himmel. »Man könnte fast glauben, dass mich irgendwer da oben auf dem Kieker hat und mich triggert.«
Er lehnte sich im Stuhl zurück und betrachtete die Frau mit den kurzen dunklen Haaren, die durchsetzt waren mit gebleichten Strähnen. Er erwartete irgendeine Art der Bestätigung ihrerseits. Stattdessen zeichnete sich auf ihrem Gesicht ein süffisantes Grinsen ab.
»Hey, Roca, ich weiß, was du denkst. Das ist nur wieder einer dieser Ausraster des verrückten Quique. Genauso schnell vorbei, wie er gekommen ist.« Er hob die Hand, formte mit den Fingern einen Schnabel und klappte sie wieder auseinander. »Puff, verdampft wie ein mallorquinischer Regen im Sommer.« Plötzlich fiel ihm etwas ein. »Hattest du eigentlich Urlaub? Kann mich nicht erinnern, dich in den letzten Tagen hier gesehen zu haben.«
Dieses Mal war es Roca, die abwinkte. »Kaum der Rede wert. Ich war nur drei Wochen weg.« Sie machte Anstalten, zu gehen, drehte sich aber noch einmal um und schoss eine kleine Spitze ab. »Na dann, viel Spaß in der Pampa. Und bring mir was Schönes mit!«
Quique quittierte es mit säuerlicher Miene, schickte ihr einen Stinkefinger hinterher, den Roca aber nicht mehr wahrnahm, weil sie ihm bereits den Rücken zugekehrt hatte. Er schnappte sich seinen Helm und machte sich auf ins mallorquinische Hinterland.
Auf dem Motorrad schlug er den Weg nach Nordwesten ein. Hinaus aus Palma, Secar de la Real, Establiments, über die Landstraße Ma-1040 bis nach Esporles. Weiter auf die Ma-1100 ein Stück Richtung Tramuntana-Gebirge. Quique war ein routinierter Motorradfahrer, kannte sich zudem als Einheimischer auf der Insel aus und kam auf der rund zwanzig Kilometer langen Strecke zügig voran.
Okay, das lag auch an seinem heutigen Fahrstil. Das Herumfrotzeln mit Penelope Roca hatte seine Bierkutscherlaune nur kurzfristig verdrängt. Kurz nachdem er sich aufs Motorrad geschwungen hatte, war sie zurückgekehrt, nun versuchte er, das durch schnelles Fahren zu kompensieren. Es war aber nicht allein der Einsatz, der ihn herunterzog. Etwas anderes, Grundsätzlicheres nagte an ihm. Und das schon seit Längerem. Der heutige Tag war nur der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten fühlte er sich in der Abteilung wie das fünfte Rad am Wagen. Und er glaubte, auch den Grund dafür zu kennen: Seine Kollegin Cristina Blum hatte ihn überholt, hatte ihn in der Rangordnung ausgestochen. Und das, obwohl sie jünger und kürzer dabei war als er. Das war nicht von heute auf morgen geschehen, sondern ein schleichender Prozess. Dessen Folgen machten sich vor allem darin bemerkbar, dass Blum immer häufiger die sensibleren Aufträge in der Mordkommission bekam, während er der Mann fürs Grobe war, für die Drecksjobs, wie er es empfand, die sonst keiner übernehmen wollte. Eine Art Dauer-Sidekick des Teams. Okay, er musste sich eingestehen, sie war unbestritten ehrgeiziger, karrierebewusster, organisierter als er, hatte auch dank ihrer Sprachkenntnisse Vorteile auf einer multinationalen Insel wie Mallorca. Er hingegen war jemand, der mit dem Status quo bisher mehr oder weniger zufrieden gewesen war, der improvisierte, dabei oft irgendeinen Glücksjoker aus dem Ärmel zog, weil er …
»Joder!« Er musste so abrupt abbremsen, dass das Hinterrad des Motorrads ein Stück ausbrach, bevor er zum Stehen kam.
Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Uff, Quique, du hirnverbrannter Idiot, dachte er, um ein Haar hättest du dich selbst für deine Verhältnisse verdammt schräg von diesem Planeten verabschiedet. Genauer gesagt wäre er fast in einen Leichenwagen gerast, der in einer Kurve am Straßenrand geparkt hatte. »Empresa Funeraria Municipal«, las er auf der Heckscheibe eines silbergrauen Tesla. Er brach in Lachen aus. »Wahnsinn, per E-Mobilität in die ewigen Jagdgründe transportiert.« In Gedanken malte er sich aus, wie wohl der Nachruf auf ihn ausgesehen hätte. Zumindest in diesem Punkt hätte Cristina Blum ihm nicht das Wasser reichen können.
Plötzlich schreckte er zusammen, weil ein Polizist vor ihm aufgetaucht war und ihn argwöhnisch musterte. Er wuchtete das Motorrad auf den Ständer und nahm den Helm ab.
Im Gesicht des Polizisten blitzte Erkennen auf. »Sieh an, Señor Montoya gibt uns die Ehre. Und sogar mit rustikalem Auftritt.« Offenbar hatte er den Beinahe-Unfall mitbekommen. Er hob die Arme und hielt die Hände in kurzem Abstand parallel zueinander nach vorn. »Das war knapp.«
Nun erkannte auch Quique sein Gegenüber. Ein Kollege der Lokalpolizei, den er bereits bei einem früheren Einsatz getroffen hatte. Er zuckte nur mit den Schultern und machte eine Kopfbewegung in Richtung der Fahrzeuge, die sich an der unübersichtlichen Stelle ballten. »Ganz schöner Auflauf wegen einer Unfalltoten.«
Neben dem Leichenwagen und der Lokalpolizei waren die Guardia Civil, ein gelb-roter Wagen des öffentlichen Rettungsdienstes SAMU und ein Notarzt vor Ort. Womöglich hatte er sich ja getäuscht und die Sache war doch wichtiger als angenommen, überlegte er, während sie ein Stück bergauf gingen. Vielleicht bot sich die Chance, zu beweisen, dass er, der als Chaot verschriene Quique, durchaus zu seriöser, strukturierter Polizeiarbeit fähig war. Doch der Anblick, der sich ihm kurz darauf im Straßengraben zwischen einer Pinie und halbhohem dichtem Gestrüpp bot, ließ seine persönlichen Probleme null und nichtig erscheinen und ihm das Blut in den Adern gefrieren.
7
Cala Gamba. Der Club Nautico Cala Gamba lag am Rand des Küstenvororts Coll d’en Rabassa, nur wenige Autominuten östlich des Hafens von Palma. Was Größe und Atmosphäre betraf, hätten die Unterschiede zwischen den beiden Anlagen jedoch kaum größer sein können. Im Gegensatz zu seinem Pendant in der Balearen-Metropole war die Cala Gamba eine überschaubare Welt. Wesentlich intimer, volkstümlicher, weniger mondänes Flair, weniger Schickimicki. Auch wenn dort ebenfalls die eine oder andere Yacht ankerte, die für Riberas finanzielle Möglichkeiten etwa so weit entfernt war wie sein verblichener Seat Ibiza von einem Lamborghini. Nur einmal pro Jahr rückte die Schiffsanlegestelle in den Fokus der Aufmerksamkeit. Verantwortlich dafür waren drei Promis, die regelmäßig in der Cala Gamba aufschlugen und für einen medialen Ansturm und enormen Menschenauflauf sorgten. Keine aktuellen Stars und Sternchen des Showbusiness, sondern die Heiligen Drei Könige, die am Abend des 5. Januar per Schiff landeten. Standesgemäß für eine Insel, auf der am 6. Januar wie im restlichen Land der Höhepunkt der spanischen Weihnacht gefeiert wurde.
Pastor wartete neben einem zweistöckigen weißen Gebäude, das den Eingang zum Areal des Club Nautico bildete, schon auf Ribera. Er war hier offenbar kein Unbekannter.
»Hola, Joan, auch wieder mal hier?«, grüßte ihn ein Mann in kurzen Hosen und T-Shirt, der gerade dabei war, einen Lieferwagen zu entladen.
»Wir wollen zum Boot von Toni, weißt du, ob es da ist?«
»Keine Ahnung. Den habe ich schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Du kennst ja seinen Platz.«
Sie marschierten zu einer der drei Anlegestellen, an denen die Boote wie weiße Zähne aneinandergereiht im Wasser lagen. Am heutigen Tag war das Gebiss unvollständig.
»Da müsste die ›Pilar‹ sein.« Pastor wies auf eine klaffende Lücke zwischen zwei kleineren Booten. Sie sprang Ribera geradezu an.
Sein Begleiter war indessen kreidebleich geworden. Als hätte der Tod seines Freundes mit dem Fehlen des Boots nachträglich eine zusätzliche, nun auch offizielle Bestätigung erfahren. Er schüttelte den Kopf, als würde er das Geschehen erst jetzt richtig begreifen.
Ein Moment des Schweigens trat ein, begleitet vom klackenden Geräusch der Stahlseile, die gegen die Masten der Segelboote schlugen. Plötzlich ein Dröhnen am Himmel. Die beiden Männer blickten nach oben. Ein Passagierflugzeug flog über sie hinweg aufs offene Meer hinaus, fast zum Greifen nah. Von unten sah es aus wie der Bauch eines riesigen Wals, dachte Ribera. Nur dass der statt Krill, seiner üblichen Nahrung, Touristen geschluckt hatte, die in ihre Heimat zurückbefördert wurden. Das Spektakel war nicht neu für ihn. Der Flughafen Son Sant Joan lag um die Ecke, die Cala Gamba befand sich in der Abflugschneise. Er kannte die Gegend durch seine Freundin Núria Oliver, die in Coll d’en Rabassa wohnte. Des Öfteren waren sie abends oder am Wochenende an den Strand gegangen. Und manchmal waren sie auf dem schmalen, geschwungenen Pfad flaniert, der direkt an der Küste entlang zu einem karstigen Felsplateau oberhalb der Cala Gamba führte. Von dort aus hatten sie die Aussicht auf die weitläufige Bucht von Palma und das Tramuntana-Gebirge im Westen genossen.
Ribera wendete sich wieder Pastor zu, der sich durch die Ablenkung von oben gefangen zu haben schien. »Wie kommt es, dass Toni Castro sein Schiff hier hatte, wohnt er in der Nähe?«
»In Can Pastilla.« Pastor deutete in Richtung des östlichen Viertels von Palma. »Er hat dort ein kleines Haus zusammen mit seiner Frau. Ich war nur ein Mal bei ihm zu Hause, ansonsten haben wir uns immer im Hafen oder irgendwo draußen beim Fischen getroffen.«
»Wie gut kannten Sie ihn?«
Pastor kratzte sich den Dreitagebart und verzog das Gesicht. »Ich sag mal so: Wir haben uns ganz gut verstanden, wenn es ums Fischen ging. So ein Hobby verbindet halt. Aber kennen, ich weiß nicht. Toni war nicht gerade der einfachste Mensch, war mein Eindruck.«
»Inwiefern?«
»Na ja.« Pastor zögerte, schien um Worte zu ringen. »Radikaler Umweltschützer halt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin auch für Umweltschutz, aber manche von diesen Ökos können verdammt nervig sein. Toni besonders. Hat für irgend so ein mallorquinisches Forschungsinstitut gearbeitet und bei allen möglichen Leuten verschissen. Aber am besten, Sie fragen jemanden von der Organisation. Denen ist er auch ganz schön auf den Sack gegangen, habe ich mal gehört.«
Ein weiteres Flugzeug donnerte über sie hinweg. Ribera blickte ihm kurz nach, bis es eine Schleife zog und Richtung Norden weiterflog. »Halten Sie es für möglich, dass er trotz der Gota fría hinausgefahren ist?«
Pastor scharrte mit dem Fuß auf dem Boden. »Na ja, Tonis Motto war immer: Je schlechter das Wetter, desto mehr Fische am Haken. Aber ganz ehrlich, ich würde nicht rausfahren, wenn eine Gota fría angekündigt ist. Zu riskant, auch wenn du trotz Unwetterwarnungen oft nicht hundertprozentig weißt, wo und wann sie zuschlägt. Und Toni mag eigen und stur gewesen sein, aber lebensmüde war er nicht.«
Ribera runzelte die Stirn. »Wir werden sehen. Halten Sie sich zur Verfügung, falls wir weitere Fragen haben.«
Er notierte die Telefonnummer, bevor er sich verabschiedete. Auf dem Weg nach draußen gingen ihm mehrere Gedanken durch den Kopf. Was, wenn Pastor recht hatte mit seiner Einschätzung? Andererseits konnte der sich täuschen und Castro ein Opfer seiner Leichtsinnigkeit geworden sein. Erfahrung war keine hundertprozentige Garantie gegen persönliche Tragödien.
Er horchte in sich hinein, wie er das oft tat, um ein Gespür für einen Fall zu bekommen. Und das hatte ihn in der Vergangenheit selten getrogen. Nichts, Stille. Bis auf eine leise, skeptische Stimme tief in seinem Inneren, die ihm zugleich sagte, dass er schlechthin zu wenig wusste – von Castro, von den Umständen seines Todes, überhaupt von allem. Er wählte die Nummer der Küstenwache und veranlasste, dass die Kollegen die Bucht von Palma nach dem Boot von Castro absuchten.