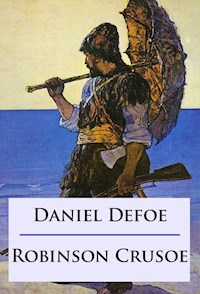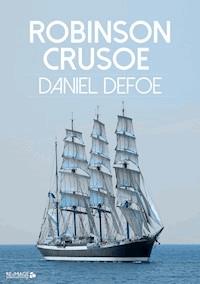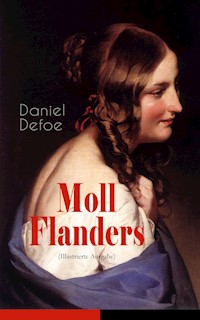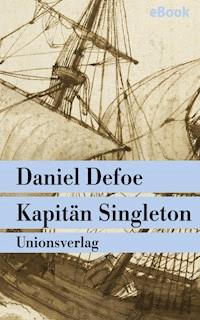
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit Daniel Defoe, so vermutet man, im Mittelmeer selbst in die Gefangenschaft von Piraten geriet, ließ ihn die Welt der Seeräuber nicht mehr los. Er besuchte und interviewte sie in den Gefängnissen, verfolgte ihre Prozesse und recherchierte fasziniert ein Leben lang ihre geheimnisvolle Welt. In diesem Roman lässt er Bob Singleton sein abenteuerliches Leben selbst erzählen: In frühester Kindheit von einer Zigeunerin entführt, kommt er als Elfjähriger zur Seefahrt, wird Anführer einer verwegenen Schar, die man wegen Meuterei auf Madagaskar aussetzt. Nun beginnt eine atemberaubende Kette von verwegenen Abenteuern. Ein fesselnder Roman und gleichzeitig eine Sozialgeschichte seiner Zeit. Ein vergessener Klassiker vom »Begründer des englischen Romans«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Seit Daniel Defoe selbst in die Gefangenschaft von Piraten geriet, ließ ihn die Welt der Seeräuber nicht mehr los. In diesem Roman lässt er Bob Singleton sein abenteuerliches Leben erzählen: Der gefürchtete Korsare häuft Schätze sonder Zahl an – und wird zuletzt wieder ein angesehener Kaufmann, der sein Geheimnis vor der Welt verbirgt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Daniel Defoe, geboren Anfang der 1660er-Jahre, war Schriftsteller, radikaler Aufklärer und Kaufmann. Mit Robinson Crusoe erlangte er Weltruhm. Er starb 1731 in London.
Zur Webseite von Daniel Defoe.
Lore Krüger, geboren 1914 in Magdeburg, war Fotografin, Literaturübersetzerin und Dolmetscherin. Sie übertrug unter anderem Mark Twain, Robert Lewis Stevenson und Joseph Conrad ins Deutsche. Lore Krüger verstarb im März 2009 in Berlin.
Zur Webseite von Lore Krüger.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Daniel Defoe
Kapitän Singleton
Roman
Aus dem Englischen von Lore Krüger
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1720 unter dem Titel The Life, Adventures and Piracies of the Famous Captain Singleton.
Die deutsche Erstausgabe dieser Übersetzung erschien unter dem Titel Das Leben, die Abenteuer und die Piratenzüge des berühmten Kapitän Singleton mit dem Nachwort von Günther Klotz 1980 im Aufbau Verlag, Berlin und Weimar.
Originaltitel: The Life, Adventures and Piracies of the Famous Captain Singleton
Übernahme von Übersetzung und Nachwort mit freundlicher Genehmigung © Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 1980, 2008
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Schiff im Sturm. Zeichnung von Claude Lorrain, 1638 (Ausschnitt) © The Trustees of the British Museum
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30864-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 20:19h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KAPITÄN SINGLETON
Ein Bericht, wie Bob Singleton an der Küste …Da es bei großen Persönlichkeiten, deren Leben bemerkenswert …Diese beiden Dinge zusammen begannen bei mir ein …Es dauerte eine Zeitlang, bis wir erfuhren …NachwortMehr über dieses Buch
Über Daniel Defoe
Über Lore Krüger
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Meer
Zum Thema Piraten
Zum Thema Schmöker
Zum Thema Sklaverei
Zum Thema Afrika
Zum Thema Geschichte
Ein Bericht, wie Bob Singleton an der Küste von Madagaskar ausgesetzt wurde und sich dort ansiedelte, nebst einer Beschreibung der Insel und ihrer Bewohner; berichtet des Weiteren von seiner Überfahrt in einem selbst gebauten Boot zum Festland von Afrika und gibt Kunde von den Sitten und Gebräuchen der Einheimischen; erzählt, wie er auf wunderbare Weise vor den Barbaren und wilden Tieren gerettet wurde und wie er bei den Eingeborenen einem Engländer begegnete, der aus London stammte; ferner, welch große Reichtümer er anhäufte und wie er nach England zurückkehrte. Schildert zum Schluss, wie Kapitän Singleton erneut zur See fuhr, mannigfache Abenteuer bestand und Piratenzüge mit dem berühmten Kapitän Avery unternahm.
Da es bei großen Persönlichkeiten, deren Leben bemerkenswert gewesen ist und deren Taten es verdienen, dass man sie für die Nachwelt festhält, üblich ist, viel über ihren Ursprung mitzuteilen und alle Einzelheiten über ihre Familie und die Geschichte ihrer Vorfahren zu berichten, will ich, um methodisch vorzugehen, das Gleiche tun, obwohl ich meinen Stammbaum nur kurz zurückverfolgen kann, wie der Leser sehr bald sehen wird.
Wenn ich der Frau, die man mich lehrte, Mutter zu nennen, glauben darf, wurde ich als ein etwa zweijähriger, sehr gut gekleideter kleiner Knabe von einem Kindermädchen betreut, das mich an einem schönen Sommerabend aufs Feld hinaus gegen Islington brachte, um, wie sie vorgab, den Kleinen an die Luft zu führen; ein zwölf- oder vierzehnjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft begleitete sie. Meine Betreuerin traf – ob nun auf Verabredung oder durch Zufall – einen jungen Burschen, ihren Schatz, wie ich vermute; er nahm sie mit in ein Gasthaus, um ihr ein Getränk und Kuchen vorzusetzen, und während sie sich dort unterhielten, spielte das Mädchen mit mir an der Hand im Garten und vor der Tür – zuweilen in Sicht, zuweilen außer Sicht, ohne sich etwas Böses dabei zu denken.
In diesem Augenblick kam eines jener Frauenzimmer vorbei, die zu jener Art von Leuten gehörte, die sich, wie es scheint, ein Geschäft daraus machten, kleine Kinder verschwinden zu lassen. Das war zur damaligen Zeit ein teuflisches Gewerbe, das sie vor allem dann betrieben, wenn sie sehr gut gekleidete kleine Kinder fanden, oder aber größere, die sie auf die Plantagen verkaufen konnten.
Die Frau, die tat, als spiele sie mit mir und umarme und küsse mich, lockte das Mädchen ziemlich weit von dem Wirtshaus fort, bis sie es schließlich unter einem glaubhaften Vorwand aufforderte, zurückzugehen und der Dienerin zu berichten, wo sie sich mit dem Kind befinde; eine Dame habe sich in den Jungen vernarrt und küsse ihn ab, sie solle sich aber weiter keine Sorgen machen, denn sie seien in der Nähe, und während das Mädchen sich dorthin auf den Weg machte, trug sie mich fort.
Anschließend wurde ich, wie es scheint, an eine Bettlerin, die ein hübsches kleines Kind haben wollte, um Mitleid zu erwecken, verkauft und danach an eine Zigeunerin, unter deren Herrschaft ich bis zum Alter von etwa sechs Jahren blieb. Und diese Frau ließ es mir an nichts fehlen, wenn sie mich auch ständig von einem Ende des Landes zum anderen schleifte, und ich nannte sie Mutter, obwohl sie mir schließlich sagte, dass sie nicht meine Mutter sei, sondern mich für zwölf Shilling einer anderen Frau abgekauft habe; die habe ihr erzählt, wie sie an mich gekommen sei, und ihr erklärt, ich hieße Bob Singleton – nicht Robert, sondern einfach nur Bob, denn anscheinend wussten sie nicht, auf welchen Namen ich getauft war.
Es ist müßig, hier darüber nachzudenken, welche furchtbare Angst das sorglose Kindermädchen, das mich verloren hatte, ausgestanden haben muss, wie meine zu Recht erzürnten Eltern sie wohl behandelt und welches Entsetzen diese empfunden haben mussten bei dem Gedanken, dass man ihr Kind auf eine solche Weise entführt hatte, denn ich erfuhr niemals etwas über die Angelegenheit, außer den Tatsachen, die ich schon berichtet habe, und auch nicht, wer mein Vater und meine Mutter waren, und so hieße es nur, nutzlos vom Thema abzuschweifen, wenn ich hier davon sprechen wollte.
Meine gute Zigeunermutter wurde, zweifellos wegen einiger ihrer würdigen Taten, schließlich gehängt, und da sich dies zu früh ergab, als dass ich bereits das Gewerbe des Herumstrolchens beherrscht hätte, nahm sich die Pfarrgemeinde, in der ich zurückgeblieben war und an die ich mich beim besten Willen nicht erinnern kann, meiner einigermaßen an, denn das Erste, worauf ich mich danach zu besinnen vermag, ist, dass ich eine Pfarrschule besuchte und der Pfarrer der Gemeinde mich zu ermahnen pflegte, ich solle ein braves Kind sein und ich könne, obgleich ich nur ein armer Junge sei, doch zu einem guten Menschen aufwachsen, wenn ich mich an die Bibel hielte und Gott diente.
Ich glaube, ich wurde häufig von einer Ortschaft in die andere geschafft, vielleicht, weil sich die Gemeinden über den letzten Wohnsitz der Frau stritten, die sie für meine Mutter hielten. Ob sie mich nun wegen dieser oder anderer Gründe hin und her schickten, weiß ich nicht, aber die Stadt, in der man mich schließlich behielt, wie sie auch heißen mochte, konnte nicht weit vom Meer entfernt liegen, denn ein Schiffskapitän, der Gefallen an mir fand, nahm mich mit an einen nicht weit von Southampton gelegenen Ort, der, wie ich später erfuhr, Bussleton war, und dort ging ich den Zimmerleuten und Handwerkern, die beauftragt waren, ein Schiff für ihn zu bauen, zur Hand. Als es fertig war, nahm er mich, obgleich ich erst zwölf Jahre alt war, mit auf See, zu einer Fahrt nach Neufundland.
Ich lebte recht gut und gefiel meinem Herrn so, dass er mich seinen Jungen nannte, und ich hätte ihn Vater gerufen, aber das wollte er mir nicht erlauben, denn er hatte eigene Kinder. Ich begleitete ihn auf drei oder vier Fahrten und wuchs zu einem großen, kräftigen Burschen heran; da kaperte uns auf der Heimfahrt von der Neufundlandbank ein algerischer Seeräuber oder ein Kriegsschiff. Das war, wenn meine Berechnung stimmt, um das Jahr 1695, denn selbstverständlich führte ich kein Tagebuch.
Ich war von dem Unglück nicht sehr betroffen, obwohl ich sah, wie die Türken meinen Herrn, nachdem ihn während des Gefechts ein Splitter am Kopf verwundet hatte, sehr grausam behandelten; ich war also nicht sehr davon betroffen, bis sie mich auf irgendeine unglückselige Äußerung hin, die ich, wie ich mich erinnere, darüber machte, dass sie meinen Herrn misshandelten, packten und mir mit einem flachen Stock erbarmungslos auf die Fußsohlen schlugen, sodass ich mehrere Tage lang weder gehen noch stehen konnte.
Mein Glück stand mir jedoch diesmal bei; denn als sie mit unserem Schiff als Beute am Schlepptau auf die Meerenge zu davonsegelten und in Sichtweite des Golfes von Cadiz gelangten, griff ein großes portugiesisches Kriegsschiff den türkischen Seeräuber an, kaperte ihn und brachte ihn nach Lissabon.
Da ich mir über meine Gefangenschaft nicht viel Sorgen gemacht hatte, denn ich begriff die Folgen nicht, die sich bei längerer Dauer daraus ergeben hätten, freute ich mich auch nicht gebührend über meine Befreiung. Freilich war es für mich auch nicht so sehr eine Befreiung, wie sie es unter anderen Umständen gewesen wäre, denn mein Herr, der einzige Freund, den ich auf der Welt hatte, starb in Lissabon an seiner Verwundung, und so war ich fast wieder in meinen Ausgangszustand, nämlich den des Hungerleiders, zurückversetzt, und dazu noch in einem fremden Land, wo ich niemanden kannte und kein Wort der Sprache beherrschte. Es ging mir dort jedoch wider Erwarten besser, denn als nun alle unsere Leute frei waren und gehen konnten, wohin es ihnen beliebte, blieb ich, der ich nicht wusste, wohin ich mich wenden sollte, noch mehrere Tage lang auf dem Schiff, bis mich schließlich einer der Offiziere erblickte und sich erkundigte, was denn dieser junge englische Hund dort tue und warum man ihn nicht an Land gesetzt habe.
Ich hörte ihn und verstand so ziemlich, was er meinte, wenn auch nicht, was er sagte, und begann mich sehr zu fürchten, denn ich wusste nicht, woher ich ein Stück Brot nehmen sollte; da kam der Steuermann des Schiffs, ein alter Seebär, der sah, wie trübselig ich war, auf mich zu, sprach mich in gebrochenem Englisch an und erklärte mir, ich müsse von dort fortgehen. »Wohin muss ich denn gehen?«, fragte ich. »Wohin du willst«, sagte er, »nach Hause in dein Land, wenn du willst.« – »Wie soll ich denn dorthin kommen?«, erwiderte ich. »Wieso, hast du keine Freunde?«, sagte er. »Nein«, antwortete ich, »auf der ganzen Welt nur diesen Hund dort«, und ich zeigte auf den Schiffshund (der kurz zuvor ein Stück Fleisch gestohlen und in meine Nähe geschleppt hatte; ich hatte es genommen und gegessen), »denn er hat sich als guter Freund gezeigt und mir mein Essen gebracht.«
»So, so«, sagte er, »dein Essen musst du freilich haben. Willst du mit mir gehen?« – »Ja«, erwiderte ich, »von Herzen gern.« Kurz, der alte Steuermann nahm mich mit sich nach Hause und behandelte mich ziemlich gut, wenn mein Schicksal auch recht hart war, und ich lebte ungefähr zwei Jahre bei ihm. Während der Zeit bewarb er sich um einen Posten in seinem Beruf und wurde schließlich Erster Steuermann unter Don Garcia de Pimentesia de Carravallas, dem Kapitän einer portugiesischen Galione oder Karake, die nach Goa in Ostindien fuhr, und sobald er sein Patent erhalten hatte, brachte er mich an Bord, damit ich seine Kabine in Ordnung hielt, in der er sich mit reichlich alkoholischen Getränken, Süßigkeiten, Zucker, Gewürzen und anderen Dingen als Annehmlichkeiten für seine Reise eingerichtet hatte, und später brachte er darin eine beträchtliche Menge europäischer Waren unter, feine Spitzen und Leinen sowie auch Flanell, Wollstoffe, Tuche und dergleichen, unter dem Vorwand, es sei zu seiner Bekleidung.
Ich war zu neu im Fach, um ein Logbuch von dieser Reise zu führen, obwohl mein Herr, der für einen Portugiesen ein beträchtlicher Könner war, mich dazu anregte; aber die Tatsache, dass ich die Sprache nicht verstand, war ein Hindernis, zumindest diente sie mir als Entschuldigung. Nach einiger Zeit begann ich mir jedoch seine Tabellen und Bücher anzusehen, und da ich eine ganz ordentliche Handschrift hatte, etwas Latein verstand und anfing, mir einige Grundkenntnisse der portugiesischen Sprache anzueignen, begann ich auch, ein oberflächliches Wissen der Navigation zu erlangen, das jedoch nicht genügte, um mich durch ein Abenteurerleben zu steuern, wie das meine es werden sollte. Kurz, ich lernte bei dieser Reise unter den Portugiesen einige wesentliche Dinge; vor allem lernte ich, ein durchtriebener Dieb und ein schlechter Seemann zu sein, und ich glaube, ich kann sagen, dass sie unter allen Völkern der Welt für beides die geeignetsten Lehrer sind.
Wir fuhren nach Ostindien, entlang der Küste von Brasilien – nicht als hätte sie auf unserer Segelroute gelegen, aber unser Kapitän fuhr – entweder auf eigenen Wunsch oder auf Anordnung der Kaufherren – zuerst dorthin, und wir löschten in der Allerheiligenbai oder am Rio de Todos los Santos, wie sie sie in Portugal nennen, fast hundert Tonnen Waren und luden eine beachtliche Menge Gold sowie einige Kisten Zucker und siebzig oder achtzig große Ballen Tabak, von denen jeder mindestens einen Zentner wog.
Hier wohnte ich auf Befehl meines Herrn an Land und versah die Geschäfte des Kapitäns, denn er hatte gesehen, dass ich für meinen Herrn sehr eifrig tätig war, und als Entgelt für sein unangebrachtes Vertrauen fand ich Gelegenheit, von dem Gold, das die Händler an Bord sandten, etwa zwanzig Moidors beiseitezubringen, das heißt zu stehlen, und dies war mein erstes Abenteuer.
Von dort zum Kap der Guten Hoffnung hatten wir eine ganz erträgliche Fahrt, und ich stand im Ruf, meinem Herrn ein sehr emsiger und sehr treu ergebener Diener zu sein. Emsig war ich wirklich, aber keineswegs ehrlich, dafür hielten sie mich aber, und das war, nebenbei gesagt, ihr großer Irrtum. Aufgrund ebendieses Irrtums fand ich die besondere Zuneigung des Kapitäns, und er beauftragte mich häufig mit seinen eigenen Geschäften; zur Belohnung meines rührigen Fleißes erwies er mir mehrmals Gunstbezeigungen. So wurde ich ausdrücklich auf Befehl des Kapitäns zu einer Art Steward ernannt, der dem Schiffssteward unterstand, und war zuständig für die Verpflegung, die der Kapitän für seinen eigenen Tisch forderte. Er hatte außerdem noch einen zweiten Steward für seine privaten Vorräte; mein Amt betraf jedoch nur das, was der Kapitän von den Schiffsvorräten für seine private Benutzung entnahm.
Auf diese Weise hatte ich aber Gelegenheit, den Diener meines Herrn besonders gut zu betreuen und mich mit genügend Proviant zu versorgen, um besser zu leben als die übrigen Leute auf dem Schiff, denn der Kapitän bestellte, wie oben erwähnt, nur selten etwas aus den Schiffsvorräten, ich zweigte davon jedoch einiges für meinen eigenen Gebrauch ab. Wir gelangten etwa sieben Monate nach unserer Abfahrt von Lissabon nach Goa in Ostindien und lagen dort acht weitere Monate. Während dieser Zeit hatte ich, da mein Herr meistens an Land war, tatsächlich nichts weiter zu tun, als nur alles zu lernen, was es Schlechtes bei den Portugiesen gibt, einem Volk, welches das hinterlistigste und verderbteste, das anmaßendste und grausamste von allen Völkern der Welt ist, die vorgeben, Christen zu sein.
Stehlen, Lügen, Fluchen und Meineide schwören, zusammen mit der abscheulichsten Unzüchtigkeit, gehörten zu den regelmäßigen Gewohnheiten der Schiffsmannschaft; dazu kam, dass die Leute die unerträglichsten Prahlereien über ihren eigenen Mut von sich gaben und dabei im Allgemeinen die größten Feiglinge waren, denen ich je begegnet bin. Die Folgen ihrer Feigheit wurden bei vielen Anlässen sichtbar. Einer oder der andere aus der Mannschaft war jedoch nicht ganz so schlimm wie die Übrigen, und da mich mein Geschick unter jene gestellt hatte, empfand ich in Gedanken die größte Verachtung für die Übrigen, die sie auch verdienten.
Ich passte wahrhaftig genau in ihre Gesellschaft, denn ich besaß keinerlei Sinn für Tugend oder Religion. Ich hatte von beiden nicht viel gehört, außer dem, was ein guter alter Pastor mir gesagt hatte, als ich ein acht- oder neunjähriges Kind war – ja, ich war auf dem besten Wege, rasch zu einem Menschen aufzuwachsen, der so verrucht war, wie er nur sein konnte oder wie es vielleicht nur je einen gegeben hat. Das Schicksal lenkte zweifellos auf diese Weise meine ersten Schritte in dem Wissen, dass ich Arbeit auf der Welt zu verrichten hatte, die nur jemand ausführen konnte, der gegen jeden Sinn für Ehrlichkeit oder Religion verhärtet war. Trotzdem aber empfand ich sogar in diesem ursprünglichen Zustand der Sündhaftigkeit einen so entschiedenen Abscheu vor der verworfenen Niedertracht der Portugiesen, dass ich sie von Anfang an und auch danach mein ganzes Leben lang nur von Herzen zu hassen vermochte. Sie waren so viehisch gemein, so niedrig und heimtückisch, nicht nur Fremden, sondern auch einander gegenüber, so schäbig unterwürfig, wenn sie die Untergebenen, und so unverschämt oder roh und tyrannisch, wenn sie die Vorgesetzten waren, dass ich dachte, sie hätten etwas an sich, was meine ganze Natur empörte. Dazu kommt, dass es für einen Engländer natürlich ist, Feiglinge zu hassen – all das trug dazu bei, dass ich gegen einen Portugiesen die gleiche Abneigung wie gegen den Teufel empfand.
Wer aber, wie das englische Sprichwort sagt, mit dem Teufel an Bord geht, muss mit ihm segeln; ich befand mich unter ihnen und richtete mich ein, so gut ich konnte. Mein Herr hatte sich damit einverstanden erklärt, dass ich dem Kapitän, wie oben beschrieben, in der Speisekammer zur Hand ging, aber da ich später erfuhr, dass dieser ihm monatlich einen halben Moidor für meine Dienste zahlte und meinen Namen auch in der Musterrolle verzeichnet hatte, erwartete ich, dass mein Herr, wenn die Mannschaft in Indien die Heuer für vier Monate ausgezahlt erhielte, wie es anscheinend üblich ist, mir etwas davon überlassen würde.
Da hatte ich mich jedoch in meinem Mann getäuscht, denn zu der Art gehörte er nicht; er hatte mich in einer Notlage aufgelesen, und sein Anliegen war, mich darin zu halten und so viel er nur konnte an mir zu verdienen. Ich begann anders darüber zu denken als zuerst, denn zu Beginn hatte ich geglaubt, er unterhalte mich aus reiner Barmherzigkeit, da er meine elende Lage sah, und als er mich an Bord brachte, zweifelte ich nicht daran, dass ich für meine Dienste einen Lohn erhalten solle.
Er war jedoch anscheinend ganz anderer Meinung darüber, und nachdem ich jemand bewogen hatte, in Goa, als die Mannschaft ausbezahlt wurde, mit ihm darüber zu sprechen, geriet er in größte Wut, nannte mich einen englischen Hund, einen jungen Ketzer und drohte, mich vor die Inquisition zu bringen. Von all den Namen, die sich mit vierundzwanzig Buchstaben zusammenstellen lassen, hätte er mich wirklich keinen Ketzer nennen dürfen, denn weil ich über die Religion nichts wusste und weder die protestantische von der papistischen noch jede der beiden von der mohammedanischen zu unterscheiden vermöchte, konnte ich niemals ein Ketzer sein. Ich entging jedoch, so jung ich war, nur mit knapper Not einer Ladung vor die Inquisition, und hätte man mich dort gefragt, ob ich Protestant oder Katholik sei, hätte ich das Erste, was sie erwähnten, bejaht. Wenn sie zuerst nach dem Protestanten gefragt hätten, wäre ich gewiss zum Märtyrer für etwas geworden, was ich gar nicht kannte.
Aber gerade der Priester oder Schiffskaplan, wie wir ihn nennen, den sie auf dem Schiff mitführten, rettete mich; da er sah, dass ich ein in der Religion völlig unwissender Junge und bereit war, alles zu tun oder zu sagen, was man von mir forderte, stellte er mir einige Fragen darüber und fand, ich beantwortete sie so naiv, dass er es auf sich nahm, ihnen zu erklären, er verbürge sich dafür, dass ich ein guter Katholik sein werde, und hoffe, er würde zum Werkzeug der Rettung meiner Seele. Es gefiel ihm, dass dies für ihn eine verdienstvolle Aufgabe war, und so machte er innerhalb einer Woche einen so guten Papisten aus mir, wie es kaum einer von ihnen war. Nun berichtete ich ihm von meiner Sache mit meinem Herrn; es stimme zwar, dass er mich in einer elenden Lage an Bord eines Kriegsschiffs in Lissabon aufgelesen habe und ich ihm Dank schuldig sei, weil er mich hier an Bord gebracht habe, denn wenn ich in Lissabon geblieben wäre, hätte ich vielleicht verhungern müssen oder etwas Ähnliches; deshalb sei ich willens, ihm zu dienen, hätte jedoch gehofft, er werde mir irgendeine kleine Entlohnung dafür geben oder mich wissen lassen, wie lange er erwartete, dass ich ihm unentgeltlich diente.
Es nützte nichts, weder der Priester noch sonst jemand vermochte ihn davon abzubringen, dass ich nicht sein Diener, sondern sein Sklave sei; er habe mich auf dem algerischen Schiff aufgelesen und ich sei ein Türke, der nur vorgab, ein englischer Knabe zu sein, um meine Freiheit zu erhalten, er werde mich als Türken vor die Inquisition bringen.
Das erschreckte mich maßlos, denn ich hatte niemanden, der bezeugen konnte, wer ich war und woher ich kam; aber der gute Padre Antonio, denn so hieß er, befreite mich auf eine Weise, die ich nicht verstand, von dieser Anklage, denn eines Morgens kam er mit zwei Matrosen zu mir und erklärte mir, sie müssten mich untersuchen, um zu bezeugen, dass ich kein Türke sei. Ich war erstaunt über sie und verängstigt; ich verstand sie nicht und konnte mir auch nicht vorstellen, was sie mit mir zu tun beabsichtigten. Nachdem sie mich nackt ausgezogen hatten, waren sie jedoch bald zufriedengestellt, und Padre Antonio forderte mich auf, guten Muts zu sein, sie könnten alle bezeugen, dass ich kein Türke war. So entging ich diesem Teil der Grausamkeit meines Herrn.
Von da an beschloss ich, ihm davonzurennen, sobald ich konnte, dort aber war dies nicht möglich, denn in jenem Hafen lagen keine Schiffe, gleich welcher Nationalität der Welt, außer zwei, drei persischen Fahrzeugen aus Hormus, und hätte ich es unternommen, von ihm fortzulaufen, dann hätte er mich an Land ergreifen und gewaltsam wieder an Bord bringen lassen, sodass mir nichts übrig blieb, als nur Geduld zu üben. Und auch die war bald erschöpft, denn danach begann er mich schlecht zu behandeln und nicht nur meine Essensrationen zu kürzen, sondern mich auch auf barbarische Weise wegen jeder Kleinigkeit zu schlagen und zu quälen, sodass mein Leben, mit einem Wort, erbärmlich war.
Weil er mich so gewalttätig behandelte und ich aus seinen Händen nicht zu entkommen vermochte, begann ich mir alle möglichen Untaten auszudenken; insbesondere beschloss ich, nachdem ich sämtliche anderen Wege meiner Befreiung überdacht und festgestellt hatte, dass sie nicht gangbar waren, ihn zu ermorden. Mit diesem teuflischen Plan im Kopf verbrachte ich ganze Tage und Nächte damit, mir zu überlegen, wie ich ihn ausführen sollte, und der Satan flüsterte mir dabei sehr eifrig zu. Ich war mir freilich über das Mittel gänzlich im Unklaren, denn ich besaß weder eine Flinte noch ein Schwert, noch sonst irgendeine Waffe, um ihn damit anzugreifen; meine Gedanken kreisten viel um Gift, ich wusste aber nicht; wo ich es mir beschaffen sollte, oder wenn ich es hätte bekommen können, wusste ich nicht, wie es hierzulande hieß und unter welcher Bezeichnung ich danach fragen sollte.
Auf diese Weise verübte ich die Tat hundert- und aberhundertmal in Gedanken. Das Schicksal vereitelte meine Absicht jedoch, entweder zu seinem oder zu meinem Wohl, und ich vermochte sie nicht auszuführen; deshalb war ich gezwungen, in seinen Ketten zu bleiben, bis das Schiff, nachdem es seine Fracht an Bord genommen hatte, nach Portugal in See stach.
Ich vermag hier nichts darüber zu sagen, wie unsere Reise verlief, denn ich führte, wie gesagt, kein Logbuch; ich kann aber berichten, dass wir, nachdem wir einmal auf die Höhe des Kaps der Guten Hoffnung, wie wir es nennen, oder des Cabo de Bona Speranza, wie sie es bezeichnen, gelangt waren, von einem heftigen Sturm aus Westsüdwest wieder zurückgetrieben wurden. Er hielt uns sechs Tage und sechs Nächte lang weit östlich fest; danach segelten wir ein paar Tage vor dem Wind und gingen schließlich bei der Küste von Madagaskar vor Anker.
Der Sturm hatte mit solcher Gewalt getobt, dass das Schiff sehr beschädigt war, und wir benötigten einige Zeit, um es wieder instand zu setzen; deshalb brachte der Steuermann, mein Herr, das Fahrzeug in größere Nähe der Küste und in einen sehr guten Hafen, wo wir in sechsundzwanzig Faden Wassertiefe etwa eine halbe Meile vom Ufer entfernt lagen.
Während sich das Schiff hier befand, ereignete sich eine verzweifelte Meuterei unter der Mannschaft wegen einiger Mängel in ihrer Verpflegung; sie ging so weit, dass die Leute dem Kapitän drohten, sie wollten ihn an Land setzen und mit dem Schiff zurück nach Goa fahren. Ich wünschte von ganzem Herzen, dass sie es täten, denn mein Kopf war voller Bosheit, und ich war durchaus bereit, sie auch in die Tat umzusetzen. Und obgleich ich nur ein Junge war, wie sie mich nannten, förderte ich doch den bösen Plan nach Kräften und ließ mich so offen darauf ein, dass ich im ersten und frühesten Abschnitt meines Lebens dem Gehängtwerden nur knapp entging, denn dem Kapitän kam zu Ohren, dass einige aus der Bande die Absicht hatten, ihn zu ermorden, und nachdem er teils durch Geld und Versprechungen, teils durch Drohungen und Folter zwei der Burschen dazu gebracht hatte, die Einzelheiten zu bekennen und die Namen der Betreffenden zu nennen, wurden sie bald gefangen gesetzt, und nachdem einer den anderen beschuldigt hatte, wurden nicht weniger als sechzehn Mann in Gewahrsam genommen und in Eisen gelegt, darunter auch ich.
Der Kapitän, den die Gefahr, in der er schwebte, zum Äußersten getrieben hatte, beschloss, das Schiff von seinen Feinden zu säubern; er hielt über uns Gericht, und wir wurden alle zum Tode verurteilt. Ich war zu jung, um die Verfahrensweise dieses Prozesses zur Kenntnis zu nehmen, aber der Proviantmeister und einer der Geschützmeister wurden sofort gehängt, und ich erwartete mit den Übrigen das Gleiche. Ich erinnere mich nicht, dass es mich stark betroffen hätte, nur, dass ich sehr weinte, denn ich wusste damals wenig von dieser Welt und gar nichts von der nächsten.
Der Kapitän gab sich jedoch damit zufrieden, diese beiden hinrichten zu lassen, und einige der Übrigen wurden auf ihre demütige Bitte und das Versprechen hin, sich in Zukunft gut zu betragen, begnadigt; er befahl jedoch, fünf Mann an Land auszusetzen und dort zu lassen, und ich war darunter. Mein Herr machte seinen ganzen Einfluss auf den Kapitän geltend, um Verzeihung für mich zu erwirken, vermochte es jedoch nicht zu erreichen, denn jemand hatte dem Kapitän gesagt, ich sei einer von denen gewesen, die ausgesucht waren, ihn zu töten, und als mein Herr bat, man möge mich nicht an Land aussetzen, erklärte ihm der Kapitän, ich solle an Bord bleiben, wenn er es wünsche, dann aber würde ich gehängt; er möge also wählen, was er für besser halte. Anscheinend war der Kapitän besonders darüber aufgebracht, dass ich an dem Verrat beteiligt war, weil er sich mir gegenüber so gütig gezeigt und mich ausgesucht hatte, ihn zu bedienen, wie ich bereits erwähnte; vielleicht war dies der Grund, weshalb er meinen Herrn vor eine so harte Wahl stellte, mich entweder an Land aussetzen oder aber an Bord hängen zu lassen. Und hätte mein Herr gewusst, welches Wohlwollen ich für ihn empfand, dann hätte er nicht lange gezögert, die Wahl für mich zu treffen, denn ich war fest entschlossen, ihm bei der ersten Gelegenheit, die sich bot, etwas Böses anzutun. Deshalb war es eine gute Fügung des Schicksals, die mich daran hinderte, meine Hände in Blut zu tauchen, und sie machte mich danach weichherziger in Dingen, die Blut betrafen, als ich es, wie ich glaube, sonst gewesen wäre. Was aber die Anklage anging, ich sei einer von denen gewesen, die den Kapitän hatten töten sollen, so geschah mir damit Unrecht, denn nicht ich war es, sondern einer von denen, die begnadigt wurden, und er hatte das Glück, dass diese Tatsache nie ans Licht kam.
Ich sollte nun ein unabhängiges Leben führen, worauf ich wirklich sehr schlecht vorbereitet war, denn ich war in meinem Betragen völlig ungehemmt und liederlich, kühn und verworfen, solange ich einen Herrn über mir hatte, und jetzt gänzlich ungeeignet, dass man mich mit meiner Freiheit betraute, denn ich war so reif für irgendeine Schufterei, wie man es bei einem jungen Burschen, dem nie ein anständiger Gedanke eingepflanzt wurde, nur erwarten konnte. Eine Erziehung hatte ich, wie der Leser bereits weiß, nicht genossen, und all die kleinen Szenen des Daseins, die ich erlebt hatte, waren voller Gefahren und von verzweifelten Umständen begleitet gewesen; ich war jedoch entweder so jung oder so töricht, dass ich dem Schmerz und der Angst, die sie hätten erwecken können, entgangen war, weil mir nicht bewusst war, wohin sie führten und welche Folgen sie haben mussten.
Diese gedankenlose, unbekümmerte Einstellung hatte tatsächlich einen Vorteil, nämlich dass sie mich wagemutig und bereit machte, jeden Frevel zu begehen, und mir den Kummer fernhielt, der mich sonst überwältigt hätte, wenn ich in einen Frevel verfiel; diese meine Torheit bedeutete für mich wirklich ein Glück, denn sie ließ meine Gedanken ledig, sich mit einer Möglichkeit des Entkommens und der Befreiung aus meiner Not zu beschäftigen, so groß diese auch sein mochte, während meine Elendsgenossen von ihrer Furcht und ihrem Kummer derartig niedergedrückt waren, dass sie einzig nur ihre jämmerliche Lage sahen und keinen anderen Gedanken hatten als den, sie müssten umkommen und verhungern, würden von wilden Tieren gefressen, ermordet, vielleicht von Kannibalen verspeist und dergleichen mehr.
Ich war zwar nur ein junger Bursche, vielleicht siebzehn oder achtzehn Jahre alt; als ich aber hörte, welches Schicksal mir zugedacht war, nahm ich es mit keinem Zeichen der Entmutigung auf, sondern fragte nur, wie sich mein Herr dazu geäußert hatte, und als ich erfuhr, dass er seinen ganzen Einfluss geltend gemacht hatte, um mich zu retten, der Kapitän ihm aber geantwortet hatte, ich solle entweder an Land gehen oder an Bord gehängt werden, was immer er vorziehe, gab ich alle Hoffnung auf, dass man mich wieder aufnähme. Ich war meinem Herrn in Gedanken nicht sehr dankbar dafür, dass er sich beim Kapitän für mich verwendet hatte, denn ich wusste: was er tat, geschah nicht aus Güte mir gegenüber, sondern vielmehr aus Eigennutz, nämlich um sich die Heuer zu erhalten, die er für mich bekam und die über sechs Dollar monatlich betrug, inbegriffen die Summe, die der Kapitän ihm für meine persönlichen Dienste bezahlte. Als ich erfuhr, dass mein Herr so scheinbar gütig gewesen war, fragte ich, ob man mir nicht gestatten würde, mit ihm zu sprechen, und erhielt die Antwort, das könne ich, wenn mein Herr zu mir herunterkommen wolle, ich dürfe aber nicht zu ihm hinaufgehen. So äußerte ich also den Wunsch, man möge meinen Herrn bitten, zu mir herunterzukommen, und das tat er. Ich fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, mir zu verzeihen, wenn ich etwas getan hatte, was ihm missfiel, und tatsächlich lastete mir zu dieser Zeit mein Entschluss, ihn zu ermorden, schwer auf dem Gewissen, sodass ich einmal nahe daran war, es zu gestehen und meinen Herrn zu bitten, mir zu vergeben, aber ich behielt es für mich. Er erklärte mir, er habe getan, was er konnte, um meine Begnadigung vom Kapitän zu erwirken, es sei ihm aber nicht gelungen und er wisse keinen anderen Weg für mich als nur, mich mit Ergebenheit in mein Schicksal zu fügen, und falls sie am Kap Gelegenheit hätten, mit Leuten von Schiffen ihrer Nation zu sprechen, wolle er sich bemühen, sie zu bewegen, hier anzulegen und uns wieder fortzuholen, falls man uns finde.
Nun bat ich ihn, meine Kleidung mit an Land nehmen zu dürfen. Er sagte, er befürchte, ich werde wenig Kleidung brauchen, denn er könne sich nicht vorstellen, dass wir auf der Insel lange am Leben zu bleiben vermöchten, man habe ihm berichtet, die Bewohner seien Kannibalen oder Menschenfresser (freilich war diese Behauptung unbegründet), und wir könnten unter ihnen nicht am Leben bleiben. Ich erwiderte, davor hätte ich weniger Angst als vor der Aussicht, aus Mangel an Nahrungsmitteln zu sterben, und was die Tatsache betreffe, dass die Eingeborenen Kannibalen seien, so hielte ich es für wahrscheinlicher, dass wir sie aufäßen als sie uns, wenn wir ihrer nur habhaft werden könnten. Ich machte mir jedoch große Sorgen, so sagte ich, weil wir keine Waffen hätten, um uns zu verteidigen, und ich wolle jetzt nur darum bitten, dass er mir eine Flinte und einen Säbel gebe sowie ein bisschen Pulver und Blei.
Er lächelte und sagte, sie würden uns nichts nützen, denn wir könnten unmöglich erwarten, unser Leben unter einer so zahlreichen und wilden Bevölkerung, wie es die Bewohner der Insel seien, zu behaupten. Ich erklärte, sie würden uns wenigstens den Vorteil verschaffen, dass wir nicht sofort getötet oder aufgefressen würden, und deshalb bäte ich sehr um die Flinte. Endlich erklärte er mir, er wisse nicht, ob ihm der Kapitän genehmigen werde, mir eine Flinte zu geben, wenn nicht, wage er nicht, es zu tun; er versprach aber, sich dafür einzusetzen, dass ich sie erhielte, was er auch tat, und am nächsten Tag schickte er mir eine Flinte mit etwas Munition, teilte mir aber mit, der Kapitän gestatte nicht, dass man uns die Munition aushändigte, bis er uns habe an Land setzen lassen und im Begriff sei auszulaufen. Mein Herr sandte mir auch ein paar Kleidungsstücke, die ich auf dem Schiff besaß, und das waren wirklich nicht viele.
Zwei Tage darauf wurden wir alle zusammen an Land gebracht; als meine Mitverbrecher hörten, dass ich ein Gewehr sowie etwas Pulver und Blei hatte, baten sie um die Erlaubnis, das Gleiche mitnehmen zu dürfen, und erhielten sie. Auf diese Weise wurden wir an Land gesetzt und waren auf uns selbst angewiesen.
Als wir auf die Insel kamen, empfanden wir zuerst heftige Angst beim Anblick der barbarischen Bewohner, die uns schrecklicher erschienen, als sie in Wirklichkeit waren, da wir an die Beschreibung dachten, die uns die Matrosen von ihnen gegeben hatten. Als wir dann aber schließlich eine Weile mit ihnen gesprochen hatten, stellten wir fest, dass sie nicht, wie man uns berichtet hatte, Kannibalen waren und nicht sogleich über uns herfielen, um uns aufzufressen. Sie kamen vielmehr und setzten sich zu uns, bestaunten unsere Kleidung und unsere Waffen sehr und machten Zeichen, sie wollten uns die Nahrungsmittel geben, die sie hatten, und das waren gegenwärtig nur aus dem Boden gegrabene Wurzeln und Pflanzen; später brachten sie uns aber Geflügel und Fleisch in reichlicher Menge.
Dies ermunterte die anderen vier Leute, die bei mir waren und zuvor den Mut hatten sinken lassen, sehr; sie begannen sich recht vertraulich zu den Eingeborenen zu verhalten und gaben ihnen durch Zeichen zu verstehen, dass wir dableiben und bei ihnen wohnen würden, wenn sie uns freundlich behandelten, worüber sie sich zu freuen schienen, denn sie hatten keine Ahnung, dass wir dazu gezwungen waren und wie sehr wir uns vor ihnen fürchteten.
Nach weiteren Überlegungen beschlossen wir jedoch, nur so lange in diesem Teil der Insel zu bleiben, wie das Schiff in der Bucht lag, und sie in dem Glauben zu lassen, wir seien mit ihm fortgefahren; dann wollten wir uns davonmachen und, wenn möglich, einen Ort aufsuchen, wo keine Einwohner zu sehen waren, leben, wie wir konnten, und vielleicht nach einem Schiff Ausschau halten, das wie unseres an die Küste verschlagen würde.
Das Schiff blieb noch vierzehn Tage auf Reede liegen; die Mannschaft besserte einige Schäden aus, die der letzte Sturm verursacht hatte, und nahm Holz sowie Wasser an Bord. Das Boot kam während dieser Zeit häufig an Land, und die Leute brachten uns allerlei Lebensmittel; die Eingeborenen glaubten, wir gehörten zum Schiff, und waren recht höflich. Wir lebten in einer Art Zelt am Strand oder vielmehr in einer Hütte, die wir mit Zweigen von den Bäumen gebaut hatten, und nachts zogen wir uns manchmal vor den Einheimischen in den Wald zurück, damit sie dachten, wir seien an Bord des Schiffs. Wir stellten freilich fest, dass sie von Natur aus recht barbarisch, verräterisch und schuftig und nur aus Furcht höflich waren; daraus schlossen wir, wir würden bald in ihre Hände fallen, wenn das Schiff erst einmal fort war.
Dieses Bewusstsein verfolgte meine Leidensgefährten bis zum Wahnsinn, und einer von ihnen, ein Zimmermann, schwamm eines Nachts in seiner schrecklichen Angst zum Schiff, obwohl es eine Meile weit draußen lag, und bettelte so jämmerlich darum, an Bord zu dürfen, dass der Kapitän sich schließlich bewegen ließ, ihn heraufzunehmen, nachdem sie ihn drei Stunden im Wasser hatten schwimmen lassen, bevor er sich bereitfand.
Nach Ablauf dieser Zeit und auf seine demütige Unterwerfung hin ließ ihn der Kapitän an Bord, weil die Zudringlichkeit dieses Menschen (der lange darum gefleht hatte, dass er wieder aufgenommen würde, und wenn sie ihn auch hängten, sobald sie ihn hätten) so groß war, dass man ihm nicht zu widerstehen vermochte, denn nachdem er so lange rings um das Schiff geschwommen war, hatte er nicht mehr die Kraft, das Ufer zu erreichen, und der Kapitän sah offensichtlich, dass er den Mann an Bord nehmen oder ertrinken lassen müsse, und da die gesamte Mannschaft sich erbot, für sein gutes Verhalten zu bürgen, gab der Kapitän schließlich nach und nahm ihn auf, wenn der Mann auch durch den langen Aufenthalt im Wasser fast tot war.
Als er sich an Bord befand, ließ er nicht nach, den Kapitän und alle übrigen Offiziere unseretwegen, die wir zurückgeblieben waren, zu behelligen, aber: der Kapitän war bis zum letzten Tag unerbittlich. Zum Zeitpunkt, als sie Vorbereitungen trafen, in See zu stechen, und er den Befehl gegeben hatte, die Boote an Bord zu holen, kamen alle Matrosen gemeinsam zur Reling des Achterdecks, wo der Kapitän mit einigen seiner Offiziere auf und ab ging; sie bestimmten den Bootsmann zu ihrem Sprecher, und er trat vor den Kapitän hin, fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn so unterwürfig wie nur möglich an, die vier Leute wieder an Bord zu nehmen. Er sagte, sie alle erböten sich, für ihre Treue zu bürgen oder aber sie in Ketten liegen zu lassen, bis sie Lissabon erreichten und man sie dort der Justiz übergebe, lieber als dass sie dort zurückblieben und, wie sie sagten, durch die Wilden ermordet oder von wilden Tieren aufgefressen würden. Es dauerte lange, bis der Kapitän Notiz von ihnen nahm, dann aber befahl er, den Bootsmann festzunehmen, und drohte, ihn zur Ankerwinde führen zu lassen, weil er für sie gesprochen hatte.
Nach dieser Äußerung der Strenge ersuchte einer der Matrosen, der kühner war als die Übrigen, dabei aber dem Kapitän allen nur möglichen Respekt erwies, Seine Ehren, wie er ihn nannte, er möge doch einigen von ihnen die Erlaubnis geben, an Land zu gehen, damit sie zusammen mit ihren Kameraden sterben oder aber ihnen, wenn möglich, im Widerstand gegen die Barbaren beistehen könnten. Der Kapitän, den dies eher herausforderte als einschüchterte, kam zum Achterdeck und sprach sehr vorsichtig zu den Männern (denn wenn er grob gewesen wäre, hätten zwei Drittel von ihnen, wenn nicht alle, das Schiff verlassen). Er erklärte ihnen, er sei ebenso im Interesse ihrer Sicherheit wie seiner eigenen zu dieser Strenge gezwungen; Meuterei an Bord eines Schiffs sei das Gleiche wie Verrat im Palast eines Königs, und er könne es vor den Schiffseigentümern, die seine Brotgeber seien, nicht verantworten, das ihm anvertraute Schiff und die Waren darauf Leuten zugänglich zu machen, deren Absichten von der schlimmsten und schwärzesten Art gewesen seien. Er wünschte von Herzen, er würde sie anderswo an Land gesetzt haben, wo sie sich vielleicht in geringerer Gefahr vor den Wilden befänden, denn wenn es seine Absicht gewesen wäre, dass sie umkämen, dann hätte er sie ebenso gut wie die beiden anderen an Bord hinrichten lassen können. Er wünschte, sie lägen an irgendeinem anderen Ort der Welt, wo er sie der Zivilgerichtsbarkeit übergeben oder sie unter Christen lassen könnte. Es sei jedoch besser, ihr Leben befinde sich in Gefahr als seins und die Sicherheit des Schiffs; und obgleich er sich dessen nicht bewusst sei, von irgendeinem unter ihnen so Böses verdient zu haben, dass sie lieber das Schiff verlassen als ihre Pflicht tun wollten, werde er doch, falls jemand dazu entschlossen sei, ihn nicht daran hindern, bevor er sich bereit erklärte, eine Bande von Verrätern an Bord zu nehmen, die, wie er vor ihnen allen bewiesen, sich verschworen habe, ihn zu ermorden, noch wolle er ihnen ihre gegenwärtige Zudringlichkeit nachtragen; jedoch, auch wenn er als Einziger auf dem Schiff bliebe, werde er nicht gestatten, dass sie an Bord kämen.
Er brachte diese Rede so gut vor, und sie war an sich so vernünftig, so gemäßigt und schloss doch so kühn mit einer Verneinung, dass sie den größten Teil der Leute für den Augenblick zufriedenstellte. Da sie aber Anlass dazu gab, dass Cliquen und Kabalen entstanden, beruhigten sich die Männer stundenlang nicht; der Wind flaute gegen Abend auch ab, und so befahl der Kapitän, die Anker nicht vor dem nächsten Morgen zu lichten.
Noch in derselben Nacht wandten sich dreiundzwanzig Leute, darunter der zweite Geschützmeister, der Gehilfe des Schiffsarztes und zwei Zimmerleute, an den Ersten Offizier und erklärten ihm, der Kapitän habe ihnen ja die Erlaubnis gegeben, zu ihren Kameraden an Land zu gehen, und sie bäten ihn, diesem auszurichten, er solle es ihnen nicht übel nehmen, dass sie den Wunsch hätten, sich zu ihren Gefährten zu begeben und mit ihnen zu sterben; sie seien der Meinung, in einer solchen Notlage könnten sie nicht umhin, sich ihnen anzuschließen, denn wenn es irgendeinen Weg gebe, ihr Leben zu retten, dann den, ihre Zahl zu vergrößern und sie genügend zu verstärken, sodass sie einander beistehen und sich gegen die Wilden verteidigen könnten, bis sie vielleicht früher oder später Mittel und Wege fänden, von dort zu entkommen und in ihre Heimat zurückzukehren.
Der Erste Offizier erwiderte ihnen, er wage nicht, dem Kapitän von einer solchen Absicht zu sprechen, und er bedaure sehr, dass sie nicht mehr Achtung vor ihm hätten, als von ihm zu verlangen, solch eine Botschaft zu überbringen; wenn sie aber zu diesem Unternehmen entschlossen seien, rate er ihnen, da ihnen der Kapitän die Erlaubnis dazu gegeben habe, am frühen Morgen das Großboot zu nehmen und davonzufahren, einen höflichen Brief an den Kapitän zurückzulassen und ihn zu bitten, er möge seine Leute an Land senden, um das Boot zurückzuholen, das sie ihm auf redliche Weise wieder aushändigen wollten, und er versprach ihnen, bis dahin darüber zu schweigen.
Dementsprechend schifften sich eine Stunde vor Sonnenaufgang die dreiundzwanzig Mann, jeder mit einer Muskete und einem kurzen Säbel, einige mit Pistolen und drei mit Hellebarden bewaffnet, samt einem guten Vorrat an Schießpulver und Blei, jedoch ohne irgendwelche Lebensmittel außer ungefähr einem halben Zentner Brot, wohl aber mit ihren Seekisten und allen ihren Kleidungsstücken, ihrem Werkzeug, ihren Instrumenten, Büchern und dergleichen mehr, völlig geräuschlos ein, sodass der Kapitän nichts davon bemerkte, bis sie schon halb an Land waren.
Sobald er es hörte, rief er nach dem Zweiten Geschützmeister, denn der Geschützmeister lag zu der Zeit krank in seiner Kajüte, und befahl, auf sie zu schießen; zu seinem großen Verdruss aber gehörte der Zweite Geschützmeister zu den Abtrünnigen und war mit ihnen gefahren; tatsächlich hatten sie gerade darum so viele Waffen und eine solche Menge Munition erhalten. Als der Kapitän festgestellt hatte, wie die Dinge lagen und dass daran nichts zu ändern war, beruhigte er sich ein bisschen und nahm es auf die leichte Schulter; er rief die Leute zusammen und sprach freundlich mit ihnen. Er sagte, er sei sehr zufrieden mit der Treue und Tüchtigkeit der Leute, die jetzt noch dageblieben waren, und zu ihrer Ermutigung wolle er die Heuer der von Bord Gegangenen unter sie aufteilen lassen; er sei sehr froh, dass das Schiff nun frei sei von einem so meuterischen Haufen, der keinerlei Grund habe, aufsässig zu werden.
Die Leute schienen recht zufrieden zu sein; und besonders das Versprechen, sie bekämen die Heuer derjenigen, die das Schiff verlassen hatten, wirkte sehr auf sie. Danach übergab der Schiffsjunge dem Kapitän den Brief, den sie anscheinend bei ihm hinterlassen hatten. Darin stand so ziemlich das Gleiche, was sie zu dem Ersten Offizier gesagt hatten und was er nicht hatte ausrichten wollen; nur am Ende ihres Briefes schrieben sie dem Kapitän, sie hätten keine unlauteren Absichten und deshalb auch nichts mitgenommen, was ihnen nicht gehörte, mit Ausnahme von einigen Waffen und etwas Munition, die absolut unentbehrlich für sie seien, sowohl zu ihrer Verteidigung gegen die Wilden als auch, um zu ihrer Ernährung Vögel oder Wild zu schießen, damit sie nicht umkämen, und da ihnen als Heuer beträchtliche Summen zustanden, hofften sie, er werde ihnen die Waffen und die Munition gegen ihr Guthaben überlassen. Sie schrieben, was das Großboot des Schiffs betreffe, das sie mitgenommen hätten, um an Land zu gehen, so wüssten sie, dass er es brauche, und seien durchaus bereit, es ihm zurückzugeben. Wenn er es holen lassen wolle, würden sie es seinen Leuten ordnungsgemäß aushändigen, und niemandem von denen, die es holen kämen, sollte irgendein Leid geschehen, und keinen von ihnen wollten sie auffordern oder überreden, bei ihnen zu bleiben. Am Schluss des Briefes ersuchten sie ihn demütig, er möge ihnen zu ihrer Verteidigung und um ihr Leben zu sichern ein Fass Pulver sowie etwas Munition schicken und ihnen erlauben, den Mast und das Segel des Boots zu behalten, sodass sie, falls es ihnen gelänge, sich ein Boot irgendeiner Art zu bauen, damit zur See fahren und sich in den Teil der Welt retten könnten, in den sie ihr Schicksal führte.
Hierauf trat der Kapitän, der bei dem restlichen Teil der Leute durch seine Ansprache sehr gewonnen hatte und ganz beruhigt war, was den allgemeinen Frieden betraf (denn tatsächlich waren die Aufsässigsten von Bord), auf das Achterdeck hinaus, rief die Mannschaft zusammen, teilte ihr den Inhalt des Briefes mit und erklärte, zwar hätten die Schreiber eine solche Großmut von ihm nicht verdient, trotzdem aber wolle er sie doch nicht mehr Gefahren aussetzen, als sie selbst es wollten; er sei geneigt, ihnen Munition zu schicken, und da sie nur um ein Fass Pulver gebeten hätten, werde er ihnen zwei schicken und entsprechend Kugeln oder Blei und Gießformen, damit sie daraus Kugeln herstellen konnten. Und um ihnen zu zeigen, dass er ihnen gegenüber großmütiger war, als sie verdienten, befahl er, auch ein Fass Arrak und einen großen Sack Brot zu ihnen hinüberzuschaffen, damit sie versorgt wären, bis sie sich selbst zu etwas verhelfen könnten.
Die auf dem Schiff gebliebenen Leute zollten der Großmut des Kapitäns Beifall, und jeder von ihnen sandte uns irgendetwas. Gegen drei Uhr nachmittags legte die Pinasse am Ufer an und brachte uns alle diese Dinge, über die wir uns sehr freuten; wir gaben das Großboot wie versprochen zurück. Was die Männer betraf, die mit der Pinasse gekommen waren, so hatte der Kapitän Leute ausgesucht, von denen er wusste, dass sie nicht zu uns übergehen würden; sie hatten auch strengen Befehl, bei Todesstrafe keinen von uns wieder mit an Bord zu bringen, und beide Seiten hielten sich so gewissenhaft an die Verabredung, dass weder wir sie aufforderten zu bleiben noch sie uns mitzukommen.
Wir waren jetzt ein recht ansehnlicher Trupp, im Ganzen siebenundzwanzig Mann, sehr gut bewaffnet und mit allem außer Proviant ausgerüstet; wir hatten zwei Zimmerleute bei uns, einen Geschützmeister und, was so viel wert war wie alle Übrigen zusammen, einen Wundarzt oder Doktor, das heißt, er war in Goa der Gehilfe eines Wundarztes gewesen und wurde bei uns als Überzähliger geführt. Die Zimmerleute hatten ihr gesamtes Werkzeug mitgebracht, der Doktor alle seine Instrumente und Arzneien, und wir hatten wirklich eine große Menge Gepäck bei uns, jedenfalls insgesamt, denn einige von uns hatten kaum mehr als die Kleidung, die sie auf dem Leib trugen, darunter auch ich; ich hatte jedoch etwas, was keiner von ihnen besaß, nämlich die zweiundzwanzig Goldmoidors, die ich in Brasilien gestohlen hatte, und zwei Pesos zu acht Realen. Die beiden Pesos und einen Moidor zeigte ich, und keiner vermutete jemals, dass ich außerdem noch irgendwelches Geld besaß, denn sie wussten ja, dass ich nur ein armer Junge war, aus Barmherzigkeit aufgelesen, wie der Leser weiß, und als Sklave benutzt von meinem grausamen Herrn, dem Steuermann.
Der Leser mag sich wohl leicht vorstellen, dass uns vieren, die wir als Erste dort geblieben waren, die Ankunft der übrigen Freude bereitete, ja dass sie uns freudig überraschte, wenn wir auch anfangs Furcht empfunden und gedacht hatten, sie kämen uns holen, um uns zu hängen; sie taten jedoch das ihrige, uns davon zu überzeugen, dass sie in der gleichen Lage waren wie wir, nur mit dem Unterschied, dass sie sich freiwillig, wir jedoch gezwungenermaßen darin befanden.
Das Erste, was sie uns nach einem kurzen Bericht darüber, wie sie das Schiff verlassen hatten, mitteilten, war, dass sich unser Kamerad an Bord befand; wie er aber dorthin gelangt war, vermochten wir uns nicht vorzustellen, denn er war heimlich ausgerissen, und wir hätten nicht gedacht, dass er gut genug schwimmen konnte, um sich bis zu dem so weit draußen liegenden Schiff zu wagen, ja wir hatten nicht einmal gewusst, dass er überhaupt schwimmen konnte, und in keiner Weise vermutet, was wirklich geschehen war, sondern wir waren der Meinung gewesen, er habe sich im Wald verlaufen und sei von wilden Tieren zerrissen worden oder den Eingeborenen in die Hände gefallen und von ihnen ermordet worden. Diese Annahme hatte vielerlei Befürchtungen in uns geweckt, es könne früher oder später auch unser Schicksal sein, den Eingeborenen in die Hände zu fallen. Als wir nun aber hörten, dass er an Bord war und dort mit Müh und Not wieder Aufnahme und Verzeihung gefunden hätte, waren wir ruhiger als zuvor.
Da wir jetzt, wie gesagt, eine beträchtliche Anzahl Leute und deshalb in der Lage waren, uns zu verteidigen, versprachen wir einander als Erstes in die Hand, uns aus keinem Anlass trennen zu wollen, sondern miteinander zu leben und zu sterben, kein Wild zu töten, ohne es mit den Übrigen zu teilen, uns in allem durch die Mehrheit leiten zu lassen und nicht auf unserem Willen zu beharren, wenn die Mehrheit dagegen war; wir wollten einen von uns zum Kapitän ernennen, der unser Befehlshaber und Anführer sein sollte, solange es uns gefiel. Während er im Amt war, wollten wir ihm bei Todesstrafe rückhaltlos gehorchen, und alle sollten an die Reihe kommen; der Kapitän dürfe aber in keiner Angelegenheit ohne den Rat der Übrigen handeln, sondern nach dem Willen der Mehrheit.
Nachdem wir diese Regeln festgelegt hatten, beschlossen wir, das Nötige zu tun, um uns Nahrung zu beschaffen und Verhandlungen mit den Einwohnern oder Eingeborenen der Insel aufzunehmen, damit sie uns versorgten. Was Lebensmittel betraf, so waren jene uns zuerst sehr nützlich, aber wir wurden ihrer schon bald müde, denn es waren unwissende, habsüchtige, rohe Menschen, schlimmer noch als die Eingeborenen aller anderen Länder, die wir gesehen hatten, und wir stellten nach kurzer Zeit fest, dass wir uns den Hauptteil unserer Nahrung mit unseren Gewehren beschaffen konnten, indem wir Rehe, anderes Wild sowie Vögel jeder Art schossen, die dort reichlich vorhanden sind.
Wir bemerkten, dass uns die Eingeborenen nicht störten und sich nicht viel um uns kümmerten; sie fragten auch nicht und wussten wohl nicht, ob wir bei ihnen blieben oder nicht, und noch viel weniger, dass unser Schiff endgültig abgefahren war und uns dagelassen hatte, wie es tatsächlich der Fall war, denn am nächsten Morgen, nachdem wir das Großboot zurückgeschickt hatten, stach das Schiff südostwärts in See und war nach vier Stunden außer Sicht.
Am folgenden Tag begaben sich zwei von uns auf einem Weg und zwei auf einem anderen ins Landesinnere, um sich umzusehen, in was für einer Gegend wir uns befanden, und wir stellten bald fest, dass das Land sehr reizvoll und fruchtbar war – angenehm, darin zu leben, aber, wie gesagt, von einer Schar von Geschöpfen bewohnt, die kaum menschlich waren und sich in keiner Weise umgänglich machen ließen.
Wir stellten auch fest, dass es in der Gegend viel Vieh und Nahrungsmittel gab, wussten aber nicht, ob wir wagen konnten, sie uns zu nehmen, wo wir sie fanden, und obgleich wir Vorräte brauchten, wollten wir uns doch nicht ein ganzes Volk von Teufeln auf einmal auf den Hals ziehen, und deshalb erklärten sich einige unserer Leute bereit, mit ein paar von den Einheimischen wenn möglich zu sprechen, um herauszubekommen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten mussten. Elf von unseren Männern unternahmen diesen Gang, gut bewaffnet und zur Verteidigung gerüstet. Sie brachten die Nachricht zurück, sie hätten einige der Eingeborenen gesehen, die ihnen gegenüber sehr höflich zu sein schienen, aber sehr scheu und ängstlich wurden, als sie ihre Gewehre erblickten, denn offensichtlich wussten sie, was diese waren und wozu sie dienten.
Die Männer machten ihnen Zeichen, dass sie etwas zu essen wollten, und da gingen sie fort und holten ein paar Kräuter und Wurzeln sowie ein bisschen Milch; anscheinend beabsichtigten sie aber nicht, sie zu verschenken, sondern sie zu verkaufen, und erkundigten sich durch Zeichen, was unsere Leute geben wollten.
Das versetzte diese in Verlegenheit, denn sie hatten nichts zum Tauschen; einer von ihnen zog jedoch ein Messer heraus und zeigte es ihnen; es gefiel ihnen so gut, dass sie bereit waren, um seinetwillen aufeinander loszugehen. Als der Seemann das sah, wollte er sein Messer vorteilhaft losschlagen und ließ sie eine gute Weile darum feilschen, während ihm einige Wurzeln, andere Milch boten; endlich bot ihm einer eine Ziege an, und er nahm sie. Dann zeigte ihnen ein Zweiter unserer Leute ein Messer, sie hatten aber nichts, was gut genug dafür gewesen wäre, und so machte einer ein Zeichen, sie wollten gehen und etwas holen; nun warteten unsere Männer drei Stunden lang auf ihre Rückkehr. Als sie kamen, brachten sie eine kleine, gedrungene, dicke Kuh, die fettes, gutes Fleisch hatte, und gaben sie ihm für sein Messer.
Der Markt hier war gut, unser Pech war jedoch, dass wir keine Ware besaßen, denn unsere Messer brauchten wir ebenso notwendig wie sie, und hätten wir keinen Mangel an Nahrungsmitteln gelitten und sie uns nicht dringend beschaffen müssen, dann hätten sich die Männer nicht von ihren Messern getrennt. Kurze Zeit darauf stellten wir jedoch fest, dass die Wälder voll waren von lebenden Geschöpfen, die wir zu unserer Ernährung erlegen konnten, ohne Anstoß bei den Einwohnern zu erregen; so gingen unsere Leute täglich auf die Jagd und kehrten niemals ohne die eine oder die andere Beute zurück, denn was die Eingeborenen betraf, so hatten wir keine Tauschwaren, und unser gesamter Geldvorrat hätte uns nicht lange am Leben erhalten. Wir beriefen aber eine allgemeine Versammlung ein, um zu sehen, wie viel Geld wir hatten, und um alles zusammenzulegen, damit es so weit reichte wie nur möglich, und als ich an die Reihe kam, zog ich einen Moidor sowie die beiden schon erwähnten Pesos hervor.
Den Moidor wagte ich zu zeigen, damit sie mich nicht verachteten, weil ich zu wenig zu dem Vorrat beigesteuert hatte, und sich nicht herausnahmen, mich zu durchsuchen; sie waren sehr gefällig zu mir, in der Annahme, ich sei ihnen gegenüber so redlich gewesen, ihnen nichts zu verbergen.
Unser Geld nützte uns jedoch wenig, denn die Leute kannten weder seinen Wert und Zweck, noch verstanden sie das Gold im Verhältnis zum Silber einzuschätzen, sodass unsere Barschaft, die nicht groß war, nachdem wir alles zusammengelegt hatten, uns nur wenig Vorteil brachte, das heißt, um uns Nahrungsmittel zu kaufen.
Als Nächstes überlegten wir, wie wir von diesem verfluchten Ort fortkommen und wohin wir uns wenden könnten. Als ich an der Reihe war, meine Meinung zu äußern, erklärte ich den anderen, ich wolle alles völlig ihnen überlassen und ich sähe es lieber, wenn sie mich in den Wald gehen lassen wollten, um Nahrung für sie zu suchen, anstatt sich mit mir zu beraten, denn ich sei mit allem einverstanden, was sie zu tun beschlossen; hierzu waren sie aber nicht bereit, da sie nicht erlauben wollten, dass jemand von uns allein in den Wald ginge, weil wir, obwohl wir noch keine Löwen oder Tiger in den Wäldern gesehen hatten, doch mit Sicherheit annahmen, dass es viele auf der Insel gab, neben anderen, ebenso gefährlichen oder vielleicht noch gefährlicheren Tieren, wie wir später durch eigene Erfahrung auch feststellten.
Wir erlebten auf der Jagd nach Nahrung viele Abenteuer in den Wäldern und trafen auf wilde, schreckliche Tiere, deren Namen wir nicht kannten; da sie aber ebenso wie wir Beute suchten und von keinerlei Nutzen für uns waren, störten wir sie so wenig wie möglich.
Die Beratungen, die wir jetzt, wie schon erwähnt, darüber abhielten, wie wir von diesem Ort entkommen konnten, endeten nur mit dem Ergebnis, dass wir, weil sich zwei Zimmerleute unter uns befanden und sie Werkzeug fast jederlei Art bei sich hatten, versuchen wollten, uns ein Boot zu bauen, mit dem wir über das Meer von hier fort und dann vielleicht zurück nach Goa gelangen oder an irgendeinem anderen geeigneten Ort landen könnten, um unsere Flucht zu bewerkstelligen. Die Beratungen auf dieser Versammlung waren zwar nicht übermäßig bedeutungsvoll, da sie aber anscheinend bemerkenswertere Abenteuer anbahnten, die sich viele Jahre später unter meiner Führung hier in der Gegend ereigneten, denke ich, dass es ganz unterhaltsam sein mag, wenn ich über diese Miniaturausgabe meiner künftigen Unternehmungen berichte.
Gegen den Bau eines Boots hatte ich nichts einzuwenden, und sie machten sich sogleich an die Arbeit; dabei aber ergaben sich große Schwierigkeiten, wie der Mangel an Sägen, um unsere Planken zu schneiden; des Weiteren an Nägeln, Bolzen und Dornen zum Befestigen der Bretter, an Hanf, Pech und Teer zum Kalfatern und Schmieren der Ritzen und dergleichen mehr. Schließlich schlug einer aus der Gesellschaft vor, sie sollten anstelle einer Barke, Schaluppe oder wie immer sie es nennen wollten, mit der sie so viele Schwierigkeiten hatten, eine große Piroge oder ein Kanu bauen, was ganz leicht auszuführen sei.
Jemand wandte ein, wir könnten niemals ein Kanu bauen, das groß genug sei, um damit über den weiten Ozean zu fahren, den wir überqueren mussten, um die Küste von Malabar zu erreichen; es würde nicht nur ungeeignet sein, dem Meer standzuhalten, sondern auch, die Last aufzunehmen, denn wir waren ja siebenundzwanzig Mann, führten eine Menge Gepäck bei uns und mussten darüber hinaus zu unserem Unterhalt noch viel mehr mitnehmen.