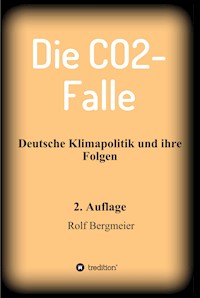15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Regelmäßig und nicht nur zur Karlspreisverleihung wird Karl der Große euphorisch beschworen. Selbst nüchterne Historiker ergehen sich dann gerne in Lobeshymnen auf den "Vater Europas" und preisen Karl als Vermittler antiker Kultur und Gelehrsamkeit. Und doch hat Karl nicht eine einzige öffentliche Schule gegründet, keine Wissenschaftsdisziplin gefördert, kein einziges Theater eröffnet und nicht eine öffentliche Bibliothek finanziert. Vor und nach ihm liegt die städtische Kultur am Boden, die Menschen hausen in armseligen Holz-Baracken, entleeren ihre Notdurft auf den Straßen, und Paris ist ein Müllhaufen. Statt Bildung, Wissenschaft und Kultur erlebt man Karls Handeln und seine Gesetze nur allzu oft als unversöhnliche Theologie, die unverhohlen droht: "Sterben soll, wer Heide bleiben will". Nicht zuletzt deshalb führt er sein ganzes Leben lang Kriege, fördert Bischöfe und Klöster nach Kräften und wird von der Kirche im Gegenzug selig und sogar heilig gesprochen. Karl ist weder "Leuchtturm", noch "Vater Europas". Sein Denken und Handeln stehen im krassen Gegensatz zu allem, was Europa Gesicht und Farbe verleiht, und hat mit dem Europa, wie wir es heute verstehen, mit der Fähigkeit zum demokratischen Diskurs, mit Kritik und Kompromiss, mit Toleranz, mit kultureller Vielfalt und freiem Denken nicht das Geringste zu tun. Europa ist anders. Es gilt, mit den traditionell gepflegten Karlslegenden aufzuräumen und mit einer Figur, die nicht als Vorbild taugt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Rolf Bergmeier
KARL DER GROßE
Rolf Bergmeier
Karl der Große
Die Korrektur eines Mythos
Tectum
Rolf Bergmeier
Karl der Große. Die Korrektur eines Mythos.
Tectum Verlag Marburg, 2016
ISBN 978-3-8288-6382-8
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter
der ISBN 978-3-8288-3661-7 im Tectum Verlag erschienen.)
Lektorat: Volker Manz
Coverabbildungen: Denkmal Kaiser Karl der Große am Karlsbrunnen vor dem Aachener Rathaus © Stihl024 – Fotolia.com; Fotografie des Autors © Evelin Frerk
Ergänzender Bildnachweis für den Innenteil: S. 144 – Fotografie von Wikimedia-User »Kemmi. 1« (CC BY-SA 3.0), S. 192 – Fotografie von Wikimedia-User »Lusitana« (CC BY-SA 3.0)
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhalt
Einleitung
1.Der Rahmen: Das antike und mittelalterliche Sozialmilieu
Antike: Das Mäzenatenparadies
Jahrtausendwende. Das katholische Christentum wird Staatskirche
Das verschwiegene Religionschaos im 4. Jahrhundert
Bischöfe – die neue Führungsschicht
Zusammenfassung
2.Karl im Konjunktiv
Mundus vult decipi – Die Welt will betrogen werden
Bildung, Wissenschaft und Gelehrte in der Karl-Literatur
Zusammenfassung: Kritik als Ausweis der Wissenschaftlichkeit
3.Karl. Sein Hof und sein Wirken
Gelehrte Männer
Die »Hofakademie«
Gipfel der Gelehrsamkeit: Karl und Aristoteles
4.Das Schulwesen
Karl, Mäzen des klösterlichen Schulsystems
Vom Wesen der fränkischen Klosterschulen
Zusammenfassung: Klosterschulen sind keine Volkshochschulen
5.Karl und die Bibliotheken
Die Klosterbibliotheken
Kataloge und Verzeichnisse mittelalterlicher Klosterbibliotheken
Karls Hofbibliothek
Karolingische Buchkunst
Die Klosterbibliotheken im Schatten antiker und arabischer Sammlungen
6.Karolingische Architektur
7.Karl und die Ökonomie
Grundlage: Das Capitulare de villis
Die fränkische Wirtschaftsverfassung
Karls feudales Gesellschaftsmodell
Die feudale Ordnung. Zusammenfassung
Der große Gewinner: Die Kirche
Fazit: Ein Hühner zählender Herrscher mit einer Residenz in der Provinz
8.Ein Analphabet reformiert Sprache und Schrift
Latein – Kirchensprache, Herrschaftssprache, Ausschlusssprache
Karl und die Reform der Schrift
9.Karls Walten, ein Entwurf für Europa?
Karl und die Errichtung eines christlichen Staates
Karls Handwerk ist der Krieg
Wie in aller Welt kann man Karl zum »Vater Europas« machen?
10.Das lateinsprachige Mittelalter wartet auf die »Wiedergeburt«
Epilog. Die Versuchung gefälliger Geschichtsschreibung
Anlagen
Zwischenruf. Der Karlspreis
Anmerkungen
Bibliografie
»So stellten sich mir die alten Zustände dar, allerdings schwierig für jedes Einzelne ohne Unterschied einen genügenden Beweis zu bringen. Denn die Menschen nehmen die Überlieferungen von den früheren Ereignissen, selbst wenn sie der eigenen Heimat angehören, ohne allen Unterschied ungeprüft an. So leicht nehmen es die meisten mit der Erforschung der Wahrheit. Sie greifen lieber nach dem, was auf der Hand vor ihnen liegt«.
(Thukydides, Der Peloponnesische Krieg 1,20, um 400 v. u. Z.)
Einleitung
Sakrosankten Texten ist niemals zu trauen. Aber wer am Heiligen rüttelt, hat es schwer. Eines dieser Heiligtümer ist die Lichtgestalt Karl der Große, »Vater Europas«, ein Allerheiligstes. Eine kaum überschaubare Schar von Nachkriegshistorikern und Publizisten des späten 20. und des frühen 21. Jahrhunderts sieht ihn über alle Zeit- und Geografieräume hinweg als einsame Größe glänzen, als jemanden, der dunkle Jahrhunderte in eine Periode kultureller Hochblüte verwandelt habe.1 Ein homo universale sei er gewesen, bildungsbewusst, unerbittlich als Heerführer, ein weitblickender Staatsmann, ein Landwirt, der die Eier zählt und die Pflanzung der Obstbäume überwacht,2 leidenschaftlicher Jäger und Frauenheld, Analphabet und Wächter über gutes Schreiben, Erfinder der deutschen Grammatik, Liebhaber von Heldenliedern und der bildenden Kunst, erlesener Geist und Hort der Gelehrsamkeit, Sänger und unermüdlicher Gesetzgeber, Haupt eines Wanderzirkus und gestrenger Richter über die Rechtgläubigkeit seiner Untertanen, Sachsenschlächter und imperator christianissimus.3 Kurzum, Karl habe »das angeblich so finstere Mittelalter hell« gemacht, meint der Bayerische Rundfunk, »sogar sehr hell«.4 Karl der Große! Was für ein Kerl! Noch heute fallen die Honoratioren in Aachen vor dem »Leuchtturm Europas« und der »Zierde des Erdkreises« auf die Knie. Karl hat fünf Ehefrauen,5 ein Dutzend Mätressen und droht Frauen die Peitsche an, wenn sie nicht das Vaterunser beherrschen. Er kann nicht schreiben, lesen wohl auch nicht, ist des Lateinischen nur mäßig mächtig und soll dennoch der mittelalterliche Bildungspapst par excellence gewesen sein. Er führt vier Jahrzehnte Krieg mit seinen Nachbarn, provoziert die muslimischen »Sarazenen« im Süden Europas, rüstet mit mythischer Wucht gegen die Awaren im Osten, weil diese eine unerträgliche Bosheit »gegenüber der heiligen Kirche und dem populus christianus gezeigt« hätten,6 und wird dennoch wegen »seiner Friedensordnung nach innen« gelobt.7 Karl marschiert in Sachsen und Bayern ein, vereint sie mit den Franken unter christlicher Fahne, spart dabei nicht mit Deportationen und Zwangstaufen, was der Historiker HEINRICH HOFFMANN als ein »geschicktes« Unterfangen beschreibt, um Staat und Kirche »zu verschmelzen«.8
Am Ende sind sich Historiker und Geschichtsfreunde weitgehend einig: Karl ist ein »Großer«. Der renommierte Mittelalterforscher FRANCOIS L. GANSHOFER meint in Karl den »ersten Baumeister Europas« erkennen zu können, während LEOPOLDVON RANKE Karl zum »Vollstrecker der Weltgeschichte« hochwuchtet und JOSEFFLECKENSTEIN, in Fragen globaler Bedeutung nicht besonders pingelig, den Kaiser zum »Verwandler der Welt« (1990) befördert. Der Bonner Mediävist MATTHIAS BECKER lässt Karls Reich zur »Keimzelle des modernen Europas« (1999) aufwachsen, sein Tübinger Kollege STEFFEN PATZOLD assistiert, Karl sei »ein epochaler Erneuerer von Wissen und Gelehrsamkeit« gewesen (2014), und LUCAS WIEGELMANN beschäftigt sich mit Karls »Riesen-Bildungshunger« (2014).
So geht das Buch um Buch, Seite um Seite, und nach dem Studium von gefühlt vierzig Karl-Biografien und rund dreißig Seiten Internet-Anmerkungen zu Karl, von Kardinal Lehmann bis zum Deutschlandfunk, gewinnt man den Eindruck, dass Kontroversen in Wahrheit keine sind, die Bedeutung Karls und seine Verdienste trotz Hinweisen auf die Schattenseiten seines Lebens nicht infrage gestellt werden und er zu Recht im Jahr 2013 mit zwei weiteren Karl-Biografien gewürdigt wird.
Dort wird uns auf mehr als tausend Seiten Karl, sein Leben und sein Wirken als gottesfürchtiger Mann nähergebracht. Die Autoren sind Mediävisten, Leute vom Fach, und sie schlagen eine scharfe Klinge für Karl und seine Zeit. »Ein einzigartiger Wissenstransfer von der Antike ins frühe Mittelalter und der Aufbau von Wissensspeichern in Form von Bibliotheken« kennzeichne die Epoche Karls, schreibt STEFAN WEINFURTHER, eine »bis dahin nicht da gewesene Bildungsoffensive« habe »weite Teile des christlichen Europas« erfasst. WEINFURTHERmeint wohl das katholische Europa, denn das christlich-orthodoxe Ostrom rund um Byzanz, einschließlich der bis ins 10. Jahrhundert unter byzantinischer Herrschaft stehenden Territorien Süditalien, Sizilien und Sardinien, wollen ebenso wenig von Karls Bildungsoffensive beglückt werden wie der skandinavische Norden und das islamische Spanien und Portugal. Was die »Bildungsoffensive« auf das Frankenreich und Nord- und Mittelitalien begrenzt und die Frage aufwirft, wie eigentlich die zeitgenössische Wahrnehmung jenseits fränkischer Grenzen, in Byzanz und im arabischsprachigen Reich, gewesen ist. Die Antwort, das sei bereits vorab verraten, fällt ernüchternd aus.
Der Begriff »Araber» oder »arabisches Reich« verkürzt die ethnische Vielfalt der arabisch sprechenden Volksteile. Die wahren Araber sind nur eine kleine Gruppe von Stämmen, die den Islam verbreiten. Die Ägypter, Syrer, Libanesen und Iraner betrachten sich nicht als Araber, obwohl sie fast alle Arabisch als ihre Sprache und den Islam als ihre Religion ansehen. Korrekt müsste man also von Entwicklungen oder Gesellschaften »im arabischen Sprachraum« sprechen.
BEGRIFF
Weinfurthers Frankfurter Kollege JOHANNES FRIEDzieht in seiner 730 Seiten starken Karl-Biografie gleichfalls alle Register. Unter dem Einfluss Karls habe sich sein Hof zu »einem einzigartigen Bildungszentrum, vorbildlich für alle kommenden Jahrhunderte«, entwickelt, zu einer »Zentrale der Wissensorganisation, wie es eine solche bis dahin nirgends gegeben hatte«. Karls Bildungshunger habe »die einzigartige Schönheit der römischen Dichtkunst gerettet«, und von Karl sei eine »Erneuerung der vernunftbetonten, intellektuellen Kultur des Abendlandes« ausgegangen sei, die »die Welt [!] in ihren Bann« geschlagen habe.9 Das sind große Worte, aber diese Glanzleistung Karls braucht den Leser eigentlich nicht weiter zu beschäftigen, da FRIED sich in der Einleitung seines Buches als Visionär vorstellt: Das Buch sei »eine Fiktion«, »subjektiv gefärbt«, eine »eigene Imagination«, denn »eine objektive Darstellung des großen Karolingers« sei »schlechterdings nicht möglich«.
Damit könnte man es eigentlich bewenden lassen: FRIED hat nach eigenem Bekunden einen üppigen, angenehm zu lesenden, an historisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen entlanggleitenden, mit Visionen und Meinungen unterlegten Roman geschrieben – wären da nicht die Rezensenten, die den Roman gerade wegen seiner Nähe zur Wissenschaft loben. FRIED, meint der Beck-Verlag, habe »alle historischen Register« gezogen, habe Quellen, Artefakten und Indizien nachgespürt, kurzum, »näher könne man Karl dem Großen nicht mehr kommen« (Buchumschlag) – was in etwa das Gegenteil von FRIEDS Bekenntnis ist, eine objektive Darstellung Karls sei nicht möglich.
*****
Darum also geht es in diesem Buch. Um die Auflösung von Widersprüchen, die bei näherer Betrachtung durch ein Konglomerat aus Vertrauenswürdigem, unkritischen Wiederholungen und frommer Weltanschauung entstanden sind. Es geht um eine karolingische Epoche, deren kulturelle Leistungen an den von der antiken Vorgängerkultur und den byzantinischen und islamisch-arabischen Parallelkulturen gesetzten Maßstäben beurteilt werden muss, was aber regelmäßig nicht geschieht. Es geht um Karl, genannt »der Große«, dessen Großartigkeit vor allem aus Textquellen abgeleitet wird, die von Schreibkundigen im Dienst der geistlichen und weltlichen Obrigkeit entworfen, kopiert, verfremdet und gefälscht worden sind und dennoch, trotz aller Bedenken, Historikern als grundlegende Basis für ihr Karl-Bild dient. Es geht um ein Monument, über dessen Denkmal mittlerweile die Flagge Europas flattert, obwohl der Mann sein ganzes Leben lang Kriege geführt hat. Und es geht auch um eine irritierend homogene Berichterstattung über eine Person, die nach Auffassung der meisten Historiker wissenschaftlich gar nicht zu fassen ist und folglich zu diskursiven Interpretationen einladen müsste, aber selten, nach Augenschein der deutschen Nachkriegsliteratur nie aus einem von Wissenschaft, Politik, Presse und katholischer Kirche getragenen Einheitsbild ausbricht.
Und so scheint es also nach einer Zeit der Panegyrik angebracht, den Geschichtenerzählern das Leben ein wenig schwerer zu machen und den Epigonen das treue Nacherzählen zu verleiden. Dass dabei manche lieb gewonnene Einsicht auf der Strecke bleibt, muss den Leser nicht verstören. Denn »dass die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden müsse, darüber ist in unseren Tagen wohl kein Zweifel übriggeblieben«, meint Goethe, und die meisten Historiker werden wohl zustimmen – zumindest soweit nicht eigene Positionen »umgeschrieben« werden müssen.
»Wieviel Dispute hätten zu einer Randbemerkung zusammengefasst werden können, wenn die Disputanten gewagt hätten, ihre Begriffe zu definieren«
(Aristoteles, 384-322 v. u. Z.).
Plato und Aristoteles, Marmortafel von Lucca della Robbia, 1437–1439, Museo dell'Opera del Duomo
1. Der Rahmen: Das antike und mittelalterliche Sozialmilieu
Wer Karls Wirken und seine Bedeutung für Europa bewerten will, wer ihn als »Vater der europäischen Kultur« auf einen hohen Sockel stellt, muss den Kaiser und seine Politik an der antiken Vorgängerkultur und der islam-arabischen Parallelkultur messen. Muss Paris und Aachen mit Rom, Byzanz und Toledo vergleichen, Bibliotheken und ihre Bestände nach Art, Inhalt und Menge in Beziehung setzen, den Schulbetrieb analysieren und den Wissenschaftsbetrieb untersuchen. Nur der Vergleich lässt eine Bewertung Karls zu. Beginnen wir mit einem kurzen Ausflug in die Antike.
*****
Die eigentliche Wiege des »Abendlandes« steht nicht in einer Hütte Bethlehems, sondern auf der Akropolis. Von hier nimmt alles seinen Anfang: die schöpferische Fantasie, die Idee des »Schönen«, die Entfaltung des Geistes, die Suche nach dem sittlich Vollkommenen. Hier, auf der Akropolis, wird das System der politischen Mitbestimmung, werden die Demokratie, die Herrschaft des Volkes, und die Bereitschaft des Einzelnen geboren, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Hier wird erstmals das Individuum als solches, sein Wert »von Natur aus« geschätzt und die Macht der Herrschenden über demokratisch legitimierte Verfahren kontrolliert. Die Griechen verehren die Götter und halten sie dennoch unter Kontrolle. Sie sind offen für fremde Kulturen, ihre Neugierde setzt schöpferische Kräfte frei, und ihr Suchen nach Erkenntnissen und Wahrheit folgt wissenschaftlichen Methoden.
Darauf aufbauend formen die Römer eine weit ausgreifende Bildungs- und Zivilisationslandschaft, die als Kern der Idee vom Imperium Romanum die halbe Welt zusammenhält. »Römer, denke daran, mit deiner Herrschaft die Völker zu regieren, den Frieden mit römischer Lebensart zu verbreiten, die Besiegten zu schonen und die Hochmütigen zu vernichten«, erinnert Vergil die Bewohner der »Hauptstadt der Welt« an das Wesen und die Aufgaben der Römer.10 Sie werden diesem Anspruch weitgehend gerecht. Ein Reich von Schottland bis Afrika, vom Atlantik bis zum Euphrat kann man nicht nur mit Divisionen zusammenhalten. Da muss wohl die Pax Romana und die Lebensart der Römer eine wichtige Rolle gespielt haben.
Dieses griechisch-römische System aus individueller Freiheit, gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein, demokratischer Kontrolle, Mitsprache durch Volkstribune und rhetorischen Glanzleistungen im Senat und auf dem Forum, aus wissenschaftlicher Neugierde und kulturellem Tiefgang beeinflusst unsere Kultur- und Wertewelt noch heute. Sie ist das, was Europa im Innersten ausmacht, wichtigster Teil europäischer »Leitkultur«.
Astronomie und Kosmologie, Medizin und Pharmakologie, Politologie und Philologie, alles trägt griechische Namen. Wir rühmen das Gefühl antiker Baumeister und Künstler für Proportionen, spielen die Dramen der großen Tragiker auf unseren Bühnen, bewundern die Harmonie von Architektur und Landschaft und verstehen nicht so recht, wie moderne Architekten diese zeitlosen Regeln vergessen können. Ciceros meisterhaft aufgebaute Reden dienen uns immer noch als Vorbild ausgefeilter Redekunst, Senecas Humanismus geht dem christlichen »Tue Gutes« voraus, ein Medizinstudium ohne Latein ist nicht vorstellbar, und der Codex Iustinianus begleitet jedes Jurastudium. »Nach dem Naturrecht sind alle Menschen gleich und frei«, heißt es dort.11 Auf diesem Grundsatz ruhen die Erklärung der Menschenrechte von 1789 und unsere heutigen Menschenrechte, die im 18. Jahrhundert erkämpft und Verfassungswirklichkeit wurden. Keine geistes- und naturwissenschaftliche Fakultät, keine künstlerische Hochschule, die nicht von diesem Erbe zehrt. Die antike Kultur ist das Fundament der europäischen Kultur.
Antike: Das Mäzenatenparadies
Freiheit und Engagement für die Gemeinschaft sind Schlüsselbegriffe der antiken Gesellschaft. Gleich ob Athener Bürger oder römischer Legionär, Kaiser oder Bürger, alle empfinden es als selbstverständliche Pflicht, der res publica zu dienen. Wer etwas auf sich hält, investiert in den öffentlichen Raum, kümmert sich um öffentliche Einrichtungen, baut Schulen, Akademien oder Theater, spendet Thermen und Bibliotheken für das Volk und finanziert Wettbewerbe und Spiele. Schulen gibt es im ganzen Land,12 Mäzene bezahlen die Lehrkräfte, soweit die Kosten nicht aus der kaiserlichen Schatulle beglichen werden. Caesar (100–44 v. u. Z.) stattet, dem Vorbild Griechenlands folgend, die westlichen Städte des Imperiums mit einer oder mehreren repräsentativen öffentlichen Bibliotheken aus, jeweils mit einer lateinischen und einer griechischen Abteilung, Kaiser Augustus lobt in den Res gestae seine Investitionen in den öffentlichen Raum,13 Kaiser Vespasian errichtet das Kolosseum, sein Nachfolger Caracalla vermacht im 3. Jahrhundert den römischen Bürgern die architektonische Glanzleistung der Caracalla-Thermen und Kaiser Konstantin gründet im Jahr 330 eine mit Kulturdenkmälern, Theatern und Foren reich ausgestattete neue Residenz: Konstantinopel. Die Stadt wird politischer Mittelpunkt des römischen Reiches und nennt sich heute Istanbul.
Den bedeutendsten Bibliotheksbau in Rom lässt Kaiser Trajan im Jahre 112/113 errichten. Ein Blick in die Trajans-Bibliothek ist für jeden Mediävisten, der die Klosterbibliotheken des Mittelalters in leuchtenden Farben darstellt, erhellend: Die Säle der Bibliothecae divi Traiani sind durch einen vierzig Meter langen quadratischen Portikus getrennt, in dessen Mitte die bekannte Trajanssäule steht. Jeder Saal ist zwanzig Meter lang, zehn Meter breit und siebenundzwanzig Meter hoch.14 Das geräumige Bauwerk umfasst zwei Stockwerke samt Galerie unter einer Kassettendecke. Die Bücherschränke sind für Schriftrollen von maximal vierzig Zentimeter Tiefe konstruiert, ihre Höhe wird auf etwa drei Meter geschätzt.15 Wie die meisten öffentlichen Bibliotheken verfügt auch die Bibliothecae divi Traiani über einen Bestand von mehreren Hunderttausend Büchern, eine Zahl, an die man sich erinnern sollte, wenn über den Bestand der »Hofbibliothek« Karls des Großen gesprochen wird.
Ab dem 5. Jahrhundert ist ein schleichender Verfall der Theater, Singspiel- und Wettkampfstätten, einschließlich der Olympiade, und ein Niedergang der öffentlichen Kultur (Schulen, Bibliotheken, Skulpturen) und der Städtelandschaft nachweisbar. Darüber gibt es mancherlei Theorien: Die Römer seien, vom Alter gezeichnet, dekadent geworden, die Germanen hätten das antike Kulturgut nicht geschätzt, überhaupt sei es fragwürdig, von einem Niedergang der antiken Kultur zu reden. Denn die christlichen Klöster hätten sich des antiken Erbes angenommen und für die Nachwelt bewahrt. Man müsse also eher von »Kontinuität« sprechen und nicht vom Niedergang.
Die Theorien werden hoch gehandelt, mal siegt die eine Seite, mal die andere. Derzeit scheint die Kontinuitätstheorie zu dominieren. Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Um 350 gibt es in Rom 28 öffentliche Bibliotheken,16 jeweils mit mehr als 100.000 Bänden; mit Eintritt in das Mittelalter gibt es dagegen im ehemals Weströmischen Reich kaum mehr öffentliche Bibliotheken. Römische Städte verfügen über öffentliche Schulen, Theater und Thermen, während das Mittelalter nichts dergleichen kennt. Im Imperium Romanum können schätzungsweise etwa 50 Prozent der Bevölkerung lesen und schreiben, während im Frankenreich 95 Prozent der frühmittelalterlichen Bevölkerung Analphabeten sind. Alle Zahlen und Vergleiche, ob Schulen, Theater, öffentliche Bibliotheken, Stadtkultur oder Landleben, rufen dem Historiker zu: Der Übergang von der Spätantike in das frühe Mittelalter wird von einem erdrutschartigen Kultur- und Zivilisationseinbruch begleitet. Vor allem, weil es am Verständnis für die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung der Städte und an privaten Gönnern mangelt, die die antike Kultur am Leben erhalten, und weil sich der Staat aus der Förderung von Schulen, Bibliotheken und Theatern zurückzieht. Damit erhält eine Bewegung Auftrieb, die Kultur und Zivilisation völlig anders definiert als bisher: Der Katholizismus.
Dieses Geschehen tritt vor allem im lateinsprachigen Mitteleuropa auf und trifft nicht das griechische Ostrom, das sich nach einer Durststrecke aufrappeln und »goldene Kultur-Jahrhunderte« einläuten wird. Auch die spanische Halbinsel muss ausgenommen werden, die ab 711 islamisch wird und nach einer Phase wenig ersprießlicher katholischer Westgoten-Tyrannei17 einen Wirtschafts- und Kulturaufschwung sondergleichen erlebt.
Wir müssen also bei dem Phänomen »Kultur- und Zivilisationsverfall« über ein Teileuropa sprechen, über die Region nördlich der Alpen, über die Merowinger und Franken. Diese Region, von den Römern Gallien genannt, war bis ins 4. Jahrhundert eine Vorzeigeprovinz des Römischen Reiches, voller blühender Städte, »römischer als Rom«, und stolpert nun in eine glanzlose Zeit hinein.
Jahrtausendwende. Das katholische Christentum wird Staatskirche
Anders als im Judentum schleppt der Katholizismus in seinem Tornister die göttliche Forderung zur Missionierung – »Geht hinaus in alle Welt« – mit sich. Und da Missionare immer die einzig richtig Wahrheit kennen, geht mit ihrem Bemühen ein rigoroses Umerziehungsprogramm einher, das den Geist der antiken Kultur, das Streben nach irdischer Glückseligkeit als Sinn und Zweck allen menschlichen Handelns, den griechische Drang, die Welt zu erforschen, und das römische Mäzenatentum verdorren lässt. Denn Ziel des menschlichen Lebens ist nun nicht mehr das diesseitige Glück, sondern die Vorbereitung auf ein ewiges Leben im Jenseits.
Dieser fundamentale Wechsel vom antiken Götterglauben, dessen Darsteller nicht »im Himmel« wohnen, sondern mit einem Bein auf griechischem Boden stehen, zu einem hypothetischen Supergott jenseits aller Galaxien, der »keine anderen Götter neben sich« mag und jede noch so kleine Glaubensabweichung mit Missmut beobachtet, wird – wenn überhaupt – in der historischen Literatur durchweg wohlwollend, bestenfalls teilnahmslos beschrieben. Offene Kritik am Monotheismus christlicher Prägung, insbesondere an der Art und Weise, wie er sich ab dem 4. Jahrhundert in der Variante des Katholizismus durchsetzt, erlaubt sich mancher Theologen, aber kaum ein deutscher Nachkriegshistoriker althistorischer oder frühmittelalterlicher Provenienz. Dabei handelt es sich um eine Zeitenwende, um ein Jahrtausendereignis mit der Idee des Endkampfes zwischen Gut und Böse, auch um den Einbruch totalitärer Gesinnungsethik in das Staatsgeschäft. Der Potsdamer Pedro Barceló ist einer der wenigen Althistoriker, der mit einer gut begründeten Analyse gegen den Strom eines in Jahrhunderten geronnenen Einheitsverständnisses ankämpft und das Werden der katholischen Staatskirche mit kritischem Abstand beschreibt.18
Das verschwiegene Religionschaos im 4. Jahrhundert
Eine »christliche Kirche« in der uns heute geläufigen Form gibt es in den ersten Jahrhunderten nicht. Sie ist ein Geschöpf des 4. Jahrhunderts. Bis dahin gibt es dreihundert Jahre lang Gemeinden mit unterschiedlichen Vorstellungen über die Rolle des Religionsgründers Jesus, aber keine geschlossene »Kirche«. Über die Dreifaltigkeit (Trinität) wird endlos debattiert, aber die Gemeinden können sich nicht einigen. Die Zwei-Naturen-Lehre ist noch nicht einmal angedacht, der christliche Markt wird von Evangelien überschwemmt, eine vorherrschende und führende Denkrichtung ist nicht auszumachen und von einem Papst spricht ohnehin noch niemand. Das religiöse Durcheinander ist so ausgeprägt und kräftezehrend, dass Eusebius von Caesarea, der Hofberichterstatter Kaiser Konstantins, um 337 seufzt: »Schlimmer als jeder Krieg und jeder furchtbare Kampf gilt mir der innere Zwist der Kirche Gottes und schmerzlicher scheint mir dies als die Kämpfe nach außen«.19 Zwar wird 325 auf dem Konzil von Nicäa eine Gottesformel gefunden, die der heutigen gleicht – homoousios,der Sohn ist dem Vater wesensgleich –, die sich aber nicht durchsetzt und Mitte des 4. Jahrhunderts auf verschiedenen Synoden wieder infrage gestellt wird.
In diesem frühchristlichen Kosmos werden Abweichler von der nicäisch-trinitarischen Norm des Jahres 325, die den Katholizismus maßgeblich prägen wird, als »Häretiker« bezeichnet. Sie gelten den »Trinitariern« als die schlimmsten Feinde der eigenen Auffassung, schlimmer noch als Ketzer und Heiden. Diese »häretischen« Bewegungen werden, ebenso wie die kleinteilige Gemeindestruktur der Jesus-Anhänger, in der Literatur durch die Bank kleingeredet.20 Im Panárion des Metropoliten Epiphanios von Zypern, genannt»Hausapotheke gegen die Schlangenbisse der Häresie«, auch als Adversus haereses bekannt, werden um 375 etwa achtzig häretische Lehren vorgestellt und verurteilt.21 Dabei handelt es sich nicht etwa nur um verstreute Splittergruppen im palästinensischen Irgendwo, sondern um beherrschende Strömungen in Ägypten, Palästina, Syrien, Arabien und dem Irak, also dem Stammland des Christentums. Die bedeutendste »häretische« Variante ist im 4. Jahrhundert der Arianismus, der Jesus nicht als gottgleich anerkennt und wohl ebenso stark gewesen sein dürfte wie die Lehre des nicäischen Bekenntnisses, die die Trinität, die Lehre von den Dreien in Einem, predigt.22
Man kann darüber streiten, ob »Häretiker« überhaupt Christen sind. Befürworter meinen, alle Jesus-Anhänger seien »Christen« gewesen. Aber nach Lage der damaligen Texte der »rechtgläubigen« Trinitarier, die »Häretiker« mit einem Tsunami von Schmähungen überschwemmen, und dem heutigen Sprachgebrauch folgend, der die »richtige« Taufformel als unabdingbar und den »Gottessohn« als Nukleus christlichen Glaubens definiert, sind Zweifel angebracht, ob Häretiker nach heutigem Verständnis Christen sind. Dennoch werden alle Jesus-Bewegungen, trotz ihrer Inhomogenität, auch in der Forschungsliteratur meist unter dem Begriff »Christentum« oder »christliche Kirche« subsummiert. Womit die Leser auf eine folgenreiche falsche Fährte gelockt werden. Denn dieses variantenreiche Bündel von Jesus-Anhängern mit unterschiedlichsten Gottesvorstellungen ist als Resultat der ideologischen Zersplitterung in seiner Durchsetzungskraft gegenüber dem Reich theologisch und politisch in einer schwachen Position. Ohne fremde Hilfe würden sich diese Streithansel gegenseitig aufreiben und im Status zahlreicher mehr oder weniger großer Sekten verharren.
Der Begriff »Gottessohn« ist in der frühen Kirche hoch umstritten. Arius (4. Jh.) meint, Jesus sei, wie Origenes es lehre, kein richtiger Gottessohn, diese Bezeichnung sei ein Ehrenname und Jesus ein Adoptivsohn Gottes. Im Übrigen ist der Begriff damals weit verbreitet. In Ägypten bezeichnet man den Pharao als Sohn des Gottes Amun. Alexander der Große wird als Sohn des Zeus verehrt. Cäsar wird nach seinem Tod zum Divus erhoben und Augustus nennt sich ab 42 v. u. Z. divi filius und begründet damit die »Gottessohn«-Serie der folgenden römischen Kaiser.
BEGRIFF
Der Streit über das »richtige« Christentum wogt bis in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts hinein, und es ist bezeichnend, dass der haeretisch-arianische Kaiser Constantius im Jahr 356 den damaligen Axomitenkönig (Ägypten) Aeizanas um Hilfe gegen die Ausbreitung der nicäischen Ketzerei und um Auslieferung Verdächtiger ersucht. Theodor Mommsen meint dazu, der Christ habe den »Arm des Heiden« zum Kampf gegen Christen gebraucht.23 360 wird in Konstantinopel die trinitarische Formel aufgehoben und eine neue ratifiziert, die besagt, der Sohn sei dem Vater nur ähnlich. Fast 400 Jahre nach dem Tod Jesu ist also immer noch nicht der christliche Gott definiert.
In diesem Durcheinander kann es auch nicht wirklich überraschen, dass Kaiser Julian im Jahr 361 die alten Götter wieder in das Zentrum des Staatskultes rückt und der gewohnte Polytheismus erneut in die Kurien und Tempel einzieht. Diese spätantike, religiöse Renaissance erfolgt ohne Widerstand des Volkes, der Senatoren und des Heeres, geht also ohne Aufsehen in aller Öffentlichkeit vor sich – was immerhin die geringe gesellschaftliche Bedeutung der christlichen Bischöfe bis in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts belegt. Und wäre Julian nicht bereits zwei Jahre nach Beginn seiner Herrschaft wieder verstorben, so wäre es wohl mit der späteren staatlich gelenkten Kanalisierung der Jesus-Bewegungen zu einer homogenen »Kirche« endgültig vorbei gewesen. Jedenfalls lassen weder die Quellen noch die innerchristlichen Streitigkeiten, noch die widerstandslose Re-Animierung der antiken Gottheiten durch Julian den Schluss zu, das Volk hätte den Wechsel von der Vielfalt der Götter zu einem Gott, der keine anderen mag, herbeigesehnt.
Nach Julians Tod im Jahr 363 droht das »Christentum« gänzlich aus den Fugen zu geraten. Die christlichen Varianten sind aufs Bitterste zerstritten, und in diesem Religionschaos wittert Ambrosius, Bischof von Mailand (374–397) und eine künftige Schlüsselfigur im Werden des trinitarischen Katholizismus, Rückenwind. Er schreibt dem »Winterkaiser« Jovian (reg. Winter 363/64) einen Brief und erinnert darin den Kaiser an das »wahre« Christentum: »Da nun Deine Frömmigkeit von uns den Glauben der katholischen Kirche kennen lernen will, so sagen wir dem Herrn Dank dafür und wollen vor allem Deinen gottesfürchtigen Sinn an das von den Vätern zu Nizäa aufgestellte Glaubensbekenntnis erinnern«.24 Der Brief hat zunächst nur geringe Wirkung, da Jovian nur acht Monate regiert.
Nach dem Tode Kaiser Jovians im Jahr 364 versucht sein Nachfolger, Kaiser Valens (reg. 364–378), den Arianismus (Jesus ist kein Gott) erneut zu etablieren. Schmähungen ob der Abweichung vom katholischen Weg der Wahrheit bleiben nicht aus. Die katholischen Kirchenhistoriker des 5. Jahrhunderts, Sokrates, Sozomenus und Theodoret, werden Valens als einen »hinterhältigen und brutalen Verfolger der Rechtgläubigen« darstellen.
Diese Phase des irrlichternden Christentums dauert bis 378. Und noch immer ist nicht klar, wohin die Reise geht. Nach einer »heidnischen« Phase, 361–363, und einer »häretischen«, 364–378, ist das Christentum immer noch weit von einer Konsolidierung im Sinne einer »gemeinsamen Religion«26 und von einer breiten Anerkennung entfernt.
Die Kontaminierung historischer Quellen
Die Entwicklungsgeschichte des spätantiken Christentums ist selbst Althistorikern meist nur in Umrissen bekannt. Die Ursachen sind auch im Fehlen nicht katholischer Quellen zu suchen, die ab dem 5. Jahrhundert systematisch zum Schweigen gebracht werden. Bereits im Decretum Gelasianum (um 495), einer Verherrlichung der katholischen Kirche, werden rund 100 Werke als »apokryph« gebrandmarkt, deren Verfasser »von der ganzen römischen katholischen und apostolischen Kirche ausgeschlossen […] unter der unlöslichen Fessel des Anathema in Ewigkeit verdammt« werden. Zusätzlich werden 30 bis 40 weitere »ekelhafte Anhänger« häretischer Schriften und »Genossen« verdammt.25 Den Verdammungen folgen weitere Buchzensuren, sodass schließlich fast nur noch mit dem Katholizismus kompatible Quellen zur Verfügung stehen. Daraus hat sich dann ein einseitiges und vergiftetes Bild der Entwicklungsgeschichte des spätantiken Christentums geformt, das in weiten Bereichen nicht die damalige Realität abbildet.
EXKURS
380 – das Jahr der Machtergreifung
Im Jahr 380 werden die Karten neu gemischt. Kaiser Theodosius (reg. 379–395) macht unter dem Einfluss des durchsetzungsstarken Mailänder Bischofs Ambrosius Tabula rasa: Er verbietet mit dem Erlass Cunctos populos alle heidnischen Religionen und schaltet die vom trinitarischen Christentum abweichenden christlichen Varianten, insbesondere die Arianer, mit Zwangsmaßnahmen aus: »Nur diejenigen, die diesem Gesetz folgen, sollen, so gebieten wir, katholische Christen heißen dürfen; die übrigen, die wir für wahrhaft toll und wahnsinnig erklären, haben die Schande ketzerischer Lehre zu tragen«.27 Von nun an ist der »Katholizismus« die beherrschende Größe im Reich, zunächst im gesamten Reich, später nur noch im Westreich.
Mit rund sechzig weiteren Edikten bauen Theodosius und seine Nachfolger in rascher Folge die programmatische Grundsatzerklärung Cunctos populos zu einem mächtigen Werkzeugkasten aus, mit dessen Hilfe die christlichen Konkurrenzen ausgeschaltet und alle Privilegien der heidnischen Priester samt der Sonderrechte ihrer Kulte abgeschafft werden. 23 Erlasse sind direkt gegen die nicht katholischen Christen gerichtet, die damit als der gefährlichste Gegner theodosianischer Missionsanstrengungen geortet werden können. Weitere dreizehn Erlasse sind gegen die »Heiden« und sechs gegen die Juden gerichtet. Sieht man diese Erlasse als ein geschlossenes Paket mit Cunctos populos als Initialgesetz, dann wird klar, dass es sich – entgegen der Annahme des Historikers KARL NOETHLICHS – um einen einzigartigen Angriff auf die Gedankenfreiheit handelt, um eine historische Fanfare, die den Einzug einer durch den Staat gegründeten und von ihm massiv bis zur Androhung und zum Vollzug von Todesstrafen unterstützten Staatsreligion ankündigt.
Die Begriffe »Heide« (pagani, gentiles) und »Heidentum« sind nur im christlich-theologischen Sprachgebrauch anwendbar. »Heide« ist ein Stereotyp, ein Sammelbegriff für alles, was nicht christlich oder jüdisch ist. Es ist noch nicht einmal klar, ob der Islam »heidnisch« ist.
BEGRIFF
Ein Gesetz vom Februar 384 nennt Häretiker »Vertreter einer kriminellen Religion«28, und zum »Heidentum« abgefallenen Christen wird rückwirkend die Testamentsfähigkeit, also die Möglichkeit zu vererben, entzogen. Die erste Todesstrafe wird 385 verhängt. Die Synode von Trier verurteilt den wegen Häresie angeklagten Bischof Priscillian und seine Anhänger zum Tode durch das Schwert. Es folgen ein Versammlungsverbot, die Strafandrohung für Mischehen zwischen Christen und Juden und das Besuchsverbot heidnischer Tempel. 392 wird die Häresie zu einem vom Staat zu verfolgenden Verbrechen erklärt, den heidnischen Priestern werden ihre letzten Privilegien entzogen und die Zerstörung der Tempel wird angeordnet. Grundstücke werden konfisziert, Berufs- und Lehrverbote verhängt und Häretiker und »Heiden« aus den Städten vertrieben, weil »die verpestende Anwesenheit von Kriminellen [die Städte] verunreinigt«. Mit einem Edikt aus dem Jahr 425 verbietet Kaiser Valentinian III. allen Nichtkatholiken den Anblick Roms, damit die Stadt nicht durch Frevler entweiht werde. Selbst die seit Jahrhunderten freie Ausübung des häuslichen Gottesdienstes wird reglementiert: Wer zu Hause den falschen Gott anruft, muss mit strenger Strafe rechnen.
Solche drakonischen Religionsgesetze sind in der großen weiten Welt des Römischen Reiches bisher unbekannt gewesen. Beschönigende Äußerungen von Ambrosius, Bischof von Mailand, Theodosius sei »mit zarter Rücksicht« vorgegangen, sind völlig haltlos und werden durch die Edikte selbst widerlegt. Auch unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Hintergrundes sind Cunctos populos, das folgende Erlasspaket und die Zustimmung der Bischöfe zu diesem Gewaltakt der Sündenfall in der Geschichte des Christentums, der Einbruch in die Denk- und Gestaltungsfreiheit der Menschheit, der Wandel staatlichen Handelns zugunsten einer Religion schlechthin. Dass diese folgenreiche Jahrtausendentscheidung bis tief in das 20. Jahrhundert hinein den Ablauf der Geschichte bestimmen wird, bedarf keiner Begründung. Und dass die Inthronisierung des christlichen Gottes per ordre de mufti undohne vorherige Konsultation mit kirchlichen und theologischen Vertretern erfolgt, ist kein Ruhmesblatt für die katholische Kirche.
Es kann daher nicht verwundern, dass Kirchenhistoriker wie religiös geprägte Wissenschaftler versuchen, die Bedeutung des 380er-Erlasses durch Hinweis auf eine spätere Bischofskonferenz in Konstantinopel (381) zu unterlaufen.* Was jedoch an der dogmatischen Eigenmächtigkeit des Kaisers und der damaligen Zweitrangigkeit der Bischöfe wenig ändert.
Religionspolitische Wirkungen
Cunctos populos hat mehrere Gesichter. Zunächst wandelt das Erlasspaket eine kunterbunte, polyphone Religionslandschaft in einen monothematischen Acker einheitlichen Glaubens, auf dessen Schollen keine Wildkräuter wachsen dürfen. Dieser Wandel wird in der Literatur als eine für den politischen Zusammenhalt des Staates segensreiche, ja notwendige Entscheidung begrüßt, ohne die negativen Auswirkungen hinsichtlich Kreativität und Innovationspotenzial zu bedenken und ohne den Beweis anzutreten, dass die im Imperium Romanum fast tausend Jahre lang gepflegte polytheistische Religionsstruktur politisch destabilisierend gewirkt hätte.
Für das Christentums hat Cunctos populos paradigmatische Bedeutung. Einmal ist die Allianz mit den Mächtigen ein religiöser Sündenfall, der Anfang einer kircheninstitutionellen Erstarrung, die das Christentum grundlegend verändern wird. Aus einer jüdisch-christlichen Erneuerungsbewegung, die in den Gründungsjahren die Solidarität mit den Schwachen und den Verzicht auf Gewalt auf ihre Fahnen geschrieben hat, wird »Kirche«, die in letzter Konsequenz bereit ist, Andersdenkenden ihre »Theologie des Todes« (ANTON GRABNER-HAIDER) zu predigen. Die Volksfrömmigkeit der hebräisch-griechischen Jesus-Bewegungen wandelt sich zum institutionellen katholischen Kirchen- und Papstkult. Ideale – deren Vollzug im Gesamtporträt des christlich-religiösen Alltagsgeschäfts des 1. und 2. Jahrhunderts allerdings nicht mehr rekonstruierbar sind – verkehren sich in ihr Gegenteil. Selbst die Gewaltmissionierung wird mit dem semantischen Gespenst der »Nächstenliebe« begründet. Manche meinen, der Wandel sei ein »Verrat an Jesus Christus«.
Zum Zweiten verändert die bisherige, den inneren Frieden sichernde polytheistische Landschaft des Reiches schlagartig ihr religionstolerantes Gesicht. Wurde im Jahre um 25 v.u.Z. in Rom noch ein Tempel »für alle Götter« gebaut (Pantheon: pân ‚alles‘ und theós ‚Gott‘) und 120 erweitert, so wird nunmehr und erstmals in der griechisch-römischen Geschichte der Monotheismus mit seiner inhärenten Charakteristik der Intoleranz gegenüber anderen Glaubensrichtungen zur Leitlinie staatlichen Handelns. Die interpretatio graeca,die Gewohnheit antiker griechischer Autoren, ihnen unbekannte Gottheiten anderer Kulturen mit griechischen Göttern gleichzusetzen und sie entsprechend zu benennen,29 versinkt im Anspruch einer Religion, die zu wissen vorgibt, was Gott will. Der tolerante römische Staatskult wirdbeerdigt und die religio licita, die römisch-staatliche Anerkennung jüdischer, christlicher und anderer Formen des Glaubens, das wilde Glaubensgemisch von jüdischer Menora, römischem Jupiter, christlichem Gott aller Varianten und den Orientalen Mithras und Serapis, wird außer Kraft gesetzt. Fast tausend Jahre Religionsfrieden, in dessen Schutz jeder nach seiner Fasson selig werden konnte, sind dahin, und man muss kein Wahrsager sein, um die kommenden Verwüstungen, die mit Kaiser Justinian und Karl erste Höhepunkte finden werden, ahnen zu können. Es reicht ein Blick in die Contra-haereses-Pamphlete des 3. und 4. Jahrhunderts oder in die Kapitularien Karls aus dem 8. Jahrhundert, der »unverfälschten Stimme Karls des Großen« (MCKITTERICK), um zu ahnen, was kommen wird.
Der Staat unterwirft sich einem abstrakten Heilsversprechen
Zugleich werden wir Zeuge eines staatspolitischen Ereignisses höchster Bedeutung: Mit Cunctos populos wird im Prozess der Selbst-Entmachtung des Staates zugunsten des katholischen Klerus ein fulminanter Höhepunkt erreicht, mit dem die bisherigen Formen und Regeln der politischen Loyalität der Bürger gegenüber der Gemeinschaft weitgehend ihre Gültigkeit verlieren. Während die Spartaner für Gesetz und Ehre gestorben sind – »Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dort, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl« – und der römische Senat Augustus für seine Tapferkeit (virtus), Milde (clementia), Gerechtigkeit (iustitia) und Pflichterfüllung gegenüber Menschen und Göttern mit einem Ehrenschild im Sitzungssaal des Senates ehrt, werden nunmehr mit dem 380er-Gesetz Taten nicht mehr an der Elle der Dienlichkeit für die Gemeinschaft gemessen, sondern an der Gottesverträglichkeit. Gottesdienst steht vor dem Dienst an der Gemeinschaft. »Keine Sache ist uns fremder als der Staat«, hatte schon Tertullian gerufen, »Vater des Kirchenlateins«,30 während Augustinus, ein Blitzgescheiter in allen Gottesfragen und Erfinder der urkomischen Theorie, die menschenverschlingende Ur-Sünde werde beim Koitus in die Eizelle übertragen, die bisher eher gleichgültig-abwehrende Haltung des frühen Christentums gegenüber dem Staat ändert und der minderwertigen irdischen Welt, der civitas terrena, die erhabene civitas dei gegenüberstellt. Die Existenz des Staates sei Folge des Sündenfalls, also ein Werk des Bösen. Gott habe zum Schutz der Christenheit zwei Schwerter verliehen (Lukas 22,38), davon sei eins von der Kirche zu führen, das andere für die Kirche. Der Papst sei der Lehnsherr beider Schwerter. Nur wenn sich der weltliche Staat in den Dienst des Gottesstaates stelle, habe er eine relative Existenzberechtigung.
Und wieder sind es römische Kaiser, die die Entmachtung des Staates vorantreiben und die weltliche Macht zugunsten der Autorität der Bischöfe mindern. War seit Augustus der Kaiser Bevollmächtigter des Staatskultes und führendes Mitglied aller wichtigen Priestergremien, so gibt der Kaiser die Rolle des Pontifex maximus, des obersten Priesters mit der Oberaufsicht über alle sakralen Angelegenheiten, auf und verschenkt den Anspruch an den Papst.31 Papst Leo (440–461) schmückt sich erstmals und ohne Widerspruch mit dem Titel, und ab Papst Gregor wird Pontifex maximus fester Bestandteil der päpstlichen Titulatur.
Verzweifelte Versuche der Aristokratie, die heidnisch-antike Kultur samt ihrer Forderung nach religiöser Toleranz zu retten, werden Ende des 4. Jahrhunderts von der Allianz aus katholischen Kaisern und einflussreichen Bischöfen abgewiesen. Symmachus bittet im Jahr 384 als Praefectus urbi der Stadt Rom und als Vertreter des traditionsbewussten Adels in einem formvollendeten Brief an Kaiser Valentinian II. um Toleranz der Religionen und um Wiederaufstellung des 382 entfernten Altars der Siegesgöttin Victoria im Sitzungsgebäude des Senates: »Zu denselben Sternen blicken wir empor«, schreibt Symmachus in einem klassisch schönen und bewegenden Appell, »der Himmel ist uns gemeinsam, dasselbe Weltall umgibt uns. Was liegt daran, unter welchem System ein jeder die Wahrheit erforscht? Auf einem Weg allein kann man nicht ein solch erhabenes Mysterium erkennen«.32 Ambrosius, Bischof von Mailand, vom Gefühl einer höheren Macht durchdrungen, die über allen weltlichen Gewalten steht, nimmt beim Kaiser entschieden Stellung dagegen und droht unverhohlen mit der Exkommunikation: »Sollte aber anders entschieden werden, so können wir Bischöfe dies nicht mit Gleichmut ertragen. […] Die Kirche wirst Du zwar besuchen können, aber Du wirst dort keinen Priester finden«.33
Eine solche Tonart hat in der Vergangenheit kein Priester anzuschlagen gewagt. Die harschen Worte belegen, wie sich innerhalb weniger Jahre die Macht von der weltlichen Seite zur kirchlich-katholischen verlagert hat. Noch zwanzig Jahre vorher hatte Kaiser Julian die heidnischen Götter gestärkt, hatte in bester römischer licita-Tradition alle Religionen geduldet, und jetzt das! Der ergreifende Appell des Symmachus um Toleranz wird vom Tisch gewischt, Symmachus selbst verlässt die Stadt und begibt sich auf seine Landgüter in Kampanien. Auch Nicomachus, ein bekannter Politiker und gebildeter Aristokrat, zieht sich um diese Zeit in das Privatleben zurück. Die Bischöfe beginnen, das Regiment zu übernehmen, und Karl wird einer ihrer größten Förderer.
Das kulturpolitische Armageddon
Mit der Aufgabe der verfassungsrechtlichen Unterordnung der Religion unter den Staat wird die Bereitschaft der Aristokratie und der Vermögenden, sich für die Gemeinschaft einzusetzen, empfindlich gestört. Bisher haben es Kaiser, Aristokraten und Gönner als selbstverständliche Pflicht empfunden, der res publica zu dienen und sich um öffentliche Einrichtungen, wie Schulen, Akademien, Foren, Theater oder Thermen, zu kümmern. Mit Cunctos populos endet das Mäzenatentum. Bischöfe beginnen eine immer größere Rolle zu spielen und machen sich auf, das geistige Leben zu okkupieren und staatliche Führungspositionen zu übernehmen. Ihr Anliegen ist nicht mehr, Thermen zu bauen, öffentliche Schulen einzurichten, Fernstraßen zu unterhalten, sondern die Kirche zu stärken in ihrem Dienst an Gott.
Schon die anmaßende Selbstsicherheit, die der Klerus in Fragen der Wahrheit zeigt, muss den freiheitlichen Geist als Quelle und Lebenselixier aller kulturellen Bemühungen stören. Denn viele Fragen im politischen und gesellschaftlichen Umfeld erlauben kein Ja oder Nein, Richtig oder Falsch, Schwarz oder Weiß. Das neue Denken steht mit seiner starren Religionsdogmatik im schroffen Gegensatz zum griechisch-philosophischen Stil der Nachdenklichkeit und des Abwägens. Epikurs Lehre von der Verstetigung der Lebensfreude durch den Genuss eines jeden Tages und Horaz’ carpe diem haben ausgedient. Glück findet der Christ nicht mehr auf Erden, sondern im Jenseits. Märtyrertum ist hoch angesehen, ein Leben hinter Mauern, Entsagung und Askese führen zur Heiligkeit. Die Bereitschaft zur Kritik und Selbstkritik, das Denken im Wettbewerb, die Suche nach der Wahrheit, das Fragen nach dem Glück des Menschen und die Idee von der Freiheit als dem höchsten Ziel allen politischen Handelns sind keine Vokabeln des katholischen Mittelalters. Die Kirche mag einzelne Elemente der antiken Kultur übernehmen, mag Platon und Aristoteles ausschlachten, aber der Geist der Antike wird von ihr ebenso bekämpft wie alle sinnlichen Freuden des Daseins. Er ist der Kirche fremd.
Neben der Veränderung des geistigen Klimas beobachten wir einen tief greifenden Wandel im Führungspersonal des Staates. Der Mediävist MARTIN HEINZELMANN belegt in einer Reihe von Beispielen, dass in den ehemaligen weströmischen Provinzen die Bischöfe als die tatsächlichen Leiter der (untergehenden) Städte angesehen werden,34 während die bisherige Führungsschicht aus dem Staatsgeschäft hinausgedrängt wird. Die Bischöfe sind damit auch mitverantwortlich für den Verfall der öffentlichen Schulen und Bibliotheken und der gesamten »heidnischen« Kultur. Was angesichts der Fülle überlieferter, zum Teil deftiger Texte und Briefe der Kirchenväter gegen die heidnische Kultur weder Theologen noch Althistoriker überraschen sollte.
Dieser im Wesentlichen nur im lateinsprachigen Bereich des Christentums zu beobachtende Machtwechsel, der unter Karl einem Kulminationspunkt entgegenstrebt, ist gewollt und wird auch in kirchlichen Kreisen nicht bestritten: »Macht«, schreibt Alkuin, nach Auffassung der meisten Historiker ein Spitzengelehrter am Hof Karls, »Macht ist aufgeteilt zwischen der geistlichen und weltlichen Macht. Letztere muss der Verteidiger der ersten sein.«35 Damit diagnostiziert Alkuin die Kirche als oberste Autorität, auch im diesseitigen Geschehen. Dies mag zunächst verwundern, da Alkuins Herr, Karl, als ein eigenwilliger Mann gilt, ohne Bereitschaft, sich einem Bischof oder Papst zu unterwerfen. Aber Karl hat die »geistliche Macht« längst als oberste Autorität anerkannt und sieht sich als ihr Vollstrecker. Er sucht sein Heil im trinitarischen Gott, der seit der Entfremdung des oströmischen, orthodoxen Christentums als »Katholizismus« definiert werden kann. Das ist die »geistliche Macht«, der er sich unterwirft.
In einer solchen Konstellation von dogmenträchtigem Katholizismus und Herrschern ohne höhere Schulbildung hat es die Philosophie besonders schwer. Als »Mutter der Wissenschaften« sucht sie die Wahrheit, während fundamentale Gläubige diese längst kennen. Und so wie die katholische Kirche die antike Kultur nur spolienhaft und unter Unterdrückung des Geistes der Kultur übernimmt, so dient die Philosophie der Kirche nunmehr als Steinbruch für Argumente und Methoden. Sie wird zur »Magd der Theologie« degradiert, verliert ihren geistigen Rang, während die Scholastiker ab dem 13. Jahrhundert versuchen, sie als Hilfsmittel der theologischen Rechtfertigung in eine Waffe spitzfindiger Gelehrsamkeit umzuschmieden – nicht um Philosophie im Kampf gegen die Rätsel der Natur zu verwenden, sondern um Haare zu spalten. Und da die Ergebnisse nicht besser sein können als die Prämissen, diese aber von unveränderbaren kirchlichen Axiomen ausgehen, ist die gesamte theologische Scholastik eine einzige bauernschlaue Veranstaltung.
Dabei ist die Frage nach dem Bösen – Warum lässt der allmächtige Gott das Böse zu? (Theodizee-Problem) – noch die anspruchsvollere Art, sich mit der Logik auseinanderzusetzen, ohne allerdings eine überzeugende Lösung anbieten zu können. Die Idee, dass das von der Kirche installierte Gottesbild Brüche haben könnte, wird aus verständlichen Gründen nicht verfolgt. Giordano Bruno musste dafür mit seinem Leben bezahlen. Stattdessen finden die Theologen auf scholastische Art und Weise die Antwort und teilen die Allmacht Gottes in die potentia absoluta und potentia ordinata auf. Diese Teilung ermöglicht es nun, nach Belieben auf der Allmachtsklaviatur Gottes zu spielen und Krieg und Frieden, Liebe und Hass gleichermaßen als Gottes Willen zu entschuldigen. Die berühmten Scholastiker Thomas von Aquin, Bonaventura, Albertus Magnus fühlen sich in diesem Sinne genötigt, Fragen von unabsehbarer Bedeutung zu diskutieren: Wie viele Engelschöre gibt es und welche Instrumente nutzen sie? Was treibt man in der Hölle? Steht Gott oder liegt er?
Warum diese theologische Haarspalterei im Gewande aristotelischer Logik »Philosophie« genannt wird, bleibt allerdings dem Philosophen verborgen.
Bischöfe – die neue Führungsschicht
Waren bisher die römischen Priester und Priesterinnen dem Staat und seinem Kult verpflichtet, so machen sich nunmehr die katholischen Bischöfe auf, die Beziehungen zwischen Priester und Staat auf den Kopf zu stellen und willfährige Kaiser auf sich auszurichten. Und man weiß nicht so recht, ob man die Standhaftigkeit und das Durchsetzungsvermögen der Bischöfe bewundern oder die Schwäche der um ihr Seelenheil bangenden Kaiser verachten soll. Jedenfalls bekommt die Kirche durch Verleihung von Privilegien und Übereignung von Immobilien ein ständig wachsendes Übergewicht gegenüber den Resten städtischer Selbstverwaltung. Der Bürgerbegriff wird entwertet, religiöse Segmente bekommen Sonderrechte, der klerikale Teil der Bürgerschaft wird der Gerichtsbarkeit entzogen, und bisher als unverzichtbar bewertete Einrichtungen des öffentlichen Lebens, wie Theater, Schulen, Bibliotheken und Thermen, verlieren die Unterstützung oder werden sofort geschlossen.
Währenddessen werden Kirchenvertreter zunehmend in die Bewältigung öffentlicher Aufgaben eingegliedert. Bischöfe werden für die Getreideversorgung, öffentliche Bauten und – in Fortsetzung der römischen Sitte – für die Betreuung Kranker und ausgesetzter Kinder zuständig und dazu mit beträchtlichen Einkünften ausgestattet.36 Die Kirche erhält eine eigene Gerichtsbarkeit und die Bischöfe werden zur Steuererhebung herangezogen bei gleichzeitig eigener Steuerbefreiung. Kirche und Administration öffentlicher Aufgaben wachsen ineinander und sind ab dem 5. Jahrhundert kaum mehr zu trennen. Das Amt des Bischofs wird de facto Teil des cursus honorum, der römischen Beamtenlaufbahn. Der Klerus hat damit nahezu den gesamten Staatsapparat in seiner Hand. Und wenn es in Ausnahmen zu einem Konflikt zwischen Bischof und den Staats- oder Kommunalorganen kommt, geht die Machtprobe meist unter Drohung mit der Exkommunikation zugunsten des Bischofs aus.37
Die Privilegierung christlicher Konfessionen...
beginnt unter Kaiser Konstantin I. mit finanziellen Unterstützungen (Besoldung, Kirchenbau, Steuerfreiheit), Sonderrechten für Bischöfe (Anerkennung ihrer Gerichtsbarkeit, Anlehnung an staatliche Ämter) und weiteren Privilegien für den Klerus. Insgesamt gilt jedoch, dass Konstantin das Imperium ohne spezifisch christlich-katholisches Gepräge zu reformieren sucht. Mal dient er Jupiter, mal dem Sonnengott, mal zeigt er Präferenzen für Jesus (vgl. R. Bergmeier, Kaiser Konstantin und die wilden Jahre des Christentums, 2010).
EXKURS
So wachsen die Bischöfe durch das Unvermögen der Kaiser, den Staat zu organisieren, in öffentlich-rechtliche Aufgaben hinein und werden nunmehr die neue gesellschaftliche und kulturelle Führungsschicht. Ohne heidnisch-philosophische Bildung, jedoch angefüllt mit Glaubensmysterien folgen die Machthaber den Geboten der Kirche, machen sich freudig die Lehre von der gottgegebenen Macht zu eigen und bereiten den Boden für den Feudalismus vor, während die Kirche die Aufteilung der Gesellschaft in Klassen absegnet: Adel, Bischöfe und Äbte hier, dort die Masse der Armen. Selbst innerhalb der Kirche wird von der urchristlichen Gleichheit aller Menschen abgewichen und eine strenge Hierarchie etabliert, an deren unteren Ende die Stadt- und Landpfarrer stehen, die die Schwerstarbeit der tröstenden Menschen- und Seelensorge bei völlig unzureichender materieller Entlohnung zu betreiben haben.
Unter der Dominanz der allmächtigen, allwissenden, jeder menschlichen Macht turmhoch überlegenen Gottheit erhebt die höhere Priesterschaft einen Herrschaftsanspruch über die Menschen, der keine Beschränkung kennt: »Wer wird sich der Einsicht verschließen«, schreibt Bischof Ambrosius von Mailand an Kaiser Valentinian II., »dass in Glaubensangelegenheiten die Bischöfe über dem Kaiser, nicht aber die Kaiser über die Bischöfe Recht sprechen können«.38 Es wird sich in Kürze zeigen, dass die katholischen Bischöfe darüber entscheiden werden, was »Glaubensangelegenheit« ist, bis schließlich der Mensch an sich, gleich welcher Abstammung und Position, dem Urteil der Kirche unterworfen wird: »So erklären wir, dass jedes menschliche Geschöpf dem Bischof von Rom unterworfen sein muss, weil dies ganz und gar heilsnotwendig ist«, erklärt Papst Bonifaz VIII. im Jahr 1302.39
Diese Schlacht um Macht und Einfluss wird auch von »starken« Kaisern, wie Justinian oder Karl dem »Großen«, nur scheinbar zugunsten der kaiserlichen Autorität entschieden, denn der gottesfürchtige und höllenbesorgte Karl bedient Papst, Kirche und Klöster nach Kräften. Der Kampf ist für ihn längst verloren. Es geht nur noch um Taktik, um machtpolitische Operationen, während die Strategie in Form einer für alle verbindlichen Weltanschauung unter der Dominanz der Kirche längst ausformuliert ist. Die glaubenstrunkenen Kapitularien von Karl sprechen eine deutliche Sprache. Und es ist vor allem diesem Karl zu verdanken, dass den Bischöfen und Äbten in kurzer Zeit halb Europa gehören wird, derweil die Armen mit Almosen und Worten getröstet werden: Armut sei eine Strafe Gottes für sündiges Leben. Im Jenseits würden sie belohnt werden.
Im Übrigen sieht sich kein Abt und kein Bischof vorrangig im Dienst der res publica