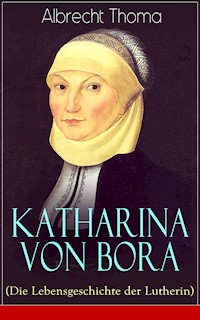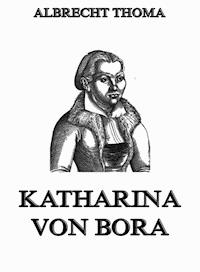0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In "Katharina von Bora: Geschichtliches Lebensbild" legt Albrecht Thoma ein sorgfältig recherchiertes und lebendig erzähltes Portrait einer der einflussreichsten Frauen der Reformationszeit vor. Thoma verbindet packende Biografie mit analytischem Geschichtsdiskurs und erklärt Katharinas Rolle als Frau hinter Martin Luther, die nicht nur seine Lebensgefährtin, sondern auch eine starke Stimme ihrer Zeit war. Der literarische Stil ist sachlich, aber dennoch fesselnd, was dem Werk sowohl wissenschaftliche Tiefe als auch Lesbarkeit verleiht. Im Kontext der Reformationsgeschichte beleuchtet Thoma die Verhältnisse und Herausforderungen, mit denen Katharina während ihrer Lebenszeit konfrontiert war, und fügt so ein wichtiges Kapitel zur Geschichte des Protestantismus hinzu. Albrecht Thoma, ein renommierter Historiker und Spezialist für die Reformationsgeschichte, hat sich über Jahre hinweg intensiv mit Quellen und Dokumenten zu Martin Luther und seiner Umgebung beschäftigt. Seine Leidenschaft für die Aufarbeitung der Geschichte und sein Interesse an marginalisierten Figuren tragen dazu bei, dass er Katharina von Bora als eigenständige Protagonistin in dieser Erzählung hervorhebt. Dieses Werk ist das Resultat seiner tiefen Beschäftigung mit der Materie und seiner Überzeugung, dass die Stimmen der Frauen in der Geschichtsschreibung nicht vergessen werden dürfen. "Katharina von Bora: Geschichtliches Lebensbild" ist eine essentielle Lektüre für alle, die sich für die Reformation, die Rolle von Frauen in der Geschichte und die komplexen Beziehungen zwischen Persönlichkeiten dieser Epoche interessieren. Thoma gelingt es, Licht auf das Leben einer bemerkenswerten Frau zu werfen, und bietet dem Leser sowohl historische als auch menschliche Einsichten. Ein Must-Read für Geschichtsinteressierte und Literaturfreunde gleichermaßen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Katharina von Bora: Geschichtliches Lebensbild
Inhaltsverzeichnis
Gleichfalls von der Wartburg aus erschien endlich ein deutsches Predigtbuch („Postilla“) von Luther und zu Michaelis desselben Jahres (1522) noch ein Wartburgswerk „Das Neue Testament deutsch“. Da konnte nun jedermann und vor allem die geistlichen Personen im Kloster, welche die evangelischen Ratschläge befolgen und ein evangelisches Leben führen wollten, aus der Quelle erfahren, was wahres Christentum sei, wie es Christus und die Apostel gelehrt, und wie es Luther ausgelegt hatte.
Demzufolge wandte sich die Stadt Grimma, in deren unmittelbarer Nähe das Kloster Nimbschen gelegen war, dem Evangelium zu, und die Mönche in mehreren umliegenden Klöstern verließen ihre Gotteshäuser.
Diese Schriften und Nachrichten kamen auch in das Kloster Nimbschen, denn so ganz verschlossen von der Welt waren auch Nonnenklöster nicht.
Auf welchem Wege und durch wen wurden sie den Klosterfrauen vermittelt?
Zweierlei Wege und Personen zeigen sich da. In Grimma war ein Kloster von Luthers Kongregation: Augustiner-Eremiten. Dort hatte Luther 1516 schon Visitation gehalten und bei der Rückkehr von der Leipziger Disputation (1519) blieb er mehrere Tage und predigte wohl auch daselbst; denn die Mehrzahl der Einwohner Grimmas standen schon längst auf seiner Seite. Der Prior des Klosters Wolfgang von Zeschau war Luthers Freund. Er trat 1522 mit der Hälfte der Ordensbrüder aus dem Kloster und wurde „Hospitalherr“ (Spittelmeister) am St. Georgen-Spital.
Von diesem Zeschau nun aber waren zwei Verwandte (Muhmen) im Kloster Nimbschen, zwei leibliche Schwestern: Margarete und Veronika von Zeschau. Gewiß konnte dieser evangelisch gesinnte frühere Mönch wenigstens vor seinem Austritt mit seinen Muhmen ohne Verdacht verkehren und ihnen Luthers Schriften zustecken. Auch der eifrig evangelische Stadtpfarrer in Grimma, Gareysen, war dazu imstande, welcher zu Ostern 1523 das hl. Abendmahl unter beiderlei Gestalt austeilte.
Außer dem nahen Städtchen Grimma konnte aber auch das ferner gelegene Torgau der Ort sein, von welchem aus reformatorische Gedanken und Schriften ins Kloster Nimbschen drangen. In Torgau war sehr früh und sehr durchgreifend die Reformation eingeführt worden, besonders seit der frühere Klostergenosse Luthers, der feurige Magister Gabriel Zwilling dort wirkte. Dieser, obwohl einäugig und ein kleines Männlein mit schwacher Stimme, hat doch durch seine begeisterte, ja stürmische Predigt, welche in Wittenberg sogar einen Melanchthon mit fortgerissen hatte, die Bürgerschaft zu einer ziemlich radikalen Abstellung aller römischen Mißstände und zu begeisterter Aufnahme des Evangeliums bewogen. Ja ein Torgauer Bürgersohn, Seifensieder seines Handwerks, entführte zu dieser Zeit — ob vor oder nach 1523 ist ungewiß, — zwei Nonnen aus dem Kloster Riesa an der Elbe und versteckte sie in einen hohlen Baum. Dann holte er Pferde und geleitete sie heim und heiratete die eine der beiden Klosterjungfrauen. Und eine Torgauerin trat 1523 aus dem Kloster Sitzerode[70].
Ein besonders entschiedener und thatkräftiger Anhänger war der ehemalige Schösser, der „fürsichtige und weise Ratsherr“ Leonhard Koppe, in dessen Kaufladen das Kloster seine Waren einzukaufen pflegte, und der wohl mit seinem Fuhrwerk selber Lieferungen nach Nimbschen brachte. So war dieser Laie, wenn auch seine evangelische Gesinnung bekannt sein mußte, vielleicht ein noch geeigneterer Mittelsmann für evangelische Schriften, als die doch immerhin verdächtigen übergetretenen Geistlichen von Grimma, vor denen als gefährlichen Wölfen die „zwei Herren an der Pforte“ ihren geistlichen Schafstall wohl gehütet haben werden. Mit seinen Waren konnte Koppe leicht lutherische Schriften einschmuggeln und auch einen Brief aus dem Kloster nach außen besorgen. Keck und schlau genug war Koppe dazu[71].
Welchen Eindruck das Auftreten und die Schriften Luthers auf die Nonnen machte, läßt sich ersehen aus einem Bericht, den eine Nonne in gleicher Lage und Zeit, jene Florentina von Eisleben, durch Luther in Druck gab. „Als nun die Zeit göttlichen Trostes, in welcher das Evangelium, das so lange verborgen, an den Tag gekommen, ganzer gemeiner Christenheit erschienen: sind auch mir als einem verschmachteten hungrigen Schaf, das lange der Weide gedarbt, die Schriften der rechten Hirten gekommen, worinnen ich gefunden, daß mein vermeintlich geistlich Leben ein gestrackter Weg zu der Hölle sei“[72].
In Nimbschen ging es einem großen Teil der Klosterjungfrauen ähnlich. Ja, eine Anzahl derselben verabredete sich zu dem Plan, aus dem Kloster auszutreten.
Das war ein schwerer Entschluß, der große Ueberwindung kostete. Eine ausgesprungene Nonne galt bisher für einen Schandfleck in der Familie. Der freie Austritt aber war nur durch päpstlichen Dispens mit großen Kosten und Mühen zu erreichen und eigentlich nur Gliedern fürstlicher Familien möglich. Freilich waren in dieser neuen, tieferregten Zeit schon Mönche aus dem Klosterverband ausgetreten und weltlich geworden; niemand wagte sie jetzt, wenigstens im kurfürstlichen Sachsen, anzutasten, ja, sie erhielten sogar Aemter und Stellen von Stadt und Staat. Aber der Austritt von Nonnen war fast noch unerhört, jedenfalls noch sehr ungewohnt[73]. Und wenn auch das Vorurteil der Welt und der eigenen Angehörigen überwunden war, so fragte sich doch: was sollten die ausgetretenen Nonnen draußen in der Welt anfangen, was thun und werden, womit sich erhalten und durchs Leben bringen?[74]
Wenn darum also auch die meisten, wo nicht alle Nonnen in Nimbschen das Klosterleben verwarfen, so haben sich doch nur die mutigsten entschlossen, den Schritt zu thun, den sie für recht und geboten erachteten, nämlich nur diejenigen, welche vermöge ihrer Bildung selbständig sich durchs Leben zu bringen im stande waren, wie die Staupitz und Kanitz, oder die noch jung genug waren, sich in ein neues Leben zu schicken, wie die beiden Schönfeld und Katharina von Bora. Es waren in Nimbschen neun Nonnen zum Austritt bereit: Magdalena von Staupitz, Elisabeth von Kanitz, Veronika und Margarete von Zeschau, Loneta von Gohlis, Eva Große, Ave und Margarete von Schönfeld und als zweitjüngste von ihnen Katharina von Bora[75].
Diese Kloster-„Kinder“ (Nonnen) thaten nun das Naturgemäßeste und Verständigste: „sie ersuchten und baten ihre Eltern und Freundschaft (d.i. Verwandte) aufs allerdemütigste um Hülfe, herauszukommen“. Sie zeigten genugsam an, daß ihnen solch Leben der Seelen Seligkeit halber nicht länger zu dulden sei, erboten sich auch zu thun und zu leiden, was fromme (brave) Kinder thun und leiden sollen“[76].
Aber freilich den Eltern und Verwandten war das Gesuch ihrer Töchter und Basen eine Verlegenheit. Einmal: der Versorgung wegen waren ja diese Töchter ins Kloster gethan worden — wie wollte man sie nun in den armen Familien unterhalten? Ihr Erbe war schon in Wirklichkeit oder in Gedanken verteilt, wer mochte es an diese weltentrückten, gesellschaftlich toten Familienmitglieder herausgeben?[77] Ferner waren solche Klosterfrauen der Welt entfremdet und taugten gar wenig ins Leben. Wenn endlich auch nicht noch religiöse oder kirchliche Bedenken abschreckten, so war es doch noch eine andere Furcht: die Lehen der meisten Anverwandten der Klosterfrauen lagen im Lande Herzogs des Bärtigen, der ein heftiger Feind der Reformation und des Wittenberger Doktors im besonderen war. Da konnte es wegen Entführung von gottgeweihten Klosterfrauen empfindliche Strafen geben oder doch Zurücksetzung bei Hofämtern. Kurzum das Gesuch der klosterflüchtigen Nonnen wurde abgeschlagen[78].
So standen die Aermsten von jedermann verlassen da, in nicht geringer Gefahr, daß ihr Vorhaben entdeckt und gehindert, die Beteiligten aber empfindlich gestraft würden, wie es z.B. der mehrerwähnten Florentina geschah, als ihr Vorhaben, aus dem Kloster zu treten, entdeckt wurde. Diese wurde von ihrer eigenen Muhme, der Aebtissin, unbarmherzig vier Wochen bei großer Kälte härtiglich gefangen gesetzt, dann in Bann und Buße in ihre Zelle gesperrt, mußte sich beim Kirchgang platt auf die Erde werfen und die anderen Nonnen über sich hinschreiten lassen, beim Essen mit einem Strohkränzlein vor der Priorin auf die Erde setzen; dann wurde sie bei einem neuen Versuch, sich an ihre Verwandten zu wenden, durchgestäupt und „7 Mittwoch und 7 Freitage von 10 Personen auf einmal discipliniert“, in Ketten gelegt und für immer in die Zelle gesperrt — bis sie durch Unachtsamkeit ihrer Schließerin doch entkam.
Solches oder Aehnliches ist im Kloster Nimbschen mit den lutherisch Gesinnten nicht geschehen; vielleicht schützte sie ihre große Zahl vor solchen Gewaltmaßregeln. Es war aber wohl auch die Gesinnung der verständigen Aebtissin, welche eine solche Bestrafung verhinderte: Margarete von Haubitz ist ja nachher mit dem ganzen übrig gebliebenen Konvent zur Reformation übergetreten, obwohl sie mit den älteren Frauen im Kloster blieb und das Leben darin nach evangelischen Grundsätzen einrichtete. Keineswegs aber konnte und wollte sie als Aebtissin schon 1523 den Klosterflüchtigen Vorschub leisten in ihrem Vorhaben[79].
Da nun die Nonnen an den Ihrigen keinen Anhalt fanden, so hatten sie gerechte Ursache, anderswo Hülf und Rat zu suchen, wie sie es haben konnten. Sie fühlten sich ja gedrungen und genötigt, ihre Gewissen und Seelen zu retten[80]. Wo anders aber sollten sie diese Hülfe suchen, als bei dem, der sie durch seine evangelischen Schriften und geistkühne Thaten auf diese Gedanken gebracht hatte? So machten sie's also wohl, wie nach ihnen noch manche andere, einzelne und ganze Haufen von Klosterjungfrauen: sie schrieben „an den hochgelehrten Dr. Martinus Luther zu Wittenberg, einen Klage-Brief und elende Schrift, gaben ihm ihr Gemüt zu erkennen und begehrten von ihm Trost, Rat und Hülfe“[81].
Und der Ueberbringer dieses Briefes wird jedenfalls niemand anderes gewesen sein als eben Leonhard Koppe von Torgau. Luther erkannte an, daß „sie beide hier haben helfen und raten können, und darum seien sie auch schuldig, aus Pflicht christlicher Liebe die Seelen und Gewissen zu retten“[82].
„Denn es ist eine hohe Not“, erklärte er weiter, mit Bezug auf die Nimbscher Nonnen, „daß man leider die Kinder in die Klöster gehen läßt, wo doch keine tägliche Uebung des göttlichen Wortes ist, ja selten oder nimmermehr das Evangelium einmal recht gehört wird. Diese Ursach ist allein genug, daß die Seelen herausgerissen und geraubt werden, wie man kann, ob auch tausend Eide und Gelübde geschehen wären. Weil aber Gott kein Dienst gefällt, es gehe denn willig von Herzen, so folgt, daß auch keine Gelübde weiter gelten, als sofern Lust und Lieb da ist; sonst sind im Klosterleben furchtbare Gefahren, Versuchungen und Sünden“[83].
„Aber wenn sich nun schwache Seelen an solchem Klosterraub ärgern?“ konnte man einwenden.
Luther erklärte: „Aergernis hin, Aergernis her! Not bricht Eisen und hat kein Aergernis. Ich werde die schwachen Gewissen schonen, sofern es ohne Gefahr meiner Seele geschehen kann; wo nicht, so werde ich meiner Seele raten, es ärgere sich dann die ganze oder halbe Welt. Nun liegt hier der Seele Gefahr in allen Stücken. Darum soll niemand von uns begehren, daß wir ihn nicht ärgern, sondern wir sollen begehren, daß sie unser Ding billigen und sich nicht ärgern. Das fordert die Liebe!“[84]
So dachte Luther und ihm gleichgesinnt war Leonhard Koppe. An ihn stellte nun Luther das Ansinnen, die Befreiung zu übernehmen. Und Koppe war trotz seiner sechzig Jahre ein entschlossener Mann, zu einem kecken Wagnis bereit, und willigte ein; er nahm keine Rücksicht, ob es ihm im Geschäfte schaden könnte, noch weniger, ob es ihn beim Hof in Ungunst bringen oder gar ans Leben gehen könnte; denn auf Nonnenraub stand eigentlich Todesstrafe, und auch Kurfürst Friedrich, der vorsichtige Schützer Luthers mißbilligte nicht nur jede öffentliche Gewaltthat, sondern war auch geneigt, sie zu strafen. Aber trotz all dieser Bedenken war Leonhard Koppe zu der That entschlossen, und wurde darin von dem Torgauer Pfarrer D. Zwilling bestärkt; denn dieser war auch in die Sache eingeweiht[85].
Zwischen Luther und Koppe wurde so der Plan verabredet. Das Unternehmen sollte von Torgau ausgehen, welches in der Mitte zwischen Nimbschen und Wittenberg gelegen war. Die Osterzeit wurde zur Ausführung ersehen.
Koppe brauchte aber Gehülfen zur Ausführung seines Unternehmens. Er wählte dazu seines Bruders Sohn, einen verwegenen jungen Mann, und einen Bürger Wolfgang Tommitsch (oder Dommitsch), dessen Stieftochter, ein Fräulein von Seidewitz, kurz vorher aus dem Kloster entkommen war und bald darauf einen ausgetretenen Augustiner-Propst, Mag. Nikolaus Demuth heiratete, welcher dann Amtsschöffer in Torgau wurde. Mit den neun Klosterjungfrauen waren jedenfalls Verabredungen getroffen worden und sie machten sich fluchtbereit[86].
In der Karwoche brachen nun die Torgauer auf einem oder mehreren mit einer Blahe bedeckten Wagen, worin sie wohl weltliche Frauenkleider verborgen hatten, von ihrer Stadt auf. Wenn die beiden Helfer nicht eigene Wagen leiteten, so waren sie zu Pferde als Bedeckung dabei. Sie kamen über Grimma am Karsamstag abends den 4. April vor Nimbschen an[87].
Hier rüsteten sich die Nonnen in gewohnter Weise zu den Ostervigilien, welche in der Auferstehungsnacht gefeiert wurden. Die außerordentliche Zeit, wo die Regel und geordneten Beschäftigungen der Klosterfrauen aufgehoben waren, muß dem Fluchtplan günstig geschienen haben. Während die beiden Begleiter in dem nahen Gehölz gehalten haben werden, fuhr Koppe an dem Kloster vor. Er nahm, wie berichtet wird, zum Vorwand, leere Heringstonnen auf der Heimfahrt nach Torgau mitnehmen zu wollen. Beim Aufsuchen und Aufladen derselben scheint er den Thorwart Thalheim beschäftigt und die Aufmerksamkeit der übrigen Bewohner des äußern Klosterhofs, namentlich der zwei Beichtväter, abgelenkt zu haben. Aus der Klausur entkamen die neun Verschworenen, indem die Pförtnerin entweder getäuscht oder gar bei dem Plan beteiligt war (es konnte ganz gut eine von diesen neun zu dieser Zeit Thürhüterin sein). Ein alter Berichterstatter erzählt, man hätte eine Lehmwand durchbrochen; ein anderer, die Jungfrauen hätten sich im Garten versammelt und seien da über die Mauer gestiegen. Aber auch zur hinteren Thüre konnten sie entkommen sein; denn an der Bewachung dieser ließ es das Kloster fehlen. Kurzum, die Neun entflohen, wurden von den beiden Begleitern Koppes aufgenommen; dieser fuhr wohl mit seinem Wagen Heringstonnen ganz unschuldig ab und nahm dann draußen die Jungfrauen auf. Die leeren Tonnen — vorne aufgestellt — konnten ganz gut dazu dienen, den lebendigen Inhalt des Wagens vor unberufenen Augen zu verbergen[88].
Auf diese oder ähnliche Weise, jedenfalls „mit ausnehmender Ueberlegung und Schlauheit“, aber auch mit „äußerster Keckheit“ — nicht mit Gewalt wurden die neun Jungfrauen durch Koppe aus Nimbschen befreit. Luther sah es fast wie ein Wunder an[89].
Bei Nacht und Nebel fuhren nun die Retter und Geretteten davon, dem Ostermorgen entgegen: es war eine eigene Ostervigilie in der Luft der Freiheit durch die frühlingsjunge Gotteswelt[90]. Die Fahrt ging durch die kurfürstlichen Lande, war also nicht bedroht durch die Nachstellungen des lutherfeindlichen Herzogs Georg. Eine Verfolgung von Nimbschen aus war nicht gerade zu befürchten: es waren dort keine Männer, welche etwa einen Kampf mit den Entführern gewagt hätten. Auch hat der kluge Koppe gewiß ihre Spuren möglichst verdeckt und die Verfolger irre geführt. Die weltliche Kleidung, welche die Jungfrauen mittlerweile mit ihrer geistlichen vertauscht hatten, machte wohl die Reise unauffällig, und so kam der Zug auch ungehindert am Ostertag in Torgau an und wurde vom Magister Zwilling freudig empfangen. In Torgau wurde übernachtet, die weltliche Kleidung der Klosterjungfrauen in der Eile noch vervollständigt und am anderen Tag ging es Wittenberg zu, weil es doch nicht geraten schien, die Entflohenen so nahe bei dem Kloster und auch so nahe beim kurfürstlichen Hof zu lassen[91].
Am Osterdienstag kam der Zug in Wittenberg an; ohne alle Ausstattung, in ihrer geborgten und eilig zusammengerafften Kleidung, mit den geschorenen Häuptern ein „arm Völklein“, aber in ihrer großen Armut und Angst ganz geduldig und fröhlich[92].
Luther empfing sie mit wehmütiger Freude. Den kühnen aber rief er zu: „Ihr habt ein neu Werk gethan, davon Land und Leute singen und sagen werden, welches viele für großen Schaden ausschreien: aber die es mit Gott halten, werden's für großen Frommen preisen. Ihr habt die armen Seelen aus dem Gefängnis menschlicher Tyrannei geführt eben um die rechte Zeit: auf Ostern, da Christus auch der Seinen Gefängnis gefangen nahm“[93]. Als dann die Befreier heimfuhren, empfahl er sie Gott und gab ihnen Grüße mit an Koppes „liebe Audi“ und „alle Freunde in Christo“[94].
Drei Tage darauf schrieb Luther zur Verantwortung für sich, für den „seligen Räuber“ Koppe und die es mit ihm ausgerichtet, sowie für die befreiten Jungfrauen zum Unterricht an alle, die diesem Exempel wollten nachfolgen „dem Fürsichtigen und Weisen Leonhard Koppe, Bürger zu Torgau, meinem besonderen Freunde“ einen offenen Brief. „Auf daß ich unser aller Wort rede, für mich, der ich's geraten und geboten, und für Euch und die Euern, die Ihr's ausgericht, und für die Jungfrauen, die der Erlösung bedurft haben, will ich hiermit in Kürze vor Gott und aller Welt Rechenschaft und Antwort geben“. In dieser „Ursache und Antwort, daß Jungfrauen Klöster göttlich verlassen mögen“ berichtet er offen die That und ihre Gründe und nennt die Namen der Befreier und Befreiten. Er sagt ihnen:
„Seid gewiß, daß es Gott also verordnet hat und nicht Euer eigen Werk noch Rat ist, und lasset das Geschrei derjenigen, die es für das allerärgste Werk tadeln. ‚Pfui, pfui!‘ werden sie sagen, ‚der Narr Leonhard Koppe hat sich durch den verdammten ketzerischen Mönch fangen lassen, fährt zu und führt neun Nonnen auf einmal aus dem Kloster, und hilft ihnen, ihr Gelübde und klösterlich Leben zu verleugnen und zu verlassen‘. Meint ihr, das ist all heimlich gehalten und verborgen? Ja, verraten und verkauft, daß auf mich gehetzt werde das ganze Kloster zu Nimptzschen, weil sie nun hören, daß ich der Räuber gewesen bin! Daß ich aber solches ausrufe und nicht geheim halte, thue ich aus redlichen Gründen. Es ist durch mich nicht darum angeregt, daß es heimlich bleiben sollte, denn was wir thun, thun wir in Gott und scheuen uns des nicht am Licht. Wollte Gott, ich könnte auf diese oder andere Weise alle gefangenen Gewissen erretten und alle Klöster ledig (leer) machen. Ich wollt mich's darnach nicht scheuen, zu bekennen samt allen, die dazu geholfen hätten, (in) der Zuversicht, Christus, der nun sein Evangelium an Tag gebracht, und des Endechrists (Antichrists) Reich zerstört, würde hier Schutzherr sein, ob's auch das Leben kosten müßte. Zum anderen thu ich's, der armen Kinder und ihrer Freundschaft (Verwandtschaft) Ehren zu erhalten, daß niemand sagen darf, sie seien durch lose Buben unredlich ausgeführt und ihrer Ehre sich in Gefahr begeben. Zum dritten, zu warnen die Herrn vom Adel und alle frommen Biederleute, so Kinder in Klöstern haben, daß sie selbst dazu thun und sie herausnehmen“[95].
Diese Aufforderung und die gelungene Flucht der neun Nonnen ermutigte, wie Luther gedacht, noch andere Klosterjungfrauen und deren Eltern zu gleichem. Noch in derselben Osterwoche entwichen abermals drei Nonnen aus Nimbschen und kamen zu ihren Angehörigen, und zu Pfingsten wurden wieder drei von ihren Verwandten selbst aus dem Kloster geholt[96].
Da endlich ermannte sich der Abt von Pforta, der dem offenen Brief Luthers nicht entgegenzutreten gewagt hatte, — Luther war ein zu gefürchteter Kämpe. Am 9. Juni schrieb er eine Klage an den — Kurfürsten über diese Vorgänge, welche zur „Entrottung und Zerstörung des Klosters“ führten, und beschwerte sich, daß die Nonnen von Sr. Kurf. Gn. Unterthanen dazu geholfen und gefördert worden seien. Der Kurfürst Friedrich gab in seiner bekannten diplomatischen Weise die ausweichende Antwort: „Nachdem Wir nit wissen, wie diese Sache bewandt und wie die Klosterjungfrauen zu solch ihrem Furnehmen verursacht und Wir uns bisher dieser und dergleichen Sachen nie angenommen, so lassen Wir's bei ihrer selbst Verantwortung bleiben“[97].
Aber damit war die Klosterflucht in Nimbschen nicht zu Ende. Bis 1526 waren einige zwanzig — auch Magdalena von Bora — ausgetreten, so daß jetzt nur noch 19 Klosterjungfrauen da waren; und diese samt ihrer Aebtissin wurden evangelisch, blieben aber im Kloster, bis sich der Konvent im Jahre 1545 auflöste[98].
Drei Wochen nach der Flucht der neun Nimbscher Nonnen, am 28. April, wagten sechs Nonnen aus Sornzig die Flucht, trotzdem dies Kloster im Lande des Reformationsfeindes Herzogs Georg lag, und trotz des schrecklichen Schicksals, das um diese Zeit den Entführer einer Nonne betroffen hatte, der zu Dresden geköpft worden war. Und weitere acht flohen aus Peutwitz[99].
Im selben Jahre der Flucht Katharinas traten noch 16 Nonnen in Widderstetten auf einmal aus. Zwei Jahre darauf wandten sich wieder andere „elende Kinder“ an Luther aus dem fürstlichen Kloster Freiberg im Gebiete seines grimmen Feindes, Herzogs Georg. Und wieder wandte sich Luther an den bewährten Nonnen-Entführer Leonhard Koppe, den er scherzweise „Würdiger Pater Prior“ anredet. Luther wußte, daß diese Zumutung fast zu viel und zu hoch sei — es konnte ja diesmal ernstlich das Leben kosten — und meinte, Koppe wisse vielleicht jemand anderes, der dazu helfen könnte. Aber der verwegene Mann ließ sich um ein solches wagehalsiges Stück schwerlich vergebens bitten und — zu Georgs allerhöchstem Verdruß — glückte das Wagestück, wie die Entführung aus Nimbschen[100].
4. Kapitel
Eingewöhnung ins weltliche Leben.
Nachdem die Befreiung Katharinas und ihrer Mitschwestern so gut gelungen war, fragte es sich nun, was sollte mit ihnen werden?
Die Sorge blieb an Luther hängen. Nochmals wandte er sich an die Angehörigen der Entflohenen und wird ihnen die Gewissen genugsam geweckt und ihre Pflicht eingeschärft haben, sich ihrer erbarmungswerten Töchter, Schwestern und Basen anzunehmen; das geht aus dem offenen Brief an Koppe und einem anderen an Spalatin hervor, worin es heißt: „O, der Tyrannen und grausamen Eltern in Deutschland!“[101]
Zugleich aber hatte er den Fall vorgesehen, daß die Verwandten, wenigstens zum Teil, ablehnten, für die Nonnen zu sorgen. Daher überdachte er, wie er sie unterbringen könnte. Aber von seinen „Kapernaiten“ (den Wittenbergern) konnte und wollte er keine Geldunterstützung oder Anleihe erhalten; dagegen erhielt er von mehreren Seiten Versprechungen, den Geflüchteten eine Unterkunft zu bieten. Etliche wollte er auch, wenn er könne, verheiraten. Amsdorf schrieb scherzend an Spalatin: „Sie sind schön und fein, und alle von Adel, und keine fünfzigjährige darunter. Die älteste unter ihnen, meines gnädigen Herrn und Oheims Dr. Staupitz Schwester, hab ich Dir, mein lieber Bruder, zugerechnet zu einem ehelichen Gemahl, damit Du Dich mögest eines solchen Schwagers rühmen. Willst Du aber eine jüngere, so sollst Du die Wahl unter den Schönsten haben“[102].
Bis dahin bat Luther und ebenso Amsdorf den Hofkaplan und Geheimschreiber des Kurfürsten Friedrichs des Weisen, „dieser ehrbaren Meidlein Vorbitter am Hofe zu sein und ein Werk der Liebe zu thun, und bei den reichen Hofleuten und vielleicht dem Kurfürsten etwas Geld zu betteln, auch wohl selbst etwas zu geben, damit die Geflüchteten einstweilen genährt und auf acht bis vierzehn Tage, auch mit Kleidung versehen werden könnten, denn sie hatten weder Schuhe noch Kleider.“ Luther ging es nämlich damals so schlecht, daß er selbst kaum etwas zu essen hatte und sein Mitbruder, der Prior Brisger, einen Sack Malz schuldig bleiben mußte: so sehr blieben die Klostereinkünfte aus, auf die Luther und der letzte mit ihm lebende Mönch angewiesen war. Er scherzt mit Beziehung auf seinen Bettelorden: „Der Bettelsack hat ein Loch, das ist groß“. Freilich der Hof des vorsichtigen Kurfürsten wollte nicht recht, wenigstens nicht offen mit Unterstützungen herausrücken, weshalb Luther seinen Freund nochmals mahnen mußte: „Vergeßt auch meiner Kollekte nicht und ermahnt den Fürsten um meinetwillen auch etwas beizusteuern. O, ich will's fein heimlich halten und niemanden sagen, daß er etwas für die abtrünnigen Jungfrauen gegeben — die doch wider Willen geweihet und nun gerettet sind“[103].
Luthers Appell an die Verwandten verfing nicht. Er mußte klagen: „Sie sind arm und elend und von ihrer Freundschaft verlassen.“ Luther mußte also trotz seiner großen Armut die Nonnen mit großem Aufwand unterstützen. Sonst erfuhr er, „was sie draußen von ihren Verwandten und Brüdern leiden müßten“ — wenn etwa eine nach Hause käme. Sie wollten meist auch nicht zu ihrer „Freundschaft“, weil sie in Herzog Jörgs Land des göttlichen Wortes Mangel haben müßten[104].
Magdalena Staupitz wurde mit der Zeit als „Schulmeisterin“ der Mägdlein in Grimma gesetzt, und ihr ein Häuslein vom Mönchskloster gegeben. Die Elsa von Kanitz fand bei einer Verwandten Aufenthalt; Luther wollte sie 1527 als Schulmeisterin der Mägdlein nach Wittenberg berufen. Die Ave von Schönfeld verheiratete er mit dem Medikus Dr. Basilius Axt[105].
Katharinas Verwandte konnten sich ihrer offenbar nicht annehmen. Die Eltern waren tot, Bruder Hans mußte selber Dienste suchen im fernen Preußen, dann Verwalterstellen in Sachsen. Der älteste Bruder war arm verheiratet, hatte wohl keinen Platz für die Schwester; vom jüngsten, Clemens, war vollends nichts zu erwarten.
So wurde denn das Fräulein Katharina von Bora nach der Ueberlieferung im Hause eines Wittenberger Bürgers untergebracht, der in der Bürgermeistergasse wohnte. Es war der ehrsame gelehrte M. Philipp Reichenbach, welcher 1525 in Wittenberg Stadtschreiber, 1529 Licentiat der Rechte, 1530 Bürgermeister und endlich Kurfürstlicher Rat wurde[106].
In dem Wittenberger Bürgerhause wurde die ehemalige Nonne mehr als eine Art Pflegetochter gehalten und der Hausherr vertrat Vaterstelle an ihr. Sie muß dort doch eine angesehene Stellung eingenommen haben. Sie war bekannt und genannt im Kreise der Universitätsgenossen, und der Dänenkönig Christiern II., der landesflüchtig im Oktober 1523 nach Wittenberg kam und bei dem Maler Lukas Kranach Wohnung hatte, beschenkte Katharina mit einem goldenen Ringe. Die jungen Gelehrten in Wittenberg sprachen mit Achtung von ihr; sie nannten sie in ihren vertrauten Briefen, wohl wegen ihrer strengen Zurückhaltung, „die Katharina von Siena“[107].
Bei dem Stadtschreiber, oder vielmehr bei seiner Frau, sollte nun Katharina von Bora sich eingewöhnen in das neue oder vielmehr alte „weltliche“, das bürgerliche Leben.
Das war nicht so gar leicht. Mindestens vierzehn Jahre lang, also fast ihr ganzes bewußtes Leben, hatte Katharina im Kloster zugebracht. Alle diese Jahre hatte sie die geistliche Tracht getragen, sich an nonnenhafte Gebärde und Haltung, an geistliche Sitten und Reden gewöhnt; den Umgang mit weltlichen Menschen hatte sie verlernt oder eigentlich nie recht gelernt, und ebenso die Arbeit, das Hantieren in Stube und Küche; in der That, man begreift, daß der praktische Luther beim Anblick der neun weltunerfahrenen Nonnen ausrufen konnte: „Ein armes Völklein“! Wie in die weltliche Kleidung mußte Katharina sich nun an weltliche Sitte und Rede gewöhnen; wie ihr bleiches Gesicht sich an Luft und Sonne bräunen, ihre zarten Hände im Angreifen von Töpfen und Besen sich härten, so mußte auch ihr geistiges Wesen an den rauheren, aber gesünderen Anforderungen und Zumutungen der Welt sich kräftigen. Aber wie ihre abgeschnittenen Haare zu langen blonden Zöpfen wuchsen, so nahm auch Sorgen und Denken an die kleinen weltlichen Pflichten und die großen weltlichen Interessen zu.
Und das gnädige Fräulein war nicht umsonst bei der Frau Magister. Sie wurde hier tüchtig vorgeschult für ihren späteren großen pflichtenreichen Haushalt. Und sie hat sich auch nach dem Zeugnis der Wittenberger Universität in dem Hause Reichenbach „stille und wohl verhalten“[108].
Aber auch andere Gedanken und Gefühle erwachten in ihr und wurden ihr von außen nahe gelegt. Und auch hier machte sie Erfahrungen und erfuhr sie schmerzliche Enttäuschungen, die sie weltkluger und vorsichtiger machten.
Katharina war jetzt 24 Jahre alt, eine reife, ja nach den Anschauungen jener Zeit, welcher das 15. bis 18. Lebensjahr einer Jungfrau für das richtigste heiratsfähige Alter galt, eine überreife Jungfrau. Daß sie an Verehelichung dachte, ist begreiflich. Denn sie hatte weder eine Stellung noch Vermögen. Der Aufenthalt bei ihren Pflegeeltern konnte doch nur ein vorübergehender und nicht befriedigender sein. Luther, der die besondere Sorge für diese, wie für andere ausgetretene Klosterleute übernommen, hatte ohnedies schon von Anfang die ausgesprochene Absicht, diejenigen, welche in ihren Familien keinen Unterhalt und Aufenthalt finden konnten, zu verheiraten. Und seine gesamte Anschauung ging dahin — darin hatte er die echt bäuerliche Ansicht seines Vaters — daß der Mensch zum Familienleben geboren und gerade das Weib von Gott zur Ehe bestimmt sei[109].
Nun kam damals im Mai oder Juni 1523 in die Universitätsstadt Hieronymus Baumgärtner, ein Patriziersohn aus Nürnberg, „ein junger Gesell mit Gelehrsamkeit und Gottseligkeit begabt“. Er hatte früher (1518-21) in Wittenberg studiert und bei Melanchthon seinen Kosttisch gehabt und wollte jetzt seine alten Lehrer und Freunde in Wittenberg: Luther und besonders Melanchthon besuchen, mit dem er später in regem Briefwechsel stand[110]. Dieser junge Mann erschien Luther als der rechte Gatte für seine Schutzbefohlene: er war 25 Jahre alt, Käthe 24, beide aus vornehmem Hause; sie ohne Vermögen, um so mehr paßte in Luthers Augen der wohlhabende Nürnberger für sie. Und er wird wohl dafür gesorgt haben, daß Baumgärtner an sie heran kam und an ihr Wohlgefallen fand. Auch Käthe faßte eine raschaufwallende Neigung für den jungen Mann, war er ja wohl der erste, der sich der gewesenen Nonne näherte. Vielleicht haben sich die beiden auch zuerst gefunden, und Luther betrieb es nun in seiner Art eifrig, die zwei zusammenzubringen. Jedenfalls wurde die gegenseitige Neigung in dem Freundeskreise bekannt, und man hielt da die Heirat für sicher.
Aber Baumgärtner zog heim nach Nürnberg und ließ nichts mehr von sich hören, trotzdem er versprochen hatte, nach ein paar Wochen wieder zu kommen, um, wie man glaubte, Katharina heimzuführen. Die Freunde, besonders Blickard Syndringer, erinnerten den Patriziersohn in ihren Briefen neckend oft genug an die verlassene Geliebte. Sie sei wegen seines Weggangs in eine Krankheit verfallen und habe sich in Sehnsucht nach ihm verzehrt. Im Anfang des folgenden Jahres bestellte noch der Nürnberger Ulrich Pinder von Wittenberg aus an Baumgärtner einen Gruß von „Katharina von Siena d.i. von Borra“. Endlich schrieb Luther noch einmal am 12. Oktober 1524 an Baumgärtner: „Wenn Du Deine Käthe von Bora festhalten willst, so beeile Dich, bevor sie einem andern gegeben wird, der zur Hand ist. Noch hat sie die Liebe zu Dir nicht verwunden. Und ich würde mich gar sehr freuen, wenn ihr beide mit einander verbunden würdet“[111].
Aber den Eltern Baumgärtners war offenbar die entlaufene Nonne anstößig, und daß sie vermögenslos war, konnte sie erst recht nicht empfehlen. Daher ging Hieronymus auf dieses Ultimatum des Freiwerbers Luther nicht ein. Als er im Frühjahr 1525 in Nürnberg Ratsherr geworden war, verlobte er sich mit einem Mädchen von 14 Jahren, Sibylle Dichtel von Tutzing „mit sehr reicher Mitgift und was ihm noch erwünschter war, von sehr angesehenen Eltern“ und hielt mit ihr am 23. Januar 1526 in München die Hochzeit[112].
Da aber Baumgärtner Katharina endgiltig aufgegeben hatte, so rückte Luther nun mit dem andern Heiratskandidaten heraus, den er für Käthe an der Hand hatte. Das war D. Kaspar Glatz, der am 27. August 1524 von der Universität Wittenberg, deren Rektor er damals war, sich auf ihre Patronatspfarrei Orlamünde hatte setzen lassen. Luther ging nun damit um, seine Schutzbefohlene dem D. Glatz zu freien. Aber Käthe, welche den Mann während seiner Lehrzeit in dem kleinen Wittenberg kennen gelernt hatte, wollte ihn nicht haben, und sie hatte ein richtigeres Gefühl als Luther. Glatz war, wie sich später herausstellte, ein rechthaberischer, eigensinniger Mensch, der Streitigkeiten mit seiner Gemeinde bekam und deshalb entsetzt werden mußte. Luther aber setzte Käthe mit der Heirat zu. Da ging sie zu Luthers Amtsgenossen, dem Professor Amsdorf und beklagte sich, daß Luther sie wider ihren Willen an D. Glatz verheiraten wolle; nun wisse sie, daß Amsdorf Luthers vertrauter Freund sei; darum bitte sie, er wolle bei Luther dies Vorhaben hintertreiben.
Hier scheint nun Amsdorf, der diese Ablehnung für adeligen Hochmut auslegte, bemerkt zu haben: Ob ihr denn ein Doktor, Professor oder Pfarrherr nicht gut genug sei? denn Katharina wurde zu der Erklärung gedrängt: Würde Amsdorf oder Luther sie zur Gattin begehren, so wolle sie sich nicht weigern, D. Glatz aber könne sie nicht haben[113].
Diese Aeußerung, welche wohl ohne viel Absicht gesprochen war, hatte ihre Folgen; zwar nicht für Amsdorf, der immer ehelos blieb, aber für Luther. Auch er hatte die Bora „für stolz und hoffärtig“ gehalten, während sie doch nur etwas Zurückhaltendes hatte und ein gewisses Selbstbewußtsein zeigte; er hatte sie also nicht recht gemocht. Durch jene Erklärung an Amsdorf wurde er aber auf andere Gedanken gebracht[114].
5. Kapitel.
Katharinas Heirat.
So machte Luther bei Käthe von Bora, aber auch bei anderen Nonnen den Freiwerber; er that es aber auch in seinen Schriften, worin er den Ehestand so hoch pries und jedermann dazu einlud. Daher scherzte er in einer Epistel an Spalatin: „Es ist zu verwundern, daß ich, der ich so oft von der Ehe schreibe und so oft unter Weiber komme, nicht längst verweibischt oder beweibt bin.“ Und mehr im Ernst: „Ich dränge andere mit so viel Gründen zur Ehe, daß ich beinahe selbst dazu bewegt werde“[115].
Wenn Luther so eifrig zur Ehe riet, so hatte er dabei vor allem seine Amtsgenossen im Auge. Denn bis zur Reformation war es nicht nur Sitte, sondern sogar Gesetz, daß Universitätslehrer sich nicht verehelichten: so sehr wurden die Schulen, auch die Hochschulen als kirchliche, ja geistliche Anstalten angesehen und die „geistigen“ Personen als „Geistliche“. Nur beschränkte Ausnahmen wurden allmählich mit der Verehelichung gestattet für Mediziner und Juristen; Rektor konnte lange Zeit, auch in Wittenberg, nur ein unverehelichter Professor werden. Die Gelehrten aber betrachteten auch ihrerseits die Ehe als eine Erniedrigung für ihren hohen Stand. Darum hat Luther nur mit Mühe den Gelehrten Melanchthon zur Heirat vermocht[116].
Daß aber die eigentlichen Geistlichen, die Priester, heirateten, das war vor Luther, seit Gregor des Siebenten Zeiten, das heißt seit sechsthalbhundert Jahren etwas Unerhörtes. Gerade aber darauf hat nun Luther allmählich in seinen vielen Schriften gedrungen, um zu zeigen daß im Christentum der geistliche Stand nichts Besonderes sei, daß vielmehr alle, die aus der Taufe gekrochen, Bischöfe und Pfarrer wären, und umgekehrt die Geistlichen nichts anders als Christenmenschen. So hat er all seine geglichen Freunde zur Ehe gedrängt und ihnen dazu mit Eifer verholfen; auch den Hochmeister von Preußen und den Erzbischof von Mainz. Er wollte sozusagen für seine Anschauung vom allgemeinen Priestertum und dem hl. Ehestand, wie der falschen Heiligkeit des Cölibats den Massenbeweis mit Tatsachen führen. So mahnt er Spalatin (Ostern 1525): „Warum schreitest Du nicht zur Ehe? Es ist möglich, daß ich selbst dazu komme, wenn die Feinde nicht aufhören diesen Lebensstand zu verdammen und die Klüglinge ihn täglich belächeln!“[117]
Der Gedanke, daß auch Klosterleute ehelich werden sollten, war Luther anfangs befremdend: galt dies doch nach der Anschauung der Zeit so sakrilegisch, daß die weltlichen Rechte Heiraten von Mönchen und Nonnen mit dem Tode bestraften[118]. Von der Wartburg schrieb Luther (am 6. August 1521): „Unsere Wittenberger wollen sogar den Mönchen Weiber geben? Nun mir sollen sie wenigstens keine Frau aufdringen,“ und mit Melanchthon scherzt er, ob dieser sich wohl an ihm dafür rächen wolle, daß er ihm zu einer Frau verholfen habe? er werde sich aber zu hüten wissen. Doch nach wenigen Monaten hatte er sich überzeugt: „Das ehelose Leben in Klöstern ist auch der geistlichen Freiheit zuwider. Darum, wo du nicht frei und mit Lust ehelos bist und mußt es allein um Scham, Furcht, Nutz oder Ehre willen, da laß nur bald ab und werde ehelich.“ So versorgte er nun auch Mönche und Nonnen in den Ehestand[119].
Aber wie er selber nur spät, — am spätesten unter den Brüdern — dazu kam, sein Klosterleben aufzugeben, seine Kutte — als die letzte zerschlissen war — im Oktober 1524 mit dem Priesterrock und Professorentalar vertauschte, so erging es ihm auch mit dem Heiraten. 1528 sagte er: „Wenn mir jemand auf dem Wormser Reichstag gesagt hätte, nach 7 Jahren würde ich Ehemann sein, der Frau und Kinder habe, so hätte ich ihn ausgelacht“. Gerade wenn ihm seine Freunde und Freundinnen wie Argula von Grumbach zuredeten oder davon sprachen, er werde doch noch heiraten, erklärte er das für Geschwätz. Noch am 30. November 1524 meinte er, bei seiner bisherigen und jetzigen Gesinnung werde er keine Frau nehmen, sein Gemüt passe nicht zum Heiraten, er fühle sich dazu nicht geschickt. Ja noch Ostern 1525 schreibt er, daß er an keine Ehe denke[120].
Aber bald nach Ostern wurde er anderen Sinnes.
Es war gerade die böse Zeit der Bauernunruhen, wo radikale Schwärmer die Sache der Reformation aufs äußerste gefährdeten, die Zeit, wo die Feinde mit gehässiger Schadenfreude auf ihn wiesen, und die Freunde mit ängstlicher Sorge nach ihm schauten; es war damals, da er umherzog die fanatischen Bauernhaufen zu beschwichtigen und dabei zweimal in Fährlichkeiten des Todes gewesen, als er überhaupt dem Tode entgegen sah[121]. Da erklärte er: „Münzer und die Bauern haben dem Evangelium bei uns so sehr geschadet und die Papisten so übermütig gemacht, daß es fast aussieht, als müsse man das Evangelium wieder ganz von vorn predigen.“ Deshalb wollte er's nunmehr „nicht mit dem Wort allein, sondern mit der That bezeugen“. Er wollte mit seinem Beispiel seine Lehre bekräftigen, weil er so viele kleinmütig finde, und so auch dem zaghaften Erzbischof von Mainz zum Exempel voran traben. Er war im Sinne, ehe er aus diesem Leben scheide, sich im gottgeschaffenen Ehestande finden zu lassen und „nichts von seinem vorigen papistischen Leben an sich zu behalten“, und sei es auch nur eine verlobte Josephsehe: auf dem Todbett wollte er sich ein fromm Mägdlein antrauen lassen und ihr zum Mahlschatz seine zwei silbernen Becher reichen. Als er gar von Dr. Scharf das Wort hörte: „Wenn dieser Mensch ein Weib nähme, so würde die ganze Welt und der Teufel selber lachen und er all seine Sach damit verderben“, da entschloß er sich erst recht: „Kann ich's schicken, so will ich dem Teufel zum Trotz noch heiraten, und die Engel sollen sich freuen und der Teufel weinen.“ Endlich drängte ihn auch sein Vater, mit dem er auf seinen damaligen Reisen zusammentraf, seinen größten Lieblingswunsch zu erfüllen, und Luther wollte „diesen letzten Gehorsam seinem geliebenden Vater nicht weigern“[122].
Und gerade eine Nonne sollte die Erwählte sein, „dem Teufel mit seinen Schuppen, den großen Hansen, Fürsten und Bischöfen zum Trotz, welche schlechterdings unsinnig werden wollen, daß geistliche Personen freien“. Und nicht nur den großen Hansen, sondern auch dem großen Haufen zum Trotz, welcher nach seinem Aberglauben den Sohn eines Mönchs und einer Nonne für den Antichrist hielt. Also wollte er „mit der That das Evangelium bezeugen, zum Hohn für alle, welche triumphieren und Ju, ju schreien, und eine Nonne zum Weibe nehmen“[123]. Diese Nonne aber sollte Katharina von Bora sein.
Sie war noch immer unversorgt im Reichenbachschen Hause, und er konnte an ihr ein Werk der Barmherzigkeit thun. Sie hatte erklärt, sie werde ihn nehmen, wenn er sie wolle. Und er hatte mittlerweile eine bessere Meinung von ihr gewonnen.
Daß Käthes außerordentliche Schönheit ihn in Feuer gesetzt habe, sagten ihm seine Gegner in gehässiger Absicht nach. Luther redet nur einmal und in ziemlich später Zeit in einem Brief an seine Gattin, in ritterlich schalkhafter Weise davon, daß er „daheim eine schöne Frau“ habe. Ausdrücklich aber erklärt er, in den ersten Tagen seiner Ehe, daß er nicht verliebt sei oder voll leidenschaftlichen Feuers, aber er habe seine Frau gern. Sie war ja auch gar nicht besonders schön. Von körperlicher Schönheit zitierte Luther den Reim:
Ist der Apfel rosenrot, Ist ein Würmlein drinnen, Ist das Maidlein säuberlich, So hat's krause Sinnen.
Und da ihm ein heiratslustiger Freund einmal sagte, er möchte eine Schöne, Fromme, (d.h. Brave) und Reiche, so bemerkte Luther: „Ei, ja, man soll dir eine malen mit vollen Wangen und weißen Beinen; dieselben sind auch die frömmsten, aber sie kochen nicht wohl und beten übel“[124].
So traf er in der Stille und ohne leidenschaftliche Erregung seine Wahl. Am 16. April scherzt er gegen Spalatin, daß er ein gar arger Liebhaber sei: „Drei Frauen habe ich zugleich gehabt und sie so wacker geliebt, daß ich zwei verloren habe, welche andere Verlobte nahmen, und die dritte halte ich kaum am linken Arme, die mir vielleicht auch bald weggenommen wird“[125].
Er hatte also doch bestimmte Persönlichkeiten ins Auge gefaßt.
Schon am 4. Mai, nach einem Besuche bei seinen Verwandten in Eisleben und Mansfeld, redet er in einem vertrauten Briefe an seinen Schwager Rühel zu Mansfeld von „meiner Käthe“, die er nehmen wolle, so er's schicken könne. Und wie seinen Schwager, hat er jedenfalls auch seine Eltern in seine Pläne eingeweiht, und der Vater redete ihm ernstlich zu[126]. In Wittenberg selbst aber vertraute er es nur wenigen Leuten an: dem Maler und Ratsherrn Lukas Kranach und seiner Frau. Gerade seinen Amtsgenossen und übrigen Freunden, vor allem auch Melanchthon, sagte er nichts davon. Die Klugen wollten für ihn gerade nicht, was Luther wollte: eine Nonne, und dachten und redeten über eine Mönchs- und Nonnenheirat „lieblos“. Und ganz besonders war ihnen Katharina von Bora nicht recht; alle seine besten Freunde schrieen: „Nicht diese, sondern eine andere!“ Und wohl um es zu verhindern, brachten „böse Mäuler“ sogar eine boshafte Nachrede auf. Aber gerade das bewog Luther, der Sache rasch ein Ende zu machen, bevor er die gegen ihn aufgebrachten Mäuler zu hören genötigt würde, wie es zu geschehen pflegt, und „weil der Satan gern viel Hindernis und Gewirrs mache durch böse Zungen“[127]. Er „betete zu unserm Herrn Gott mit Ernst“, wie er berichtet, und handelte dann ohne Menschen-Rat und -Bedenken, ja wie Melanchthon klagt, ohne seinen Freunden etwas davon zu sagen[128].
Mit Katharina hatte sich Luther jedenfalls ins Einverständnis gesetzt: wenn er schon wochenlang schreiben konnte „Meine Käthe“, so mußte sie doch von seinen Absichten wissen.
Daß Käthe an Martin Luther auch ein rein menschliches Gefallen fand, begreift sich. Er war wohl schon 42 Jahre alt und 16 älter wie sie selbst. Aber ein Zeitgenosse bezeugt: „Ein fein klar und tapfer Gesicht und Falkenaugen hatte er und war von Gliedmaßen eine schöne Person. Er hatte auch eine helle feine reine Stimme, beides zu singen und zu reden, war nicht ein großer Schreier“. Auch einem edeln, feineren Geschmack mußte der ehemalige Mönch und Bauernsohn zusagen: er hielt etwas auf ein ansprechendes Aeußere und wegen seiner Sorgfalt in der Kleidung nannten ihn sogar seine Gegner tadelnd einen „feinen Hofmann“, denn er trug „Hemden mit Bändelein“, hatte einen Fingerring und gelbe Stiefel[129].
Dabei war Luther für alles Schöne in Kunst und Natur eingenommen, ein guter Sänger und „Lautenist“, heiteren Sinnes und fröhlicher Laune.
Aber noch mehr mußte Luthers Gemütsart einem weiblichen Wesen zusagen: er war bei aller Heftigkeit doch gutmütig, bei aller Halsstarrigkeit lenkbar wie ein Kind, bei aller Derbheit doch sinnig und feinfühlig. Dabei war er „ein frommer (guter) Mann“, der sein Weib herzlich lieb haben konnte, und in dessen Besitz, wie er selber sagte, eine Frau sich als Kaiserin dünken dürfte[130].
Freilich auch die äußere Stellung, welche Luthers Gemahlin einnahm, mußte einen hochstrebenden Sinn reizen. Das Doktorat war in dieser Humanistenzeit noch höher gewertet als heutzutage die akademische Professur, es stand mindestens dem Adel gleich. Der einfachste Doktor, der vom Bauern- und Handwerkerstand sich emporgearbeitet hatte, wurde von adeligen Jungfrauen als wünschenswerter Ehegenosse begehrt, sodaß eine große Anzahl Professorenfrauen in Wittenberg von Adel waren. Und gar Luthers Gattin zu heißen, des gefeiertsten Mannes nicht nur in ganz Wittenberg, sondern in der ganzen Christenheit, mußte einem Weibe von Selbstgefühl schmeicheln, wenn es sich auch umgekehrt sagen mußte, daß mit der Größe des Mannes auch all der Haß und die Beschimpfung mit in Kauf zu nehmen, welche ihm die Feinde entgegenbrachten. Es war auch ein gewagtes Unternehmen, einen solchen außerordentlichen Mann zu befriedigen, des Gewaltigen ebenbürtige Lebensgefährtin zu werden. Jungfer Käthe hatte den Mut wie das Selbstbewußtsein dazu.
So weigerte sich Käthe der Annäherung Luthers nicht.
Die förmliche Bewerbung Luthers ist wahrscheinlich erst Dienstag den 13. Juni geschehen, natürlich im Reichenbachschen Hause. Ein späterer Bericht sagt, daß Käthe überrascht war und anfänglich nicht gewußt, ob es Luthers Ernst sei, dann aber eingewilligt habe. Gleich abends am selben Tage war die Trauung oder „das Verlöbnis“, entweder ebenfalls beim Stadtschreiber oder möglicherweise in Luthers Behausung im Kloster. Auf die Zeit des Nachtmahls lud der Doktor den Stadtpfarrer Bugenhagen und den Stiftspropst Jonas, den Juristen Apel und den Ratsherrn und Stadtkämmerer Meister Lukas Kranach und seine Frau — Melanchthon war nicht dabei — was Jonas ausdrücklich als auffällig hervorhebt: er war so ängstlich über diesen Schritt seines großen Freundes, daß er nicht zu diesem Akt paßte. Auch seinen Freund Dr. Hier. Schurf konnte Luther nicht zu seinem Rechtsbeistand wählen, weil dieser Lehrer des bürgerlichen und kirchlichen Rechts allerlei juristische Bedenken hatte gegen die Priesterehe[131].
Die Trauung geschah nach den herkömmlichen Bräuchen[132]: der Rechtsgelehrte vollzog die rechtlichen Formalitäten, den schriftlichen Ehevertrag, er (oder Bugenhagen) fragte im Beisein der Zeugen den Bräutigam, ob er die Braut zum Weibe nehmen und die Braut, ob sie den Mann zum ehelichen Gemahl haben wollte. Dann gab der Pfarrer sie beide mit Gebet und Segen zusammen. Darauf folgte ein kleines Abendessen und dann das Beilager: Braut und Bräutigam wurden zum Brautbett geführt, lagerten sich darauf unter einer Decke und damit war die Ehe gültig[133].
Das war Luthers „Gelöbnis“, wie es in der Wittenberger Redeweise hieß. Jonas konnte sich beim Anblick der Verlobten auf dem Brautlager nicht enthalten, Thränen zu vergießen, so sehr war er bewegt. Aber auch die Gemüter der anderen waren gewiß in großer Bewegung, nicht zum wenigsten Luther und Käthe[134].
Am folgenden Morgen, Mittwoch, gab Luther den Freunden ein kleines Mittagsmahl, das damals um 10 Uhr stattfand. Da mittlerweile die Vermählung in dem kleinen Wittenberg rasch bekannt geworden war, so sandte der Stadtrat einen Ehrentrunk von einem Stübchen (= 4 Maß) Malvasier, einem Stübchen Rheinwein und anderthalb Stübchen Frankenwein[135].
„Das Gelöbnis“ war aber nach damaliger Sitte nicht die „Beilage“ oder öffentliche Hochzeit; diese folgte erst später mit öffentlichem Kirchgang und der „Wirtschaft“ (d.i. Hochzeitsschmaus) und feierlicher Heimführung der „Jungfer Braut“. Vierzehn Tage nach der Trauung, Dienstag den 27. Juni, folgte nun bei Luther dieses hochzeitliche Mahl und „Heimfahrt“, denn das junge Ehepaar und seine Freunde wollten nicht nur die Sitte ehren, sondern gerade recht auffällig in öffentlicher Feierlichkeit vor der Welt ihren heiligen Ehestand ehrenvoll bezeugen. Dazu lud der Doktor seine Eltern und seinen Schwager Dr. Rühel in Mansfeld nebst noch zwei Mansfeldischen Räten, Johann Dürr und Kaspar Müller, ferner den Hofkaplan M. Spalatin und den Pfarrer Link in Altenburg, den kühnen Befreier der Nonnen Leonhard Koppe als „würdigen Vater Prior“, den Kurfürstlichen Hofmarschall Dr. Johann von Dolzig, vor allem aber den Superintendenten („Bischof“) Amsdorf in Magdeburg u.a.[136].
Die mit Scherz und Ernst gewürzten Einladungsbriefe an diese Gäste — außer dem an die Eltern — sind noch vorhanden. Da schreibt Luther an die drei Mansfeldischen Räte: „Bin willens, eine kleine Freude und Heimfahrt zu machen. Solches habe ich Euch als guten Herren und Freunden nicht wollen bergen und bitte, daß Ihr den Segen helft darüber sprechen. Wo Ihr wolltet und könntet samt meinem lieben Vater und Mutter kommen, mögt Ihr ermessen, daß mir's eine besondere Freuden wäre“. An Link: „Der Herr hat mich plötzlich, da ich's nicht dachte, wunderbarer Weise in den Ehestand versetzt mit der Nonne Käthe von Bora…. Wenn Ihr kommt, will ich durchaus nicht, daß Ihr einen Becher oder irgend etwas mitbringt“. An Dolzig: „Es ist ohne Zweifel mein abenteuerlich Geschrei für Euch kommen, als sollt ich ein Ehemann worden sein. Wiewohl nun dasselbige fast seltsam ist und ich's selbst kaum glaube, so sind doch die Zeugen so stark, daß ich's denselben zu Dienst und Ehren glauben muß, und fürgenommen, auf nächsten Dienstag mit Vater und Mutter samt anderen guten Freunden in einer Kollation dasselbe zu versiegeln und gewiß zu machen. Bitte deshalben gar freundlich, wo es nicht beschwerlich ist, wollet auch treulich beraten mit einem Wildbret und selbst dabei sein und helfen das Siegel aufdrücken und was dazu gehört“[137].
Das Wildbret fehlte nicht; Wittenberg, welches wußte, was die Universität und Stadt an Luther besaß — er hat die kleine Stadt und Universität erst groß und berühmt gemacht — spendete reichliche Geschenke. Der Stadtrat sandte „Doctori Martino zur Wirtschaft und Beilage ein Faß Eimbeckisch Bier und zwanzig Gulden in Schreckenbergern“; und die löbliche Universität verehrte als Brautgeschenk „H.D. Marthin Luthern und seiner Jungfraw Käthe von Bor“ einen hohen Deckelbecher aus Silber mit schönen vergoldeten Verzierungen. Johann Pfister, der zu Ostern den Mönch ausgezogen und zu Pfingsten nach Wittenberg gereist war, um da zu studieren, hat auf D. Luthers Hochzeit das Amt eines Mundschenken versehen. Vielleicht waren jetzt auch die Eheringe fertig, welche die Freunde besorgten. Diese Eheringe soll der Kaiserl. Rat Willibald Pirkheimer in Nürnberg von Albrecht Dürer haben anfertigen lassen und geschenkt haben; desgleichen auch eine goldene Denkmünze mit Luthers Bild. Der Trauring Luthers ist ein zusammenlegbarer Doppelreif mit Diamant und Rubin, den Zeichen von Liebe und Treue; unter dem hohen Kasten sind die Buchstaben M.L.D. und C.V.B. und in dem Reif der Spruch: „Was Gott zusammenfüget, soll kein Mensch scheiden“. Katharinas Ring hat einen Rubin und ist mit Kruzifix u.a. geziert, mit der Inschrift: „D. Martinus Lutherus, Catharina von Boren 13. Juni 1525“[138].
Daß dabei Katharina in üblichem Brautschmuck erschien, ist selbstverständlich, wenn dieser auch nicht so reich war, als das angebliche Bild Katharinas von Bora im Hochzeitsstaat denken läßt[139].
So wurde mit den guten Freunden eine fröhliche Hochzeit gefeiert. Freilich werden der unruhigen Zeitläufte wegen nicht alle Eingeladenen erschienen sein — Luther setzte das schon in seinen Briefen voraus. Auch Magister Philipp Melanchthon war nicht dabei, der ängstliche Gelehrte, welcher gegen Luthers Ehe und besonders mit der Nonne war, wäre ein übler Hochzeitsgast gewesen. Von Katharinas Verwandten scheint niemand anwesend gewesen zu sein. Vater und Mutter waren wohl schon längst tot, zwei Brüder im fernen Preußen, der älteste vielleicht auch ferne; den anderen Verwandten war Käthe doch durch ihr Klosterleben entfremdet, es hatte sich ja auch bisher niemand von ihnen ihrer angenommen. So mußte sie ihre Gefreunde und Verwandte in ihren Pflegeeltern und Luthers Freunden und Eltern sehen. Und wenn ihr's an ihrem Hochzeitsfest recht wehmütig ums Herz gewesen sein wird, so mußte sie doch die hohe Verehrung und Freundschaft trösten, welche ihr Gatte bei seinen Amtsgenossen und Landsleuten gefunden hatte.
6. Kapitel
Das erste Jahr von Katharinas Ehestand.
Luther führte nach seiner Vermählung die junge Frau in seine Wohnung im Augustinerkloster. Denn dies hatte ihm der Kurfürst Johann der Beständige, der seit Mai seinem Bruder Friedrich dem Weisen gefolgt war, unter der Bedingung des Vorkaufsrechts zur Verfügung gestellt.
Das „schwarze Kloster“ lag oben am Elsterthor, unmittelbar am Wall und Graben, still und abgewandt von der Welt, von der Straße durch einen großen Hof geschieden. Das dreistöckige Hauptgebäude gegen die Elbe zu gelegen war die Behausung der Mönche gewesen und jetzt Luthers Aufenthalt. In der westlichen Ecke nach Mittag gerichtet und mit Aussicht auf die gelben Fluten des Stromes war Luthers Zelle, woraus er „den Papst gestürmt hatte“: sie blieb auch jetzt seine Studierstube. Dagegen richtete das Ehepaar nach dem Hofe zu, wo die Gemächer des ehemaligen Priorats lagen, die geräumige Wohnstube ein, worin auch gespeist und die Besucher empfangen und Gäste bewirtet wurden. Davor lag ein kleineres Empfangszimmer mit Holzbänken. Die Decken der Gemächer und bis zur halben Höhe auch die Wände des behaglichen Wohnzimmers waren mit Holzgetäfel versehen, an den Wänden hin zogen sich Bänke, Pflöcke darüber dienten zum Aufhängen von Geräten und Kleidern. Zwei große Fenster mit Butzenscheiben schauten in den Klosterhof. Aber um deutlicher zu sehen, waren kleine Schiebfenster angebracht, welche klirrend geöffnet wurden, wenn dahinter etwas beobachtet werden sollte, ein Besuch kam oder ging oder auf die Dienstboten und das Geziefer des Hauses geachtet werden sollte. Dort in der Fensternische wurde ein einfacher hölzerner Sitz aufgestellt mit einer Art Pult, der als Nähtisch dienen mochte. Ein mächtiger Eichentisch auf Kreuzgestellen stand in der Mitte und die eine Ecke füllte ein mächtiger Kachelofen. Darum hieß die Wohnstube auch „das gewöhnliche Winterzimmer“. Es war wohl noch von der Klosterzeit her bemalt. Wahrscheinlich befand sich auch hier ein Bild der Maria mit dem schlafenden Jesuskind[140].
Hinter dieser Wohnstube war das Schlafzimmer und eine weitere Kammer, von dieser wurde später eine Stiege mit einer Fallthüre in das Erdgeschoß angelegt, auf der man in die Wirtschaftsräume drunten gelangen und namentlich die Speisen von der Küche innerhalb des Hauses heraufbringen konnte. Denn Küche, Dienstbotenzimmer und dgl. waren unten im ehemaligen Refektorium[141].
Schon in diesem Jahre, 1525, schenkte der Stadtrat verschiedene Fuhren Kalk, womit das Klosterhaus innen und außen, wenigstens teilweise, getünscht werden konnte. Vielleicht geschah dies bereits in der Zwischenzeit zwischen der Trauung und Heimführung, dieser zu Ehren, als das Haus viele festliche Besucher aufnehmen mußte[142].
Die erste Ausstattung des Hauses wird dürftig genug gewesen sein, denn Luther konnte bei seiner bekannten Freigebigkeit und Gastfreiheit mit seinem Gehalt kaum für sich selbst bestehen, und obwohl der Kurfürst es bei seiner Verheiratung auf 200 fl. aufbesserte, so waren daraus nicht viel Anschaffungen zu machen, namentlich für ein so weitläuftiges Gebäude. Die 100 fl., die der Kurfürst, und die 20 fl., die der Stadtrat zur Hochzeit schenkte, gingen darauf für das kostspielige Festmahl. Der Klosterhausrat, so weit er noch übrig und nicht weggeschleift war durch allerlei unberufene Hände, war Luther von den Visitatoren geschenkt worden. Aber es war geringfügig: Schüsseln und Bratspieße, einiger sonstiger Hausrat und Gartengeräte — zusammen kaum 20 fl. wert. So werden wohl die Freunde durch Hochzeitsgeschenke, die freilich in der Regel aus silbernen Bechern bestanden, unmittelbar oder mittelbar dazu beigetragen haben, die öden Räume des Klosters ein bißchen wohnlich zu gestalten. Verwöhnt durch mannigfaltigen Hausrat war man damals überhaupt nicht, und die zwei ehemaligen Klosterleute noch weniger. So schenkte D. Zwilling von Torgau einen Kasten, der war aber bald so lotter und wurmstichig, daß Frau Käthe kein Leinen mehr darin aufbewahren konnte vor lauter Wurmmehl. Nach und nach kamen auch sonst von auswärts allerlei Geschenke, sogar künstliche Uhren. Vom Stadtrat wurde das junge Ehepaar ein ganzes Jahr lang mit Wein aus dem Ratskeller freigehalten, brauchte aber nur (trotz vieler Gäste) für 3 Thlr. 4 Groschen 6 Pfennige. Auch schenkte die Stadt „Frau Katharinen Doktor Martini ehelichem Weibe zum neuen Jahr (1526) ein Schwebisch“ (schwäbisches Tuch)[143].
Der einzige Mitbewohner und neben Luther letzte Mönch, der Prior Brisger verheiratete sich gleich nach Luther und zog nach einiger Zeit in sein neugebautes Häuschen, das neben dem Kloster, aber vorn an der Straße gelegen war, dann auf die Pfarrei Altenburg. Von den alten Klosterbewohnern blieb nur Luthers Famulus Wolfgang Sieberger im Hause, der arm an Geld und Geistesgaben zwar zu studieren angefangen, aber es nicht hatte fortsetzen und vollenden können, und besser zu einem Diener taugte als zum Gelehrten, eine treue Seele, die von 1517 bis zu Luthers Tod im Hause blieb und den Doktor nur um ein Jahr überlebte. Eine Magd war auch da und andere folgten bald, als der Haushalt sich ausdehnte.
In diesem Hause nun gewöhnte sich das junge Paar zunächst einigermaßen in Ruhe in den Ehestand und aneinander, und Luther schrieb da: „Ich bin an meine Käthe gekettet und der Welt abgestorben“[144].
Es war dem 42jährigen Gelehrten, Junggesellen und ehemaligen Mönch im ersten Jahre des Ehestandes ein seltsames Gefühl, wenn er jetzt selbander bei Tische saß statt allein, oder wenn er morgens erwachend zwei Zöpfe neben sich liegen sah. Aber auch der jüngeren Ehefrau, der früheren Nonne mochte ihr neuer Stand seltsam dünken, hier im ehemaligen Kloster, namentlich an der Seite des gewaltigen Mannes, der die Weltordnung umgekehrt hatte und mit Papst, Kaiser, Welt und Teufel im Kampfe lag[145].
Da saß Käthe in dieser ersten Zeit bei Luther hinten in seiner Studierstube, von wo er mit dem Flammenschwert seiner Feder den Papst gestürmt, sah ihn von Büchern umgeben, den Tisch mit Briefen und Schriftbogen bedeckt, spann und horchte ihm zu und that auch Fragen nach diesem und jenem. Ihre Fragen zeugten nicht immer von Welterfahrung und theologischer Bildung. So ergötzte es den Gelehrten, als sie einmal fragte: „Ehr Doktor, ist der Hochmeister in Preußen des Markgrafen Bruder?“ Es war dieselbe Person. Luther weihte seine junge Frau bald in theologische Fragen ein. Als ihm Jonas 1527 seine jetzige Ansicht über Erasmus meldete, las er seiner Frau ein Stück des Briefes vor. Da sprach sie alsbald: „Ist nicht der teure Mann zur Kröte geworden?“ Und sie freute sich, daß Jonas nun die gleiche Ansicht mit Luther über Erasmus hatte. Mit der Zeit erweiterte sich ihr Wissen, sie lernte in ihres Mannes Haus, wo so viele Fäden der Kirchen- und Weltgeschichte zusammenliefen und so viele bedeutende Männer, Gelehrte, Staatsmänner und Fürsten einkehrten, die Weltdinge verstehen und lebte sich in die theologische Gedankenwelt so ein, daß sie an den Tischreden lebhaften Anteil nahm und auch Gelehrte durch ihren gesunden Menschenverstand und ihr natürliches Gefühl mitunter in Verlegenheit brachte[146].
Frau Käthe hatte eine ziemliche Beredsamkeit, so daß Luther sie oftmals damit neckte und sie einmal einem Engländer als Sprachlehrerin empfahl oder auch davon redete, daß sie das Amen nicht finden könnte bei ihren Predigten. Er sagt aus der Erfahrung von seiner Gattin: „Weiber reden vom Haushalten wohl als Meisterinnen mit Holdseligkeit und Lieblichkeit der Stimm und also, daß sie Cicero, den besten Redner, übertreffen; und was sie mit Wohlredenheit nicht zu Wege bringen können, das erlangen sie mit Weinen. Und zu solcher Wohlredenheit sind sie geboren, denn sie sind viel beredter und geschickter von Natur zu diesen Händeln, denn wir Männer, die wir's durch lange Erfahrung, Uebung und Studieren erlangen. Wenn sie aber außer der Haushaltung reden, so taugen sie nichts.“[147]
Zur Abwechslung arbeiteten die jungen Eheleute auch in dem umzäunten Klostergarten hinter dem Hause, worin auch ein Brunnen war. Da wurde gegraben und gepflanzt und allerlei Kräuter, Gemüse und Obstbäume, aber auch zierliche Sträucher und Blumen gepflegt. So konnte Luther schon im folgenden Sommer Spalatin einladen: „Ich hab einen Garten gepflanzt, einen Brunnen gegraben, beides mit gutem Glück. Komm, und Du sollst mit Lilien und Rosen bekränzt werden.“ Auch zu dem „Lutherbrunnen“ vor dem Elsterthore wandelten die Ehegatten hinaus, welchen der Doktor 1521 entdeckt hatte und 1526 fassen und mit einem „Lusthaus“ überbauen ließ, in dem er manch liebes Mal in Muße mit seiner Frau und seinen Freunden saß. Sonst ruhten die beiden unter dem Birnbaum im Klosterhofe, der schon zu Staupitz' Zeiten manches ernste Gespräch vernommen[148].
Von dem jungen Ehepaar haben wir ein Bild aus der Werkstatt Kranachs. Die junge Frau, mehr eine zarte als robuste Erscheinung, hat ein ovales Gesicht mit feiner Hautfarbe, die Augenöffnung erscheint ein bißchen „geschlitzt“, die Backenknochen, welche in einem anderen Käthe-Typus sehr stark hervortreten, sind normal. Charakteristisch ist die volle Unterlippe. Die Augenbrauen sind schwach und hoch gewölbt, das wenig üppige feine Haar hat rötliche oder blonde Farbe und die mattblauen Augen schauen verständig drein. Der Eindruck des ganzen Gesichtes läßt nüchternen Ernst und eine gewisse zähe Energie erwarten[149].