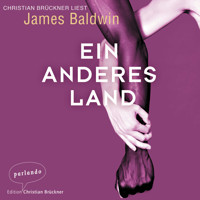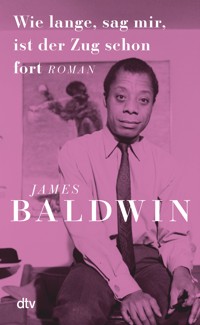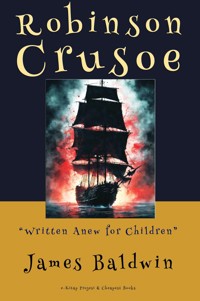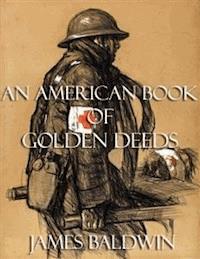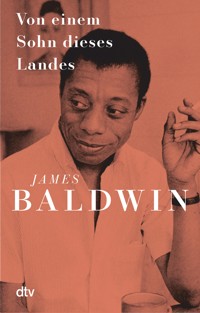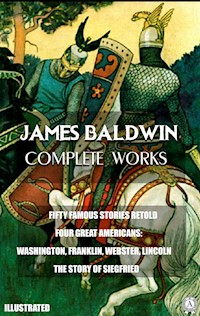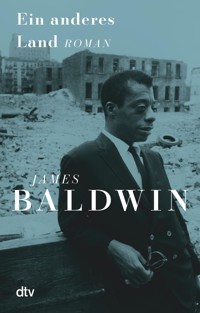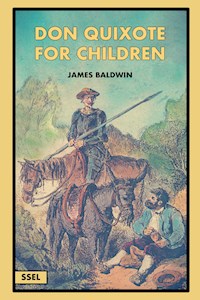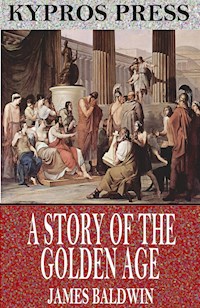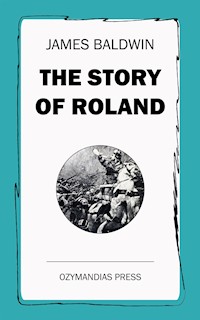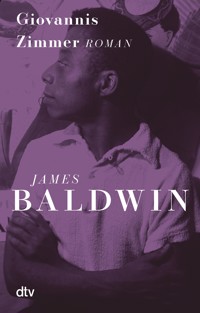18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Ein Prophet der klaren Worte.« Susanne Kippenberger, Tagesspiegel »Wenn wir jetzt nicht nachlassen, sind wir vielleicht imstande, diesen rassistischen Albtraum zu beenden«, schrieb Baldwin 1963 in ›Nach der Flut das Feuer‹. Sein Ruf ging unter in den brennenden Städten Amerikas: Ausschreitungen, Attentate, der Furor von Black Power und White Backlash. ›Kein Name‹ ist, neun Jahre später, eine Bestandsaufnahme dieser Zeit, eine schmerzliche Chronik des Verlusts: die Ermordungen von Malcolm X und Martin Luther King, der Zerfall der Bürgerrechtsbewegung und der bittere Verrat Amerikas. In atemberaubend persönlichen Einblicken legt Baldwin Zeugnis ab von einem Trauma, das ein kollektives ist. Und spricht zu uns durch die Jahrzehnte, die seinen Worten bis heute größte Dringlichkeit verleihen. Eine einzigartige Chronik der turbulenten Sechziger- und Siebzigerjahre, ein berührend intimes Dokument und eine schonungslose Abrechnung mit der Scheinheiligkeit des weißen Amerikas. »Baldwin ist inspirierend, unwiderstehlich, gnadenlos und unterhaltsam. Worte sind ihm wie Wellen dem Meer, fließend und pulsierend, an- und abschwellend.« The New York Times Zum 100. Geburtstag von James Baldwin – dem großen Stilisten und der Ikone der Gleichberechtigung. Neue Werkausstattung mit Begleitworten von Ijoma Mangold und Elmar Kraushaar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Wenn wir jetzt nicht nachlassen, sind wir vielleicht imstande, diesen rassistischen Albtraum zu beenden«, schrieb Baldwin 1963 in ›Nach der Flut das Feuer‹. Sein Ruf ging unter in den brennenden Städten Amerikas: Ausschreitungen, Attentate, der Zerfall der Bürgerrechtsbewegung.
›Kein Name bleibt ihm weit und breit‹ ist, neun Jahre später, eine Bestandsaufnahme dieser Zeit, eine schmerzliche Chronik des Verlusts. In atemberaubend persönlichen Einblicken legt Baldwin Zeugnis ab von einem Trauma, das ein kollektives ist: Er schreibt über seine Jahre in Paris, über Hollywood und Polizeigewalt; er schreibt über den Anzug, den er zur Beerdigung Martin Luther Kings trug, und schildert den Horror, dem er auf einer Reise durch den amerikanischen Süden ins Gesicht blickt.
James Baldwin
Kein Name bleibt ihm weit und breit
Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow Mit einem Vorwort von Ijoma Mangold
VORWORT
Ijoma Mangold
Der Son of a Preacher Man
Die Figur des Predigers ist einem Land wie Deutschland mit seinen Amtskirchen und Konkordaten völlig fremd, aber in den Vereinigten Staaten von Amerika spielt sie als Sozialtypus in weißen, aber viel mehr noch in schwarzen Milieus historisch eine überragende Rolle. Die USA sind in gewisser Weise aus dem freischwebenden Evangelikalismus hervorgegangen – hier wurde seit je mehr pfingstlich in Zungen geredet als in Europa. Die Pilgerväter hatten einst England den Rücken gekehrt, um in den Kolonien radikale Gemeindeautonomie gegenüber der anglikanischen Staatskirche anzustreben. Kein Bischof sollte Macht über sie haben. Schematisch könnte man sagen: In Europa wurde der Glaube institutionell eingehegt, in den USAcharismatisch entgrenzt.
Charismatische Wirkungsmacht kennt, der Logik frei schwebender sozialer Energien entsprechend, keinen klar definierten Amtskörper: Der Prediger, der preacher (Laienprediger, Wanderprediger), kann auf eigene Faust machtvoll seine Stimme erheben, er kann aber auch ein pastor (ein Pfarrer) mit entsprechenden Gemeindepflichten für seine Schäfchen sein; mal trägt er den ungeschützten (und unübersetzbaren) Titel eines reverend (der Geistliche, Hochwürden), der weniger ein Amt als eine Respektsbezeigung meint, mal nennt er sich minister (Seelsorger), der die heiligen Handlungen vornimmt, sich aber auch der sonstigen Bedrücktheiten und Kümmernisse seiner Schäfchen annimmt oder sich zu ihrem politischen Sprachrohr aufwirft – alles Rollenfiguren jedenfalls, die so im deutschen Staatskirchenrecht nicht vorgesehen sind.
In Tom Wolfes Roman Fegefeuer der Eitelkeiten gibt es den ominösen Bürgerrechtler Reverend Bacon, der es so gut versteht, den schwarzen Volkszorn aufzuwiegeln – im Namen welchen Mandats er dabei genau spricht, das bleibt hinter seinem Titel eines Reverends bewusst etwas vage und unklar. So vage und unklar wie die Frage, ob dieser Reverend ein eher geistliches oder weltliches, ein moralisches oder ein politisches Amt ausübt. Diese fehlende Trennschärfe ist die Essenz seiner Macht, sein Arkanum. Reverend Bacon kann jederzeit politische Energien freisetzen, deren affektive Quelle den aufgescheuchten New Yorker WASPs, aus deren Perspektive Wolfes Roman geschrieben ist, verborgen bleiben soll, denn nichts verunsichert mehr, als wenn man die magischen Kräfte des Gegners nicht einzuschätzen vermag. Und über Kräfte wie nicht von dieser Welt pflegen erfolgreiche Prediger zu verfügen.
Die Quelle dieses Charismas aber ist das Wort – und das Wort, muss man in diesem Kontext hinzufügen, ist für die Christenheit durch Jesus Christus, unseren Herrn, Fleisch geworden. Wer je an einem Gottesdienst in einer schwarzen Gemeinde in den USA teilgenommen hat, weiß, welche ekstatische Wirkung hier die Worte des Herrn auszulösen vermögen. Amen! Während der Sklaverei waren Gottesdienste in den Südstaaten für Schwarze ein Medium der Selbstartikulation, die ihnen an anderen Orten versagt blieb. Und in Jesus erkannten sie einen zweiten Moses, der sie aus der Sklaverei herausführen würde, ganz so, wie Moses seine Israeliten durchs Rote Meer aus der ägyptischen Gefangenschaft geführt hatte. Die Wirkung des Bibelworts bleibt dabei nicht auf den kirchlichen Raum beschränkt. Wie Bibelworte sich auch unter höchst weltlich-profanen Umständen durch ihre rhetorische Kraft Gehör (und Streetcredibility) zu verschaffen vermögen, das hat, popkulturell bleibend, Quentin Tarantinos Film Pulp Fiction gezeigt (der, by the way, auch von der charismatischen Wirkung eines son of a preacher man erzählt), wenn der Gangster Jules, gespielt von Samuel L. Jackson, seinem Opfer erst einmal mit Hesekiel 25:17 in den Ohren liegt, bevor er das arme (weiße) Würstchen erschießt: »Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen: Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.« Hier werden die Schwarzen gewissermaßen zu den Erwählten des alttestamentarisch strafenden Gottes – auch eine besondere Form der Translatio Imperii, mit der den Weißen die Rückversicherungsmacht Gottes entzogen wird: Cultural appropriation at its best! (Dass es sich bei Jules’ Donnerworten nicht exakt um ein Originalzitat aus der Bibel handelt, sondern um eine wiederum von einem anderen Film inspirierte freie Ausschmückung, setzt nur mehr den pastoraltheologischen Rat um, wonach ein Prediger seine Rede jederzeit den konkreten gesellschaftlichen Umständen seines Auftritts anpassen können sollte.)
Auch James Baldwin ist der son of a preacher man. 1924 in New York geboren, wuchs er in Harlem auf als Stiefsohn eines Mannes, der ein Pfingstprediger in Teilzeit war. Baldwin hat seinen Stiefvater bis zu dessen Tod gehasst, aber unter seinem Einfluss stand er nur umso mehr. Von klein auf wusste er um die Macht des biblischen Wortes, sein Pathos und seinen moralischen Hallraum. Es ist kein Zufall, dass sein meisterhafter, stark autobiografisch geprägter Debütroman Von dieser Welt (im Original: Go Tell It on the Mountain) aus dem Jahr 1953 über sein Alter Ego John Grimes mit dem Satz beginnt: »Alle hatten immer gesagt, John werde später mal Prediger, genau wie sein Vater.«
Die Welt des Vaters, der Tischgebete, der Bibelstunden und des sonntäglichen Kirchgangs, erschien ihm beides: strahlend und eng, kraftvoll und bigott, feierlich und verdruckst. Diese Welt war in der Wahrnehmung des Kindes direkt verknüpft mit der Hautfarbe: Es war eine schwarze Welt, in der Gottes Gerechtigkeit galt. Wenn die Erwachsenen in Von dieser Welt John davor warnen, vom rechten Pfad des Glaubens abzukommen und sich von den Verlockungen der Welt ins Verderben führen zu lassen, dann ist die verlockende und gefährliche Welt eine weiße, während die kirchliche, Sicherheit und Stabilität versprechende Welt schwarz ist.
Der jugendliche John hat eine Lieblingsstelle im New Yorker Central Park, zu der es ihn bei seinen Spaziergängen immer wieder zieht, einen Hügel, von dem aus er die eindrucksvolle Skyline von New York im Blick hat, als wäre er Master of the Universe. Alle Verlockungen und Abenteuer, aller Glanz und jede Köstlichkeit einer bis zum Bersten vitalen Metropole liegen dann zu seinen Füßen: »Er, John, fühlte sich wie ein Riese, der diese Stadt mit seiner Wut zermahlen könnte, er fühlte sich wie ein Tyrann, der diese Stadt unter seinem Absatz zerquetschen könnte, er fühlte sich wie ein langersehnter Eroberer, dem Blumen gestreut würden, dem die Menschen mit Hosianna! huldigten. Er wäre von allen der Mächtigste, der Meistgeliebte, der Gesalbte des Herrn, und er würde in dieser Stadt des Lichts leben, die seine Vorfahren aus weiter Ferne mit Sehnsucht erblickt hatten.« Das ist nicht das himmlische Jerusalem, auch nicht a city on a hill, sondern ein irdisches Babylon, das hier lockt.
Natürlich steht dieser Hügel seiner Größenphantasie, wie stets bei Baldwin, weniger in Manhattan als in der Bibel. Die Stelle spielt auf das Matthäusevangelium an. Da heißt es über Jesu Versuchungen: »Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.«
Lassen die Einflüsterungen des Versuchers den jungen John Grimes schwach werden? Was ihn jedenfalls vorerst zurückschrecken lässt, ist der Gedanke an seine schwarzen Vorfahren, für die diese Welt der Weißen nicht gedacht war. Von den Freuden der Welt zu kosten heißt, die Beschränkungen des schwarzen Milieus hinter sich zu lassen. Sich jedoch in die Welt der Weißen zu begeben, sei für einen Schwarzen ein sicherer Weg ins Verderben, das hatte ihm der Vater stets eingebläut: »Sein Vater sagte, alle Weißen seien verkommen, und Gott werde sie noch zu Fall bringen. Er sagte, niemals dürfe man den Weißen trauen, sie erzählten nur Lügen und keiner habe jemals was übrig gehabt für einen Nigger.«
Die Ängstlichkeit und Bigotterie des Stiefvaters sind psychologisch aus demselben Stoff, Ergebnis der bitteren Erfahrung, was für einen Schwarzen, der gerade erst aus den Südstaaten im Norden angekommen war, in der Welt der Weißen möglich ist und was nicht.
Als Jugendlicher erfährt James Baldwin durch seinen Vater nur Herabsetzung – er tauge zu nichts und sei hässlich. Besonders letzterer Vorwurf erscheint uns Nachgeborenen grotesk, weil Baldwins Physiognomie längst kanonisch geworden ist, als exzentrische Schönheit eines kämpferischen Dandys. Doch gewinnt James Baldwin die ödipale Auseinandersetzung auf ganzer Linie: Er wird als Jugendlicher tatsächlich in der Kirche predigen, und zwar mit solchem Erfolg, dass er seinen Vater auf demütigende Weise deklassiert. Aber auf die Welt, vor der die Seinen ihn gewarnt haben, will er nicht Verzicht tun. Diese Askese wäre eine Form der Selbstbeschneidung, als würde es sich von selbst verstehen, dass die Welt für Schwarze nicht zu haben sei. Baldwin wird die babylonische Welt mit den rhetorischen Mitteln der Bibel erobern.
Und also ist er kein Prediger geworden, sondern Schriftsteller. Von allen Schriftstellern gewiss der bibelfesteste. Das väterliche Erbe besser und virtuoser zu beherrschen als der Vater selbst, nur um es dann auszuschlagen oder in etwas anderes, Freieres zu überführen, das ist der vollkommene ödipale Vatermord. Deshalb hat Baldwin als Schriftsteller wie kein Zweiter all die Register gezogen, die ihm die kirchliche Tradition seit Kindestagen an die Hand gegeben hat. So wie man die Kunst ja generell als säkularisierte Religion betrachten kann, so hat James Baldwin die Energie und den Rhythmus des geistlichen Gospels ins Weltliche überführt. James Baldwin war mondän, weil er frei sein wollte.
Dies ist überhaupt ein Schlüssel zu seinem Werk, in dem Abkehr und Rückkehr, Nähe und Distanz, Dazugehören und Außen-vor-Sein wiederkehrende Muster bilden. Baldwin musste sich maximal weit von seiner Harlemer Herkunftswelt entfernen, um diese in den Blick nehmen zu können. Seinen Debütroman schrieb er zum großen Teil in einem Chalet, das ihm ein Freund in den Schweizer Bergen überlassen hatte. Um der Determinierung durch die familiär-soziale Prägung zu entkommen, ging er als junger Mann beherzt nach Paris – hier war er zwar schwarz, aber kein nigger, denn die nigger Frankreichs waren die Algerier, deren Befreiungskampf Baldwin genau, aber durchaus mit der Distanz des Beobachters verfolgte.
Auch sein großer Essay Kein Name bleibt ihm weit und breit aus dem Jahr 1972, halb autobiografische Erinnerung, halb tagespolitischer Kommentar, zwischen Erzählung und Manifest oszillierend, ist Dokument dieser Zerrissenheit: Wie kann er seinen eigenen Weg gehen, ohne »den Preis des Verrats an den eigenen Brüdern und Schwestern« zu bezahlen? Eine delikate Balance zwischen Engagement und Autonomie, zwischen kollektiver Verantwortung und individuellem Eigensinn.
Man könnte auch sagen: Die Wirklichkeit verweigerte Baldwin die ästhetische Distanz, nach der er sich innerlich sehnte. Baldwin ist in diesem Essay mitten im Geschehen der Bürgerrechtsbewegung der Sechzigerjahre, die Politik lässt ihn nicht los, die laufenden Ereignisse zwingen ihm ein ums andere Mal Einschätzungen, Haltungen, Bekenntnisse und Richtungsentscheidungen ab, die er lieber vermeiden würde, weil er doch ein Erzähler ist, der die Räume der Ambivalenz ausloten möchte. Aber die Wirklichkeit ist manchmal zu grobschlächtig für Ambivalenzen. Ganz bei sich als Erzähler ist er, wenn er berichtet, wie er eine Kneipe in den Südstaaten durch den nur für Weiße bestimmten Eingang betritt (ein Fehler, wie er nur einem Besucher aus New York unterlaufen kann) und die weißen Gäste erstarren, als würde ihnen die Luft wegbleiben, bis ein Mann sich aufrafft und auf die Tür für Schwarze weist – dieser »Platzanweiser der Hölle«, wie Baldwin schreibt, hielt sich selbst gar noch für einen hilfreichen Menschenfreund, bemüht, Schlimmeres zu verhindern. Diese Szene ist auf wenigen Absätzen ein sozialpsychologisches Kammerspiel, das die Lebensrealität der Südstaaten auf die sinnlich bedrohlichste Weise einfängt, gleichzeitig Baldwins eigene Gefühlsreaktionen genau notiert und ermessen lässt, wie weit die amerikanische Gesellschaft als Ganze noch davon entfernt ist, sich einen angemessenen Begriff von der Wirklichkeit ihres Rassismus zu machen.
Aber bei solchen erzählerischen Kabinettstücken kann es nicht bleiben, denn die geschichtlichen Ereignisse verlangen danach, Farbe zu bekennen. Was ist der richtige Weg für die Schwarzen? Ist es der Weg der Gewaltlosigkeit, den Reverend Martin Luther King in der Nachfolge Gandhis lehrt mit seiner Versöhnungsvision einer Welt, in der Hautfarbe keine Rolle mehr spielt? Oder ist der Weg des gewaltlosen Widerstands naiv, liefern sich die Lämmer da nicht aus freien Stücken ihren Schlächtern aus? Ist es nicht höchste Zeit, sich für einen anderen Weg zu entscheiden, für den Weg des Zorns, wie ihn Malcolm X (der Martin Luther King für eine Art Uncle Tom hielt und belächelte) und die Black Panther weisen mit ihrer Strategie eskalierender Gegengewalt?
Für James Baldwin ist das nicht einfach nur eine politische Entscheidung, sondern auch eine persönliche, die zwischen zwei Freunden, denn er ist mit beiden Zentralfiguren des schwarzen Befreiungskampfs der Sechzigerjahre befreundet gewesen. Als er vom Tod Martin Luther Kings erfährt, der am 4. April 1968 auf dem Balkon eines Hotelzimmers in Memphis durch einen weißen Rassisten erschossen wird, sitzt Baldwin gerade in Hollywood und soll ein Drehbuch über die Autobiografie seines einstigen Freundes Malcolm X schreiben, womit er sich nicht leicht tut: Malcolm, den die Weißen für einen Brandstifter hielten, war am 21. Februar 1965 durch ein Mitglied derselben Nation of Islam (NOI) erschossen worden, der sich Malcolm einst angeschlossen hatte, weil ihm der Gott der Christen zu weiß war. Und jetzt war er, nach seinem Bruch mit der Nation of Islam, durch die Hand eines schwarzen NOI-Anhängers gestorben.
Auch wenn Baldwin selbst als son of a preacher man die Liebe immer über den Hass stellte, will er auf keinen Fall beschwichtigend ins Horn jener blasen, die Malcolm X und seinen Zorn dämonisieren und der Black-Panther-Bewegung die Legitimität absprechen. Zorn ist für Baldwin, der selber schreibt, als spräche der alttestamentarische Gott aus ihm, ein legitimer politischer und ästhetischer Affekt. Und wurde Malcolm X durch Kings Ermordung nicht ins Recht gesetzt?
Das ist der zeitgeschichtliche und biografische Kontext, aus dem dieser Essay entstanden ist, der alles ist, nur nicht ausgeruht, kontrolliert, souverän, beherrscht, mit sich im Reinen und seiner selbst sicher. Denn es geht um etwas. Baldwins anderer großer Essay über den amerikanischen Rassismus, Nach der Flut das Feuer (The Fire next Time), war 1962 wie eine Bombe eingeschlagen und hatte seinen Verfasser weltberühmt gemacht. Mit diesem Text hatte er die amerikanische Gesellschaft gewissermaßen noch einmal unter Bewährungsauflagen auf freien Fuß gesetzt. So kann man den Titel zumindest verstehen. Er ist wieder einmal eine Anspielung auf einen Gospel, wonach Gott Noah für dieses Mal noch mit der Flut habe davonkommen lassen, doch im Wiederholungsfalle Feuer schicken werde: God gave Noah the rainbow sign / No more water, the fire next time. Anders gesagt: No more Mister Nice Guy! Sonst müsste von Martin Luther King auf Malcolm X umgestellt werden.
Nach der Flut das Feuer ist ein Essay wie ein ungedeckter Scheck mit erheblichem Vertrauensvorschuss. Aber war die amerikanische Gesellschaft in den Jahren seit 1962 diesem Vertrauensvorschuss gerecht geworden? Beziehungsweise war er selbst nicht Lügen gestraft worden? War er naiv gewesen?
Kurz vor seiner Ermordung und bereits unter dem Eindruck zunehmender Todesdrohungen hatte Martin Luther King in Memphis in einer berühmten Rede zu seinen Anhängern gesprochen und den traditionellen Moses-Topos aufgegriffen: »Vor uns liegen schwierige Tage, aber das macht mir nichts aus […]. Ich will nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen, und ich habe hinübergesehen und ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch, aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das Gelobte Land gelangen werden. Und deswegen bin ich heute Abend glücklich und mache mir keine Sorgen wegen irgendwas.«
Seither liegt das Gelobte Land weiter entfernt denn je. Eigentlich ist es überhaupt nicht mehr in Sicht, so muss es zumindest aus der Perspektive derer erscheinen, die mitten im Sturm stehen. Neben Martin Luther King und Malcolm X war noch eine weitere wichtige Figur des Civil Rights Movement, Medgar Evers, ermordet worden – auch er ein Freund von James Baldwin, mit dem dieser noch kurz zuvor zusammen gewesen war. Führt nach all diesen Desillusionserfahrungen überhaupt noch ein Weg am reinigenden Feuer vorbei?
Man spürt auf jeder Seite von Kein Name bleibt ihm weit und breit, wie Baldwin nicht länger als Appeaser dastehen will, als »Integrationist«, als der er manchen galt; wie er hin- und hergerissen ist zwischen Kings Erbe und seiner Loyalität zu Malcolm; wie er seine Eskalationsbereitschaft signalisiert, wenn er mit Blick auf die Blumenkinder von Haight Ashbury schreibt: »Die Schwarzen vertrauten nicht auf Blumen. Sie vertrauten auf Waffen.« Und wie er gleichzeitig auch noch Raum sucht für sich als Künstler-Freak, für den es nicht nur die Straße des politischen Kampfes, sondern auch noch die Welt der Kunst gibt. Denn er war ja nicht einfach nur schwarz, sondern auch Schriftsteller – und am Ende auch schlicht und einfach berühmt! Und auch diese Perspektive arbeitet er in seinen Essay ein wie ein unerlöster Montaigne der Selbstbeobachtung.
Wenige Wochen vor Kings Ermordung hatte Baldwin einen gemeinsamen Auftritt mit dem Reverend in der Carnegie Hall in New York. Für diesen Auftritt hatte er sich einen neuen Anzug gekauft, den er dann wenig später auch zu Kings Beerdigung tragen wird. Einem Journalisten gegenüber erwähnt Baldwin danach, diesen Anzug könne er nie wieder in seinem Leben tragen, zu sehr sei er verknüpft mit der Erinnerung an den großen Bürgerrechtler. Und nun setzt in Kein Name bleibt ihm weit und breit ein kühner, ein überwältigender erzählerischer Schwenk ein, der wie in einer Nussschale vorführt, wie virtuos Baldwin das Große und Kleine, das Politische und das Private, Fragen von Klasse und Fragen der Rasse so zusammenzuführen vermag, dass die Wahrheit der Situation als große Ambivalenz virulent bleibt.
Der Zufall will es nämlich, dass ein alter Freund aus Highschool-Tagen in der Zeitung von Baldwins Aussage erfährt, dass er diesen Anzug nie wieder tragen wolle. Und der Freund erinnert sich, dass die beiden, die früher so eng waren, tatsächlich auch gleich groß waren. Es wäre doch schade, wenn dieser nahezu neue Anzug ausrangiert würde. Er, der als einfacher Postangestellter arbeitet, hätte durchaus Verwendung für ihn. Und so meldet er sich nach Jahren wieder bei seinem alten, inzwischen weltberühmten Freund.
Dieser hat sofort ein schlechtes Gewissen, weil sein jetziges Leben mit dem eines Postangestellten und mit seiner eigenen Vergangenheit so gar nichts mehr gemein hat; weil er sich so sehr entfernt hat von den »Brüdern und Schwestern«, die ihm seinerzeit eine verlässliche Gemeinschaft waren. Also beschließt Baldwin, dem Freund den Anzug vorbeizubringen. Nur: Der Freund wohnt in der Bronx. Und damals ist kein New Yorker Taxifahrer bereit, in das Schwarzenviertel zu fahren. Also muss Baldwin eine Limousine mit (weißem) Chauffeur anheuern, auch wenn das auf die Familie des Freundes in der Bronx wie die reine Angeberei wirkt. Aber vielleicht ist diese zufällige Äußerlichkeit nur das treffende Symbol für eine tiefere Wahrheit? »Ich war nicht mehr der, den mein Freund und seine Familie gekannt und geliebt hatten – ich war jetzt ein Fremder.« Und mit jedem Wort, das zwischen ihm und seinem Freund und dessen Familie hin- und hergeht, scheint der Graben zu wachsen: »Ich war nicht mehr derselbe, aber sie waren noch dieselben, als hätte man sie damals eingefangen und konserviert.«
»Konserviert« ist ein hartes, ein brutales Wort, aber vermutlich fasst es genau Baldwins eigene Ängste, was auch ihm widerfahren wäre, hätte er nicht als junger Mann Harlem und die Welt seiner Herkunft hinter sich gelassen, um nach Paris aufzubrechen: »Sie glaubten noch immer an Gott, ich aber hatte mit ihm gerechtet, hatte ihn beleidigt und sein Haus verlassen.« Anders als Herakles am Scheideweg hat er auf seinem Hügel im Central Park sich für das Laster, für die Welt entschieden.
War es ein Verrat? Hat er sich aus dem Staub gemacht? Und wer ist er heute? Wo gehört er hin? Ist er nicht nur »ein alternder, einsamer, sexuell dubioser, politisch skandalöser, unsagbar erratischer Freak«? Und auch das gehört zu Baldwins Delikatesse: Dass er ein Außenseiter in der amerikanischen Gesellschaft ist, liegt ja nicht nur daran, dass er schwarz ist, sondern auch daran, dass er homosexuell ist. Er liebt Männer – und gerade in seiner schwarzen Herkunftswelt macht ihn das dubios, ja exzentrisch. Über Homosexualität, über die Liebe zweier interessanterweise weißer Männer, hat James Baldwin einen eigenen, berührenden Roman geschrieben, GiovannisZimmer. In Kein Name bleibt ihm weit und breit scheint seine Kommunikationsstrategie in Bezug auf seine Homosexualität zu lauten: Nicht verschweigen, aber auch nicht ins Zentrum rücken. Sie soll jetzt nicht zu einer definierenden Identitätskategorie werden. Schließlich geht es gerade um anderes. (In einem Interview aus den achtziger Jahren wird er später sagen, Homosexualität sei für ihn eher ein Verb als ein Substantiv, und deswegen könne er auch mit dem Wort gay als Selbst- oder Gruppenbeschreibung nichts anfangen. Anders gesagt: Baldwin leugnet seine Homosexualität nicht, aber er will ein Dandy und Eigenbrötler (maverick) bleiben, den man nicht so leicht in Schubladen verräumen kann.)
Aber lassen sich diese beiden unterschiedlichen Weisen des Außenseitertums überhaupt so leicht trennen? Wie ein Intersektionalist avant la lettre beschreibt er, wie er einst als junger Mann nach einer gescheiterten konventionellen Eheanbahnung in New York erst in Paris die Leidenschaft der Liebe entdeckt und wie diese ihn dann verwandelt und befreit hat. »Sie half mir«, schreibt er, »mich aus der Hautfarbenfalle herauszuschälen, denn Menschen verlieben sich nicht nach Hautfarbe […], und wenn Liebende sich streiten, was sie zwangsläufig tun, streiten sie nicht über den Grad ihrer Pigmentierung, noch können Liebende Hautfarbe, auf welcher Ebene auch immer, als Waffe benutzen. Das heißt, wir müssen unsere Nacktheit akzeptieren. Und Nacktheit kennt keine Farbe.«
Das sind eindringliche Worte voller Pathos – hinter dem dann fast untergeht, dass Baldwin über die Hautfarbe des Geliebten schreibt, nicht aber über dessen Geschlecht. Die Liebe, die ihn vom Los der Hautfarbe befreit hatte, galt einem Mann.
Kein Name bleibt ihm weit und breit ist auch so etwas wie Distanzmanagement – wie findet man die richtige Dosierung aus Nähe und Ferne? Wie kann man seine Sonderrolle behaupten, ohne die Brüder und Schwestern im Stich zu lassen? Ohne Frankreich als Flucht- und Entlastungsrevier geht es nicht. Fühlt er sich in Frankreich freier, weil es dort keinen Rassismus gegen Schwarze gibt? So einfach liegen die Dinge nicht. Jenes spezifische Gemisch aus Jim Crow (also den Gesetzen der Rassensegregation), Redlining (der Zementierung ethnisch motivierter Vermögensungleichheiten durch Grund- und Immobilienbesitz), buchstäblicher Lynchkultur, Polizeigewalt und sozialer Abwertung – das alles gibt es in Frankreich nicht. Dass er in Frankreich mit der ihn umgebenden Gesellschaft einfach gar keine gemeinsame Geschichte und Schicksalsverquickung teilt, das empfindet er als Freiheit. Er zieht die Gleichgültigkeit Frankreichs der »kleinmütigen Gunst amerikanischer Liberaler« vor. Anders ausgedrückt: In Frankreich konnte Baldwin Exzentriker auf eigenem Ticket sein, nicht Personifikation eines kollektiv erlittenen Unrechts. In Paris ist er einfach nur »ein sonderbarer Fremder«. Die Gnade der Dekontextualisierung. Doch auch diesen Ausweg eines apolitischen Individualismus, Urlaub von der Solidarität, will er sich nicht ganz gönnen, es sei ihm »zu einer Frage der Ehre« geworden, schreibt er, das Schicksal der Algerier in Frankreich nicht auszublenden, denn die Algerier seien die »nigger« Frankreichs. Und mit erstaunlicher Schärfe rechnet er mit Albert Camus’ individualistisch-existentialistischem Freiheitsbegriff ab, der die Algerier mit einem abstrakten Gerechtigkeitsversprechen abspeisen wolle, wo diese nicht nach Gerechtigkeit verlangten, sondern nach Macht, nach der Macht, »ihr Schicksal selbst zu bestimmen«: »Macht, nicht Gerechtigkeit zeichnet Landkarten«, schreibt er, als habe er gelernt, sich von der Toleranz der Liberalen nicht länger Sand in die Augen streuen zu lassen. Und ein wenig klingt es auch, als spreche hier eher Malcom X als Martin Luther King aus ihm.
Für Christen gilt, dass nur die Wahrheit frei mache. Von diesem Grundsatz ist James Baldwin nie abgewichen: Unfrei, so hatte er es schon in Nach der Flut das Feuer ausgeführt, seien nicht die Schwarzen, sondern die Weißen, weil sie die Wahrheit ihrer Taten noch immer leugneten. Diese Leugnung habe sie gewissermaßen zu seelischen Krüppeln gemacht: »Der Sündenbock wird irgendwann durch den Tod erlöst; sein Mörder lebt weiter.«
Für die Schwarzen entwickelt er hingegen eine besondere kleine Theorie der Schönheit, die man eine Variation auf Hemingways Vorstellung von grace under pressure nennen könnte: Sie haben immer unter den »Klauen des Südstaatenterrors« leben und sich bewähren müssen, sich im Bewusstsein ihrer Bedrohtheit bewegt. Gefahr macht anmutig, geht Baldwins Argument: »Denn das köstlich mokante, provokante Selbstbewusstsein, mit dem sich schwarze Männer bewegten, rührte vom unausgesprochenen Wissen um den Preis, den jeder Einzelne dafür zahlte, sich überhaupt bewegen zu können.« Und dann, als wolle er das Schwarzsein und das Schwulsein doch noch irgendwie zusammenführen, entwickelt er eine heute etwas unzeitgemäß klingende Virilitätstheorie: Die Weißen haben sich gewissermaßen selbst kastriert, ihr unbewusstes Wissen um ihre moralische Erbärmlichkeit hat sie entmannt – und »ein Mann ohne Eier« sei eben kein Mann. Schwarze tragen hingegen das gefährliche Potenzial in sich, dass sie eigentlich jederzeit einem Weißen an die Gurgel fahren müssten, und diese latente Gefährlichkeit liest Baldwin als moralisch-ästhetische Anmut, eine ins Positive gewendete toxische schwarze Männlichkeit mit allen Insinuationen homoerotischer Verklärung. Diese vibrierende Gefährlichkeit holt die Schwarzen aus der Ohnmachtsposition heraus.
Für die weißen Männer der Südstaaten gilt hingegen: Sie sind zu erbärmlich, um schwul sein zu können: »Langsam wollte mir scheinen, nicht ganz unbegründet, dass der Süden nur aus einem einzigen Grund keine durch und durch homosexuelle Gemeinschaft war, nämlich wegen der himmelschreienden Abwesenheit von Männern.« Schwarze Virilität als Antwort auf den sozialen Inferioritätskomplex – das mag aus heutiger Sicht vielleicht zu sehr das Klischee des schwarzen Phallus bedienen, hat aber doch so in seiner Verbindung aus Körperbewusstsein und Ideenraum eine spezifisch Baldwin-hafte Delikatesse.
Und wie schauen wir heute auf die Figur James Baldwin und sein Werk? Von einer Renaissance zu sprechen ist nicht übertrieben. Seit Black Lives Matter zu einer weltweiten Massenbewegung mit offenbar erheblichem Identifikationspotenzial geworden ist, ist James Baldwin zur Ikone geworden. Der Film I Am Not Your Negro hat das Seine dazu beigetragen, weil er Baldwins Habitus, seinen Redestil, ja seine ganze Körperästhetik so überschwänglich inszenierte. Deswegen ist es umso wichtiger, Baldwin nicht hagiografisch zu überhöhen und in Dienst zu nehmen, wie es teilweise geschieht, wenn sein Kampf und seine Verzweiflung bruchlos in die Gegenwart übertragen werden. Dinge haben sich verändert und zwar stärker, als Baldwin es in diesem Essay zu hoffen wagte. Den Rassismus, wie er ihn aus den Südstaaten berichtet, gibt es nicht mehr. Und viele der Ungleichheiten, die Black Lives Matter umstandslos dem angeblich unauslöschlich rassistischen Charakter der westlichen, patriarchalen Gesellschaften zuschreibt, haben in Wahrheit mehr mit Klasse als mit Rasse zu tun. Seit dem Tod George Floyds führt diese Aussage aber im juste milieu zu Schnappatmung.
Während James Baldwin 1972 noch hin- und hergerissen war zwischen Martin Luther King auf der einen und Malcolm X auf der anderen Seite, zwischen der universal-liberalen Seite der Bürgerbewegung und ihrem identitätspolitisch-partikularen Strang, hat sich Black Lives Matter unzweideutig für Malcolm X und gegen Martin Luther King entschieden: Das Ideal der Farbenblindheit gilt in linksprogressiven Kreisen heute als Teil des Rassismusproblems, nicht als Teil seiner Lösung. Der sogenannte Antirassismus, wie ihn breitenwirksam Ibram X. Kendi oder Robin J. DiAngelo propagieren, will die Menschen ganz auf ihre Identität verpflichten und hält Kings Traum, wonach Menschen nicht aufgrund ihrer Hautfarbe, sondern aufgrund ihres Charakters gewürdigt werden sollten, für ein heuchlerisches Manöver weißer Privilegiertheit.
Und es ist nicht zu bestreiten, dass sich im Werk Baldwins ausreichend viele grimmig leuchtende Zitate finden, um ihn als Propheten der Unerbittlichkeit des Antirassismus heranzuziehen. Und das verweist vielleicht auch auf eine Schwäche in Baldwins Werk, der ästhetisch-rhetorisch in seinen Formulierungen so überschäumend brillant war, dass sein politischer Realismus nicht immer ganz nachkam. Man könnte auch sagen: Der Preis, den er für seine Sprachmacht zahlte, war ein gewisser Manichäismus: »Jeder schwarze Mann, welchen Stil er auch pflegte, trug Narben wie von einem Stammesritual; und jeder weiße Mann, wobei weiße Männer zumeist gar keinen Stil pflegten, war verstümmelt.« So ein Satz glänzt, weil er mehr auf das Pathos als auf die Nuance abstellt. Man möchte solche Baldwin-Sätze nicht missen, aber belastbar sind sie auch nicht.
Bei einem berühmten Treffen am 24. Mai 1963 mit dem damaligen Justizminister Robert Kennedy – kurz vor dessen Ermordung – explodiert Baldwin, als Kennedy hoffnungsfroh in Aussicht stellt, vielleicht könne ja in vierzig Jahren ein Schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Baldwin empfand dieses In-Aussicht-Stellen als herablassend und bevormundend und dem Ernst der Lage unangemessen – und außerdem sind langfristige Hoffnungsperspektiven mitten in den Kämpfen der aufgewühlten Gegenwart immer etwas hohl und wohlfeil. Das ändert aber nichts daran, dass 45 Jahre später tatsächlich ein Schwarzer zum Präsidenten der USA gewählt wurde, der sich seinerseits ganz für die Martin-Luther-King-Tradition und gegen die Malcolm-X-Option entschieden hatte. Und weil es den Zeitgenossen aller Epochen immer so schwerfällt, geschichtlichen Fortschritt zu würdigen, herrschte nach den acht Jahren Obama-Regierung zumindest in den akademisch privilegierten Milieus die Einschätzung vor, es seien für die Schwarzen verlorene Jahre gewesen, in Wahrheit sei mehr Malcolm X notwendig, Obama selbst sei gar kein richtiger Schwarzer gewesen und jetzt gelte es erst recht, in Race-Kategorien zu denken, nur bei umgedrehter Hierarchie.
1972 schrieb Baldwin in seinem großen Essay: »In gewisser Weise war ich in jenen Jahren, ohne es ganz zu durchschauen, die Große Schwarze Hoffnung des Großen Weißen Vaters. Ich war kein Rassist – so glaubte ich; Malcolm war ein Rassist, so glaubte er.« In gewisser Weise nahm Baldwin also 1972 eine Debatte von heute vorweg. Die Beruhigungstablette (heute würde man sagen: der token) der Weißen wollte er nicht sein, aber auch nicht wie Malcolm ein »Rassist mit umgekehrten Vorzeichen«. Gibt es einen dritten Weg?
Nun, der dritte Weg ist Baldwins eigene intellektuelle Physiognomie, aber die ist kein politisches, sondern ein ästhetisches Programm und insofern weit mehr als ein Weg, eher ein Labyrinth. In seinem ganzen Essay gibt es bezeichnenderweise nicht eine einzige konkrete politische Forderung. Stattdessen scheint es eher wie der Versuch, allem, was ist und empfunden werden kann, Ausdruck zu geben, auch wenn das verlangt, widersprüchliche Positionen nebeneinander stehen zu lassen. Dass der Essay in diesem Sinne nicht konsistent ist, genau das macht ihn so reich: Einerseits sieht Baldwin als Feuer-Prophet »die Gestalt des kommenden Zorns«, andererseits will er sich nicht zur Gewalt bekennen. Aber schafshafte Friedfertigkeit will er sich auch nicht vorwerfen lassen, weshalb er der affektgetriebenen Gewalt der Weißen eine kühl rationale, hassfreie Gegengewalt der Schwarzen gegenüberstellt. Und weil seine tiefste metaphysische Einsicht lautet, dass nur die Wahrheit frei macht, müssen nicht die Schwarzen befreit werden, sondern müssen die Weißen sich selbst befreien – nämlich aus der erniedrigenden Zwangslage, sich permanent über die Grausamkeit ihrer eigenen Geschichte zu belügen. Diese Art eines erbärmlichen Lebens in Unwahrheit ist keine Position der Stärke, und deshalb kann Baldwin erklären, dass »die Party des Westens« vorbei und »die Sonne der Weißen« untergegangen ist.
Was gibt ihm diese Einsicht in den Geschichtsverlauf? Nun, als son of a preacher man, der er ist, landet im Schlusssatz seines machtvollen Essays eine weiße Taube: Das ist der Heilige Geist, jenes Pneuma, von Gott oder den Musen der Wortkunst eingehaucht, das alle seine Sätze schillern und fliegen lässt.
für
Berdis Baldwin
und
Beauford DeLaney
und
Rudy Lombard
und
Jerome
Sein Andenken
schwindet von der Erde,
kein Name
bleibt ihm weit und breit.
Sie stoßen ihn vom Licht
in die Finsternis
und jagen ihn vom Erdkreis fort.
Hiob 18,17–18
If I had-a my way
I’d tear this building down.
Great God, then, if I had-a my way