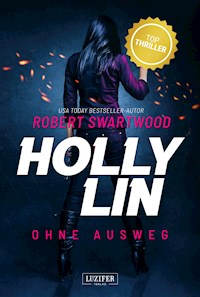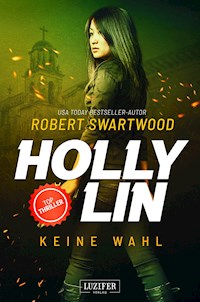Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Holly Lin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Holly Lin. Kindermädchen am Tag, Auftragskiller bei Nacht. Holly Lin hat ein neues Leben. Eine neue Identität. Etwa ein Jahr ist es her, seit sie ihren Job als Auftragskillerin der Regierung an den Nagel gehängt hat. Nun lebt sie in einer kleinen Stadt in Texas, verbringt ihre Nächte als Barkeeper und sortiert tagsüber Bücher in der örtlichen Bibliothek ein. Doch das alles ändert sich schlagartig, als sie auf eine blutüberströmte Frau trifft – mit einem Baby in den Armen … Binnen weniger Minuten landet das Baby in Hollys Händen und die Frau stirbt. Getötet von zwei Männern. Kurz darauf muss Holly Lin lernen, dass die Welt, der sie den Rücken kehrte, sie nicht vergessen hat und alles dafür tun wird, um sie zurückzuholen. ★★★★★ »Großartig – unvergesslich und ein Roman, den ich mehr als einmal lesen werde.« - Roxane Gay, New York Times Bestseller-Autorin ★★★★★ »Ich kann nicht genug von Holly Lin bekommen oder einfach nur dem Schreibstil von Robert Swartwood, egal, es ist eine fantastische Lektüre voller Wendungen und Nervenkitzel, ein Non-Stop-Pageturner!« - Amazon.com ★★★★★ »Die Charaktere sind gut ausgearbeitet, und es gibt eine unvorhersehbare Überraschung nach der anderen! Die Spannung und die Handlung machen dieses Buch zu einer unterhaltsamen und fesselnden Lektüre!« - Amazon.com ★★★★★ »Ich bin wirklich süchtig nach dieser Serie. Non-Stop-Action von Anfang an lässt mich durch die Seiten fliegen. Holly ist zurück! Ich will auf jeden Fall mehr Zeit mit Nova und Holly verbringen. Sie sind das perfekte Team!« - Amazon.com ★★★★★ »Hey Leute, geht raus und kauft das. Es ist Teil einer Reihe, aber ich glaube nicht, dass man die Vorgänger gelesen haben muss, um dieses Buch zu genießen. Wenn ihr es einmal gelesen habt, wollt ihr natürlich auch alle anderen lesen! Die Figur der Holly Lin ist einfach klasse. Ich kann den nächsten Band kaum erwarten!« - Amazon.com
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kein Vergessen
ein Holly Lin Roman
Band 3
Robert Swartwood
© 2018 by Robert Swartwood
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Für Joseph D'Agnese und Denise Kiernan
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: HOLLOW POINT Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Kalle Max Hofmann Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-674-0
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
TEIL EINS
Kapitel 1
Das Mädchen ist mit Blut überströmt.
Das ist das Erste, was mir auffällt. Diese Gegend der Stadt ist genauso dunkel und ruhig, wie man es um drei Uhr morgens erwarten würde. Das einzige Licht kommt von ein paar spärlich verteilten Straßenlaternen, und als das Mädchen unter einer von ihnen entlanggeht, leuchtet das rote Blut förmlich. Es bildet einen starken Kontrast zu ihrer leicht bräunlichen Haut. Sie sieht aus, als wäre sie höchstens sechzehn, noch ein Kind. Sie trägt Shorts und ein T-Shirt und hat einen Rucksack dabei, doch meine Aufmerksamkeit liegt vollständig auf dem Blut. Sie hat es auf dem Gesicht und auf den Armen, es hat sich in ihre Kleidung und ihr Haar gesaugt.
»Bitte, helfen Sie mir. Bitte.« Sie murmelt die Worte auf Spanisch, ich kann sie kaum verstehen, und jetzt, wo sie keine fünf Meter mehr von mir entfernt ist, wird mir klar, dass sie humpelt. Sie zieht das rechte Bein nach und versucht, es so wenig wie möglich zu belasten. Jetzt, wo sie mich fast erreicht hat, kann ich sie auch riechen – das Blut, aber auch die anderen Körperflüssigkeiten. Sie hat sich entweder in die Hose gepinkelt oder geschissen oder beides. Sie kommt weiter auf mich zu, murmelt immer noch »Bitte, bitte, helfen Sie mir« – dann schubst sie den Rucksack in meine Arme und geht zu Boden.
Fünf Sekunden.
So viel Zeit ist vergangen, seit ich sie zum ersten Mal habe rufen hören, woraufhin ich mich umgedreht und das Blut gesehen habe.
Fünf Sekunden sind normalerweise nicht viel, aber unter gewissen Umständen können sie eine Ewigkeit sein. In meinem früheren Leben konnten fünf Sekunden den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ganze Länder können innerhalb von fünf Sekunden gerettet oder verloren werden.
Ich habe in den letzten fünf Sekunden keinen Muskel bewegt, was merkwürdig ist, denn vor nicht allzu langer Zeit war ich noch sehr entscheidungsfreudig. Ich habe keine Zeit damit verschwendet, mir verschiedene Konsequenzen meiner Handlungen vorzustellen. Ich habe einfach eine Entscheidung getroffen und auf das Beste gehofft.
Aber die Dinge haben sich geändert, ich bin nicht mehr die Person, die ich einst war. Diese Person ist längst weg, tot und begraben, und die Person, die ich jetzt bin – eine Barkeeperin, die gerade die Kneipe zugemacht hat und nun auf dem Weg nach Hause ist – hat mit Blut und Waffen und Mord nichts am Hut. Für dieses neue Ich ist das Wichtigste, was innerhalb von fünf Sekunden passiert, dass ich eine Getränkebestellung über einen hohen Geräuschpegel aus Country-Musik und Stimmengewirr verstehen muss, und dieses Getränk dann dem Kunden bringe, ohne einen Fehler zu machen.
Das Mädchen kauert jetzt auf den Knien, sie murmelt immer noch auf Spanisch, und ich nehme mir einen kurzen Moment, um mich umzuschauen. Natürlich ist die Umgebung immer noch menschenleer. Kein Wunder. Dieser Bereich der Stadt ist tagsüber immer leer, die meisten Gebäude sind ungenutzt, da die ganzen Firmen hier pleitegegangen sind, und im ganzen letzten Jahr habe ich auf dem Weg nach Hause eigentlich nie jemanden gesehen – erst recht kein blutüberströmtes Mädchen.
Mir wird plötzlich klar, dass ich immer noch den Rucksack halte. Er ist so plötzlich in meinen Armen gelandet, dass ich noch gar keine Zeit hatte, darüber nachzudenken. Jetzt hebe ich ihn an – scheint sieben, acht Kilo zu wiegen – und schaue hinunter auf das Mädchen.
»Was ist passiert? Wer hat dir das angetan?«
Erst eine Sekunde später wird mir klar, dass ich diese Fragen auf Englisch gestellt habe, also wiederhole ich sie auf Spanisch. Das Mädchen schaut zu mir auf, mit Tränen in den Augen. Ihre Stimme ist kaum noch mehr als ein ersticktes Flüstern.
»Helfen Sie mir!«
Bevor ich irgendetwas tun oder sagen kann, springt sie auf. Sie schiebt sich an mir vorbei und eilt weiter den Gehweg hinunter, wobei sie immer noch ihr rechtes Bein nachzieht.
Mit dem Rucksack in den Armen drehe ich mich um und schaue ihr fassungslos hinterher.
»Warte!«
Sie hört nicht. Stattdessen beschleunigt sie ihren Schritt und verschwindet in eine Gasse. Ich eile ihr hinterher, wobei der Gedanke, die Tasche zurückzulassen, mir überhaupt nicht in den Sinn kommt. Als ich den Eingang der Gasse erreiche, sehe ich, dass das Mädchen bereits am anderen Ende angekommen ist. Wie sie das geschafft hat, vor allem mit diesem Gehumpel, ist mir schleierhaft. Doch sie steht einfach da, mit dem Rücken zu mir, und schaut rechts und links in die Querstraße.
Ich rufe erneut nach ihr, während ich die Gasse hinuntereile. Ich habe etwa die Hälfte der Strecke geschafft, als das Mädchen urplötzlich auf die Fahrbahn rennt – und in diesem Moment wird sie auch schon von einem Auto gerammt und durch die Luft geschleudert.
Kapitel 2
Das Auto kommt mit quietschenden Reifen zum Stehen. Die Türen öffnen sich und zwei Männer steigen aus. Sie sind vollkommen ruhig – nicht das normale Verhalten, wenn man gerade eine junge Frau überfahren hat. Ganz lässig schauen sie sich um, während sie auf das Mädchen zulaufen, um nach ihr zu schauen.
Die beiden Männer sind Ende dreißig, Anfang vierzig. Sie tragen Jeans und Cowboystiefel. Einer von ihnen hat ein weißes, ärmelloses Oberhemd in die Hose gestopft, der andere trägt ein blaues Polohemd. Der Kerl in Weiß hat auch einen Cowboyhut auf. Er ist der Fahrer und richtet seinen Blick nun auf den regungslosen Körper auf dem Asphalt.
»Da hol mich doch der Teufel, wir haben sie«, sagt der andere Mann.
»Jepp.«
»Sie ist am Leben.«
»Noch.«
»Aber sie hat die Tasche nicht dabei!«
»Nein.«
Der Mann im Cowboyhut kniet sich neben die junge Frau.
»Hey.«
Sie antwortet nicht. Ihre Beine sind auf der Asphaltdecke gespreizt, ihr Körper ist überall verdreht, und sie ist noch blutiger als zuvor. Der Cowboy schnipst direkt vor ihrem Gesicht mit den Fingern.
»Hörst du mich, du Schlampe?«
Das Mädchen antwortet immer noch nicht. Selbst wenn sie es wollte, könnte sie es meiner Meinung nach nicht. Ein heiseres Krächzen kommt aus ihrer Kehle. Wahrscheinlich hat sie sich mehrere Rippen gebrochen, die jetzt in ihre Lungen stechen.
Ich stehe im Schatten am Ausgang der Gasse und halte immer noch den Rucksack. Ich lehne mich nur so weit vor, dass ich das Geschehen verfolgen kann. Mein erster Impuls ist, sofort zur Hilfe zu eilen, doch seit ich gesehen habe, wie seelenruhig die Männer aus dem Wagen gestiegen sind, schrillen bei mir ununterbrochen sämtliche Alarmglocken.
Und diese Glocken werden noch lauter, als der Fahrer zurück zum Wagen geht – wobei etwas Silbernes an seinem Gürtel im Licht der Scheinwerfer aufblitzt – und nachdem er die Fahrertür geöffnet hat, plötzlich eine schwarze Automatikpistole in der Hand hält.
Pistolen sind hier in Texas keine Seltenheit. Alden ist eine vergleichsweise kleine Ortschaft, hier wohnen vielleicht tausend Menschen, und eigentlich hat jeder immer eine Waffe dabei.
Doch nur die wenigsten haben einen Schalldämpfer.
Und genauso einen hat der Mann in der anderen Hand. Lässig beginnt er, ihn aufzuschrauben, während er zu dem Mädchen zurückgeht.
Die gesamte Zeit – vielleicht eine Minute – war ich ruhig und habe die beiden Männer beobachtet. Dieser Bereich von Alden ist nachts menschenleer. Die Leute nennen ihn den Industriehafen, aber Industrie gibt es hier eigentlich keine mehr, weswegen die meisten Gebäude ungenutzt sind. Ich gehe fast immer zu Fuß zurück in meine Wohnung, weil sie nicht weit entfernt ist, und ich außerdem die frische Luft nach der Arbeit genieße. Ich versuche, den Zigarettenrauch so gut es geht aus meinen Haaren und der Kleidung zu bekommen. Doch worauf ich eigentlich hinauswill, ist, dass weit und breit keine andere Menschenseele existiert.
Diese beiden Männer – die ich noch nie zuvor gesehen habe – scheinen das genau zu wissen, und dass das Mädchen sich vor Schmerzen auf dem Boden krümmt, ist ihnen offensichtlich herzlich egal.
Ein Teil von mir möchte ihr zu Hilfe kommen. Dieser Teil möchte aus den Schatten hervortreten und die Männer zur Rede stellen. Ich habe keine Pistole, ich habe kein Messer, ich habe überhaupt keine Waffe. Aber irgendjemand muss diesem Mädchen helfen, bevor der Cowboy ihr eine Kugel in den Kopf jagt.
Doch bevor ich das tun kann, bewegt sich der Rucksack. Natürlich ist es nicht der Rucksack, sondern etwas in dem Rucksack.
Es ist kaum Licht in der Gasse, doch als ich den Reißverschluss öffne, sehe ich trotzdem sofort, was in der Tasche ist.
Ein Baby.
Es ist noch sehr klein – vielleicht einen Monat alt – und hat einen Schnuller im Mund, wahrscheinlich der einzige Grund, warum es die ganze Zeit keinen Mucks von sich gegeben hat. Seine dunklen Augen schauen fragend zu mir auf, und in diesem Moment fällt ihm der Schnuller aus dem Mund.
Das Gesicht des Babys knautscht sich zusammen. Es sieht so aus, als würde es gleich anfangen zu schreien – es schnappt sogar kurz nach Luft – doch ich schiebe ihm einen Finger in den Mund, bevor es loslegen kann. Trotzdem habe ich ein Geräusch gemacht. Nur ein ganz winziges zwar, doch ich halte den Atem an und hoffe, dass die Männer nichts gehört haben.
Für einen Moment herrscht absolute Stille.
Dann sagt einer von ihnen etwas – klingt für mich nach dem Beifahrer im blauen Hemd: »Hast du das gehört?«
Als Antwort erklingen zwei gedämpfte Schüsse aus der Pistole.
Ohne einen Blick aus meiner Deckung zu wagen, weiß ich, dass das Mädchen nun tot ist. Wahrscheinlich haben sie ihr ins Gesicht geschossen, um sie von ihren Qualen zu erlösen. Doch natürlich hätte man sie auch retten können. Die Männer hätten einen Krankenwagen rufen können. Doch wahrscheinlich wollten sie sie nicht retten.
»Was gehört?«, fragt der Fahrer.
»Klang wie ein Geräusch aus der Gasse da!«
Doch bis der Kerl in Blau die Einmündung erreicht hat, bin ich nicht mehr da. Und die Tasche mit dem Baby auch nicht. Auf halbem Weg in der Gasse steht ein alter Müllcontainer. Er wurde sicher jahrelang nicht benutzt und rostet vor sich hin. Ich kauere dahinter und umschließe die Tasche mit meinen Armen, einen Finger immer noch im Mund des Babys.
Wenn der Mann auf mich zukommt, wird er mich auf jeden Fall bald sehen. In diesem Fall muss ich die Tasche vorsichtig absetzen und mein Bestes tun, um das Baby zu beschützen. Wahrscheinlich hat der Kerl eine Waffe, genau wie sein Partner, aber das ist in Ordnung. Ich habe zwar seit einem Jahr keinen Einsatz mehr gehabt, aber ich bin sicher, dass mein Training sich wieder bezahlt machen wird, sobald ich es brauche. Zwei Männer mit Pistolen? Kein Problem. Aber andererseits ist das im Moment nicht meine Sorge. Meine Sorge gilt dem Baby.
Doch der Mann kommt nicht viel näher. Nach ein paar Schritten, die die Absätze seiner Stiefel durch die engen Wände der Gasse hallen lassen, bleibt er stehen und leuchtet mit einer Taschenlampe umher. Das ist alles.
»Ist da was?«, ruft der Fahrer.
»Nein.«
»Dann schieb deinen Arsch hierher und hilf mir mit der Leiche!«
»Was ist mit der Tasche?«
»Die kann sie überall auf dem Weg versteckt haben.«
»Die Tasche ist aber wichtig!«
»Im Moment ist aber viel wichtiger, dass wir diese Sauerei hier beseitigen! Jetzt komm endlich her und pack mit an!«
Das Licht geht aus. Die Schritte des Mannes werden leiser, als er zum Wagen zurückkehrt.
Das Baby saugt inzwischen so intensiv an meinem Finger, dass es langsam wehtut. Mit der anderen Hand wühle ich in der Tasche herum. Ich ertaste eine Decke, eine Flasche, eine kleine Packung Milchpulver und endlich den Schnuller.
Ich warte noch einen Augenblick und höre den Männern zu, wie sie leise den leblosen Körper im Kofferraum verstauen. Dann blicke ich mich um, um sicherzugehen, dass ich allein bin. Ich schnappe mir die Tasche und eile so geräuschlos wie möglich zurück, fest entschlossen, das Baby so weit weg von den Bewaffneten zu schaffen, wie ich kann.
Kapitel 3
Ich nehme den umständlichen Weg nach Hause.
Es sind eigentlich nur drei Blocks bis zu meinem Apartmenthaus, gerade einmal ein fünfminütiger Spaziergang, aber ich laufe einen großen Bogen, wobei ich mich dicht an den Fassaden halte und von einem Schatten zum nächsten eile. Die Nacht ist totenstill, hin und wieder höre ich ein Auto auf dem entfernten Highway oder einen Hund bellen.
Den Rucksack halte ich eng umschlossen, wiege ihn hin und her, um das Baby ruhig zu halten. Denn ich weiß jetzt, dass die Männer hinter dem Baby her sind.
Ein Handy habe ich schon lange nicht mehr, aber selbst wenn es so wäre, bin ich mir nicht sicher, ob ich den Notruf wählen würde. Nicht, nachdem ich das glitzernde Etwas am Gürtel des Mannes gesehen habe – es war eine Polizeimarke. Allerdings war er kein Beamter aus der Stadt, sonst hätte ich ihn erkannt. Trotzdem sprach diese Marke eine deutliche Sprache – er ist ein Gesetzeshüter.
Zwanzig Minuten später erklimme ich die Stufen zu meiner Wohnung im ersten Stock. Das Gebäude hat nur zwei Etagen, und auf der oberen gibt es vier Apartments. Meines ist am Ende des Flures links.
Ich werfe einen argwöhnischen Blick auf die Nachbartür, bevor ich meine Wohnung aufschließe und eintrete. Ich bin ziemlich spartanisch eingerichtet – ich habe keinen Fernseher, keinen Computer und auch kein Telefon. Ein Stapel Bücher aus der Bücherei steht neben der Couch.
Dort gehe ich als Erstes hin, nachdem ich die Tür geschlossen und das Licht angemacht habe. Vorsichtig setze ich die Tasche ab und öffne sie – und sofort springt mir ein übler Geruch entgegen. In den letzten paar Minuten hat das Baby sich ordentlich erleichtert. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung, so machen Babys das halt, nur habe ich leider keine Windeln parat. Genauso wenig wie irgendetwas anderes, das ein Baby braucht.
Aber eines nach dem anderen. Ich nehme das Baby heraus und trage es ins Bad. Dort drehe ich beide Hähne auf, um Wasser in die Wanne zu lassen. Ich nehme die Windel ab und stelle fest, dass das Baby ein Mädchen ist. Es gefällt mir nicht, dass ich das Baby in meinen Gedanken wie ein Ding bezeichne, nun weiß ich wenigstens schon mal, dass es eine Sie ist. Doch einen Namen habe ich immer noch nicht.
Der säuerliche Geruch bringt mich zum Würgen. Ich werfe die Windel in den Mülleimer, doch der hat leider keinen Deckel, was also gegen den Gestank nicht viel hilft.
Ich schalte die Lüftung an, als ob das etwas bringen würde, und lege mir das Baby dann auf einen Unterarm, während ich mit der anderen Hand die Wassertemperatur prüfe. Es scheint weder zu kalt noch zu warm zu sein, also fange ich an, die Kleine abzuwaschen. Ich hatte noch nie mit Babys zu tun, doch ich habe gehört, dass man eigentlich eine besonders milde Seife braucht, um ihre Augen zu schützen. Ich will aber auch nicht, dass sie stinkt, also nehme ich einen frischen Waschlappen, befeuchte ihn mit einem Spritzer Duschgel und seife sie dann komplett ein, bis zum Hals. Sie hat noch den Schnuller im Mund, den ich auch irgendwann sauber machen muss. Ich habe nur Angst davor, was passieren wird, wenn ich ihn ihr aus dem Mund nehme. Sie wird garantiert zu schreien anfangen, und das darf nicht passieren. Meine Nachbarn sind alle nette Menschen, aber sie wissen, dass ich kein Kind habe. Wenn sie ein Baby schreien hören, wirft das Fragen auf, die ich nicht beantworten möchte.
Das Baby hat ein Muttermal auf dem Rücken, das wie eine kleine Sternschnuppe aussieht.
»Sternchen«, flüstere ich. »Vielleicht nenne ich dich einfach so. Klingt das gut?«
Sternchen antwortet nicht.
Nachdem ich sie mit lauwarmem Wasser abgespült habe, trockne ich sie erst ab und wickle sie dann in ein frisches Handtuch. Dann gehe ich mit ihr zum Waschbecken und ziehe ihr den Schnuller aus dem Mund. Obwohl ich erwarte, dass sie zu weinen anfängt, tut sie das nicht. Sie starrt mich einfach nur an, als wäre sie verwundert, wer ich bin und was ich mache.
Nachdem ich den Schnuller so gut wie möglich abgespült habe, schüttle ich ihn trocken und stecke ihn Sternchen wieder in den Mund.
Okay, was jetzt?
In meinem früheren Beruf habe ich als Kindermädchen gearbeitet, aber das war ich nicht wirklich. Eigentlich war ich eine Art Bodyguard für die Kinder meines Bosses. Ich habe mit ihnen Dinge unternommen, ihnen mit den Hausaufgaben geholfen, aber da sie keine Windeln mehr getragen haben, kam ich nie mit Babyzeug in Berührung. Natürlich habe ich schon mal gesehen, wie jemand Windeln gewechselt hat, aber ich habe es noch nie selbst gemacht. Normalerweise würde man sich in so einem Fall wahrscheinlich auf YouTube Hilfe holen, aber wie gesagt: Ich habe weder Computer noch Handy.
Obwohl … so ganz stimmt das nicht. Ich habe ein Handy, sogar zwei. Beides sind Wegwerfhandys, die ich einen Monat, nachdem ich hier eingezogen bin, gekauft habe. Nur für den Fall, dass ich sie mal brauchen würde. Dabei bin ich nicht mal sicher, ob die Startguthaben nicht längst verfallen sind. Und selbst wenn nicht, wen sollte ich anrufen?
Sternchen braucht richtige Windeln. Kleidung. Nahrung. Praktisch alles, was jedes Baby braucht.
Ich sollte die Polizei rufen, doch ich denke immer noch an das Glänzen am Gürtel des Fahrers. Natürlich kann ich nicht wissen, ob diese Polizeimarke echt war – man kann sicher Fälschungen im Internet bestellen, aber ich kann kein Risiko eingehen.
Bevor ich zur Couch zurückgehe, um zu schauen, was noch in dem Rucksack ist, schaue ich im Schlafzimmer vorbei. Dort steht eine Kommode mit drei Schubladen. Während ich Sternchen in meinem linken Arm wiege, öffne ich die unterste Schublade, die ich mit Sweatshirts und Jogginghosen vollgestopft habe. Ich wühle darin herum, bis ich eine von den beiden Pistolen gefunden habe, die dort versteckt sind.
Es ist eine SIG Sauer P320 Nitron Compact. Das Magazin hat Platz für fünfzehn 9-mm-Patronen und ist bereits geladen. Ich muss nur noch den Schlitten zurückziehen, um das erste Geschoss in den Lauf zu laden.
Die Waffen habe ich seit Monaten nicht angefasst. Ich habe sie nicht mal angeschaut, geschweige denn gereinigt. Mein früheres Ich wäre viel sorgsamer mit diesen Waffen umgegangen. Sie hätte sichergestellt, dass die beiden Pistolen – und auch die Mossberg-Schrotflinte, die im Kleiderschrank im Flur versteckt ist – jederzeit optimal gewartet sind. Aber nach einem Jahr des Alleinlebens, der Integration in diesen Ort und die Gewöhnung an meine neue Identität, hatte ich nie das Gefühl, eine Waffe benutzen zu müssen. Mein altes Leben habe ich weit hinter mir gelassen.
Ich vergewissere mich, dass die Pistole gesichert ist, bevor ich sie mir in den Hosenbund stecke. Anschließend schaue ich in meinen Kleiderschrank und ziehe die dicke Wolldecke hervor. Ich schnuppere daran – riecht muffig, aber es muss reichen.
Als ich ins Wohnzimmer zurückkomme, breite ich die Wolldecke auf dem Boden aus. Ich falte sie einmal, damit es weich genug ist, dann lege ich Sternchen darauf ab.
Jetzt habe ich die Hände frei, also drehe ich mich um und knie mich neben den Rucksack. Er riecht immer noch säuerlich, aber nicht so schlimm wie zuvor. Die Babydecke muss ich auf jeden Fall waschen.
Bevor ich den Inhalt des Rucksacks genauer durchsuchen kann, fallen mir die Flasche und das Milchpulver ins Auge. Ich weiß nicht, wann Sternchen das letzte Mal gefüttert wurde, aber irgendetwas sagt mir, dass Babys unglaublich viel Nahrung brauchen.
Ich schnappe mir die Packung, überfliege die Anleitung auf der Rückseite und beschließe, dass sie recht einfach klingt.
»Warte hier«, flüstere ich Sternchen zu.
Dann eile ich mit der Flasche und dem Pulver in die Küche. Ich spüle die Flasche und trockne sie ab, dann befolge ich die Instruktionen zur Zubereitung. Als ich wieder ins Wohnzimmer komme, liegt Sternchen zum Glück immer noch auf der Decke. Ich setze mich neben sie auf den Boden, lege sie mir auf den Unterarm und ziehe ihr den Schnuller aus dem Mund, den ich sodann mit dem Gummistutzen der Flasche austausche.
Erst mache ich mir Sorgen, dass sie die Nahrung nicht annehmen wird, doch da fängt sie auch schon an zu saugen. Ich ermuntere sie mit gurrenden Geräuschen und feuere sie an: »Braves Sternchen!«
Als die Flasche leer ist, lege ich mir die Kleine auf die Schulter und tätschle ihren Rücken, bis sie rülpst.
»Alles klar, Sternchen?«
Da sie nicht antwortet und ich nicht weiß, ob ich weitermachen soll, lasse ich es drauf ankommen, lege sie wieder auf die Decke und stecke ihr den Schnuller in den Mund.
Jetzt sind meine Hände wieder frei und ich kann den Rucksack weiter untersuchen. Ganz unten sehe ich zwei weitere Gegenstände: Ein knallgelbes Portemonnaie mit Klettverschluss, wie kleine Mädchen es mögen, und einen abgehackten, kleinen Finger.
Bevor ich die Sachen herausziehen kann, klopft es plötzlich an der Tür – zwei schnelle, gedämpfte Schläge – und eine Stimme ruft halblaut: »Polizei, aufmachen!«
Kapitel 4
Ich werfe Sternchen einen Blick zu und bin nicht sicher, ob ich sie hier auf dem Boden lassen möchte. Sie liegt auf dem Rücken, schaut zu mir auf und saugt rhythmisch an ihrem Schnuller.
Als es noch einmal klopft, stehe ich auf und begebe mich zur Tür, wobei ich spüre, wie mir die Pistole in den Rücken drückt. Doch ich greife nicht nach der Waffe. Stattdessen lege ich die Sicherheitskette an und mache die Tür einen Spalt auf.
Erik grinst mir entgegen und hält zwei Flaschen Heineken hoch.
»Wollen wir abhängen?«
Abhängen ist unser Codewort für ficken. Das machen Erik und ich nämlich seit ein paar Monaten. Erik arbeitet als Hilfssheriff beim Polizeidezernat von Colton County. Er wohnt am anderen Ende des Flures und hat mir sehr hilfsbereit beim Einzug unter die Arme gegriffen. Anschließend haben wir uns hin und wieder gesehen, »Hallo« gesagt und gelächelt, aber mehr nicht. Einmal hat er dann ein Gespräch angefangen und mich auf einen Kaffee eingeladen, aber ich lehnte höflich ab. Nicht, dass ich nicht interessiert gewesen wäre – Erik war ein paar Jahre jünger als ich und definitiv heiß. Ein großer, muskulöser Mann mit einem niedlichen Lächeln – aber ich wollte damals keinen Freund. Außerdem war ich sowieso schon die einzige asiatisch aussehende Person im Ort. Wenn ich da noch mit einem der wenigen Schwarzen gesehen würde, wäre das sehr auffällig. Mein Plan war aber, unter dem Radar zu bleiben. Um ehrlich zu sein, will ich auch immer noch keinen Freund haben, aber es führte nun mal eines zum anderen, wie das oft so ist, und wir fingen an, ab und zu Sex zu haben. Ohne Verpflichtungen, ohne Dates, ohne den anderen kennenzulernen. Einfach nur ficken.
Ich sehe ihm fest in die Augen und schüttle den Kopf. »Ich kann gerade nicht.«
Sein Lächeln verschwindet und er scheint erst jetzt die Sicherheitskette zu bemerken.
»Ist alles in Ordnung?«
»Alles prima.«
Er hält kurz inne, als er einen Geruch zu bemerken scheint. Sternchens Dunstwolke hat wohl ihren Weg in den Flur gefunden. Ich räuspere mich schüchtern.
»Um ehrlich zu sein, mir geht es gerade nicht gut. Ich glaube, ich habe etwas Falsches gegessen.«
Erik setzt wieder ein Lächeln auf – es wirkt etwas gezwungen, doch in seinen dunklen Augen schimmert kein Vorwurf. Ein weiterer Grund, warum ich den Kerl mag.
»Hast du Magentabletten?«
»Weiß ich nicht genau.«
»Ich habe, glaube ich, noch welche.«
Bevor ich etwas sagen kann, hat er sich umgedreht und ist verschwunden. Dreißig Sekunden später ist er wieder da, diesmal ohne die Bierflaschen. Er schüttelt den Kopf.
»Sorry, habe auch keine.«
»Das ist schon in Ordnung.«
»Wenn du willst, hole ich welche.«
Alden ist so ein Ort, wo nichts vierundzwanzig Stunden lang offen hat, nicht einmal die Tankstelle. Was bedeutet, dass Erik fünfzehn Meilen zum Truck-Stop am Highway fahren müsste oder noch weitere siebzig Meilen bis zum nächsten Einkaufszentrum. Und das würde er tun, wenn ich ihn bitten würde – da bin ich mir ganz sicher. Aber ich schüttle den Kopf. »Das ist total lieb von dir, aber nicht nötig. Es war einfach eine lange Schicht, deswegen werde ich jetzt versuchen, mich schlafen zu legen.«
Erik nickt und sagt: »Ich hoffe, du bist bald wieder fit. Lass mich wissen, wenn du irgendwas brauchst.«
»Mach ich.«
Ich schließe die Tür und warte, bis ich höre, dass seine Tür ebenfalls zugeht. Dann kehre ich zu Sternchen zurück und lächle sie an.
»Das war Erik. Er ist ein netter Kerl. Wir haben uns am Anfang darauf geeinigt, dass sich keiner in den anderen verlieben darf, aber ich glaube, diese Regel hat er schon vor langer Zeit gebrochen. Was kann ich dazu sagen – es muss an meinem Charme liegen.«
Sternchen starrt mich an, sie ist eindeutig nicht beeindruckt.
Ich wende mich wieder dem Rucksack zu. Das gelbe Portemonnaie ignoriere ich und untersuche stattdessen den Finger. Als das Mädchen auf mich zugekommen ist – was jetzt vielleicht gerade einmal eine Stunde her ist – war ich zu abgelenkt von dem ganzen Blut, als dass mir irgendetwas anderes aufgefallen wäre. Wie zum Beispiel, ob sie noch zehn Finger hatte.
»Rühr dich nicht vom Fleck, Sternchen!«
Ich eile in die Küche und schaue unter der Spüle nach dem Putzmittel. Ich finde eine Packung Latexhandschuhe und ziehe mir ein Paar über, als ich zur Couch zurückkehre.
»Schön, dass du noch da bist«, sage ich zu Sternchen, aber sie scheint den Witz nicht zu verstehen.
Ich nehme den Finger aus der Tasche und schaue ihn mir genauer an. Er ist nicht sauber abgeschnitten, sondern sieht eher abgerissen aus. Wahrscheinlich mithilfe einer Zange. Und das bedeutet, das Mädchen wurde höchstwahrscheinlich gefoltert.
Wenn die beiden Männer, die ich gesehen habe, sie entführt hatten und ihr mit einer Zange den kleinen Finger abgerissen haben, worum ging es dann? Wenn sie die Tasche – und damit Sternchen – gesucht haben, würde das bedeuten, dass das Mädchen sie zu diesem Zeitpunkt nicht bei sich hatte. Also waren sie woanders, und dann … hat es das Mädchen irgendwie geschafft, zu entkommen? Okay, das könnte sein. Also ist sie abgehauen, vor den Männern weggerannt, hat sich den Rucksack mit dem Baby darin geholt … Oder Sternchen war vorher irgendwo anders und das Mädchen hat sie dann erst in die Tasche gestopft … jedenfalls ist sie dann durch die dunklen Straßen geirrt. Dieser Teil der Stadt ist normalerweise menschenleer. Damit ist es die ideale Umgebung für böse Menschen, einem hilflosen Mädchen schlimme Dinge anzutun.
Sternchen wird jetzt unruhig.
Ich lege den Finger beiseite und strecke die Hände nach ihr aus, wobei mir die Latexhandschuhe auffallen. Ich müsste sie erst ausziehen, die Packung war aber fast leer, und ich will jetzt keine Handschuhe verschwenden. Also flüstere ich ihr stattdessen zu.
»Ich weiß, Sternchen, ich weiß. Ich habe auch schon jemanden im Kopf, der uns helfen kann, aber wir müssen noch ein paar Stunden warten. Und ich muss noch ein wenig aufräumen.«
Sternchen schaut mich einfach nur an. Sie sieht alles andere als glücklich aus.
Ich wende mich wieder dem Finger zu und verziehe das Gesicht. Wenn ich davon ausgehe, dass er zu dem Mädchen gehört, und dass diese Männer ihn abgerissen haben, warum sollte sie dann bei ihrer Flucht den Finger mitgenommen haben? Das wirft gewisse Zweifel auf diese Theorie. Vielleicht gehört der Finger gar nicht dem Mädchen, sondern jemand anderem.
Ich beschließe, dass ich den Finger in eine Plastiktüte tun und dann in den Kühlschrank legen sollte. Auch wenn ich gar nicht weiß, was ich später damit machen soll. Eine vernünftige Person hätte längst die Polizei gerufen, damit die sich einen Reim auf das Ganze machen können. Eigentlich halte ich mich selbst ja durchaus für vernünftig, aber das kann ich definitiv nicht machen. Nicht, nachdem ich dieses blutüberströmte Mädchen gesehen habe. Nicht, nachdem sie mir die Tasche, und damit das Baby, übergeben hat. Sie hat Sternchen damit in meine Obhut gegeben. Und dann ist da natürlich noch die Tatsache, dass der Fahrer, der wahrscheinlich bei der Polizei ist, das Mädchen erschossen hat.
Nein, die Polizei kann ich nicht rufen, jedenfalls noch nicht. Ich kann nicht mal Erik in die Sache mit reinziehen, obwohl er mir ganz sicher helfen würde. Soweit ich das beurteilen kann, ist er ein guter Cop, was bedeutet, dass er alles streng nach Vorschrift machen würde. Und das bedeutet wiederum, in dem Moment, wo ich ihm von der Sache erzähle, würde er sie melden. Und das wiederum würde wahrscheinlich die beiden Männer alarmieren, die Sternchens Mutter ermordet haben, zumindest denke ich, dass es ihre Mutter war.
Als Nächstes überprüfe ich das Portemonnaie. Der Klettverschluss macht ein widerliches Geräusch. Es klingt so giftig, dass sich meine Nase kräuselt, und ich befürchte, dass es Sternchen zum Weinen bringen könnte. Doch ihr ist es vollkommen egal – es sieht sogar so aus, als würde sie gleich einschlafen.
In der Geldbörse sind fünf Einhundert-Dollar-Scheine. Sie sind so glatt und frisch, als kämen sie direkt aus der Druckerei. Als ob die einzige Person, die sie je in der Hand gehabt hätte, ein Bankmitarbeiter war.
Außerdem finde ich eine Visitenkarte. Darauf sind kleine Fußabdrücke am Strand zu sehen. Darüber prangen die Worte: »Kleine Engel Adoptionsagentur« und der Name »Leila Simmons, LSW«. Die Adresse ist in San Angelo, was etwa drei Stunden entfernt liegt. Auf der Rückseite der Karte hat jemand mit blauer Tinte eine Telefonnummer hinterlassen.
Die Abkürzung LSW steht für »Licensed Social Worker«, also ist diese Leila Simmons eine staatlich geprüfte Sozialarbeiterin. Sie werde ich also morgen als Erste anrufen. Aber erst, nachdem ich einige Recherchen angestellt habe.
Jetzt muss ich allerdings erst mal die Gelegenheit nutzen, dass Sternchen schläft, und hier sauber machen. Es ist inzwischen kurz nach vier, was bedeutet, dass ich noch mindestens drei Stunden warten muss, bevor es weitergeht.
Ich sammle das Portemonnaie und den Finger wieder ein. Ich muss sie an einem sicheren Ort verstauen, auch wenn ich noch nicht weiß, was ich später damit machen soll. Doch zuerst halte ich inne und werfe einen Blick auf Sternchen.
Ich ziehe mir die Handschuhe ab, werfe sie in den Rucksack, dann stehe ich auf und ziehe die Pistole aus meinem Hosenbund. Ich lege sie auf die Armlehne des Sofas und beuge mich hinab, um Sternchen von der Decke zu nehmen. Ich setze mich wieder auf die Couch, lege sie mir auf den Schoß und schaue sie an, wobei ich mein Bestes tue, um nicht einzuschlafen. Ich bin seit fast vierundzwanzig Stunden wach, und irgendetwas sagt mir, dass es noch sehr lange dauern wird, bis ich wieder eine Chance haben werde, die Augen zu schließen.
Kapitel 5
Alden war mal richtig belebt, mit mehreren tausend Einwohnern, doch als die Fabriken vor einer Dekade geschlossen wurden, sind die meisten Leute weggezogen. Jetzt gibt es kaum noch Geschäfte in der Gegend und erst recht keine Fitnessstudios.
Deswegen absolviere ich mein Training in der Regel vormittags, wenn ich aufwache, indem ich drei Meilen durch den Ort jogge. Deswegen habe ich nie eine Sporttasche gebraucht, geschweige denn irgendeine andere Tasche, in der man unauffällig ein Baby transportieren könnte.
Da Alden so klein ist, kennt hier jeder jeden. Natürlich verstehen sich nicht alle miteinander, aber man sieht die Leute halt im Vorbeigehen. Man weiß, wer verheiratet ist, wer einen Lebenspartner hat und wer Single ist. Und natürlich, wer Kinder hat.
Jeder im Ort kennt mich als Jen Young. Sie wissen, dass ich Single bin und kein Kind habe, also wäre es keine gute Idee, Sternchen offen durch den Ort zu tragen.
Am Ende muss ich also eine große Einkaufstüte nehmen. Sie ist nicht mal so groß, wie ich es gern hätte, doch es reicht. Ich stopfe zwei Handtücher hinein – meine letzten beiden sauberen Handtücher, übrigens – und lege Sternchen dann darauf.
Ich ziehe mir ein graues Sweatshirt über, das schlabbrigste, das ich habe, damit es die Waffe in meinem Hosenbund verbirgt.
Den Rucksack und die vollgeschissene Windel habe ich schon in eine Mülltüte gepackt. Mein erster Gedanke ist, sie direkt in einen der Container vor dem Haus zu werfen, doch ich überlege es mir anders. Immerhin handelt es sich dabei um Beweisstücke, und vielleicht wird es ja doch nötig, dass sich die Polizei der Sache annehmen muss. Da muss ich nicht noch mehr Schaden anrichten, als ich es bereits getan habe.
Ich besitze ein Auto – einen Honda Civic von 2002 – aber ich fahre kaum damit. Außerdem haben wir nur fünf Blocks vor uns, das ist nicht einmal eine Viertelmeile. Es ist gerade sieben Uhr durch, der frühe Samstagmorgen ist kühl und klar, der weite Himmel blassblau.
Ich trage die Tüte in der linken Hand und schwinge sie beim Gehen leicht vor und zurück, damit Sternchen im Schlaf gewogen wird. Die rechte Hand halte ich mir frei, für den Fall, dass ich nach der Pistole greifen muss. Ich rechne zwar nicht damit, aber letzte Nacht habe ich auch nicht damit gerechnet, dass mir eine blutüberströmte junge Frau ein Baby in die Hand drückt. Von daher sage ich mir, lieber auf Nummer sicher gehen.
Alden erwacht langsam zum Leben. Weil es das Wochenende ist, sind die meisten Menschen aber noch zu Hause. Es gibt kaum Verkehr. Zwei Blocks weiter befindet sich Benny's Barbecue, und wie ich riechen kann, haben sie schon den Grill angeworfen. Sie machen zwar erst mittags auf, doch das Fleisch wird jetzt schon angeräuchert.
Meredith hat ein Ranchhaus mit zwei Schlafzimmern gemietet, welches sich auf der High Street befindet. Die Hütte ist eigentlich abrissreif, doch mehr kann sie sich von ihrem Gehalt als Kellnerin nicht leisten. Sie ist zweiundzwanzig, hat zwei Kinder und macht eine Ausbildung zur Arzthelferin. Die Väter der beiden Kinder haben sich längst aus dem Staub gemacht, und ihre Mutter hilft auch nicht mehr als unbedingt nötig. Irgendwie gibt es da dicke Luft, zumindest soweit ich es mitbekommen habe. Ich bin nicht supergut mit Meredith befreundet, doch wir kommen auf der Arbeit gut miteinander zurecht. Sie scheint eine gute Mutter zu sein, und das ist der eine Grund, warum ich an sie gedacht habe, als ich gestern mit Sternchen auf dem Sofa saß. Der andere Grund ist, dass sie unter ständigem Geldmangel leidet und sich bestimmt gern etwas dazuverdient.
Nun steht sie vor mir in der offenen Tür und hält ihr eigenes Baby in den Armen. Sie wischt sich den Schlaf aus den Augen, bevor sie skeptisch den Stapel Zwanzig-Dollar-Scheine beäugt, den ich ihr vor die Nase halte.
»Ich verstehe das nicht – wie viel hast du gesagt?«
»Dreihundert Dollar.«
»Für ein paar Stunden Arbeit?«
»Genau.«
»Und was muss ich machen?«
Bevor ich antworten kann, fällt Sternchen der Schnuller aus dem Mund und sie fängt an zu quengeln. Meredith bekommt sofort große Augen und sie beugt sich vor, um in die Tüte sehen zu können. »Ist das etwa …«
Ich schneide ihr das Wort ab: »Kann ich reinkommen?«
Bevor sie etwas sagen kann, schiebe ich mich auch schon an ihr vorbei. Meredith ist regelrecht gelähmt. »Ist das ein Baby?«, fragt sie. »Wo hast du ein Baby her?«
Ehe ich antworten kann, stürmt ein paar Füße auf uns zu und Merediths anderer Sohn, der fünfjährige Johnny, wirft sich seiner Mutter ans Bein.
»Pfannkuchen!«
»Johnny, ich habe dir doch schon gesagt; nicht jetzt!«
»Pfannkuchen!«
»Nicht jetzt, Johnny!«
Ihre Stimme klingt schärfer, als sie es wahrscheinlich gemeint hat, und Johnny wirkt wie versteinert. Sein Gesicht wird fahl, seine Unterlippe fängt an zu zittern, und Meredith, die einen Tobsuchtsanfall kommen sieht, seufzt schwer.
»Na gut, Pfannkuchen. Jetzt geh fernsehen und lass uns in Ruhe.«
Johnnys Augen fangen an zu leuchten, er grinst triumphierend und zischt dann ins Wohnzimmer.
Meredith schüttelt den Kopf und schaut mich müde an. »Was auch immer du tust, bekomme bloß keine Kinder!«
Doch dann hält sie inne und schaut wieder hinab auf die Tüte.
»Wessen Baby ist das überhaupt?«
»Ich bin nicht ganz sicher.«
»Was soll das denn heißen?«
»Das heißt, dass ich nicht ganz sicher bin. Schau mal, Meredith, je weniger du weißt, umso besser.«
Diese Aussage ist so absurd, dass Meredith fast lachen muss.
»Du machst Witze, oder? Du kommst hier also direkt nach Sonnenaufgang reinspaziert und bietest mir dreihundert Dollar, um … ja, wofür eigentlich genau?«
»Dafür, dass du ein paar Stunden auf Sternchen aufpasst.«
»Sternchen?«
»Ja, so nenne ich sie.«
»Du kennst nicht mal ihren richtigen Namen?«
»Sagen wir mal, ich habe sie letzte Nacht gefunden.«
»Gefunden? Wo denn?«
»Wie gesagt, je weniger du weißt, desto besser.«
Sie seufzt schwer. »Ich habe doch schon zwei eigene Kinder, um die ich mich kümmern muss.«
»Ich weiß. Deswegen würde ich dich auch normalerweise in Ruhe lassen. Aber ich habe keine andere Wahl.«
»Was soll ich denn mit ihr machen?«
»Sie füttern, baden, windeln und ihr etwas anziehen. Halte einfach ein Auge auf sie, bis ich wieder da bin.«
»Wo gehst du denn hin?«
»Je weniger, desto besser, Meredith.«
»Scheiße, Jen. Ich weiß nicht. Das klingt extrem unseriös.«
»Ist es auch. Deswegen kriegst du ja auch extrem viel Geld dafür.«
»Dreihundert Dollar.«
»Genau.«
Sie starrt den Stapel Geldscheine in meiner Hand an. »Okay. Wann kommst du zurück?«
»Ich bin nicht ganz sicher.«
»Aber nicht mehr als ein paar Stunden?«
»Richtig.«
»Wäre es okay, wenn ich meine Mutter anrufe, damit sie vorbeikommt und mir hilft?«
»Lieber nicht. Ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, deine Mutter tratscht ganz gern, und es darf niemand davon erfahren.«
Meredith beißt sich auf die Unterlippe und schaut wieder auf die Tüte.
»Das ist aber nicht illegal, oder?«
»Nein.«
Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass es das nicht ist. Jedenfalls nicht, was Meredith angeht. Sie passt nur auf ein Baby auf. Sie weiß nicht, worum es geht. Und das muss sie auch nicht.
Über die Geräusche des Kinderfernsehens ruft Johnny: »Mami, Pfannkuchen!«
Merediths Gesichtszüge verhärten sich. Mir wird klar, dass mein Angebot auf der Kippe steht. Natürlich ist es verlockend, aber es bedeutet, noch so ein Monster an der Backe zu haben.
»Fünfhundert.«
Ihre Augen weiten sich, als ich diese Worte sage, und ihr Mund steht offen.
»Fünfhundert?«
»Ja. Dreihundert sofort, und weitere zweihundert, wenn ich zurück bin. Du musst sie nur füttern, baden und anziehen. Mehr nicht. Ich komme in ein paar Stunden zurück und du wirst das Baby nie wieder sehen. Diese ganze Sache wird unser kleines Geheimnis bleiben.«
Sie kaut weiter auf ihrer Unterlippe, es ist definitiv keine leichte Entscheidung, doch der Verlockung von fünfhundert Dollar kann sie nicht widerstehen.
Mit ihrer freien Hand nimmt sie mir die Einkaufstüte aus der Hand und wirft mir die Art von Lächeln zu, welches sie auch in der Kneipe benutzt, wenn sie ein wenig extra Trinkgeld erschleichen möchte.
»Dann bis in ein paar Stunden.«
Kapitel 6
Die Stadtbücherei von Alden befindet sich direkt im Zentrum. Es ist ein stämmiges Backsteingebäude mit nur einer Etage. Die Öffnungszeiten sind sehr überschaubar und es gibt nicht viele Leute im Ort, die das Angebot von Büchern, DVDs und kostenlosem Internet nutzen.
Ich jobbe dort ehrenamtlich ein paar Tage in der Woche, die Arbeit besteht überwiegend daraus, die Regale wieder einzuräumen. Dadurch habe ich nebenbei etwas zu tun. Sonst würde ich doch nur allein in meinem Appartement sitzen, die Wände anstarren und über Dinge nachdenken, an die ich nicht denken möchte.
Am Samstag ist die Bücherei nicht mal halbtags geöffnet. Sie macht um neun auf und um zwölf schon wieder zu. Also fahre ich um Punkt neun auf den Parkplatz. Dank Meredith hatte ich Zeit, noch mal in meine Wohnung zu gehen, zu duschen und frische Klamotten anzuziehen. Meine Haare sind noch feucht, als ich aus dem Auto steige und auf den Eingang zugehe.
Obwohl es bereits eine Minute nach neun ist, ist die Tür abgeschlossen. Ich lehne mich nah an die Glasscheibe in der Tür und schaue hinein: Alles dunkel, niemand zu sehen.
»Jen?«
Gloria Ruskins Stimme ertönt hinter mir und ich drehe mich leicht, um einen Blick über die Schulter zu werfen. Die alte Dame schlurft den Gehweg entlang.
»Guten Morgen, Gloria!«
Sie kneift die Augen zusammen. »Geht es dir gut?«
»Warum fragst du?«
»Du trägst einen Pullover – und das mitten im Juni!«
Natürlich habe ich das schlabbrige Sweatshirt nur an, um die Pistole zu verdecken, die immer noch in meinem Hosenbund steckt, aber das braucht Gloria nicht zu wissen.
»Mir ging es die letzten Tage nicht so gut. Vielleicht kriege ich eine Erkältung.«
Sofort hält Gloria sich die Hand vors Gesicht. »Dann bleiben Sie mir vom Leib, junge Frau, ich will nicht krank werden!«
»Keine Sorge, ich verspreche, dich nicht anzuniesen! Ist denn bei dir alles okay? Du bist doch sonst immer vor neun Uhr hier.«
Ich gehe aus dem Weg, als Gloria mit einem dicken Schlüsselbund in der Hand auf die Tür zutritt.
»Howard ging es heute Morgen auch nicht so gut. Ich dachte, ich sollte vielleicht bei ihm bleiben, aber … du weißt ja, wie es ist.«