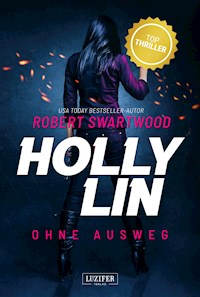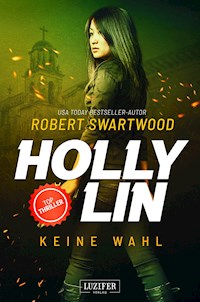
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Holly Lin
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Holly Lin. Kindermädchen am Tag, Auftragskiller bei Nacht. Javier Diaz ist tot. Dessen ist sich Holly Lin sicher … immerhin war sie es, die Javier und seine Männer tötete. Um ihre Familie zu beschützen, muss sie nun jedoch nach Mexiko aufbrechen und auch Javiers Vater ausschalten, bevor dieser vom Tod seines Sohnes erfährt. Eigentlich eine einfache Mission – aber für Holly Lin verlaufen die Dinge nur selten einfach … Ihr Plan ist es, jeden auf Diaz' Anwesen umzubringen. Doch dann entdeckt sie eine Frau und ein Kind, welche sich auf dem Gelände versteckt halten. Damit hat die Nacht erst begonnen – und an ihrem Ende sieht sich Holly mit einer neuen Gefahr konfrontiert. Eine Gefahr, die ihr keine andere Wahl lässt, als sie zu besiegen … "Großartig – unvergesslich und ein Roman, den ich mehr als einmal lesen werde." - Roxane Gay, New York Times Bestseller-Autorin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Keine Wahl
Ein Holly Lin Roman
Band 2
Robert Swartwood
© 2013 by Robert Swartwood
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Für Norman und Rosemary Sargent
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE DEVIL YOU KNOW Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Kalle Max Hofmann Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-628-3
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
TEIL EINS
Kapitel 1
Der Wachmann ist klein und stämmig, fast schon pummelig. Er patrouilliert seinen Abschnitt mit einer AK-47 in der Hand. Er ist jetzt schon zweimal an dieser Stelle vorbeigekommen und lässt sich Zeit, seine Aufmerksamkeit scheint hauptsächlich auf dem Strand zu liegen. Er hält inne, hängt sich das Gewehr an seinem Tragegurt über die Schulter und zieht eine Packung Zigaretten hervor. Mit einem Streichholz steckt er sich eine an und wirft das verkohlte Stück Holz dann beiseite. Er nimmt einen tiefen Zug und bläst den Rauch zur Nase hinaus.
Ich lasse ihm dieses letzte Vergnügen, bevor ich mit einem Messer in der Hand aus dem Schatten trete. Er hat mir den Rücken zugewandt, deswegen sieht er mich nicht, doch im letzten Moment hört er mich. Er dreht sich um und ich ramme das Messer mehrmals in seine Brust. Die Zigarette fällt ihm aus der Hand. Er versucht, nach seinem Gewehr zu greifen, doch das ist längst sinnlos. Meine Klinge hat sein Herz und beide Lungen punktiert. Blut läuft durch sein Hemd und er macht seinen letzten Atemzug. Nicht gerade die schonendste Art, sein Leben zu beenden, aber die leiseste, die ich unter diesen Umständen gewährleisten konnte.
Aus dem Knopf in meinem Ohr höre ich die Stimme von Atticus: »Es kommen zwei weitere Kerle auf dich zu!«
»Wie lange habe ich?«, flüstere ich.
»Zehn Sekunden! Fünfzehn, wenn du Glück hast.«
Über mir schweben in diesem Moment sechs Mini-Drohnen leise summend durch die Luft. Jede von ihnen ist mit einer Infrarotkamera ausgestattet, und diese Bilder von der mexikanischen Küste werden Atticus in den Vereinigten Staaten zugespielt. Ich befinde mich zwanzig Meilen von Culiacán entfernt auf einem Gelände, das Ernesto Diaz gehört. Seit drei Tagen bin ich in Mexiko – in dieser Zeit habe ich versucht, das Grundstück so gut wie möglich auszukundschaften. Ernesto Diaz hat sich mit einem Haufen Wachen in seinem Haus verschanzt. Er weiß längst, dass sein Sohn tot ist. Vielleicht nicht mit Sicherheit, denn es ist absolut unmöglich, dass jemand Javiers Leiche gefunden hat – aber doch mit dem Bauchgefühl, das ein Vater haben sollte, wenn der eigene Sohn spurlos verschwindet.
Obwohl es mitten in der Nacht ist, habe ich eine Sonnenbrille auf. Ich überprüfe ihren festen Sitz, dann lasse ich das Messer wieder in seiner Scheide verschwinden und packe den Wachmann mit beiden Händen, um ihn in mein schattiges Versteck zu ziehen. Ich versuche, das so schnell wie möglich zu bewerkstelligen, aber meine gebrochene Rippe schmerzt ordentlich. Natürlich versuche ich auch, es so Ieise wie möglich zu machen, doch seine Stiefel scharren über den Boden, was mir so laut vorkommt wie ein Feuerwerk. Zum Glück ist der Ozean nicht allzu weit weg und das Geräusch der brechenden Wellen hilft, so einiges zu kaschieren. Ich habe den Toten gerade komplett in die Dunkelheit gezogen, als die beiden anderen Männer um die Ecke biegen.
»Die Zigarette!«, höre ich Atticus in mein Ohr zischen. Scheiße. Sie liegt vielleicht fünf Meter entfernt auf dem Boden und glimmt noch schwach. Bis die Wachleute nahe genug herangekommen sind, ist sie vielleicht von selbst ausgegangen, vielleicht aber auch nicht. Natürlich könnte ich die beiden Männer einfach mit einer meiner Pistolen erledigen – ich habe zwei an den Gürtel geschnallt, beide mit Schalldämpfern – aber ich will so lange wie möglich vermeiden, dass irgendjemand Alarm schlägt. Denn nach Atticus' Beobachtungen sind es insgesamt vierzehn Mann, minus dem, den ich gerade getötet habe. Insgesamt waren es zehn, die draußen patrouillieren oder Wache stehen, und vier im Haus. Alle von ihnen schwer bewaffnet.
»Hector, wir wissen genau, dass du eine frische Packung Kippen hast! Die wird gefälligst geteilt!«, lacht einer der Männer.
Die beiden kommen in mein Blickfeld. Sie tragen beide identisch ausgestattete Kalaschnikows.
Ich könnte sie jetzt mühelos ausschalten, doch wie gesagt, ich will mich noch nicht verraten. Die Pistolen sind zwar schallgedämpft, aber das bedeutet nicht, dass man sie nicht hört. Das ist hier schließlich kein Kinofilm. In Wirklichkeit sind auch schallgedämpfte Schüsse so laut, dass sie auf jeden Fall alle anderen Wachleute alarmieren werden. Mir ist zwar klar, dass ich irgendwann anfangen werde zu schießen – die Chance, diese Aktion bleifrei zu beenden, ist einfach viel zu klein – aber ich will damit so lange warten, wie es geht.
Meine linke Hand berührt die Stange an meinem Gürtel. Sie ist etwa dreißig Zentimeter lang, schwarz und sieht aus wie ein Schlagstock. Doch sie ist mehr als das.
Derselbe Mann, der eben schon gesprochen hatte, meldet sich wieder zu Wort: »Hector, mi Amigo, wo bist du?«
In diesem Moment entdeckt sein Kollege die immer noch schwach glimmende Zigarette. Er hält inne, tippt seinem Nebenmann auf die Schulter und streckt den Zeigefinger aus.
Zeit, dass ich mich an die Arbeit mache.
Ich ziehe das Messer und werfe es in Richtung des einen Wachmannes, der etwa zwölf Meter entfernt ist. Die Klinge kracht in seinen Rücken. Er grunzt, lässt sein Gewehr fallen und versucht, nach dem Messer zu greifen, das zwischen seinen Schulterblättern hervorragt. Als er auf die Knie fällt, befinde ich mich schon im vollen Sprint. Der andere Mann dreht sich in meine Richtung und hebt seine AK-47. Ich werfe ihm den Schlagstock entgegen und treffe ihn am Hals, was ihn lange genug lähmt, dass ich sie beide erreichen kann.
Ich schnappe mir den Schlagstock vom Boden und ziehe ihn dem Mann durchs Gesicht, dann verdrehe ich seinen Griff, um seine Zweitfunktion zu aktiveren: Ein Würgedraht kommt zum Vorschein, den ich dem Mann um den Hals lege, als ich hinter ihn wirble. Er kämpft dagegen an und versucht, hinter seinem Rücken nach mir zu greifen, doch das kalte Metall ist scharf und gräbt sich in sein Fleisch. Blut spritzt aus seinem Hals und innerhalb weniger Sekunden hört er auf, sich zu wehren. Das Leben weich aus seinem Körper.
Sein Kollege hat inzwischen mit dem Versuch aufgehört, das Messer aus seinem Rücken zu ziehen. Er ignoriert auch die Kalaschnikow, die nur ein paar Meter entfernt liegt, sowie die Pistole, die er im Holster trägt. Stattdessen greift er nach etwas anderem, das an seinem Gürtel befestigt ist: sein Funkgerät.
Blitzschnell schätze ich den Abstand zwischen uns ein. Es sind weniger als zehn Meter, doch das ist mehr, als ich überbrücken kann, bis er seine Hand an dem Gerät hat.
Und was mache ich dann? Ihm das Messer aus dem Rücken ziehen und ihm damit die Kehle aufschlitzen? Es spielt keine Rolle mehr, wie ich ihn töte, denn bis dahin wird er das Funkgerät schon benutzt haben. Vielleicht wird er den anderen Wachleuten nicht wirklich sagen können, was passiert ist – aber jegliche Warnung ist mehr, als ich zulassen kann.
Mir wird klar, dass ich keine Wahl habe, und ich ziehe eine meiner Pistolen aus ihrem Gürtelholster. Dann jage ich eine Kugel in seinen Hinterkopf.
Trotz des Schalldämpfers bereitet der Schuss der Stille der Nacht ein jähes Ende. Für einen Moment stehe ich wie eingefroren da und starre den toten Wachmann an.
»Sie kommen auf dich zu«, sagt Atticus über Funk.
»Wie viele?«
»Alle.«
Kapitel 2
Das Grundstück von Ernesto Diaz befindet sich auf einer Anhöhe mit Blick über den Pazifik. Ein Maschendrahtzaun läuft ringsum, hier und da durch Büsche und Bäume aufgelockert. Ich kann die Männer, die auf mich zueilen, noch nicht sehen, doch ich kann sie hören. Die schweren Schritte ihrer Stiefel nähern sich aus zwei Richtungen. Ich mache einen Schritt auf die Schatten zu, in denen ich mich versteckt hatte, doch dann halte ich inne.
»Du hast weniger als zehn Sekunden«, sagt Atticus.
Ich ignoriere ihn und ziehe eine Kette von Knallfröschen hervor, die ich heute Vormittag aus einem Gefühl heraus einem Jungen abgekauft habe, der einen kleinen Straßenstand mit Feuerwerk hatte. Ich nehme mein Feuerzeug und zünde die Lunte an – genau in dem Moment, wo Atticus »fünf Sekunden« raunzt. Mit einem weit ausholenden Wurf schmeiße ich die Knallfrösche in Richtung des Abgrundes, aus dem ich zuvor auf einem schmalen Pfad hochgeklettert war.
Dann verschwinde ich wieder im Schatten, drücke mich direkt neben die Leiche des ersten Wachmannes und beobachte, wie die Männer angelaufen kommen. Es sind insgesamt fünf. Jeder von ihnen hat eine Kalaschnikow im Anschlag. Als sie die beiden Leichen auf dem Boden sehen, halten sie kurz inne. Sie werfen sich ernste Blicke zu, sagen jedoch nichts. Einer von ihnen bemerkt die Fußabdrücke im Sand und schaut in meine Richtung, doch in diesem Moment gehen die Knallfrösche los.
Die Männer wirbeln alle herum und fangen an, in Richtung des Abgrundes zu feuern. Während sie abgelenkt sind, trete ich hervor und mähe sie alle mit der AK-47 des toten Wachmannes nieder. Ich schwenke den Lauf von links nach rechts, von rechts nach links.
Sechs Sekunden, mehr braucht es nicht, und nun liegen sieben Leichen vor mir.
»Drei weitere sind noch auf der anderen Seite des Zauns«, sagt Atticus.
»Wo?«
»Direkt neben dem Eingang.«
Ich werfe das Gewehr beiseite und laufe auf das Tor zu. In vollem Lauf ziehe ich eine Blendgranate von meinem Gürtel, ziehe den Ring ab und werfe sie über den Zaun. Inzwischen bin ich weniger als zehn Meter vom Eingang entfernt. Auf der anderen Seite geht die Granate hoch, ich höre einen der Männer schreien, und dann gibt es einige Feuerstöße in Richtung der Explosion. Doch in diesem Moment komme ich um die Ecke, Pistole in der Hand, und schalte die beiden Wachleute aus, die mit dem Rücken zu mir stehen. Sie kriegen jeder eine Kugel in den Hinterkopf, aber wo zur Hölle ist der dritte?
Jemand ruft mir von hinten auf Spanisch zu, stehenzubleiben und meine Waffe fallen zu lassen.
Ich fange langsam an, mich umzudrehen.
Der Mann ruft erneut, dass ich meine Waffe fallen lassen soll. In meinem Ohr höre ich Atticus sagen: »Gib mir eine Sekunde!«
Ich bin mir nicht sicher, was er meint, und weiß auch nicht, ob dieser Wachmann mir noch eine Sekunde geben wird, bevor er mich abknallt.
»Schmeiß die verdammte Waffe weg«, ruft er jetzt.
Das ist wirklich das Allerletzte, was ich tun möchte, doch mir bleibt nichts anderes übrig. Ich lasse meine Pistole in den Sand fallen.
»Atticus?«, flüstere ich.
»Eine Sekunde«, tönt es in meinem Ohr.
Hinter mir fragt der Mann: »Wo sind die anderen?«
Mit erhobenen Händen drehe ich mich langsam um. Der Mann ist jung, fast noch ein Kind. Er hat eine AK-47 in der Hand und zeigt nicht die geringste Spur von Unsicherheit.
»Ich bin allein«, antworte ich auf Englisch.
»Bullshit.«
Ich lächle einfach nur – und schaue zu, wie eine der Drohnen in den Hinterkopf des Mannes rast. Er stolpert zur Seite.
Diese Ablenkung gibt mir maximal zwei Sekunden Zeit, aber es reicht, um die andere Pistole zu ziehen und dem jungen Mann zwei Kugeln ins Gesicht zu jagen.
Während er auf den Boden schlägt, drehe ich mich einmal im Kreis, um nach weiteren Bedrohungen Ausschau zu halten.
Das Hauptgebäude ist etwa hundert Meter entfernt. Mehrere SUVs und Pick-up-Trucks sind davor geparkt. Innen ist Licht an, aber ich kann keine Bewegung erkennen.
»Ist irgendjemand durch die Hintertür geflüchtet?«, frage ich.
»Bis jetzt noch nicht.«
»Welche Seite ist für mich interessant?«
»Die Ostseite.«
Ich mache mich auf den Weg zum Haus, wobei ich einen Bogen laufe, um Platz zum Ausweichen zu haben. Ich behalte die hell erleuchteten Fenster genau im Auge und kann immer noch keine Bewegung im Haus ausmachen, was beunruhigend ist. Ist Ernesto Diaz am Ende etwa gar nicht hier? Eigentlich müsste er es sein, zumindest laut meiner Recherche während der letzten Tage – doch ich muss zugeben, meine Möglichkeiten waren begrenzt. Nun habe ich bereits zehn seiner Leute ausgeschaltet, aber es könnte natürlich sein, dass sie nur menschliche Köder waren, und dass das Haus in Wahrheit leer ist.
»Atticus, deine fliegenden Helfer können keine Wärmeabstrahlung aus dem Haus wahrnehmen, oder?«
»Ich fürchte, nein.«
Ich erreiche die geparkten Fahrzeuge und schlängele mich vorsichtig an ihnen vorbei, die Pistole im Anschlag, falls sich jemand in einem der Führerhäuschen verstecken sollte. Im Vorbeigehen platziere ich ein paar Überraschungen unter den Wagenböden, dann komme ich an der Hauswand an. Dort entdecke ich sofort den Sicherungskasten, über dessen Lage Atticus mich informiert hatte. Dort hinterlasse ich ebenfalls eine Überraschung und bewege mich dann schnell zum Vordereingang, wobei ich die Wand als Deckung nutze. Es ist nun schon eine Minute vergangen, seit ich auf dieser Seite des Zaunes angekommen bin, und nichts ist passiert. Diese Stille macht mich nervös. In meinem Kopf klingeln die Alarmglocken, auch wenn es bis jetzt keinen konkreten Grund gibt.
Kurz vor der Eingangstür halte ich wieder inne und warte ab. »Was ist los?«, fragt Atticus.
»Irgendetwas stimmt nicht.«
»Willst du abbrechen?«
»Nein.«
»Dann komm zur Sache.«
Ich lasse meinen Blick noch ein letztes Mal über den Vorhof schweifen, bevor ich die Eingangsstufen hinaufeile. Die Tür ist bereits offen, was den Alarm in meinem Kopf verstärkt.
Ich trete ins Foyer ein.
Und das ist wirklich groß angelegt. Zwei Etagen hoch und mit einer geteilten Treppe, die sich an den Außenwänden entlang schmiegt. Ein Kronleuchter hängt über meinem Kopf. Das Haus ist zwar keine prunkvolle Villa, wie man sie in den Staaten finden würde, aber für diese Gegend, in der die meisten Menschen verarmt in Slums leben, ist es schon mächtig beeindruckend.
Scheiß drauf.
Ich rufe. »Klopf, klopf! Ist jemand zu Hause?«
Stille.
Jedenfalls für die ersten paar Sekunden, dann höre ich Schritte und vier Männer tauchen aus den Nebenräumen auf, zwei weitere am oberen Ende der Treppe. Keiner von ihnen sagt ein Wort – sie starren mich einfach nur an, also beschließe ich, das Eis zu brechen, und deute auf die Sonnenbrille auf meinem Kopf.
»Ich bin ein Tourist im Urlaub. Ich suche den Strand. Kann mir irgendjemand die richtige Richtung sagen?«
Immer noch schweigend richten die Männer ihre Waffen auf mich.
»Atticus, jetzt!«, flüstere ich.
Irgendwo in den Staaten drückt Atticus eine Taste auf seinem Keyboard und draußen detoniert meine kleine Überraschung – das Viertelpfund Plastiksprengstoff, das ich am Sicherungskasten angebracht hatte. Es gibt einen fantastisch klingenden Knall, dann wird es im Haus stockdunkel.
Die Party kann losgehen.
Kapitel 3
Die Sonnenbrille auf meinem Kopf ist eigentlich gar keine Sonnenbrille. Es ist eine Nachtsichtbrille, die wie eine Sonnenbrille aussieht, und als das Licht ausgeht, lasse ich mich auf den Boden fallen und ziehe sie auf meine Nase – genau in dem Moment, in dem die Wachleute das Feuer eröffnen.
Sie sind allerdings nicht ganz dumm, denn sie wissen, dass sie nicht völlig planlos in die Dunkelheit feuern sollten. Schließlich ist es nicht komplett finster, denn die Nacht ist klar und der Mond ist hell, doch es dauert ein paar Sekunden, bis ihre Augen sich an die Lichtsituation gewöhnt haben.
Ich drücke einen Knopf an meinem Brillengestell und die Welt färbt sich grün. Jetzt kann ich genauso gut sehen wie am Tag.
Die Männer, die angefangen hatten, zu schießen, haben es inzwischen wieder bleiben lassen, denn sie wollen ja nicht ihre Kollegen treffen. Einer von ihnen ruft, dass jemand eine Taschenlampe anmachen soll. Ich schaue mich um, doch niemand scheint eine zu haben. Einer von ihnen zieht jedoch sein Handy aus der Tasche, bestimmt will er damit Licht machen.
Deswegen töte ich ihn zuerst.
Wegen des Schalldämpfers ist das Mündungsfeuer sehr klein, man sieht es kaum, sodass meine Gegner kaum etwas haben, auf das sie zielen können. Ein paar von ihnen feuern blind, aber viel zu hoch. Dennoch wird es Zeit, die Sache zu beenden.
Ich nähere mich der Wand, die mir am nächsten ist, und schieße dem Mann, der dort steht, aus nächster Nähe in den Kopf. Dann sprinte ich zum anderen Ende des Foyers, da die beiden Kerle auf der Treppe nun in meine Richtung feuern. Langsam gehen sie die Treppe hinunter und warten darauf, dass sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnen.
Doch diese Zeit gebe ich ihnen nicht – ich schalte den vorderen zuerst aus; zwei Kugeln in den Kopf. Dann eile ich die Treppe hoch und schieße dabei auf den anderen Mann. Meine Kugel trifft ihn in die Schulter, sodass er zurücktaumelt und rückwärts die Treppe auf der anderen Seite hinunterfällt. Aber er lebt noch. Er kämpft sich wieder in den Stand, wirkt desorientiert und feuert ziellos in den Raum. Ich stehe inzwischen am Kopf der Treppe, lege auf ihn an und drücke ab.
Sein Kopf wird zur Seite gerissen, dann geht er tot zu Boden.
Ich bin zufrieden damit, dass endlich alle Wachleute tot sind, drehe mich um und laufe direkt in eine Wand aus Fleisch.
Als ich zurückweiche, habe ich kurz Gelegenheit, den Hundertfünfzig-Kilo-Mann zu mustern, der vor mir steht. Ich erinnere mich daran, ihn tags zuvor gesehen zu haben. Er lief hinter Ernesto her und ist demnach einer seiner Bodyguards. Er ist ein Riesenkerl, der nur aus Muskeln zu bestehen scheint. Seine Augen haben sich noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt, aber er schafft es trotzdem, mich mit seiner riesigen Faust zu treffen.
Ich fliege gegen die Wand, wobei mir die Waffe beim Aufprall aus der Hand fällt. Ich rapple mich auf und greife nach der Waffe, doch der Riese schleudert mir seine riesigen Pranken entgegen und betatscht meinen Körper, bis eine seiner Hände meinen Hals findet. Er drückt mich hoch gegen die Wand. Ich trete und schlage ihn, aber das beeindruckt ihn überhaupt nicht. Durch die Nachtsichtbrille sehe ich den irren Blick in seinem Gesicht, die rasende Wut in den Augen, als er anfängt, mir die Luft abzudrücken. Als ich versuche, ihm in die Eier zu treten, schlägt er mir mit der freien Hand ins Gesicht, wodurch die Brille einen Abgang macht.
Nun kann auch ich nichts mehr sehen, aber das ist in Ordnung. Schließlich habe ich ja noch die andere Pistole an meinem Gürtel. Ich greife nach ihr, aber der Riese scheint zu ahnen, was ich vorhabe. Er packt sich die Pistole selbst und reißt sie aus ihrem Holster.
Verdammt.
Ich trete dem Hünen in die Eier, so fest ich kann, und ramme ihm meine rechte Faust in die Kehle. Das haut ihn nicht um, aber immerhin strauchelt er und lässt mich los. Ich habe jedoch keine Zeit, tief durchzuatmen. Stattdessen versuche ich einfach, auf den Beinen zu bleiben, und trete mehrmals blind in die Finsternis, in der Hoffnung, dass meine Stiefel sein Gesicht erwischen.
Der Riese lässt ein paar Schüsse aus meiner schallgedämpften Pistole los; sie gehen direkt nach oben in die Decke. Ich bin nah genug, um das Mündungsfeuer zu sehen – das nur einen Meter von meinem Gesicht entfernt ist – und stürze darauf zu, ich greife mir die Waffe und versuche, sie dem Hünen aus der Hand zu winden.
Er verpasst mir einen Schwinger mit seiner linken, doch ich kontere das, indem ich ihm meinen Ellenbogen in die Kehle haue, wieder und wieder, bis er hustend zurücktaumelt und die Waffe loslässt.
Da ich jetzt wieder im Besitz der Waffe bin, drücke ich dem Kerl den Schalldämpfer in die Brust und drücke immer wieder ab, bis das Magazin leer ist und der Schlitten in der geöffneten Position stehen bleibt.
Der Riese geht zu Boden – aber er ist nicht sofort tot. Ich höre, wie er nach Luft japst. Spätestens in einer Minute ist er hinüber.
Ich werfe das leere Magazin aus, stecke ein frisches in die Pistole und halte dann Ausschau nach der Nachtsichtbrille. Schnell habe ich das grüne Glimmen entdeckt und die Brille wieder auf der Nase. Ich wende mich dem Bodyguard zu und stelle fest, dass er trotz der vielen Kugeln in seiner Brust im Begriff ist, aufzustehen. Er hat eine Waffe in der Hand und auch wenn ihn die Anstrengung zum Zittern bringt, hält er sie in meine ungefähre Richtung. Ich mache schnell einen Ausfallschritt und seine Kugel schlägt in die Wand ein. Ich hetze auf ihn zu und jage ihm eine Kugel in den Kopf.
Er fällt zurück, tot.
»Bist du in Ordnung?«, fragt Atticus.
Mir zieht sich vor Schmerzen alles zusammen – meine Rippe war sowieso schon gebrochen, jetzt habe ich noch lauter Prellungen bekommen.
»Alles fantastisch.«
»Du hast es beinahe geschafft, Holly. Mach, was du am besten kannst.«
Ich gehe weiter voran.
Kapitel 4
Jetzt, wo die Schießerei vorbei ist, herrscht absolute Stille im Haus.
Ich versuche mein Glück zuerst im Obergeschoss. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass ich Ernesto Diaz hier finden werde. Logischer wäre es, zuerst das Erdgeschoss zu durchsuchen, aber ich will keine Zeit mit Hin- und Herlaufen verlieren. Denn es besteht die Chance, dass einer der Wachleute Hilfe angefordert hat, als die ersten Schüsse fielen. Bis hierher habe ich mich ja ganz gut gehalten – ich meine, ich lebe zumindest noch – aber ich bin nicht sicher, wie lange ich noch durchhalte, zumal auch meine Munition zur Neige geht.
Vor mir erstreckt sich ein Flur, von dem zu beiden Seiten Türen abgehen. Sie sind alle geschlossen. Ich nähere mich der ersten und halte mich schön weit seitlich, als ich den Türknauf drehe und sie aufmache. Da niemand auf mich schießt, werfe ich einen Blick hinein.
Leer.
Dasselbe mache ich mit dem nächsten Raum und dem darauffolgenden. Alle leer. Als ich das vierte Schlafzimmer erreiche, höre ich ein Geräusch – ein Wimmern.
Ich stoße die Tür auf, gehe aber nicht hinein, da ich erwarte, dass jemand auf mich schießt. Das passiert aber wieder nicht, deswegen trete ich langsam durch die Tür und schwenke den Lauf meiner Waffe durch den Raum. Er scheint leer zu sein – da stehen nur ein Bett, ein paar Stühle sowie ein Fernseher.
Doch trotzdem höre ich ein Wimmern. Es kommt aus dem Kleiderschrank. Könnte das Ernesto sein? Nein, denn als ich näherkomme, wird mir klar, dass es eine Kinderstimme ist. In mir zieht sich alles zusammen. Denn meine Mission lautet, alle zu töten – alles und jeden in diesem Haus. Während meiner Überwachung habe ich nie Kinder auf dem Grundstück gesehen.
Ich trete auf eine knarrende Diele. Das plötzliche Geräusch reicht schon, um das Kind vor Angst aufschreien zu lassen.
Doch Moment – das klingt wie ein anderes Kind. Um Himmels willen, es sind zwei!
Ich reiße die Tür des begehbaren Kleiderschrankes auf und trete zurück, wobei ich meine Waffe auf die Öffnung richte. Dank der Nachtsichtbrille kann ich die beiden Kinder sehen, die dort auf dem Boden kauern sowie die Frau zwischen ihnen, an die sie sich klammern. Beide Kinder fangen an zu weinen. Das eine ist ein Junge, höchstens fünf Jahre alt, das andere ein Mädchen – vielleicht ein, zwei Jahre älter. Tränen rinnen ihre Wangen hinunter. Die Frau starrt mich mit angsterfülltem Blick an.
»Wo ist er?«, flüstere ich.
Die Frau antwortet nicht, sondern drückt die Kinder noch fester an sich. Ein Teil von mir – der kalte, berechnende Teil – weiß, dass ich sie sofort töten sollte. Es wäre das Beste, ihnen einfach ein paar Kugeln zwischen die Augen zu jagen. Denn ich bin mit dem Entschluss nach Mexiko gekommen, Ernesto Diaz zu töten, sowie seine ganze Familie und jeden, der sich mir in den Weg stellt. Diese Tatsache habe ich akzeptiert, denn ich weiß, dass ich keine andere Wahl habe, um meine Schwester und ihre Familie zu schützen. Denn Javier Diaz hat sie bedroht. Und weil er sie bedroht hat, habe ich ihn getötet.
Schon in diesem Moment war mir klar: Sobald diese Nachricht Javiers Vater erreichte, würde er jeden Hebel in Bewegung setzen, um ihn zu rächen. Diesen Kreislauf musste ich durchbrechen, und deswegen bin ich jetzt hier – deswegen bin ich auf das Grundstück von Ernesto Diaz eingedrungen mit dem unumstößlichen Plan, jede Menschenseele, die ich hier antreffe, auszulöschen.
Aber Kinder?
Nein, diese Mission hat vielleicht mit eiskaltem Kalkül begonnen, aber ich werde mich niemals dazu durchringen können, Kinder zu töten. Die beiden erinnern mich an David und Casey, die ich vor wenigen Tagen zuletzt gesehen habe, und die ich nie wiedersehen werde. Als sie entführt worden waren, habe ich getötet, um sie zurückzubringen, und jetzt töte ich, um meine Familie zu schützen. Aber verdammt nochmal, ich kann doch keine Kinder töten! Das geht einfach nicht.
»Ich werde euch nichts tun. Aber ich muss wissen, wo Ernesto ist!«
Als das kleine Mädchen den Namen hört, wird ihr Schluchzen wieder lauter und sie murmelt etwas auf Spanisch, das mir einen Kloß im Hals verpasst.
Großpapa.
Natürlich. Das sind Ernestos Enkelkinder. Und die Frau könnte die Mutter der Kinder sein. Falls dem so ist, ist sie Javiers Ehefrau, oder zumindest seine Geliebte. Das allein würde ihren Namen auf meine Todesliste bringen, aber ich kann ihrem Leben kein Ende setzen, während sich ihre beiden Kinder an ihr festhalten.
»Sind Sie die Mutter?«
Die Frau schüttelt den Kopf verneinend und flüstert: »Nein, das Kindermädchen.«
»Sie müssen sofort gehen. Nehmen Sie die Kinder mit. Hauen Sie ab!«
Die Frau bewegt sich nicht. Die Kinder, die sie immer noch fest umklammert, rühren sich ebenfalls nicht vom Fleck.
»Jetzt sofort!«
Alle drei zucken vor Schreck zusammen.
»Da sind Kinder?«, fragt Atticus.
»Ja.«
Er seufzt.
»Das ist nicht gerade ideal.«
»Nein.«
Atticus klingt, als würde er noch etwas hinzufügen wollen, doch er hält inne.
»Was ist?«, frage ich.
»Du musst dir etwas anschauen.« Seine Stimme bekommt eine verstärkte Dringlichkeit. »Das Schlafzimmerfenster an der einen Wand ist gerade aufgeschoben worden. Sieht aus, als würde Ernesto versuchen, abzuhauen!«
Ich ziehe eine Mini-Taschenlampe aus der Tasche und werfe sie der Frau zu. Sie prallt von ihrem Bein ab und sie schreit, als hätte sie eine Kugel abbekommen.
»Ganz ruhig! Es ist nur eine Taschenlampe! Damit finden Sie den Weg nach draußen. Gehen Sie, so bald wie möglich. Und lassen Sie die Lampe an, damit ich sie nicht erschieße! Verstanden?«
Atticus spricht wieder in mein Ohr: »Er klettert aus dem Fenster!«
»Verstanden?«, frage ich die Frau erneut, sie nickt ängstlich. Die Kinder fangen wieder an zu weinen. Das Mädchen sagt immer wieder abuelo. Der Junge hat sich vor Angst in die Hose gepinkelt.
»Los!«, schreie ich.
Ohne eine Reaktion abzuwarten, stürme ich aus dem Zimmer.
Kapitel 5
»Er ist schon fast draußen!«
Atticus' Stimme hallt durch meinen Gehörgang, als ich auf die Tür am Ende des Flures zusprinte.
Wegen der Dringlichkeit der Lage halte ich mich nicht mehr mit Vorsicht auf, was natürlich dumm ist. Statt mich beim Öffnen der Tür an die Seite zu stellen, trete ich sie einfach in vollem Lauf auf. Schließlich erwarte ich, nur Ernesto in dem Zimmer vorzufinden, doch es sind auch noch zwei Wachen bei ihm. Der eine hilft seinem Chef aus dem Fenster, der andere steht mir gegenüber und zielt mit seiner Waffe genau in meine Richtung.
Er gibt einen Schuss ab. Wäre das Licht an gewesen, hätte seine Kugel mich erledigt, aber dank der Dunkelheit verpasst er mich um wenige Zentimeter.
Ich erschieße ihn zuerst, zwei Kugeln in den Kopf, dann richte ich meine Pistole auf den anderen Mann. Er hat Ernesto bereits losgelassen – wobei der alte Mann einen unterdrückten Schrei losgelassen hat – und nach seiner AK-47 gegriffen hat, die ihm um den Hals hängt. Er dreht sich in meine Richtung und scheißt auf Zielgenauigkeit. Stattdessen drückt er den Abzug einfach durch und lässt nicht mehr los, sodass die Kugeln breit gefächert in meine Richtung jagen. Ich tauche zur Seite ab und bleibe flach auf dem Boden liegen, von wo ich genau auf die Nase des durchgedrehten Schützen ziele. Mein Schuss zerschmettert sein Gesicht und er stolpert zurück, wobei er den Abzug jedoch weiter umklammert, sodass sich der restliche Inhalt seines Magazins in die Decke entleert.
Ich springe auf und sprinte zum offenen Fenster. Ernesto versucht bereits, Land zu gewinnen, doch er humpelt, wobei er das linke Bein nachzieht. Das muss er sich wohl durch den Aufprall verstaucht oder gebrochen haben.
Ich ziele sorgfältig und gebe dann zwei Kugeln ab – eine davon trifft Ernestos rechtes Bein. Er fällt zu Boden und liegt dann für einen Moment regungslos da, bevor er seine verbleibenden Kräfte mobilisiert und anfängt, sich an den Armen voranzuziehen.
Direkt vor dem Fenster schwebt eine der Drohnen, ihre Kamera ist auf mich gerichtet.
»Ist sonst noch jemand auf dem Gelände?«, frage ich in die Linse.
»Soweit ich sehen kann, nein«, antwortet Atticus. »Nur Ernesto ist übrig.«
Ich schaue hinunter auf den Boden. Wenn Ernesto beweglicher wäre, würde ich aus dem Fenster klettern und mich fallen lassen, aber wieso soll ich mir etwas verstauchen, wenn ich alle Zeit der Welt habe?
Ich lasse das Fenster hinter mir und gehe zurück durch den langen Flur, zum Kopf der Treppe des Foyers, wo das Kindermädchen ihren Schützlingen gerade die Treppe hinunterhilft. Den Jungen trägt sie und das Mädchen hat sie an der Hand. Zum Glück für die Kinder ist die Lampe nicht besonders hell, sodass die meisten Leichen von der Dunkelheit verborgen werden. Dennoch haben die Kinder immer noch sehr viel Angst. Der Junge weint, das Mädchen kämpft mit ihren Tränen.
Der Lichtschein der Lampe schwenkt abrupt in meine Richtung, als die Frau mich kommen hört.
»Ganz ruhig! Einfach konzentriert weitergehen.«
Der Lichtkegel bleibt noch einen Moment auf mich gerichtet, dann wandert er wieder in Richtung Treppe. Das Kindermädchen gibt sich Mühe, die Toten und das Blut zu umschiffen.
Ich nehme die andere der beiden Treppen nach unten. An der Eingangstür muss ich über ein paar Leichen steigen.
Ernesto ist noch nicht weit gekommen. Vielleicht zehn Meter, vielleicht sogar weniger. Er ist nicht mal annähernd an die Autos herangekommen, die wohl sein Ziel gewesen waren, bevor ich ihn getroffen habe. Der Mond scheint hell genug, dass er meine Bewegungen wahrnimmt. Als ihm klar wird, dass ich es bin, gibt er auf und sackt in sich zusammen.
Ich stelle mich direkt in sein Blickfeld, die Waffe in der Hand. Er starrt mich mit hasserfülltem Blick an. Die Muskeln in seinem Gesicht sind durch Schmerzen verkrampft. Als er anfängt zu sprechen, ist seine Stimme tief und brüchig.
»Mein Sohn?«
Ich hebe meine Pistole und ziele auf seinen Kopf. »Du kannst ihm gleich schöne Grüße von mir ausrichten!«
Trotz des Schalldämpfers klingt der einzelne Schuss wie eine Explosion.
Hinter mir höre ich das kleine Mädchen schreien.
Ich drehe mich um und sehe, dass sie nicht weit weg von mir stehen. Die Frau trägt immer noch den Jungen, das Mädchen hält sie am Arm fest. Die Taschenlampe ist immer noch an, doch sie leuchtet nur auf den Boden.
Ich werde es gar nicht erst versuchen, die Kinder zu trösten. Das ist nicht mein Job. Und ich werde mich auch nicht erklären.
Ich mache einen Schritt auf sie zu.
Die Frau zuckt zusammen und presst die Kinder fester an sich.
»Ich habe doch schon gesagt, ich werde Ihnen nichts tun! Ich bin nicht wegen euch da, sondern wegen dem!«
Ich mache mir nicht mal die Mühe, auf den Toten hinter mir zu zeigen.
»Steigt in eines der Autos und fahrt los. Glaubt mir, ihr wollt nicht in der Nähe sein, wenn die nächste Phase beginnt.«
Die Frau starrt mich an. Ihre Stimme zittert, als sie anfängt zu sprechen: »Was ist die nächste Phase?«
»Wenn ich so drüber nachdenke: Ihr solltet auf keinen Fall diesen SUV oder den Pick-up nehmen.«
Ich deute auf zwei der Fahrzeuge.
Die Frau starrt mich immer noch an. »Warum?«
Ich antworte nicht. Stattdessen trete ich an ihr und den Kindern vorbei und gehe zurück ins Haus. Es dauert genau zwei Minuten, das zu erledigen, was ich erledigen muss, und dann bin ich wieder draußen. Die Frau und die Kinder haben sich nicht von der Stelle bewegt.
»Verdammt noch mal«, sage ich erschöpft und wütend, »Ihr solltet doch längst weg sein!«
Die Frau schüttelt den Kopf. »Wir können nirgendwohin gehen.«
Atticus spricht mir ins Ohr: »Du bekommst Gesellschaft.«
Ich drehe mich um und suche mit den Augen das Gelände ab. »Was meinst du damit?«
»Zwei Pick-up-Trucks kommen die Straße herauf!«
Ich sprinte zu der Öffnung im Zaun. Das Grundstück liegt einsam im Niemandsland, sonst hätte ich den Angriff gar nicht gewagt. Der nächste Ort ist fünf Meilen entfernt. Doch jetzt rasen zwei Fahrzeuge die unebene Schotterpiste entlang.
Ich höre, wie die Frau sich mir von hinten nähert. Ich werfe ihr und den Kindern einen Blick zu, sage aber zunächst nichts, da ich im Kopf alle Möglichkeiten durchgehe. Die ganze Sache wäre viel einfacher, wenn sie nicht hier wären. Verdammt, es wäre auch alles noch viel einfacher, wenn ich nicht versucht hätte, Rosalina in Las Vegas zu helfen. Jede Tat hat Folgen, und es war mein Versuch, Rosalina zu retten, der diese ganze Scheiße losgetreten hat.
»Du musst dich jetzt entscheiden«, sagt Atticus.
»Ich kann sie nicht einfach hierlassen.«
Die Frau mustert mich verwirrt, offenbar denkt sie, dass ich mit ihr rede.
»Du kannst sie aber auch nicht mitnehmen«, mahnt Atticus.
Ich schweige, was Atticus als Antwort ausreicht. Er kennt mich noch nicht lange, doch er versteht mein Wesen.
Er seufzt.
»Tu, was du tun musst – aber mach es schnell.«
Die Fahrzeuge sind bereits recht nah. In dreißig Sekunden werden sie hier sein. Die Zeit läuft mir davon, also wende ich mich der Frau zu und sage ihr, dass sie und die Kinder mir folgen müssen. Doch sie starrt mich nur an. Der Junge fängt wieder an zu schluchzen.
Ich richte die Waffe auf sie und schreie »Jetzt sofort!«, was zum Glück wirkt. Ich führe die drei um das Haus herum zu dem schmalen Trampelpfad, der am Felsen entlang zum Strand führt. Inzwischen ist die Nacht völlig klar und der Mond beleuchtet die vielen Leichen. Die Frau murmelt etwas, das ein Gebet sein könnte, und die Kinder fangen an zu weinen. In diesem Moment jaulen die schweren Motoren der Trucks in unmittelbarer Nähe auf. Sie haben das Ende der Zufahrt erreicht und jagen durch das offene Tor.
Ich bedeute der Frau, sich auf den Weg nach unten zu machen. Der Pfad ist schmal und sie muss das Mädchen noch fester packen, um sicherzugehen, dass es nicht abstürzt. Auf der anderen Seite des Zauns ertönen nun aufgeregte Stimmen, als eine ganze Ladung Männer aus den Fahrzeugen strömt.
»Ich habe die Kerle im Blick«, sagt Atticus. »Bist du in Sicherheit?«
Denn das ist Teil des Plans: Ich weiß, dass jetzt noch drei Drohnen in der Nähe des Hauses schweben – nahe genug, dass morgen keine Spur mehr von ihnen zu finden sein wird. Ich vergewissere mich, dass die Frau mit den Kindern weit genug vorangekommen ist, dann mache ich mich auf den Weg, ihnen zu folgen.
»Du kannst loslegen.«
Vor meinem geistigen Auge sehe ich die Männer auf das Haus zurennen. Sie sind besser ausgestattet und haben Taschenlampen dabei, mit denen sie schnell die Leichen finden, die überall herumliegen. Vielleicht haben ein paar von ihnen auch schon Ernesto Diaz gefunden. Es ist schwer zu sagen, was diese Männer gerade denken – sicher ist nur, dass sie nicht mehr lange denken werden. Ich habe mehrere Sprengladungen im Haus platziert, dazu noch die bei den Fahrzeugen, und wo auch immer Atticus gerade ist, er drückt jetzt ein paar Tasten und sendet das Signal, das diese Bomben zündet.
Als ich den schmalen Pfad hinuntereile, dicht auf den Fersen der Frau und der beiden Kinder, wird die Welt hinter mir zum Flammenmeer.
Kapitel 6
Eine Minute später haben wir den Strand erreicht und die Frau setzt den Jungen erschöpft in den Sand. Dem gefällt das allerdings gar nicht, er klammert sich an ihr Bein, als würde er sie nie mehr loslassen wollen.
Die Frau starrt den Pfad hinauf. Eine Feuerwalze war hinter uns entflammt, als wir zum Strand hinuntereilten, und jetzt füllt schwarzer Rauch den Nachthimmel.
»Du hast alles in die Luft gesprengt«, sagt sie fassungslos. Ich nicke und betrachte dabei den leeren Strand.
»Warum?«
Die Frau starrt mich an, völlig außer sich. Im Mondlicht sehe ich zum ersten Mal ihr Gesicht richtig. Sie ist hübsch, doch ihre Haare sind völlig durcheinander. Sie trägt keinerlei Schmuck – keine Ohrringe, keine Kette, keine Ringe. Ihr Arbeitsplatz – der höchstwahrscheinlich ihre einzige Einnahmequelle war – wurde gerade ausgelöscht, und sie versucht nun, sich einen Reim darauf zu machen.
Die Kinder klammern sich an ihr fest, jedes an einem Bein. Das Mädchen hat aufgehört zu weinen – vielleicht hat sie keine Tränen mehr – doch der Junge macht energisch weiter.
Ich deute auf den Strand: »Gehen wir.«
Die Augen der Frau verengen sich. »Wir gehen nirgendwo mit dir hin!«
»Kein Problem. Ich wollte euch sowieso nur vor der Explosion schützen. Ist mir scheißegal, wo ihr jetzt hingeht.«
Das stimmt nicht ganz – beim Gedanken, die Kinder hier im Nirgendwo zurückzulassen, bricht mir das Herz. Aber es ist ganz einfach so, dass ich keine Zeit zu verlieren habe. Die Verstärkung war äußerst schnell hier, von daher kann es gut sein, dass noch mehr Angreifer kommen. Ich habe fast meine gesamte Munition verbraucht und Atticus' fliegende Spione können mich auch nicht mehr vor unliebsamen Überraschungen warnen. Ich bin jetzt auf mich allein gestellt, und wenn ich überleben will, muss ich abhauen.
Ich gehe an der Frau und den Kindern vorbei und gehe zum Strand. Nach nicht einmal zehn Schritten ruft die Frau hinter mir: »Warte!«
Ich drehe mich zu ihr um.
»Wohin gehst du?«
»Ich verschwinde von hier.«
»Aber wohin?«
Ihre Stimme ist von purer Verzweiflung gefärbt. Es ist noch keine reine Panik, aber auf dem besten Wege dahin.
»Hinter diesen Felsen und Bäumen liegt ein Boot versteckt. Damit werde ich ein paar Meilen die Küste hinauffahren.«
Ich warte ab, was sie dazu sagt. Doch es passiert nichts. Sie steht einfach nur da und schaut mich an.
»Ich habe keine Zeit für Blödsinn«, sage ich, »ich muss verschwinden.«
»Kann ich …« Sie muss schlucken. »Kann ich mitkommen?«
»Davon kann ich nur abraten, Holly«, sagt Atticus.
»Ich rufe dich gleich zurück.«
Ich ziehe mir den Transmitter aus dem Ohr und schalte ihn ab.
»Ich kann dich ein Stück die Küste entlang mitnehmen, aber mehr nicht.«
Die Frau starrt mich an. Sie sagt immer noch nichts und es sieht auch nicht so aus, als hätte sie etwas zu sagen. Vielleicht entfaltet jetzt der Schock seine Wirkung. Falls dem so ist, kann ich sie auf keinen Fall mit den Kindern allein lassen.
»Hey!« Ich klatsche ihre Hände, um mir ihre Aufmerksamkeit zu sichern. »Hörst du mich?«
Sie zwinkert und schaut mich an, als würde sie mich zum ersten Mal sehen.
»Wie weit die Küste hinauf?«, fragt sie schließlich.
»Ein paar Meilen. Aber wir müssen jetzt los.«
Die Frau sieht immer noch nicht überzeugt aus.
»Wenn ihr jetzt mitkommt, verspreche ich, dass ich für eure Sicherheit sorgen werde.«
Es ist ein ziemlich leeres Versprechen, auch wenn ich mir selbst vornehme, mein Bestes zu geben. Ich will die Kinder nicht schutzlos zurücklassen, aber ich kann hier nicht bleiben. Wenn ich also lügen muss, um sie endlich in Bewegung zu kriegen, dann ist es eben so.
Die Frau denkt noch einen Moment nach, dann nickt sie und schaut hinab zu den Kindern. Sie nimmt den Jungen auf den Arm, packt das Mädchen an der Hand und kommt dann auf mich zu.
Ich halte eine Handfläche hoch, um sie aufzuhalten. »Wie heißt du?«
»Wie ich heiße?«
»Ja, wie lautet dein Name.«
Sie denkt wieder kurz nach, als würde sie sich nicht daran erinnern.
»Maria.«
»Und die Kinder?«
»Das sind Jorge und Ana.«
»Okay, Maria, dieses Boot, in das wir jetzt steigen werden, ist anders als andere Boote. Es ist sehr wichtig, dass du die Kinder und dich gut festhältst, damit sie nicht hinausfallen.«
Ihre Augen weiten sich. »Wir könnten … rausfallen?«
»Wenn ihr euch nicht festhaltet, ja.«
Ich wende mich ab und gehe auf die Felsen zu, als Maria die Stimme erhebt.
»Wie heißt du?«
Ich schüttle den Kopf.
»Das willst du nicht wissen.«
»Wieso?«
»Je weniger du über mich weißt, desto besser.«
Ich führe sie über das Ende des Privatstrandes hinaus an den Felsen und Bäumen vorbei, wo wir nach einigen Minuten eine Lichtung erreichen. Mein CRRC liegt immer noch da, wo ich es hinterlassen hatte. Die Abkürzung steht für Combat Rubber Raiding Craft – dieses aufblasbare Angriffsboot wird überwiegend von Navy Seals und Marines verwendet. Das Gummi hat keine besondere Verstärkung, deswegen wird das Gefährt überwiegend für Nacht-Einsätze benutzt.
Ich zerre das Gefährt zum Wasser und helfe Maria und den Kindern hinein. Maria benutzt das Zugseil, um sich und die Kinder festzubinden, so gut es geht.
Ich schiebe das Boot weiter hinaus, bis mir das Wasser zu den Hüften steht, dann hieve ich mich an Bord und setze mich neben den Außenbordmotor.
»Haltet euch fest!«
Ich reiße am Starter, um den Motor anzulassen, und steuere uns tiefer in die Dunkelheit.