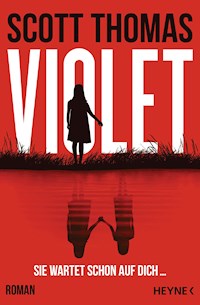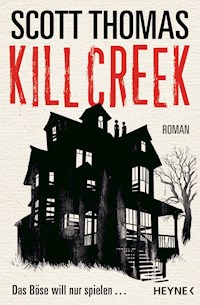
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Am Ende einer langen Straße mitten im ländlichen Kansas liegt einsam und verlassen das Finch House. Es ist berüchtigt, schließlich ereilte jeden seiner Bewohner einst ein grausames Schicksal. Könnte es eine bessere Kulisse geben, um die vier erfolgreichsten Horrorautoren der USA zu einem Interview zusammenzubringen und das ganze live im Internet zu streamen? Was als harmloser Publicity-Spaß beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum für alle Beteiligten. Denn es kommen nicht nur die dunkelsten Geheimnisse der vier Schriftsteller ans Tageslicht, auch das Finch House selbst hütet ein dunkles Geheimnis. Aber anders als die vier Autoren möchte es dieses nicht für sich behalten. Und schon bald gibt es den ersten Todesfall ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Am Ende einer langen Straße mitten im ländlichen Kansas liegt einsam und verlassen das Finch House. Es ist berüchtigt, schließlich ereilte jeden seiner Bewohner einst ein grausames Schicksal: Sein Erbauer wurde kaltblütig ermordet und dessen Geliebte von einem Lynchmob gehängt. Und die Finch-Schwestern, die Jahre später in das Haus einzogen, sollen dort immer noch ihr Unwesen treiben. Seitdem hat die böse Aura des Hauses jeden potenziellen Bewohner abgeschreckt. Könnte es also eine bessere Kulisse geben, um die vier erfolgreichsten Horrorautoren der USA an Halloween zu einem Interview zusammenzubringen und das ganze live im Internet zu streamen? Was als Publicity-Spaß beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum für alle Beteiligten. Denn es kommen nicht nur die dunkelsten Geheimnisse der vier Schriftsteller ans Tageslicht, auch das Finch House selbst hütet ein dunkles Geheimnis. Aber anders als die vier Autoren möchte es dieses nicht für sich behalten. Und schon bald gibt es den ersten Todesfall …
Der Autor
Scott Thomas hat an der University of Kansas Englisch und Filmwissenschaften studiert. Er ist Co-Creator und Produzent von Disney Channel’s Best Friends Whenever und Disney XD’s Randy Cunningham: 9th Grade Ninja und hat Fernsehfilme und Teleplays für verschiedene Netzwerke wie MTV und VH1 geschrieben. Kill Creek ist sein Debüt; sein zweiter Roman, Violet ((kursiv)), erscheint im September 2020 bei Heyne. Scott Thomas lebt mit seiner Familie in Sherman Oaks, Kalifornien.
SCOTT THOMAS
KILL CREEK
Roman
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Kristof Kurz
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
KILL CREEK
Deutsche Übersetzung von Julian Haefs
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 09/2019
Redaktion: Elisabeth Bösl
Copyright © 2017 by Scott Thomas
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabeund der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT GbR, München
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-24492-7V002
www.heyne.de
Für Kim, Aubrey und Cleo.
Für meine Eltern.
Und für Old Parker,denn die unglaublichsten Geschichtenwerfen oft die längsten Schatten.
»Schlimmes Gered’ ist leicht, insofern du’s ohne Bemühen aufregst, doch schlimm zu ertragen und schwer zum Erliegen zu bringen. Nie mehr schwindet die Kunde so ganz, die unter den Leuten viele verkünden; sie ist ja zugleich unsterbliche Göttin.«
– Hesiod
»Nur die stillen, schläfrigen, starrenden Häuser in der tiefsten Provinz können von all dem berichten, was seit den frühen Tagen verborgen wurde … Manchmal spürt man, dass es ein Gnadenakt wäre, diese Häuser abzureißen, denn sie träumen wohl häufig.«
– H. P. Lovecraft
PROLOG
Kein Haus ist von vornherein böse. An die meisten Häuser denkt man voller Zuneigung, wenn nicht sogar Liebe. Und da machte das Haus am Kill Creek anfangs auch keine Ausnahme.
Das Haus bestand aus ganz gewöhnlichem Holz, aus Nägeln, Mörtel und Stein. Es stand nicht auf unheiligem Boden, und weder Hexen noch Zauberer wohnten darin. Ein Mann erbaute es im Jahre 1859 in Kansas, ganz allein mit seinen eigenen Händen. Nur gelegentlich halfen ihm Freunde aus der nahe gelegenen Ortschaft Lawrence. Einige schöne Jahre lang erfüllte eine leidenschaftliche Liebe seine vielen Räume, wenngleich es auch eine geheime Liebe war, das Flüstern zweier Herzen.
Wie in den meisten Häusern, in denen es angeblich spukt, spielte sich auch im Haus am Kill Creek eine Tragödie ab. Der Mann, der es erbaut hatte, wurde ermordet – und das nicht einmal einen Meter von der Frau entfernt, die er liebte. Er streckte die Hände nach ihr aus, um ihre dunkle Haut zu berühren, ihr Haar zu streicheln, doch es gelang ihm nicht, diese lächerlich kurze Entfernung zu überbrücken. Sein Verstand beharrte darauf, dass sie beide gerettet würden, wenn er sie nur in die Arme schloss. Wenn er es sich nur fest genug wünschte, würden sie zusammenbleiben.
Doch es gab keine Rettung. Der Leichnam seiner Liebsten wurde weggezerrt und an dem einzigen Baum aufgehängt, der vor dem Haus stand – eine verkümmerte Buche. Sie war bereits tot und der Akt des Aufknüpfens nur eine letzte Demütigung. Dann wurden die toten Körper so kalt, wie es der sengend heiße August erlaubte, während sich Stille wie ein Leichentuch über das Haus und seine Umgebung senkte. Mehrere Wochen lang blieben sie ungestört. Niemand sah nach ihnen, da das Örtchen Lawrence selbst von einer Tragödie heimgesucht wurde. Als die Sonne unterging, flackerte ein orangefarbener Flammenschein am südöstlichen Himmel. Lawrence brannte.
Ein Haus, in dem Blut geflossen ist, wird zwangsläufig zum Ziel übler Gerüchte. Sooft ein Einwohner von Lawrence auf den abgelegenen Feldwegen nach Kansas City unterwegs war, sprach er über das Haus, als wäre es lebendig. Groß war das Mitleid mit diesem armen, traurigen Ort, verwaist wie so viele Kinder nach den blutigen Grenzscharmützeln, die dem Bürgerkrieg vorausgegangen waren. Was wohl in den langen, dunklen Winternächten in jenem Haus vor sich ging, wenn der Wind durch den kahlen Wald fegte und an den Fensterläden rüttelte? Unwillkürlich beschleunigte jeder Reisende seinen Schritt, sobald er an der Kill Creek Road vorbeikam.
Das Haus stand nicht lange leer, dafür war es zu groß und seine Architektur zu majestätisch. Im Lauf der Zeit wollte es so mancher zu seinem Heim machen, doch niemand fühlte sich dort willkommen, und die meisten verließen es innerhalb eines Jahres wieder. Warum sie den Zwang verspürten, wieder auszuziehen, konnten sie nicht erklären. Es war, als wollten die Wände die Wärme nicht aufnehmen. Selbst im Sommer war es innerhalb seiner Mauern zehn Grad kälter als draußen.
Es war ein böses Haus geworden. Ein Haus, vor dem man sich fürchtete.
Ende der Zwanzigerjahre wurde der Kansas Highway 10 gebaut, der Lawrence mit Kansas City verband, und in den Siebzigern war aus dieser bescheidenen Pflasterstraße eine vierspurige Autobahn geworden. Wer mit beinahe hundert Stundenkilometern unterwegs war, konnte die Ausfahrt zur Kill Creek Road sowie das dazugehörige Schild leicht verpassen. Der Fortschritt ließ sich nicht aufhalten, das früher so einfache Leben wurde immer hektischer, und das Haus am Kill Creek war nur ein weiteres verlassenes Gemäuer, das sich die Prärie allmählich zurückholte. Selbst der Bach, der einst so üppig vom Kansas River gespeist worden war, vertrocknete. Die Sonne brannte unbarmherzig auf ihn nieder, bis sein Bett so rissig war wie die Haut eines alten Menschen.
Die nächsten Nachbarn konnten nach wie vor von merkwürdigen Vorkommnissen berichten, die sie im Lauf der Zeit beobachtet hatten – Lichter in den Fenstern, ein Klopfen an der Tür, ein Flüstern in der Dunkelheit. Doch inzwischen waren das Haus und seine blutige Geschichte nicht mehr als ein Märchen, das die Eltern ihren Kindern vor dem Schlafengehen erzählten, obwohl sie selbst nicht mehr daran glaubten. Es waren nur Geschichten, die die Kinder davon abhalten sollten, in dem verfallenen und baufälligen Gemäuer herumzuklettern. Damals war das Haus einsam und die Leidenschaft, mit der es errichtet worden war, verloren, verpufft wie Morgennebel.
Nachdem es der letzte Bewohner im Frühling 1961 aufgegeben hatte, war das Haus der Regierung zugefallen. Im Jahre 1975 kauften die Finch-Schwestern es ihr samt dem dazugehörigen Grundstück ab. Die finstere Geschichte des Hauses machte den achtundsechzigjährigen eineiigen Zwillingsschwestern keine Angst. Sie hatten in ihrem Leben schon mehr durchgemacht als ein paar merkwürdige nächtliche Geräusche – insbesondere Rebecca, die seit einem Unfall, über den keine der beiden Frauen sprach, an den Rollstuhl gefesselt war.
Viele begrüßten die Ankunft der Schwestern und glaubten, sie würden dem Haus die Liebe und Zuwendung zukommen lassen, mit der es einst erbaut worden war. So fanden sie unter den Einheimischen auch viele bereitwillige Helfer, und sowohl die Lawrence Journal-World wie auch der Kansas City Star brachten mit DAS HAUS AM KILL CREEK WIRD ENDLICH EIN TRAUTES HEIM respektive ZWILLINGSSCHWESTERN ERWECKEN »SPUKHAUS« ZU NEUEM LEBEN betitelte Berichte.
Leider wurden die Finch-Schwestern den Erwartungen nicht gerecht. Sie waren, wie sich die Leute in der Gegend ausdrückten, »schräge Vögel«. Sie redeten mit den Handwerkern, die im und am Haus arbeiteten, nur das Nötigste, und sobald sie eingezogen waren, setzten sie praktisch keinen Fuß mehr vor die Tür. Am zugänglichsten war noch Rachel, die ihr langes, fließendes schwarzes Haar offen trug. Sie bezahlte die Arbeiter unverzüglich und gerecht. Rebecca dagegen, die das Haar zu einem strengen Knoten zusammenzubinden pflegte, ließ sich so gut wie nie blicken. Sie hielt sich im einzigen Raum des zweiten Stocks auf, bis es ihr ein Aufzug – eine der ersten Baumaßnahmen, die die Schwestern in Auftrag gaben – erlaubte, sich mit ihrem Rollstuhl frei im Haus zu bewegen. Und doch tat sie das nur selten und kehrte danach schnell wieder in ihr Zimmer zurück, wo sie die übrige Welt lediglich durch ein einsames, einen halben Meter breites Fenster betrachten konnte.
Einmal erkundigte sich ein Klempner, der die Rohrleitungen überprüfte, bei Rachel, weshalb ihre Schwester nicht öfter nach unten kam. »Da oben muss es doch furchtbar einsam sein«, sagte er. Rachel verzog ihr Gesicht, soweit es ihr möglich war, zu der Andeutung eines Lächelns. »Sie hat alle Gesellschaft, die sie braucht«, erklärte sie.
Zwei Jahre später starb Rebecca Finch. Herzversagen, stellte der Amtsarzt fest. Rachel blieb im Haus am Kill Creek wohnen. Sie empfing keine Besucher, noch nicht einmal diejenigen, die ihr ihr Beileid zum Ableben ihrer Schwester aussprechen wollten. Fünf Jahre lang war Rachel Finch der einzige Mensch im Haus. Der einzige lebende jedenfalls.
Daher kam es umso überraschender, dass Rachel im Jahr 1982 dem weltbekannten Parapsychologen und Autor Dr. Malcolm Adudel ein Interview gewährte. Obwohl Adudel in Wissenschaftskreisen als Scharlatan galt, kamen die Bücher über seine übersinnlichen Abenteuer bei einem sensationslüsternen Publikum gut an.
Nur Rachel Finch und Dr. Adudel wurden Zeuge dessen, was an dem Wochenende seines Besuchs geschah. Das Buch mit dem Titel Phantome der Prärie: Ein Tatsachenbericht über die Schrecken des Übernatürlichen, das er daraufhin verfasste, machte das Haus am Kill Creek landesweit bekannt. Obwohl Kritiker und Skeptiker die darin beschriebenen Ereignisse als pure Fiktion abtaten, hielt sich das Buch erstaunliche sechsunddreißig Wochen auf der Bestsellerliste. Dr. Adudels Bericht war arm an Fakten, doch dafür umso reicher an atmosphärischen Beschreibungen, und jeder, der nach Beweisen für die Existenz von Geistern suchte, fand brauchbares Material darin. Das Haus am Kill Creek galt nun offiziell als Pforte zur anderen Seite. Ein Haus der Albträume, dessen Name wieder einmal in aller Munde war.
Rachel Finch starb 1998 im Alter von einundneunzig Jahren. Genau wie der Leichnam des Mannes, der ihr geliebtes Haus erbaut hatte, wurde auch Rachel Finchs toter Körper erst Wochen nach ihrem Ableben gefunden. Ein paar Teenager aus einem Vorort von Kansas City hatten, sozusagen als Mutprobe, die verwitterte Brücke über das trockene, staubige Bett des Kill Creek überquert. Etwa dreißig Meter nach der Brücke blieben sie wie angewurzelt stehen. Dort, an demselben Ast der Buche, an dem man seinerzeit die geheime Geliebte des ersten Bewohners aufgehängt hatte, baumelte nun Rachel Finchs Leichnam langsam hin und her. Ein stümperhaft gebundener Knoten fraß sich in das verwesende Fleisch ihres lang gezogenen Halses. Das dünne schwarze Haar wehte sanft im Wind und fiel dann auf ihre Schultern zurück. Während die Jugendlichen noch versuchten, das, was sie da vor sich sahen, zu begreifen, drehte sich die Leiche plötzlich zu ihnen herum, und ein Käfer kroch vergnügt aus der Höhle, die einst eines ihrer grauen Augen beherbergt hatte.
Es wurde viel darüber spekuliert, warum sich die alte Frau erhängt hatte. Aus Einsamkeit, glaubten manche. Sie hätte den Tod ihrer Schwester nicht verkraftet. Andere sagten, das Haus wäre schuld – es hätte sie dazu gebracht. Doch wie oder warum das geschehen war, wusste niemand zu sagen. Und die wenigen, die Freude an menschlichen Tragödien hatten, deuteten mit geflüsterten Worten an, dass Rachel sich nicht erhängt hatte, sondern vielmehr gegen ihren Willen aus dem Haus gezerrt und am Baum aufgeknüpft worden war. Irgendjemand – oder irgendetwas – hatte ihr das angetan. Ein weiterer Beweis dafür, dass man das Haus am besten in Frieden ließ.
Rachel hatte testamentarisch verfügt, dass all ihre Besitztümer nach ihrem Tod im Haus verbleiben sollten, wozu auch die Einrichtung des Zimmers im zweiten Stock gehörte. Was genau sich dort befand, wusste jedoch niemand. Der Eingang war zugemauert, die Treppe dorthin endete an einer Backsteinwand, als hätte es nie ein Zimmer im zweiten Stock gegeben.
Wieder einmal machte das Gerücht die Runde, dass es im Haus am Kill Creek nicht mit rechten Dingen zuging. Rachel Finchs Tod war nur das jüngste Kapitel seiner finsteren Geschichte. Das Haus samt Grundstück fiel wieder an das Douglas County zurück und wurde erneut zum Verkauf ausgeschrieben, doch es fand sich kein Interessent. Sehr zum Leidwesen des Sheriffs, der mit seinen Mitarbeitern routinemäßig Patrouille fahren musste, zog das berüchtigte Anwesen lediglich die Neugierigen und Schaulustigen an. 2008 finanzierten die örtlichen Geschäftsleute einen Maschendrahtzaun um das Grundstück, der Unbefugte am Betreten hindern sollte. So konnten sie ruhiger schlafen, sagten sie, und spendierten sogar eine Rolle Stacheldraht, der oben am Zaun befestigt wurde.
Ein weiteres Mal wurde es still um das Haus. Kniehohes Präriegras wuchs auf dem Grundstück, Schlingpflanzen kletterten die Wände hinauf.
Das Haus am Kill Creek steht immer noch. Leer. Verlassen. Aber nicht vergessen. Nicht ganz. Denn es atmet Geschichten und nährt sich von Gerüchten.
ERSTER TEIL
DIE EINLADUNG
Vergangenen Oktober
»Ich tat einen weiteren Schritt ins Dunkel hinein. »Was ist da unten?«, rief ich zu ihr hinauf, da ich ihre Anwesenheit am Ende der Treppe spürte.
»Keine Sorge«, antwortete Rachel. »Es hat mehr Angst vor Ihnen als Sie vor ihm.«
Ich hörte ihr Kichern, ein Laut, der aus ihrer Kehle drang, aber niemals ihre Lippen erreichte.
Wie immer musste ich es wohl auf eigene Faust herausfinden.«
– Dr. Malcolm AdudelPhantome der Prärie
1
Freitag, 7. Oktober
Die Luft brannte.
Die Buntglasscheiben des hohen Spitzbogenfensters glühten in der Nachmittagssonne. Staubflocken tanzten im Licht, das durch das Glas fiel.
Im Schatten hinter dem Sonnenschein herrschte unruhige Bewegung.
Gesichter.
Starrend. Stumm. Hungrig.
Alle Augen waren auf einen gut aussehenden Mann Ende dreißig mit kurz geschorenen braunen Haaren gerichtet. Er war etwas über eins achtzig groß und trug eine alte schwarze Levi’s. Unter seinem Pullover zeichnete sich ein schlanker, muskulöser Körper ab. Der Mann hatte die Ärmel hochgekrempelt, sodass die vielen Tätowierungen auf seinem linken Unterarm zum Vorschein kamen. Die Haut unter den scheinbar willkürlich verlaufenden dunklen Linien war uneben und bis zum Handrücken hinab völlig vernarbt. Inmitten des abstrakten Musters waren hier und da Bilder zu erkennen: Bäume. Eine Wildblume. Die leere Augenhöhle eines Schädels. Und Flammen. Viele, alles verschlingende Flammen.
Der Mann ließ die Augen über die dreihundert Studenten schweifen, die sich auf den ansteigenden Sitzreihen drängten. Wo er auch hinsah, blickte er in gespannte Gesichter. Offiziell fand hier, im Hoch-Auditorium der Budig Hall, eine Einführungsveranstaltung zum Thema »Horror in der Populärkultur« statt, doch das erklärte wohl kaum den großen Andrang. Dass der Hörsaal bis zum letzten Platz besetzt war, lag an seiner Person: Er war nicht nur Einwohner von Lawrence und Absolvent der University of Kansas, sondern auch Bestsellerautor und »Experte«, wenn es um das Thema Horror ging.
Sam fuhr mit der Hand über den geschorenen Kopf und spürte die Stoppeln unter der Handfläche.
Jetzt bau bloß keinen Scheiß – immerhin bist du doch angeblich ein Meister des Makabren.
Er ging einmal durch den Hörsaal. Die Blicke der Anwesenden verfolgten ihn wie ein Jäger seine Beute.
»Was wissen wir nicht?« Seine Stimme hallte bis in die letzten Winkel des dunklen, hohen Raums, als er diese rhetorische Frage stellte. »Was wurde absichtlich vor uns verborgen? Im traditionellen Schauerroman geht es um Geheimnisse. Dunkle Geheimnisse, schreckliche Geheimnisse, die direkt hinter der Fassade der Normalität lauern. Diese Tradition hat den modernen Horror entschieden beeinflusst. Heute sind es nicht mehr nur unheimliche alte Schlösser, in denen sich diese Geheimnisse verbergen. Heute lauert der Horror im Alltag. In The Texas Chain Saw Massacreist es ein altes Bauernhaus, in The Grudge eine japanische Vorstadt, bei The Ring sogar eine Videokassette. Das Böse, das in der Literatur des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts auf verfallene Ruinen beschränkt war, wie zum Beispiel in Lewis’ Der Mönch, Radcliffes Udolphos Geheimnisse oder Maturins Melmoth der Wanderer, hat sich auf die Städte, die kleinen Ortschaften, ja sogar auf unseren Wohnraum ausgebreitet. Und das macht es noch viel gruseliger, finden Sie nicht auch?«
Zustimmendes Gemurmel ertönte. Er sah mehrere Köpfe in der Menge nicken.
Sam tigerte noch schneller hin und her. Seine Begeisterung für das Thema gewann allmählich die Oberhand. »Was macht eine Geschichte zu einer Gruselgeschichte? Bei Nightmare on Elm Street dreht sich alles um ein Geheimnis, das die Eltern vor ihren Kindern verbergen: dass sie das Gesetz in die eigene Hand genommen und Freddy Krueger ermordet haben. Bei Saw besteht das Geheimnis in der Identität des Mörders und seinem Motiv. Und dennoch scheinen diese Filme nicht so tief in der Tradition der Schauerliteratur verwurzelt zu sein wie andere Genrestreifen. Wieso?«
Die Studenten sahen sich ratlos an. Niemand wollte der Erste sein, der eine falsche Antwort gab.
»Na schön«, sagte Sam nach einer Weile. »Meiner Meinung nach gibt es dafür mehrere Gründe.«
Er zog die Kappe von einem Filzstift, und sofort stieg ihm der chemische Geruch in die Nase. Sam drehte sich zu dem riesigen Whiteboard hinter sich um und notierte den ersten Punkt.
»Erstens: die Beschränkung auf einen klar abgegrenzten Ort«, sagte er beim Schreiben.
Er wandte sich wieder den Studenten zu und stützte sich auf ein schweres Holzpult. »Obwohl uns schon der Titel verrät, dass der Albtraum in der Elm Street stattfindet, haben wir im Film selbst nie das Gefühl, dass das Böse dort seinen Ursprung hat. Der Film legt keinen Wert darauf, uns die Geografie der Elm Street näherzubringen, und es wird auch nie behauptet, dass sich Freddys schreckliche Taten auf diesen Straßenzug in Springwood beschränken. Der heimelige, idyllische Klang des Wortes ›Elm Street‹ soll einfach nur einen schönen Kontrast zu dem von sich aus bedrohlichen ›Albtraum‹ bilden.
In Texas Chainsaw Massacre dagegen spielen sich alle schrecklichen Dinge mehr oder weniger in einem alten Haus auf dem Land ab. Hätten sich die neugierigen Teenager von Leatherface’ Haus ferngehalten, wäre ihnen nichts zugestoßen. Das Böse lauert hinter dieser Tür. Wenn man sie nicht öffnet, hat man auch nichts zu befürchten.«
Der Filzstift glitt über das Whiteboard und quietschte dabei wie die Stimme einer Zeichentrickfigur.
»Zweitens: ein Geheimnis aus der Vergangenheit. Besagter Ort hat eine düstere Geschichte, sei es die heimliche Affäre zwischen Quint und der ehemaligen Gouvernante in The Turn of the Screw oder der alte Friedhof, auf dem das vorstädtische Neubaugebiet in Poltergeist errichtet wurde. In diesen Beispielen, die immer ein deutliches übernatürliches Element beinhalten, wird diese düstere Geschichte vor den Hauptfiguren absichtlich geheim gehalten.
Drittens: eine Atmosphäre des Verfalls und Verderbens. Entweder handelt es sich hierbei um einen materiellen Verfall wie in der klassischen Schauerliteratur – die bereits erwähnten baufälligen Burgen und finsteren Schlösser, wie man sie auch in Filmen wie The Others, Die Frau in Schwarz oder Crimson Peak findet. Genauso gut kann es sich aber auch um geistigen Verfall handeln, dem beispielsweise der Protagonist von Roman Polanskis Der Mieter anheimfällt, sobald er in seine neue Wohnung zieht. Dieses Motiv begegnet uns immer wieder, in Büchern wie Spuk in Hill House oder Filmen wie Session 9, wo der gewalttätige Anführer einer Baukolonne bei Renovierungsarbeiten zunehmend den Verstand verliert. Und schließlich …«
Sam schrieb den letzten Punkt an die Tafel.
»Viertens: die Korrumpierung der Unschuldigen. Damit sind Sie gemeint.«
Gelächter.
Er steckte die Kappe wieder auf den Stift, legte ihn auf seinen Platz unter das Whiteboard zurück und wandte sich wieder seinem Publikum zu.
»Das vielleicht wichtigste Element jeder guten Gruselgeschichte, ohne das wir nur ein baufälliges altes Gemäuer hätten, für dessen Geschichte sich niemand interessiert, weil sich niemand daran erinnert. Das Böse braucht einen Unschuldigen, um weiterexistieren zu können.«
Sam nahm ein abgegriffenes Taschenbuch aus einem Fach des Rednerpultes und hielt es in die Höhe, damit alle das elegante, handgemalte Cover und die in geschmackvollen Lettern gesetzten Namen des Verfassers und Titels sehen konnten.
»Der Letzte macht das Licht aus von Sebastian Cole. Ich hoffe, dass Sie sich alle mittlerweile ein Exemplar besorgt haben.«
Der Großteil der Studenten nickte. Manche hielten ihre Ausgabe sogar in die Höhe, um zu beweisen, dass sie Sams Lektüreempfehlung beherzigt hatten.
»Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, weshalb Sie das ganze Buch kaufen mussten, wenn wir nur eine Kurzgeschichte daraus besprechen. Ganz einfach: weil Sebastian Cole einer der größten Horrorautoren aller Zeiten ist. Sie sollten zumindest eines seiner Werke besitzen. Wer ist mit Sebastian Cole bereits vertraut?«
Mehrere Hände schossen in die Höhe. Leider nicht so viele, wie Sam erwartet hatte. »Ein langer, dünner Schatten«, rief ein pickliger junger Mann aus einer der mittleren Reihen.
Sam nickte begeistert. »Wahrscheinlich Coles bester Roman, obwohl ich wirklich Schwierigkeiten habe, mein Lieblingsbuch aus seinem umfangreichen Werk zu benennen. In der Geschichte, die Sie für heute lesen sollten …«
Ein junger, arabisch aussehender Mann hob die Hand. Selbst im Sitzen war seine außergewöhnliche Körpergröße deutlich zu erkennen – er hatte die langen Beine ungeschickt angewinkelt, die Knie in den Sitz vor sich gedrückt und schien mit dem ausgestreckten Arm beinahe die Decke berühren zu können.
»Ja?«, fragte Sam.
»Was ist mit Ihren Büchern?«, fragte der junge Mann. »Trifft das auch auf die zu?«
»Was ist mit Unter dem Teppich?«, fragte eine weibliche Stimme von der rechten Seite her.
Mehrere übereifrige Studenten pfiffen und jubelten.
Vorsicht, dachte Sam. Sonst nehmen sie dich auseinander.
Er legte die Hand auf die raue Reptilienhaut auf seinem linken Arm und drückte zu.
»Na schön«, sagte er, sobald der Applaus verstummt war. »Also gut. Steht mein Werk in der Tradition der Schauerliteratur? In Unter dem Teppich habe ich zumindest versucht, alle vier Elemente zu einem modernen Schauerroman zu verbinden. Ein alleinerziehender Vater aus der Arbeiterklasse zieht mit seinem Sohn in ein altes, verfallenes Farmhaus in Oklahoma. Punkt eins auf der Liste: die örtliche Begrenzung. Der Vater hofft, mit seiner Hände Arbeit den steinigen Boden urbar machen zu können, um Feldfrüchte darauf anzubauen, weiß aber nicht, dass das Land verödet ist, weil dort vor hundert Jahren etwas geschehen ist. Wenn Sie das Buch gelesen haben, wissen Sie, wovon ich rede, und wenn nicht, dann will ich Ihnen die Überraschung nicht verderben. Nur so viel: Es geht um einen Kindsmörder, ein entführtes Baby und um blutige Rache. Das wäre Nummer zwei: das Geheimnis aus der Vergangenheit. Nummer drei: Verfall und Verderben. Das bezieht sich einerseits auf die Farm selbst, andererseits auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Sosehr sich der Vater auch bemüht, er kann nur Unkraut ernten, gleichzeitig entwickelt der Junge furchterregende, übersinnliche Kräfte. Und schließlich Nummer vier: die Korrumpierung der Unschuldigen. Die Kräfte, die der Junge entwickelt, sind kein Gottesgeschenk, sondern die Nebenwirkungen einer bösen Macht, die auf ihre Wiedergeburt hinarbeitet. Man würze alles mit unterschwelligen Bezügen zum Thema Fruchtbarkeit und der Fragilität des Männlichen, füge mehrere unerwartete und grausame Todesfälle hinzu, garniere es mit einer Falltür, die sich buchstäblich ›unter dem Teppich‹ befindet, und voilà, fertig ist das moderne Horrorsüppchen – gerade so scharf, dass es niemand mit Limonade verwechselt.«
Diese Bemerkung wurde mit wohlmeinendem Gelächter quittiert. Ein blasses, rothaariges Mädchen hob die Hand. »Und was ist Ihr Geheimnis?«, fragte sie, bevor sie Sam aufrufen konnte.
Sam schmeckte Rauch. Einen Augenblick lang schnürte sich ihm die Kehle zu. Als er wieder Luft bekam, schmeckte sie nach beißender, grauer Asche.
»Verzeihung«, sagte er, sobald er sich wieder in der Gewalt hatte. »Was meinen Sie?«
»Sie haben gesagt, dass es in diesen Büchern und Filmen immer um ein Geheimnis geht, richtig?« Sie bewegte beim Sprechen kaum die dünnen Lippen, und ihre Stimme war so leise, dass Sam gezwungen war, sich zu ihr vorzubeugen, was merkwürdigerweise ein Gefühl der Beklemmung bei ihm hervorrief.
»Ja, nun …«, fing er an.
Sofort fiel sie ihm ins Wort. »Sie haben gesagt, dass das Schreiben immer eine persönliche Sache ist, dass der Autor immer etwas von sich selbst in seinen Geschichten preisgibt. Also, was ist Ihr Geheimnis?«
Sam fehlten die Worte.
»Sie will wissen, warum Sie Horrorromane schreiben«, rief jemand aus der letzten Reihe.
Er hob den Blick. Der schmale Streifen Sonnenlicht war bis in die Mitte der Sitzreihen gewandert. Die Reihen darüber lagen fast völlig im Dunkeln. Er konnte unmöglich sagen, wer ihm diese Bemerkung zugerufen hatte.
Der dünne Rauchfaden glitt seine Kehle hinunter und in seine Lunge. Sam biss die Zähne zusammen und atmete schwer. Die Rauchschlange kroch an seinen Rippen entlang und drückte fester zu, ihr grauer Kopf schlängelte sich um seine geriffelte Luftröhre, stieß mit der Schnauze gegen die oberen Lungenlappen, suchte nach einem Loch, durch das sie hindurchschlüpfen konnte.
»Warum schreiben Sie Horrorromane?«, fragte die tiefe Stimme erneut.
Sam McGarver befand sich nicht länger in einem Hörsaal auf dem Campus der University of Kansas.
Er war zehn Jahre alt. Sein Hemd war mit dem Blut eines anderen Menschen befleckt, der wütende Schein eines unlöschbaren Feuers fiel auf sein Gesicht. Er war nur ein kleiner Junge, eine winzige Silhouette vor einem brüllenden Inferno.
Sam – nun wieder erwachsen – stand sprachlos vor seinen Studenten, bis ihn die Glocke von der Frage erlöste, die er auf keinen Fall beantworten wollte.
Eli Bloch saß in seinem verknitterten Anzug mit einem Bierglas in der einen und seinem Handy in der anderen Hand auf der Terrasse der Free State Brewery. Er hatte noch kaum einen Schluck getrunken, weil er ganz darauf konzentriert war, seinen Assistenten per E-Mail mit so wenig Buchstaben wie möglich zur Sau zu machen. Doch eigentlich war er hier mit Sam McGarver verabredet, seinem wichtigsten Klienten.
»Meine Güte, du siehst ja beschissen aus«, sagte jemand.
Eli sah auf. Sam. Endlich.
»Mir geht’s auch beschissen. Hier ist es ja grauenhaft. Könntest du bitte sofort nach New York ziehen?«
Sam lächelte müde. »Keine Chance.«
Eli machte ihm soweit möglich auf der überfüllten Bierbank Platz. »Setz dich.«
»Gleich. Ich hol mir erst noch ein Bier.«
»Du kannst meines haben.« Er drückte Sam das Glas in die Hand, ohne eine Antwort abzuwarten.
Sam ließ sich auf der schmalen Kante der Bank nieder, setzte das Glas an und trank es in zwei Zügen zur Hälfte aus. Eine Lichterkette aus kleinen Kürbissen war im Zickzack über ihnen aufgespannt. Einer flackerte und schien jeden Moment den Geist aufgeben zu wollen. Sam lehnte sich gegen das Holzgeländer, holte tief Luft und beobachtete den defekten Kürbis. An. Aus. An. Aus.
»So schlimm ist es also schon?«, fragte Eli.
Sam nahm noch einen Schluck Bier. Nun war das Glas so gut wie leer. »Was willst du, Eli?«
»Nur mal nach dem Rechten sehen. Wie’s dir so geht.«
»Und deshalb bist du extra hergeflogen? Du hättest auch anrufen können.«
Jetzt fehlten Eli die Worte. Da er sowieso nicht wusste, wie er es durch die Blume sagen sollte, konnte er auch direkt auf den Punkt kommen.
»Erin hat mich angerufen. Sie macht sich Sorgen um dich.«
»Das hätte sie nicht tun sollen.«
»Ich mache mir auch Sorgen.«
Sam leerte das Glas und hielt es in die Höhe, um die Kellnerin auf sich aufmerksam zu machen. »Pale Ale«, formte er mit den Lippen. Sie nickte und verschwand im Innenbereich des Restaurants.
»Du schreibst nicht«, sagte Eli geradeheraus.
»Du bist wohl kaum in der Lage, das zu beurteilen, oder?«
»Ach, nicht? Kannst du denn auch etwas vorzeigen? Hast du schon was zu lesen für mich?«
»Bald.«
»Und wann ist bald?« Der letzte Rest Höflichkeit war aus Elis Stimme verschwunden. »Böses Blut ist vor einem Jahr von der Taschenbuchbestsellerliste gerutscht. Die Leute wollen wissen, wann dein nächster Roman erscheint. Was soll ich ihnen sagen? Ich glaube ja schon selbst nicht mehr dran.«
»Ich bin so gut wie fertig«, sagte Sam beschwichtigend.
»Bullshit. Ich habe noch nicht eine Zeile gelesen. Und dein Lektor auch nicht.«
»Werdet ihr schon noch. Wenn ich fertig bin.«
»Und wann ist das?«, fragte Eli, dem man die Verzweiflung allmählich anmerkte. »Du arbeitest seit zwei Jahren daran. Behauptest du zumindest.«
Wie durch Zauberhand erschien die Kellnerin neben ihm und reichte ihm ein frisches Bier. Sam deutete mit dem Kopf auf Eli. »Schreiben Sie’s auf seine Rechnung.«
Sie sah Eli an. Der nickte unwirsch, woraufhin die Kellnerin wieder verschwand.
Eli rieb mit den schweißbedeckten Händen über seine Hose, als wollte er sie glatt streichen. »Was soll das, Mann? Du schreibst nicht, sondern redest über anderer Leute Bücher. Du verschanzt dich in einem verfluchten Klassenzimmer und unterrichtest.« Er hielt kurz inne, als wüsste er nicht so recht, ob er das nächste Thema überhaupt zur Sprache bringen sollte. »Und es sieht ganz danach aus, als müsstest du dich demnächst mit einer Scheidung herumschlagen.«
»Wir leben getrennt«, berichtigte Sam ihn.
»Aha. Okay. Und wie viele getrennt lebende Ehepaare kennst du, die wieder zusammengefunden haben?«
Sam schwieg.
»Warum wirfst du deine Karriere einfach so weg?«
»Tue ich doch gar nicht.«
»Na ja, aber du kämpfst auch nicht darum.«
Ein wellenförmiger Ruck ging durch die Menge, als jemand zur Eingangstür ging. Ein bärtiger Mann vor Sam trat einen Schritt zurück und stieß gegen Sams Schulter. Das Bier in Sams Hand schwappte über, die kühle Flüssigkeit lief über seine Hand und in die Rillen zwischen den Narben.
»Alles, was ich schreibe, ist platt und leicht zu durchschauen«, beichtete Sam plötzlich. Er runzelte die Stirn, als wäre er selbst von diesem Geständnis überrascht. »Alles. Dabei hat Erin immer gesagt, dass ich das Zeug zu einem guten Geschichtenerzähler habe.«
»Wirklich?«, wollte Eli wissen. Es war keine rhetorische Frage, sondern echtes Interesse.
»Tut mir leid, dass du den weiten Weg hierhergekommen bist«, sagte Sam und trank das Bier zur Hälfte aus. »Das weiß ich wirklich zu schätzen, Eli. Aber ein Anruf hätte auch gereicht.«
»Ich weiß«, sagte Eli.
Sam stand auf, klopfte Eli auf die Schulter und drängte sich durch die Menge.
»Warum schreiben Sie Horrorromane?«, rief ihm Eli hinterher, als er das Ende der Terrasse beinahe erreicht hatte.
Sam blieb wie angewurzelt stehen.
Das war die Stimme. Die Stimme, die ihm in der Budig Hall genau diese Frage aus dem Schatten heraus zugerufen hatte.
Langsam drehte sich Sam zu Eli um. »Das warst du?«
Eli erwiderte seinen Blick herausfordernd, sogar kampfeslustig. »Ich wollte wissen, was das beste Pferd in meinem Stall vom Schreiben abhält. Was auch immer dich daran hindert, dein Buch zu Ende zu bringen, du musst dich ihm stellen. Du kannst dich nicht in alle Ewigkeit in deinem Klassenzimmer verstecken.«
»Leck mich, Eli.«
»Wenn du wirklich so ein guter Geschichtenerzähler bist, wie Erin behauptet, dann erzähl eine Geschichte. Schreib über etwas, das dir am Herzen liegt. Wenn es so etwas überhaupt noch gibt.«
Ohne zu antworten, glitt Sam durch die Menge und verschwand.
Die Bulleit-Flasche stand noch auf der Arbeitsfläche.
Mit einem leisen Klirren nahm Sam ein Whiskeyglas aus dem Schrank und goss sich zwei Fingerbreit ein. Der erste, scharfe Schluck löste die verkrampften Muskeln in seiner Kehle, die sanfte Hitze des Alkohols verdrängte die erstickende Wolke aus Asche und Rauch. Er schloss die Augen und spürte, wie sich die Wärme von seiner Brust aus in seinem Körper ausbreitete.
Sam ging ins Wohnzimmer und lauschte dort der vollkommenen Stille des leeren Hauses, das über ein separates Esszimmer, zwei Badezimmer und drei Schlafzimmer verfügte, von denen er eines zu seinem Büro umfunktioniert hatte. Alles war noch genauso wie vor fünf Jahren, als er mit Erin hier eingezogen war. Nur dass es jetzt seine Zimmer waren, sein Haus.
Sam führte das Glas an die Lippen, trank aber nicht, sondern stand so unbeweglich da wie ein in Bernstein eingeschlossenes Insekt, dem die Zeit nichts anhaben konnte. Er wollte einfach nur auf der Stelle stehen bleiben. Er wollte nicht allein ins Bett gehen und erst recht nicht vor Schuldgefühlen zerfressen dasitzen und den leeren Bildschirm anstarren. Wenn er einfach nur hier stehen blieb, war er sicher, sogar vor seinen eigenen Launen.
Der Computer in seinem Büro am Ende des Flurs im Obergeschoss verkündete mit einem leisen Ping! das Eintreffen einer E-Mail.
Eine Sekunde später vibrierte das Handy in seiner Tasche.
Sam nahm es heraus. Das Display leuchtete auf.
Erin erschien darauf. Mit Mitte dreißig war sie so schön wie nie zuvor. Ihre grünen Augen leuchteten vor Freude. Auf dem Foto hatte sie den Arm um Sams Hüfte gelegt und ihre Wange an seine gepresst.
Sammy, es wird Zeit für einen Tapetenwechsel.
Er strich über den Bildschirm, und gnädigerweise verdeckte eine Flut aus Icons das Foto.
Über der Mail-App schwebte eine 1 in einem roten Kreis.
Sam tippte darauf, und in seinem Posteingang war in dicken, schwarzen Buchstaben der Betreff der eingegangenen Nachricht zu lesen:
Einladung
Er runzelte die Stirn. Die Mail kam von einem gewissen [email protected].
Er öffnete die Nachricht und überflog sie.
Das leere Haus wartete geduldig darauf, dass Sam die Stille durchbrach.
2
Samstag, 8. Oktober
Die Klinge glitt mühelos durch das feuchte rote Fleisch. Der Mann leckte sich voller Vorfreude mit der dicken Zunge über die Lippen, dann schob er sich den Brocken zwischen die schiefen Zähne. Klarer Fleischsaft lief sein Kinn hinunter.
»Wir sind immer noch sehr an einer Zusammenarbeit interessiert«, sagte er mit vollem Mund. »Wirklich. Wir sind nach wie vor sehr an einer Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert.«
T. C. Moore sah dem dicken, glatzköpfigen Mann im schlabbrigen schwarzen Anzug dabei zu, wie er sein Steak verzehrte. Das war’s, dachte sie. Das wird nichts mehr. So eine beschissene Zeitverschwendung.
Sie hatte große Hoffnungen in dieses Abendessen gesetzt. Sie hatten sie lächelnd begrüßt, sie umarmt und ihr Küsschen auf die Wangen gedrückt. Einer hatte sogar den Stuhl für sie zurechtgerückt, als wäre sie mit der Bedienung dieses vierbeinigen Möbelstücks überfordert. Sie hatten hochprozentige Cocktails bestellt, sich gegenseitig mit ihrem Fachwissen über Whiskey und Scotch zu beeindrucken versucht und sich über die Appetithäppchen hergemacht – hausgeräucherter Schinken, Käse aus der Region, gegrillter Tintenfisch und Hamachi, Rindertatar und Bauchfleisch vom Lamm. Obwohl das Steakhaus in West Hollywood ziemlich schummrig beleuchtet war, hatte sie sich geweigert, die Sonnenbrille abzunehmen. Sie hatten es mit einem freundlichen Lächeln quittiert und ihr versichert, mit ihr auf Augenhöhe über das Projekt zu sprechen, um dann mit frischer Kraft einen Neuanfang zu wagen.
Alles Schwachsinn, wie an den hohlen Phrasen und dem verhaltenen Lob deutlich zu erkennen war. Und so wartete sie mit verschränkten Armen auf das Unvermeidliche.
Verdammte Scheiße. Sie hatte es gleich gewusst.
Der Mann in dem weiten Anzug wischte sich das Kinn an einer Leinenserviette ab und säbelte das nächste Stück von seinem Filet mignon.
»Also«, fuhr er fort und leckte mit der Zunge Fleischsaft von den Lippen. »Wir wollten mal hören, was Sie von diesem Projekt halten. Worum es Ihrer Meinung nach wirklich geht.«
Er stopfte sich ein noch größeres Fleischstück in den Mund und kaute lautstark.
Moore sah die drei Männer vor sich an. In der Mitte saß Gary Bryson, der Chef des Studios. Zu seiner Linken saß Tanner Sterling, Vizepräsident Produktentwicklung, ein klapperdürres Frettchen im Karohemd und mit himmelblauer Brille. Tanner lächelte stets etwas dümmlich und herablassend, als wäre er ausschließlich von Vollidioten umgeben, die nichts als seine Verachtung verdienten. Zu Garys Rechten saß Phillip Chance, der für das Projekt zuständige Produzent. Er war wirklich schwer in Ordnung, allerdings brachte sein gutmütiges Naturell zwangsläufig einen Mangel an Durchsetzungsfähigkeit mit sich. Phillip rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl herum. Er hatte seine Mahlzeit, bei der nur der Preis gesalzen war, kaum angerührt. Phillip war Mitte sechzig. Die dünne Haut hing schlaff von seinem Schädel herab, die gutmütigen braunen Augen lagen in tiefen Höhlen. Es war ihm anzusehen, wie unwohl er sich in seiner Rolle als Vermittler fühlte.
»Sie wollen von mir wissen, worum es geht?«, fragte Moore. Jedes Wort war ein Eissplitter.
»Wenn Sie so nett wären, es uns zu verraten.« Gary schmatzte laut mit den Lippen.
Tanner beugte sich vor. Phillip versank noch tiefer in seinem Stuhl.
Moore fuhr mit der Hand über das rabenschwarze Haar auf ihrer Schulter, als würde sie ein Haustier streicheln. Sie hatte sich beide Kopfseiten glatt rasiert. Die tanzende Flamme der Kerze auf dem Tisch spiegelte sich in der dunklen Sonnenbrille. Es sah aus, als würden ihre Augen lichterloh brennen.
»Sie fragen mich, worum es in dem Drehbuch nach meinem eigenen beschissenen Roman geht? Scheiße, ist das Ihr Ernst?«
Garys Kiefer hielten mitten in der Kaubewegung inne. Sein Mund stand offen.
»Wir wollten nur …« Er schluckte und räusperte sich. »Wir hätten gerne gewusst, wie Ihre Vision aussieht.«
Meine Vision. Mein Buch, meinen Sie wohl.
Moore lehnte sich zurück und ließ den Blick über die Gäste an den anderen Tischen schweifen: Eine Ansammlung stinkreicher Typen aus der Filmbranche in engen Anzügen; bärtige Hipster mit lächerlichen, zurückgegelten Seitenscheiteln; klapperdürre Blondinen mit blutegeldicken Lippen. Nichtssagende elektronische Musik dröhnte aus den weißen, in die Decke eingelassenen Lautsprechern.
Eine unangenehme Weile lang sagte Moore gar nichts.
Tanner rieb sich die schweißbedeckten Hände. Als er das Wort ergriff, erinnerte er Moore an eine kleine Zeichentrickfigur mit dicker, runder Brille: eine nervtötende Cartoonmaus, die hoffentlich bald von einer hungrigen Katze in Stücke gerissen wurde.
»Sollten wir nicht alle auf derselben Wellenlänge sein?«
Moore drehte sich so ruckartig zu ihm um, dass sich die schwarze Mähne auf ihrer Schulter hob wie eine zustoßende Schlange.
»Haben Sie mein Buch gelesen?«
»Selbstverständlich habe ich es gelesen.«
»Worum geht es?«
Tanner rutschte peinlich berührt hin und her. »Ich glaube nicht, dass ich hier …«
»Worum geht es?«, wiederholte Moore.
Tanner, der immer weiter in Bedrängnis geriet, gab ein kurzes, ungläubiges Schnauben von sich. »Ist das Ihr Ernst?«
»Sie sind doch hier der Fachmann, oder?«
Tanner blickte Gary an. Es war ihm deutlich anzusehen, dass er lieber nicht über das Thema reden wollte.
Was Moore nicht entging.
»Tanner, Sie können mich mal.« Sie wandte sich dem Studiochef im weiten schwarzen Anzug zu. Dieser schien das Steak vor sich vergessen zu haben. Der Fleischsaft erkaltete auf dem Teller. »Worum geht’s hier wirklich, Gary?«, fragte Moore. »Warum haben Sie mich zum Essen eingeladen?«
Gary legte die Gabel beiseite.
»Mit Ihrem Roman hat das überhaupt nichts zu tun, Schätzchen.«
Schätzchen. Wage es nicht, mich noch einmal so zu nennen.
»Den finden wir ganz großartig. Deshalb haben wir ja auch die Filmrechte gekauft.«
»Ganz großartig«, wiederholte Tanner.
»Nur etwas … zu extrem.«
»Nur ein bisschen«, plapperte Tanner nach.
»Wir wollen ihn leicht abmildern, um ein größeres Publikum zu erreichen.«
»Sie meinen, Sie wollen eine Teenagerromanze daraus machen, damit er die Jugendfreigabe erhält«, zischte Moore wütend.
»Nein, nicht doch«, sagte Gary. »Wir wollen uns nur auf die düstere Liebesgeschichte konzentrieren, die im Zentrum des Buches steht. Die wollen wir etwas zugänglicher machen.«
Moore griff in die glänzende Lederhandtasche, die hinter ihr an der Stuhllehne hing, nahm ein Taschenbuch heraus und warf es auf den Tisch. Es landete direkt in der Mitte. Das Gewicht von vierhundertzweiunddreißig Seiten ließ das Besteck gegen die Teller klirren und die Eiswürfel in den Gläsern hüpfen.
»Was sehen Sie hier?«, fragte sie herausfordernd.
Die drei Männer starrten das Buchcover an.
Das Motiv war – wie immer bei ihren Romanen – ebenso einfach wie brutal: die Hand einer jungen Frau, die eine blutige Rasierklinge über ihrem nackten Oberschenkel hielt. In die Haut des Oberschenkels war mit groben, schartigen Buchstaben der Buchtitel geritzt: Schlitzer. Der Schatten einer zweiten – bedrohlichen und eindeutig männlichen – Hand fiel auf das Handgelenk des Mädchens, als hätte sie die Selbstverstümmelung des weichen Fleisches angeregt. Der Buchrücken war völlig zerfleddert, und durch die vielen Eselsohren stand die obere rechte Ecke ab.
Nur Gary wagte es, die Herausforderung anzunehmen. »Nun, es ist ein sehr komplexes Buch. Sexy und düster. Deshalb wollen wir diese Geschichte auch erzählen. Um das Wesen des Buches herauszuarbeiten.«
»Okay«, sagte Moore. »Anscheinend waren Sie alle so beschäftigt damit, sich gegenseitig einen runterzuholen, dass Sie noch nicht mal den Klappentext gelesen haben. Wenn Sie gestatten.«
Sie nahm das Buch vom Tisch, drehte es um und las den Text auf der Rückseite. »›Ein scheinbar idyllischer Vorort wird von einer Selbstmordreihe unter Teenagern erschüttert. Dies ist die rabenschwarze Geschichte einer von Drogen und Sex gelangweilten Clique auf der Suche nach dem nächsten Kick. Sie brechen in das Haus einer Klassenkameradin ein, um es zu verwüsten – und finden ihre Mitschülerin tot vor. Auf ihrem Körper sind tausend Rasierklingenschnitte – Selbstmord?‹«
Tanner seufzte gereizt. »Bitte, Ms. Moore. Wir alle wissen, worum es in Ihrem Buch geht.«
»Jetzt kommt das Beste«, verkündete sie, ohne ihn zu beachten. »›Vor ihnen auf dem Boden liegt ein altes, unheiliges Buch, das den Weg zu außerkörperlicher Erfahrung durch Selbstverletzung beschreibt. Schon bald führen die Teenager immer blutigere Rituale durch, um ihre Körper zu verlassen und orgiastische Trips jenseits der Realität zu erleben.‹«
»Ist das wirklich nötig?«, fragte Tanner.
»Ja. Ja, und ob«, antwortete sie lapidar, dann las sie weiter. »›Doch irgendetwas will sie an der Rückkehr hindern. Eine böse Macht, verdorbener und stärker als in ihren wildesten Fantasien und dunkelsten Albträumen.‹«
»Was bezwecken Sie damit, Ms. Moore?«
Mit einem Ruck riss sich Moore die Sonnenbrille vom Gesicht. Sie hatte graue, kalte Augen. Nur einige wenige grüne Sprenkel in der Iris, die an Moos auf uralten Felsen erinnerten, verliehen ihnen Leben. Mit ihrem rechten Auge stimmte etwas nicht: die Pupille. Sie war ausgelaufen wie der schwarze Dotter aus einem faulen Ei und bildete ein dunkles Oval, das die Iris zu verschlingen drohte.
»Was genau daran hört sich nach einer gottverdammten Liebesgeschichte an?«
»Niemand will aus Schlitzer eine Liebesgeschichte machen«, versicherte Gary ihr.
Moore drehte sich langsam zu ihm um. Die deformierte Pupille schien sich auszudehnen, das wenige Licht um sie herum förmlich aufzusaugen. »Sie haben einen weiteren Schreiberling hinzugezogen. Ich habe die letzte Drehbuchfassung gelesen.«
Gary warf Tanner einen fragenden Blick zu. Der zuckte mit den Schultern und schob den Schwarzen Peter mit anklagender Miene an Phillip weiter.
»Sie hatte das Recht, es zu lesen«, sagte Phillip.
Gary fuhr sich mit der Hand über die glänzende, teigige Stirn. »Du meine Güte, Phillip. Sind Sie noch bei Trost?«
»Wir wollen lediglich ein größeres Publikum erreichen«, wiederholte Tanner im Versuch, die Kontrolle zurückzuerlangen. »Also haben wir den Sympathieträgern mehr Raum gegeben.«
»Mehr Raum gegeben«, wiederholte Moore höhnisch.
»Ganz richtig.«
»Sie haben eine Liebesgeschichte erfunden, die es in meinem Buch überhaupt nicht gibt, weil sie irgendeinen erbärmlichen Twilight-Scheiß daraus machen wollen.«
»Und was genau ist daran so falsch?«, ereiferte sich Gary.
»Es ist nicht mehr mein Buch!«
»Da haben Sie recht. Es ist nicht Ihr Buch.« Er lehnte sich zurück. »Sondern unser Film.«
Da war sie. Die Wahrheit. Endlich.
Sie hatten die Samthandschuhe ausgezogen. Allen am Tisch war sehr wohl bewusst, dass Gary Moore in die Ecke gedrängt hatte. »Die Rechte gehören uns. Sie hatten Ihre Chance, sich am Drehbuch zu versuchen, aber jetzt sind Sie raus, und wir machen aus Schlitzer, was wir für richtig halten. Wer weiß, vielleicht ändern wir sogar den beschissenen Titel, der ist sowieso etwas grotesk. Wenn Sie deshalb jemanden anschreien oder mit Ihren Stilettos treten wollen, dann bitte schön den Anwalt, der Ihnen das Ganze überhaupt erst eingebrockt hat. Und jetzt würde ich gerne mein Steak aufessen, wenn Sie nichts dagegen haben. Vielleicht bestelle ich mir sogar einen Nachtisch. Sie können bleiben oder gehen, ganz wie Sie wollen.«
Gary nahm sein Besteck wieder auf, schnitt den nächsten Brocken von seinem kalten Steak und steckte ihn sich fröhlich in den höhnisch grinsenden Mund. Dabei ließ er Moore nicht aus den Augen. Er schien den Moment ebenso zu genießen wie das Fleisch.
Langsam setzte sich Moore die Sonnenbrille wieder auf. Dann nickte sie zu aller Überraschung.
»Sie haben recht«, sagte sie.
Zum zweiten Mal an diesem Abend hielt Gary mitten im Kauen inne.
Moore fuhr sich mit den Händen über die rasierten Kopfseiten. Als würde sie eine Kapuze zurückschlagen, die ihr bisher die Sicht verdeckt hatte. »Sie haben recht. Offenbar habe ich das Ganze von der falschen Seite betrachtet.«
Garys Blick huschte zu Tanner, dann verengten sich seine Augen. Was zum Teufel hat die irre Schlampe vor?, sollte das wohl heißen.
Tanner zuckte mit den Schultern.
Moore griff über den Tisch und berührte Garys Hand. Die silbern lackierten Fingernägel kratzten leicht über seine sonnenverbrannte Haut. Gary fuhr ein kalter Schauer vom Nacken bis hinunter in seinen Schwanz.
»Tut mir leid, Gary«, sagte sie. »Ich will mich nicht mit Ihnen streiten.«
Gary wandte sich von seiner Mahlzeit ab. Sein Blick ruhte kurz auf Moores freizügigem Dekolleté und wanderte dann zu der dunklen Sonnenbrille hinauf. Der Tanz der flackernden Flamme darauf war geradezu hypnotisierend.
»Es ist nur so … Horror bedeutet mir so viel.«
Sie nahm seine Wurstfinger in ihre Hand und zog sie zu sich.
»Ja, natürlich, verstehe«, plapperte Gary. »Sie haben nur Ihre Meinung gesagt, da kann man Ihnen keinen Vorwurf machen.«
Moore lachte erleichtert. »Gott sei Dank. Tut mir leid. Hoffentlich habe ich Sie nicht beleidigt.«
Gary wedelte ihre Entschuldigung mit der freien Hand beiseite wie einen üblen Geruch. »Aber woher denn. Gar kein Problem, wirklich.«
Tanner und Phillip verfolgten die Szene mit wachsendem Misstrauen. Keiner der beiden hatte jemals miterlebt, dass sich T. C. Moore für irgendetwas entschuldigt hätte.
»Ich will nur eine Sache verstehen.« Sie starrte Garys Hand beinahe bewundernd an und zeichnete mit einem silbernen Nagel ein kompliziertes Muster auf seine haarigen Knöchel und den Handrücken hinauf bis zum Handgelenk.
Gary setzte sich gerade hin.
Nun konzentrierte sich Moore auf seinen Zeigefinger. Im Gegensatz zu seiner übrigen Erscheinung waren seine Hände perfekt gepflegt, zweifellos das Ergebnis einer sehr teuren Maniküre.
»Wissen Sie, ich finde, dass man den Horror am eigenen Leib erleben muss.«
»Verstehe.«
»Horror ist nichts Leichtes, Flauschiges.«
»Ja.«
Sie zog leicht an seinem Finger.
Garys schlaffen Lippen entfuhr ein kaum hörbarer Seufzer.
Tanner sah Phillip ungläubig an. Es war, als wären sie gar nicht mehr da. Störendes Beiwerk in diesem intimen Augenblick zwischen Moore und Gary.
»Horror ist wie Sex«, fuhr Moore fort. »Roh und ungezügelt. Und wenn er gut ist, wenn er wirklich gut ist, tut er sogar ein bisschen weh. Aber auf angenehme Art, verstehen Sie?«
Der dicke Mann nickte und stieß ein wortähnliches Geräusch aus.
Moore streichelte seinen Finger. Auf und ab. Auf und ab.
»Denn letzten Endes ist Horror nichts als Schmerz. Unerträglicher, allumfassender Schmerz, so real und brutal, dass wir uns auf perverse Art und Weise sogar danach sehnen. Er lässt unsere Haut prickeln und unsere Mösen feucht und unsere Schwänze hart werden. Wir brauchen ihn, um uns lebendig zu fühlen. Um uns zu vergewissern, dass wir existieren. Und das Erschreckende dabei ist die Erkenntnis, dass uns unser Verlangen nach diesem Gefühl – der Bestätigung unseres Daseins – an einen dunklen, schrecklichen Ort geführt hat, von dem es kein Entkommen mehr gibt. Das ist der wahre Horror: wenn der Verführer sich gegen uns wendet und wir nicht länger die Oberhand haben. Wenn wir die Kontrolle verlieren. Dann bezahlen wir einen fürchterlichen, unaussprechlichen Preis.«
Moore umklammerte Garys Finger so fest, dass sich die Spitze weiß färbte. Dann nahm sie mit der anderen Hand das Steakmesser von seinem Teller.
»Beispielsweise dachten Sie bis vor einer Sekunde noch, ich wollte Sie verführen.«
Moore drückte die Messerspitze gerade unterhalb des sorgfältig manikürten Nagels in Garys Finger.
»Und jetzt werde ich Ihnen ein beschissenes Steakmesser unter den Fingernagel rammen.«
Moore verstärkte ganz leicht den Druck. Die Spitze drang in das weiche Fleisch, und ein winziger Blutfleck erschien unter dem Nagel.
Gary japste so erbärmlich wie ein getretener Welpe. Moore ließ seinen Finger los, und er zog ruckartig die Hand zurück.
Tanner griff über den Tisch hinweg nach ihr, doch sie hatte das Messer bereits beiseitegelegt und war aufgestanden.
»Blöde Schlampe!«, zischte Gary. »Haben Sie völlig den Verstand verloren?«
Die Gespräche verstummten. Alle Anwesenden drehten sich zu Moore und den drei Männern um.
»Danke fürs Essen, Gary. War mir eine Freude.« Sie schlang sich die stählerne Kette ihrer Umhängetasche um die Schulter. Das schwarze Haar kräuselte sich um die Kettenglieder wie die Ranken einer vernunftbegabten Schlingpflanze.
Dann deutete sie mit einem silbernen Nagel auf das Taschenbuch auf dem Tisch.
»Das dürfen Sie behalten«, sagte sie. »Vielleicht schaffen Sie es ja sogar mal, es zu lesen.«
»Ich mach Sie fertig, hören Sie?« Gary zitterte vor Wut.
Doch Moore war bereits aus der Tür und im warmen kalifornischen Herbstabend verschwunden.
Autoscheinwerferlicht strich über die abweisende Fassade des Hauses auf dem Hügel, das in der Mitte des letzten Jahrhunderts mit viel Beton und Glas errichtet worden war.
Der chromfarbene Maserati GranTurismo kam so abrupt in der Einfahrt zum Stehen, dass die Reifen quietschten.
Moore schaltete den Motor aus und sprang aus dem Fahrersitz. Sie bebte, ihr Körper wurde von unbeherrschbaren Krämpfen geschüttelt. Beim Verlassen des Restaurants war sie noch die Ruhe selbst gewesen. Doch je weiter sie in die Hollywood Hills gefahren war, je näher sie ihrem Haus gekommen war, desto stärker hatten die vorhin noch so ruhigen Hände auf dem Lenkrad gezittert. Hätte sie auch nur ein Stück weiter auf der kurvigen, engen Straße fahren müssen, sie hätte wahrscheinlich die Kontrolle über den Wagen verloren und ihn über die Klippe gesteuert und wäre in den Canyon darunter gestürzt.
Doch jetzt war sie zu Hause. In Sicherheit.
Wieso zittere ich dann immer noch wie ein beschissener Chihuahua?
Bei diesem Gedanken stieg Wut in ihr auf, und Adrenalin flutete ihren Körper. Ihr Herz raste in ihrer Brust.
Tief durchatmen, befahl sie sich und sog tief die kühle Nachtluft in die Lunge.
Allmählich ließ das Zittern in ihren Händen und dann auch in den übrigen Gliedmaßen nach.
Eine geschlagene Minute stand Moore in ihrer Einfahrt und atmete.
Ein und aus. Ein und aus.
Okay, dachte sie.
Okay.
Sie hatte sich wieder in der Gewalt. Die Panik war fürs Erste besiegt.
»Reiß dich verdammt noch mal zusammen«, sagte sie sich und musste beim Klang ihrer eigenen Stimme kichern.
Als sie die Hälfte der Einfahrt durchquert hatte, bemerkte sie ein kleines, blasses Rechteck, das vor ihrer Haustür in der Luft zu schweben schien.
Als sie näher kam, begriff sie, dass es nicht schwebte, sondern an die schwere Eichentür geklebt war. Das Licht der Straßenlampe in der Nähe war auf den cremefarbenen Umschlag gefallen und hatte die optische Täuschung erzeugt.
Auf dem Umschlag stand ein einziges, in eleganter Schrift geschriebenes Wort:
Einladung.
Moore wollte nach dem Umschlag greifen und ihn von der Tür lösen, hielt aber mitten in der Bewegung inne.
Auf dem Umschlag waren weder Briefmarke noch Absender. Irgendjemand hatte ihn persönlich vorbeigebracht.
Nicht öffnen, sagte eine Stimme in ihrem Kopf.
Das war völlig irrational. Es gab keinen Grund, sich vor dem Inhalt des Umschlags zu fürchten. Und doch ging ihr Verstand fieberhaft alle Möglichkeiten durch: der Liebesbrief eines Stalkers; der Hassbrief eines wütenden Elternteils, das sie für die Selbstverletzung seines Kindes verantwortlich machte; der Gruß eines Nachbarn, den sie lieber nicht kennenlernen wollte.
Und, was am furchterregendsten war: nichts davon, sondern tatsächlich etwas völlig Unerwartetes.
Wieder hörte sie die Stimme, diesmal etwas lauter.
Nicht öffnen.
T. C. Moore stand vor ihrer Haustür. Der Oktoberwind fuhr mit unsichtbaren Fingern durch ihre schwarze Mähne.
3
Dienstag, 11. Oktober
Es war das Haus.
Es streckte seine Hände nach ihm aus, erdrückte ihn, erstickte ihn.
Stille.
Eine Stille, die ihm kaum Luft zum Atmen ließ.
Vor dem großen Panoramafenster des Arbeitszimmers im zweiten Stock zeichneten sich die dunklen, gezackten Umrisse der kahlen Bäume vor dem Nachthimmel ab. Zweige mit einigen wenigen hartnäckigen Blättern daran wurden von einer unsichtbaren Straßenlampe beleuchtet. Der Wind vor dem Doppelglasfenster wurde stärker, pfiff eine merkwürdige, traurige Melodie. Dann legte er sich wieder, und einmal mehr senkte sich die Stille über das Haus.
Weißer Lack blätterte von dem großen, mit kreisrunden Kaffeeflecken übersäten Holzschreibtisch, an dem Sam saß. Er starrte auf den Bildschirm, und der blinkende Cursor auf der leeren Seite schien ihn zu verhöhnen. Früher hatten seine Finger zum Takt dieses Blinkens wie Fred Astaire auf der Tastatur getanzt, jetzt lagen sie nutzlos in seinem Schoß. Er wollte sie dazu zwingen, zum Leben zu erwachen, sich auf die Tasten zu stürzen, doch sie gehorchten ihm nicht.
Er hatte bereits unzählige erste Sätze seines neuen Romans geschrieben – sie ruhten allesamt als einzeilige Dokumente in einem Dateiordner mit dem treffenden Namen »Müll«.
Der kleine Keller Reed wachte mitten in der Nacht auf. Sein Atem war eine eisige Wolke in der Dunkelheit. Der Mann war wieder aus dem Schrank gekommen.
Es waren vier Mann nötig, um den verwitterten Grabstein auf dem Feld hinter Keller Reeds Haus zu bewegen.
Sarah Ann starrte ihr Spiegelbild an und wartete darauf, dass es sich zuerst bewegte.
An ihrem sechzehnten Geburtstag taumelte Sarah Ann um Viertel nach drei nach Hause. Da sah sie von der Straße aus das bleiche Gesicht in ihrem Schlafzimmerfenster.
Es war Brauch unter den Fischern, ihrem größten Fang den Kopf abzuschneiden und an einen der Telefonmasten entlang der River Road zu nageln – doch es war kein Welskopf, der Sheriff Beaumont da entgegenstarrte, sondern das abgetrennte Haupt von Sarah Ann Baker.
Die Puppe war nicht an dem Platz, an den sie sie gestern Abend gelegt hatte.
Und, Sams womöglich aufrichtigster erster Satz:
Sam, du bist ein beschissener Schriftsteller und wirst niemals irgendetwas schreiben, was jemand lesen will, weil du nur ein Hochstapler bist und deine Bücher scheiße sind.
Und jetzt saß er an einem weiteren Abend da und starrte eine leere Seite an.
Die Zeiger des Weckers hoch oben auf einem Einbauregal näherten sich zwei Uhr.
Schlaf. Er musste dringend ins Bett, immerhin hatte er morgen um zehn Uhr eine Vorlesung. Und die fünf Bier hatten ihn auch nicht gerade munterer gemacht.
Blink, blink, blink.
Sam legte seine Finger auf die Tastatur, ganz leicht, wie bei dem Zeiger eines Ouijabretts.
Blink, blink, blink.
Er hatte noch ein paar Geschichten auf Vorrat, Fragmente, im Gedächtnis gespeichert oder auf Schreibblöcke oder Servietten gekritzelt. Vieles davon hatte starke Ähnlichkeit mit den vier Romanen, die er bereits veröffentlicht hatte – Unter dem Teppich, Blutroter Mond, Ein anschwellender Schrei und Böses Blut – und die nun unter dem verdammten Wecker auf einem Ehrenplatz im Regal standen. Er brauchte einen ganz neuen Ansatz, vielleicht konnte er ja dann ein paar Seiten zu Papier bringen. Es musste nichts Großartiges sein, noch nicht mal gut, nur das, was die Leute inzwischen von einem Sam-McGarver-Roman erwarteten: Männer, die schwer arbeiteten und noch schwerer tranken, Frauen, die sie liebten, und die unaussprechliche Monstrosität, die gleich hinter der scheinbar so perfekten Fassade einer ländlichen Kleinstadt lauerte.
Kurswechsel, dachte er. Probier in Gottes Namen etwas Neues aus, aber schreib. Irgendetwas. Nur einen Absatz. Einen Satz. Ein Wort!
Blink, blink, blink.
»Du hast das Zeug zu einer besseren Geschichte.«
Sam keuchte und wirbelte im Stuhl herum.
Er hatte die Stimme deutlich unten aus dem Flur gehört.
Die geöffnete Tür hinter ihm war ein schwarzer Monolith.
Er musste sich getäuscht haben. Er war allein im Haus.
Er war ganz allein.
Sam saß noch eine halbe Stunde vor dem leeren Word-Dokument. Dann fuhr er seufzend den Computer herunter. Die Festplatte kam sirrend zum Stillstand, auf dem Monitor blinkte ein müdes Lämpchen.
Wieso tat er sich nur so schwer? Immerhin war das sein Beruf, das Einzige, was er konnte. Eine verdammte Geschichte erzählen.
Du hast das Zeug zu einer besseren Geschichte.
Er legte den Finger auf den Einschaltknopf des Computers, drückte ihn aber nicht. Stattdessen lauschte er dem gelegentlichen Knistern und Knarzen. Nächtliche Geräusche.
Das Haus kam allmählich zur Ruhe.
Er schloss die Augen.
Und schmeckte Rauch.
Ein Junge stand vor einem brennenden Haus, ein kleiner Schatten vor einem gewaltigen Inferno.
Sam nahm den Finger vom Knopf. Er würde den Computer heute Nacht nicht noch einmal einschalten.
Er machte sich bettfertig, putzte sich die Zähne, wusch sich das Gesicht und zog die abgetragene blaue Jeans aus. Dann nahm er ein orangefarbenes Pillenfläschchen aus dem Spiegelschrank und schüttelte eine einzelne grüne Tablette heraus: dreißig Milligramm Paroxetin. Gegen die Angstattacken, wie er sich einredete. In Wahrheit waren sie gegen seine Depressionen. Um seiner Trauer die Schärfe zu nehmen. Eine Tablette gegen das Ding, vor dem er weglief, seit er ein Kind gewesen war.
Obwohl es Mitte Oktober war und die Kälte allmählich in die Wände kroch, trug er nur Boxershorts, als er sich – aus alter Gewohnheit – auf »seine« Seite des Bettes legte und die dunkle Zimmerdecke über ihm anstarrte.
Du hast das Zeug zu einer besseren Geschichte.
Wieder fühlte es sich an, als würde etwas in seiner Kehle stecken. Etwas Graues, Raues, Erdiges. Er bekam keine Luft. Er wollte auch keine. Er wollte, dass es ihn mit sich in die Finsternis riss. Er hatte es nicht anders verdient. Das Ding in seiner Kehle schlängelte sich höher, es glühte, als würde es jeden Augenblick in Flammen aufgehen. Wenn es ihn doch nur verbrannte, bis sich seine Haut in schwarzen Streifen vom Körper löste! Er hatte diese Qualen verdient, den widerlichen Gestank seines eigenen brennenden Fleisches.
Er umklammerte den linken Unterarm. Die Narben unter den Tattoos erwachten zum Leben wie ein Reptil in der warmen Sonne.
Orangefarbenes Licht flackerte an seiner Schädelbasis. Schatten tanzten auf der Höhlenwand.
Das reichte nicht. Er war viel zu leicht davongekommen. Er hätte sich schon vor langer Zeit umbringen sollen. Er hatte sich weiß Gott schon oft genug vorgestellt, wie es wäre, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen; sich den Arm mit einem Cutter vom Handgelenk bis zum Ellenbogen aufzuschlitzen; sich an einem Dachbalken in der Garage aufzuhängen und mit den Beinen in der leeren Luft zu zappeln.
Er drehte sich auf die Seite und atmete die grauschwarze Faust in seiner Kehle in die Dunkelheit hinaus. Dann streckte er den Arm zur rechten Seite der Matratze aus. Spürte die Kälte der Bettdecke, unter der einst Erins warmer Körper gelegen hatte. Kurz bevor er einschlief, in dem Augenblick, in dem er das Bewusstsein verlor, war er sich gewiss, sie mit den Fingerspitzen zu berühren. Ihre sanfte Haut. Ihren lockenden Körper.
Als er fünf Stunden später aufwachte, schien ihm die grelle Morgensonne, die durch das Schlafzimmerfenster fiel, direkt ins Gesicht. Ein neuer Tag.
Er kniff die Augen gegen das Licht fest zusammen.
»Was ist mit Stull?«, rief eine dünne Studentin im zweiten Studienjahr, die ihre Liebe zum Genre ganz ungeniert in Form eines viel zu engen Fangoria-T-Shirts zum Ausdruck brachte. »Da spukt es doch hundertprozentig.«
Sam nahm einen Schluck aus seinem Thermobecher und spürte den bitteren Kuss des lauwarmen Kaffees in seinem Mund. Die Schauerliteratur war abgehandelt, nun stand ein kurzer Abstecher in Gefilde des paranormalen Romans auf dem Lehrplan, angefangen von Sheridan Le Fanu über M. R. James bis hin zu … spielte das überhaupt eine Rolle? Sobald er den Studenten erlaubt hatte, Fragen zu stellen, war die Diskussion völlig aus dem Ruder gelaufen.
»Stull.« Sam schloss die Augen und rieb sich die Schläfen. »Das Tor zur Hölle. Davon hat sicher jeder von Ihnen schon einmal gehört. Angeblich befahl der Papst, als er 1993 nach Denver flog, dem Piloten seiner Maschine, diesen ›unheiligen Boden‹ großräumig zu umfliegen, wie in einem Interview zu lesen ist, das Johannes Paul II. im selben Jahr der Time gegeben hat. Das Problem ist nur, dieses Interview hat niemals stattgefunden. Die Legende besagt, dass keine Glasflasche, die gegen die Kirchmauern von Stull geworfen wird, zu Bruch gehen kann, und doch liegen vor der Kirche Hunderte zerbrochene Flaschen. So ungern ich Ihnen auch die Illusion raube, aber Stull ist nichts weiter als eine urbane Legende. Wenn auch eine ganz bemerkenswerte, auf die die Region durchaus stolz sein kann.«
Sam verließ die Deckung des Stehpults und ging auf die Studenten zu.
Vorsichtig, dachte er. Sie sind neugierig. Sie wollen dein Geheimnis lüften.
Irgendetwas knackte in seinem Hinterkopf, als würde dort etwas zusammenstürzen. Der Schmerz verschwand mit einem hellorangen Flackern, als hätte ihn jemand gefressen. Und dann war er weg. Erstickt von den Schatten.