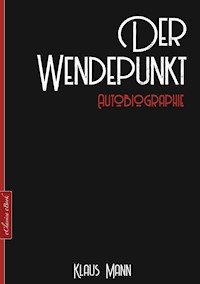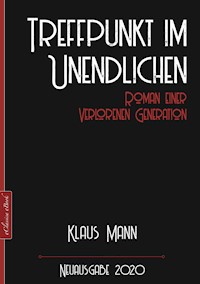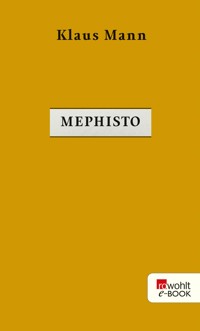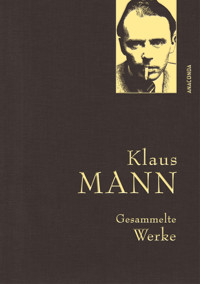4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Kind dieser Zeit» erschien erstmals 1932. Klaus Mann, der älteste Sohn von Katia und Thomas Mann, bilanziert darin anschaulich und engagiert seine Kindheits- und Jugendjahre. Mittlerweile ist das Buch zu einem Klassiker der autobiographischen Literatur geworden. Die vorliegende Ausgabe enthält zahlreiche, zum Teil unbekannte Fotos der Mann'schen Familiengeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus Mann
Kind dieser Zeit
Über dieses Buch
«Kind dieser Zeit» erschien erstmals 1932. Klaus Mann, der älteste Sohn von Katia und Thomas Mann, bilanziert darin anschaulich und engagiert seine Kindheits- und Jugendjahre. Mittlerweile ist das Buch zu einem Klassiker der autobiographischen Literatur geworden. Die vorliegende Ausgabe enthält zahlreiche, zum Teil unbekannte Fotos der Mann’schen Familiengeschichte.
Impressum
Erweiterte Neuausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2019
Copyright © 1967, 2000 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Barbara Hanke
Umschlagabbildung Sammlung Annemarie Süskind
ISBN 978-3-644-00446-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Ricki Hallgarten
La réalité ne se forme que dans la mémoire
MARCEL PROUST
Vorbemerkung
Wenn ich es unternehme, etwas wie die « Geschichte meiner Kindheit» aufzuschreiben, so wage ich das keineswegs, weil ich gerade die Geschichte meiner Kindheit so auffallend interessant finde, sondern einzig und allein, weil die Geschichte einer Kindheit mir erzählenswert vorkommt, deren erste acht Jahre vor Ausbruch des Weltkrieges lagen, so daß die Revolution uns zwölfjährig, die Inflation sechzehn- und siebzehnjährig fand.
Dabei sind über den historisch-politischen Voraussetzungen einer solchen Jugend nicht ihre soziologischen zu vergessen. Sind wir Kinder des späten Kapitalismus: letzte, verwöhnte Sprößlinge einer hoch intellektuahsierten Bourgeoisie? – Unsere Kindheit, nach außen noch ziemlich behütet, war, tiefer drinnen, von den abnormen, ungeheuren Umständen der Zeit derart in Mitleidenschaft gezogen, daß sie fragwürdiger, gefährdeter wurde, als man sich «bürgerliche Kindheiten» gemeinhin vorstellt. Ihre Geschichte könnte also am Ende auch ein geringer und bescheidener Beitrag werden zu der riesengroßen Geschichte von der Krise des Bürgertums, in deren Mitte wir uns bekanntlich seit fünfzehn Jahren befinden. Wenn mein Vater sowohl als meine Mutter noch aus einem – soziologisch gesprochen – rein kapitalistischen Milieu stammten (so verschieden auch das Lübecker Kaufmanns- und das Münchener Gelehrtenhaus in jedem anderen Bezuge voneinander waren), so steht fest, daß die Daseinsformen, in denen wir aufwuchsen, entschieden nicht mehr rein bürgerliche waren. Wir hatten eine Reihe von Jahren hindurch fast nichts zu essen und nichts anzuziehen: das ist wichtig, denn nun könnte auf diesem Gebiete nichts mehr kommen, was uns neu und unerträglich wäre. Wichtiger ist, daß uns der feste Boden unter den Füßen fehlte, den unsere Eltern noch hatten. Sowohl geistig-moralisch als wirtschaftlich hatten wir gar nichts, womit wir rechnen konnten. Auf irgendwelche ethischen Voraussetzungen war ebensowenig zu bauen wie auf die Zinsen irgendwelcher Vermögen.
Mein Erinnerungsfragment bricht in dem Augenblick ab, da ich, allem Anschein nach, so gut wie erwachsen bin (im Herbst des Jahres 1924). Von dort an würden erst die «Memoiren» – das heißt: ein privates Zurückschauen – beginnen; denn alles, was an meinem Leben mehr als «privat» war, mußte mit dem Beginn dieser neuen Stunde in das eingehen, was ich zu schreiben versuche. Hier wollte ich nur die Wege und Irrwege aufzeichnen, die mich bis zu diesem Punkte des Erwachsenwerdens führten: sie schienen mir – wenngleich von unwiederholbaren, persönlichsten Umständen bedingt – charakteristisch genug für die Zeit, die ihr großer Hintergrund war. Mich deucht aber, auch der Schriftsteller des ersehnten Kollektivstaates wird nur fähig sein, für das Allgemeine etwas auszusagen, solange er, als Beispiel und Gleichnis, das Einzelne nehmen darf. Nicht Überwindung des Individualismus sei unser Ziel, sondern Einfügung des individuellen Bewußtseins in ein umfassenderes, kollektiveres. Die Schriftsteller, unverbesserlich, werden nie aufhören, von sich selbst zu erzählen. Aber sie werden sich als Teil eines Ganzen wissen, wenn sie in ihr Privatestes einzukehren scheinen.
Sich erinnern ist immer von Nutzen, man kann es kaum jung genug tun. Während man sich über das klar wird, was vergangen ist, könnte man sogar etwas über die verhüllte Zukunft lernen. Den weltgeschichtlichen Veränderungen, denen wir, schnell oder langsam, entgegengehen und die wir gläubig begrüßen, werden wir uns eher würdig und gewachsen zeigen, wenn wir unsere Herkünfte klären, als wenn wir in der panischen Stimmung des Aufbruchs alles zerstören, was hinter uns liegt.
Kindliche Landschaft
«Es wär gut, viel nachzudenken, um von so Verlorenem etwas auszusagen, von jenen langen Kindheit-Nachmittagen, die so nie wiederkamen – und warum?
Noch mahnt es uns: vielleicht in einem Regnen, aber wir wissen nicht mehr, was das soll; nie wieder war das Leben von Begegnen, von Wiedersehn und Weitergehn so voll,
wie damals, da uns nichts geschah, als nur, was einem Ding geschieht und einem Tiere: da lebten wir, wie Menschliches das Ihre und wurden bis zum Rande voll Figur.»
RILKE
Womit beginnen? Am Anfang ist Dunkelheit. Aus der Dunkelheit wächst die Legende. Wir bewahren unsere ersten Erinnerungen, so wie die Menschheit sich die frühen Abenteuer merkt: als Mythos. Ohne Frage ist es nicht nur Geistesträgheit, sondern auch fromme Scheu, wenn wir dazu neigen, dieses Dunkel unberührt lassen zu wollen, anstatt es zu lichten und aufzuheben, mit allen Mitteln, über die wir verfügen. Den Mythos zu analysieren ist nicht immer eine schöne Aufgabe; auch wenn es nur der Mythos unserer eigenen Kindheit ist. Ein anderes ist es, ihm ehrfurchtsvoll nachzuspüren; ihn erhellen, ohne ihn zu zerstören. Der Kindheitsmythos ist empfindlichste Materie. Ach, hätte man doch so zarte und genaue Sinne wie Proust, der allen Zauber der Erinnerung bewahrt, indem er ihn aufs exakteste untersucht.
Er heißt die Erinnerungen das einzig Reale. Und wie er aus einem Löffel Tee, dessen Geschmack eine Unendlichkeit von Assoziationen in ihm erweckt, den ersten Band seiner «Verlorenen Zeit» steigen läßt – den Band über Combray in seiner ganzen magischen Dichtigkeit –, so bemühe ich mich nun, meinen Erinnerungen nachzuspüren bis in jene mystische Tiefe, wo sie beginnen – und bediene mich dabei, wie Proust, der Geschmacks- und Geruchseindrücke, die sich mir bieten, als Senkblei, das ich in die Dunkelheit jenes Abgrundes schicke, den wir unser Gedächtnis nennen. So genau ich hinuntertaste, ich finde den Grund nicht. Das Dunkel ist zu tief, ich kann nichts erkennen. Erst mit meinem fünften oder sechsten Jahre wird es heller. Was ich vorher zu sehen glaube, bleibt so unklar, daß ich nicht unterscheiden könnte, wieweit es seine Existenz Erzähltem, gesehenen Bildern (Photographien usw.) verdankt oder real – das heißt: reale Erinnerung ist. Ich weiß, daß ich als Kind lange, goldblonde Locken bis zu den Schultern trug, aber ich spüre diese Locken nicht mehr, sondern erst den Pagenkopf, den man mir doch erst wesentlich später stutzte. Ich sehe auch meine Schwester Erika nicht als kleines Kind, sondern nur als Schulmädchen, schon recht aufgeschossen, ernsthaft schauend, mit verwildertem schwarzem Haar und zerkratzten Knien.
Und doch, sind da nicht Ahnungen? Gibt es da nicht etwas, was wie eine allererste, sehr entfernte und wunderbare Erinnerung ist? Der Eindruck von Gummi – ganz deutlich kommt mir jetzt vor, aber vielleicht täusche ich mich –: ein Kinderwagen; die Allee an der Isar (Widenmayerstraße) –: wie halte ich das? Es ist dunkel und leicht, dabei von einer unzerstörbaren Zähigkeit der Substanz. Wie halte ich das? Das Eisengitter eines Balkons. Es muß der kleine Balkon unserer ersten Wohnung in der Franz-Joseph-Straße sein, wo ich geboren wurde. Bin ich unbeaufsichtigt aus dem Eßzimmer auf den Balkon gekrochen, oder hat das Kindermädchen mich hier festgebunden? Außer dem Gefühl des Eisengitters ist nichts mehr da. – Es ist nichts mehr da, so innig ich hinuntertaste und horche; so tief ich die Augen auch schließe und die geheimsten Kräfte meines Wesens spanne – à la recherche du temps perdu.
Ich bin geboren am 18. November 1906 in der Franz-Joseph-Straße zu München. Die Räume dieser Schwabinger Wohnung finde ich nirgends mehr in meinem Gedächtnis, sie sind völlig verschwunden, aufgesogen von der Dunkelheit ganz und gar – und doch sind wahrscheinlich diese Räume diejenigen, in denen ich lebensentscheidende Eindrücke empfing. Das Eisengitter des Balkons ist das einzige, wovon ich noch eine Spur in mir finde; mit aller Mühe versuche ich zu unterscheiden, ob das Gefühl eines Teppichs, über den ich krieche, wirklich aus dieser Zeit in mir geblieben ist, oder ob ich es mit sehr viel späteren Teppichsensationen verwechsle. – Auch wenn ich heute an dem Franz-Joseph-Straßen-Haus vorbeigehe, weht mich keine Erinnerung an, Haustür und Straßenpflaster bleiben stumm, nichts verrät mir, was ich hier gelassen habe. (Das liegt vielleicht daran, daß ich inzwischen zu oft an diesem Haus vorbeigegangen bin. Wäre ich 24 Jahre lang der Franz-Joseph-Straße ferngeblieben und beträte dann plötzlich das Mietshaus von Nummer zwei – wer weiß, welche Welt von Erinnerungen mir aufstiege aus dem Geruch des Treppenhauses, aus der Berührung mit der Türklinke.)
Ungefähr im Jahre 1910 zogen wir in eine größere Etage, draußen im Herzogpark, in der Mauerkircher Straße; im Januar 1914 in das Poschingerstraßenhaus, in dem wir seitdem wohnen. Merkwürdigerweise ist mir auch von der Mauerkircher Straße wirklich lebendig und gegenständlich nur ein kleiner Balkon geblieben. Die einzige Situation, deren ich mich stark erinnere, spielt eben auf diesem Balkon, und zwar drei Uhr nachts. Wir waren mitten in der Nacht aufgestanden – Erika vielleicht sieben-, ich sechsjährig –, nur um zu sehen, wie die Welt aussah, während man eigentlich schlafen sollte. Wir wagten nicht Licht anzumachen und hockten im finsteren Spielzimmer auf dem kalten Linoleumboden. Dann traten wir auf den Balkon in unseren Nachthemden. Spüre ich nicht noch den Anhauch der nächtlichen Luft? Und ich erkenne deutlich das Bild der ausgestorbenen Straße im fahlen Dämmerlicht. Daß es drei Uhr morgens war, schließe ich aus der Beleuchtung, die ich so genau wiedererkenne. Die Nacht ging schon fast zu Ende; es war die graueste Stunde, deren ich mich entsinne. Unser Hausmädchen kam mit Federhütchen und Regenschirm die Straße herunter, von einem Bummel heimkehrend, zugleich angeregt und übermüdet. Sie ertappte uns auf dem Balkon, und wir wurden wieder ins Bett gesteckt.
An den Korridor, in dem der Telephonapparat hing, erinnere ich mich genauer als an unser Schlafzimmer. Die Räume der Eltern (Eßzimmer, Salon usw.) habe ich völlig vergessen. Dabei war ich doch schon sieben Jahre alt, als wir dann in das «neue Haus» einzogen. Sehr reizvoll und verwirrend ist es mir, dieses «neue Haus», das ich damals, siebenjährig, kennenlernte, mit dem inzwischen altgewohnten zu vergleichen. Natürlich ist es nicht mehr dasselbe Haus, die Materie bleibt nicht, sie wird von der Zeit verwandelt. Die Badezimmer und die Treppen, auf denen man von einem Stockwerk ins andere geht, erschienen mir ein unermeßlich weites Reich, sich darin zu verirren – und inzwischen ist dies alles so übersichtlich geworden. – Da der Bauplatz nur drei Minuten Weges von der Mauerkircher Straße entfernt lag, durften wir oft hingehen, um zuzuschauen, wie das «neue Haus» langsam wuchs. Ich suche vergeblich diesen Neubau, durch dessen kahle Schluchten wir neugierig streiften, mit unserem heutigen Heim zu identifizieren. Die Identität ist nicht herzustellen, denn sie besteht nur in unserem logischen Urteil, nicht aber in einer erlebten Realität.
Unser Landhaus in Tölz habe ich als Neubau wahrscheinlich nicht kennengelernt. Wir müssen es im Jahre 1909 oder 1910 bezogen haben (ich weiß nicht das Datum). Von den ersten Sommern meines Lebens weiß ich zwar, wo man sie mit mir verbracht hat, aber dieses Wissen verhilft mir nicht zu der geringsten klaren Erinnerung. – Das schwierigste am Aufrichtig-sich-erinnern-Wollen ist, daß einem immer das Erzählte dazwischen kommt. Man erzählt mir zum Beispiel, wir seien in dem Sommer, ehe das Tölz-Haus fertig war, im Örtchen Geisach bei Tölz gewesen. Meine Lebenslust in diesem Sommer war fulminant, nach diesen Berichten. Der Kriegsruf und Freudenschrei, den ich bevorzugte, war der Name, mit dem wir unseren Großvater anredeten: Ofei. Wie ein Besessener: «Ofei! Ofei! » brüllend, rannte ich einen kleinen Wiesenhügel hinauf und hinunter. – Bei aller Anstrengung vermag ich mir nicht klar zu werden, ob ich mich dieses Hügels und dieses Schreis wirklich erinnere oder ob ich sie mir nicht mittels des Erzählten nachkonstruiere.
Das Städtchen Bad Tölz zerfällt in zwei Teile: in den alten Marktflecken mit der schönen, steilen Hauptstraße und in das Bad Krankenheil, jenseits der Isar, das Quellen und nicht sehr angenehme Hotels bietet. Unser Haus lag oberhalb des alten Ortes mit dem Blick aufs Gebirge. Es hatte ein rotes Dach, auf dem ein Gockelhahn sich nach dem Winde drehte, eine Terrasse, auf der wir aßen, wenn es draußen nicht gar zu unwirtlich war, und einen sehr großen Garten. Gleich hinter dem Garten begann ein Wald von sehr hohen, schlanken und schönen Tannen, der in den ersten Jahren völlig unberührt und wie ein Privatbesitz zu unserer Verfügung stand. Später wurde ein Heim für blinde Kinder dort eingerichtet, die sich nun, weißäugig tappend, mit ihren Hunden und frommen Schwestern zwischen den Tannen ergingen; und während des Krieges wurde der Wald ein Erholungsort für kranke Soldaten. – In unserem Garten gab es den Platz mit der großen Kastanie, den Spielplatz mit Sandhaufen, die Asternbeete, den Tennisplatz, der verfiel, und die Apfelbäume. Eine Allee – die wir langweilig zu gehen fanden, so kurz sie war – führte vom Zaun zum Hause. In den ersten Tölzer Sommern war der Garten nur halb so groß, als wir ihn später kannten, man kaufte ein Stück dazu, was zur Folge hatte, daß Klein-Monika sich in dem neuen, unbekannten Gartenteil verirrte und bitterlich weinen mußte. Was denn hier für Leute wohnten, fragte sie, als sie unseres Hauses von einer ungewohnten Seite ansichtig wurde. – Wir waren in Tölz jeden Sommer, und später auch oft noch im Winter, bis zum Jahre 1918. Im letzten Kriegsjahre tauschten die Eltern ihren Besitz gegen ein wenig Kriegsanleihe ein. – Immer, wenn ich «Kindheit» denke, denke ich zuerst «Tölz».
Über den Wiesenweg ging man zum Klammerweiher, in dessen moorigem Wasser ich so mühsam schwimmen lernte. Auf dem Arm meiner Mutter – auf Mieleins Arm mußte ich mich «auslegen»; was für gräßliche Angst ich immer hatte, sie könnte loslassen! Der Geruch dieses Moorwassers – unvergeßlich. Ich spüre die glitschige Berührung der Holzstange, die das Nichtschwimmerbecken vom gefürchteten Tiefen trennte. – Das Sprungbrett, von dem wir nicht sprangen, aber auf dem wir uns zu sonnen liebten, und wo die Damen aus Krankenheil ihre matten Scherze mit uns machten. (Es war mit rauhem Rupfentuch bezogen; ich spüre noch seine Berührung, die kitzelte.) – Mielein konnte bis zu den Seerosen schwimmen; weiter ging es überhaupt gar nicht.
Später bekamen wir ein flaches, kleines Planschbassin in unserem Garten. Wenn die Sonne stark brannte, wurde sein Wasser rasch warm, man konnte herrlich lange darin liegenbleiben. Auch kleine Spiele waren hier möglich, für die der Klammerweiher denn doch zu gefährlich war; etwa als zerstreuter alter Gelehrter spazierengehen, ins Gespräch vertieft auf nichts achthaben, um plötzlich mit ungeheuerem Gespntze ins Wasser zu purzeln.
In den Ort konnte man entweder über die Wiesenwege – die ich sehr feucht und rutschig in Erinnerung habe – oder die Landstraße hinunter, von der mir im Gegenteil vorkommt, als sei sie stets heiß und staubig gewesen. Die Landstraße hatte den Vorteil, daß man sie beim Hinweg zum Ort mit dem Leiterwagen benutzen konnte: der Leiterwagen rollte mit prachtvollster Geschwindigkeit fast bis zur Bahnhofstraße. Zurück und hinauf mußten ihn dann «die Kleinen» ziehen (Golo und Moni), die wir tyrannisierten. Nicht nur, daß sie beim Heimweg diese häßliche Last hatten, ohne daß sie an den Genüssen der Hinunterfahrt jemals hätten teilhaben dürfen, fiel ihnen auch die wirklich demütigende Aufgabe zu, vorauszulaufen, während wir bergab sausten, um uns dort abzufangen, wo das Gefäll endete, und uns, so geschwind sie es schaffen konnten, bis zum nächsten zu ziehen, damit unsere stolze Fahrt nur ja nicht unterbrochen werde.
Im Ort gab es verschiedene Geschäfte, wo wir immer etwas geschenkt bekamen. Frau Holzmayer spendete Cremehütchen; Frau Pöckel, deren weißes, aufgeschwemmtes müdes Antlitz mit einem angewiderten Zug um den Mund (so, als wenn sie Erbrochenes schmeckte) ich merkwürdig stark in Erinnerung habe, rote Zuckerbonbons, die sie auf eine maulfaule und vom Überdruß gedehnte Manier, welche wir zu parodieren liebten, eine «Himbäre» nannte; der Apotheker mit weißem gütigem Spitzbart eine Stange zähen Eibischzuckers. Bitterste Enttäuschung, wenn wir nur auf die Post oder ins Papiergeschäft gingen, wo es schlechterdings gar nichts gab.
Wir waren vier Kinder in Tölz: Erika, ich, Golo und Monika; Erika ein Jahr älter, Golo zwei Jahre jünger als ich (Elisabeth und Michl gab es noch nicht). Erika und ich übten die grausamste Herrschaft, die Monika sich gefallen ließ, weil sie noch so klein und dumm und niedlich war, Golo hingegen aus zerknirschter Überzeugtheit und masochistischem Hang zur Demütigung. Wir waren alle vorwiegend nett, dann erst sonderbar. Golo aber repräsentierte unter uns das groteske Element. Von skurriler Ernsthaftigkeit, konnte er sowohl tückisch als unterwürfig sein. Er war diensteifrig und heimlich aggressiv; dabei würdevoll wie ein Gnomenkönig. Ich vertrug mich ausgezeichnet mit ihm, während er sich mit Erika viel zankte. Halb aus dämonischer Servilität und halb, weil ihn Neugierde und Ehrfurcht bannten, ging er stundenlang mit mir im Garten spazieren, wo ich ihm Geschichten erzählte. Ich konnte erfinden wie die listige Dame der Tausendundeinen Nacht, so endlos und so phantastisch. Was gäbe ich darum, wenn eines von diesen großen Gartenmärchen aufbewahrt geblieben wäre! Vielleicht würde es viel schöner sein als irgend etwas, was ich mir seitdem habe einfallen lassen. – Um erzählen zu können, brauchte ich zwei harte und genau gleichmäßig lange Gräser als Spielzeug, das ich «Handding» nannte. Es konnte losgehen, sobald das Handding gepflückt und zubereitet war. Ich fabulierte von Königen, Hexen und orientalischen Großkaufleuten, wobei ich etwas mit der Zunge anstieß. Golo trippelte nebenher, das finster-schlaue Mäusegesicht vom glatten Pagenhaar witzig gerahmt, verzaubert von den Verwicklungen meiner Mären, die er vielleicht hinter der eigenen wunderlichen Stirne weiterspann und überraschend deutete.
Erika war die rüstigste von uns. Sie konnte wie zwei Buben turnen und raufen, und sah aus wie ein magerer, dunkel hübscher Zigeunerjunge, dessen braune Stirn sich manchmal trotzig verfinstert. Als einzige von uns beherrschte sie die bayerische Mundart, die ich niemals erlernt habe. Wenn eines von den Kindern des Zwickerbauern, mit denen wir manchmal spielten, sie fragte: «Ärika, magst an Äpfi?» konnte sie in ganz ähnlichem Tonfall antworten, was mir doch einfach unmöglich gewesen wäre.
Außer den Zwicker-Kindern sahen wir in Tölz nur noch zuweilen die kleinen Öttels (Sprößlinge unseres Winterhausmeisters), die aber ziemlich schüchtern-störrisch waren, und die Söhne des Postexpeditors Möslang, Hugo, Hans und Angelus. (Von Hugo sagten wir, daß er «hinterm Rücken» sei; Angelus wollte Damenschneider werden; nach ihm wurde übrigens, Erikas striktem Wunsch zufolge, Golo getauft.) – Kinder im Alter von drei bis dreizehn Jahren haben kaum ein Bedürfnis nach Freunden, vor allem wenn sie mehrere Geschwister sind und also für sich eine kleine Macht bilden. Sie stehen grausam kühl zu allen Menschen, die nicht zur Familie gehören. Einiges Ansehen genießen noch die Wesen, die zum Hause, wenn auch nicht zur Familie gehören. Man muß sie nicht geradezu lieben, aber man rechnet doch fest mit ihnen, so sehr ist man an sie gewöhnt. Sie werden zu Begriffen, zu kleinen Extramythen, die im großen Kindheitsmythos einen Platz einnehmen, dessen Wichtigkeit man beileibe nicht unterschätzen darf.
Wer ist wichtiger: die Kinderfräulein oder die Hunde? Aber vielleicht sind Herr Gundermann oder Herr Öttel auf ihre Art ebenso wichtig. Denn Herr Gundermann, ein mäßig beleibter Onkel, der in Tölz Lastwagen und Einspänner vermietete, galt uns als der dicke Mann par excellence, als die Dickheit selber, ganz einfach als das Prinzip des Dicken. Er wiege mindestens zwei Zentner, hatten wir uns sagen lassen; «dick wie Herr Gundermann», klang nicht schlechter als «reich wie Krösus». – Herr Öttel muß humorvoll und stämmig gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Mir schwebt da ein rotblonder Schnurrbart vor, der über den Lippen feucht ausfranste. Golo bemerkte eines Tages mit verschmitzter Gravität, daß dieser Öttel eigentlich ein «ganz gelungener Mensch» sei – Gott weiß warum.
Der Hund hieß Motz. Es war ein schottisches Schäfertier, seidig schwarz, mit einem weißen Latz auf der Brust, und von überzüchtetster Rassigkeit. Wie ein Toller winselte und jaulte er beim Spazierengehen vor uns her; sein schöner, erregter Kopf und sein rasendes Gekläffe sind an dem wunderbaren Percy-Hund in «Königliche Hoheit» wiederzuerkennen. – Der alte Motz wurde räudig und mußte erschossen werden. Unvergeßlicher Tag, da die Eltern nach München fuhren, nur um nicht dabei sein zu müssen, wenn es aus dem Walde knallte. Man führte den Motz mittags davon. Ich erinnere mich, daß wir eine Reisspeise aßen, und wie traurig uns die Bissen im Munde quollen. Der Hund glaubte, daß er spazierengehen dürfe, und bellte freudig-erregt. Nach ein paar Minuten hörten wir den Schuß. – Am Waldessaum schmückten wir die ganzen Jahre, die wir noch in Tölz waren, sein Grab.
Einige Dienstmädchen wurden sehr erinnerungsmächtig und legendenumwoben: so Köchin Maja, der Bravsten und Stattlichsten eine, die dann Herrn Schmiedel heiratete (oh, Herrn Schmiedels mageres, rotbraunes, lachendes, von Schweißperlen besätes Gesicht – warum sehe ich es plötzlich so deutlich?) und Hausfrau in der Gärtnerei wurde, nicht weit von unserem Hause; oder Grete Bauernschubert, an die ich eine Erinnerung finde, als habe sie sich ununterbrochen im feschen Rhythmus des Schuhplattlertanzes bewegt (was wahrscheinlich nur vom Klange ihres forschen Namens herrührt); oder Resi Adelhoch, aus dem stolzen Geschlecht der Adelhochs, deren Brüder zahlreich und ebenso strahlend brünett, südlich-stämmig waren als Schön-Resi selbst; oder schließlich Affa, von der ich später noch erzählen muß. – Aber alle diese schrumpfen ein, werden Zwerginnen und gar nicht der Rede wert, neben der Kinderfräulein ehrfurchtgebietender Familie. Wie eine Dynastie von Königinnen – die jeden männlichen Thronfolger ermorden lassen, um die heilige Einrichtung des Matriarchats zu wahren – schreiten diese regierenden Damen durch unsere Kindheitsgeschichte; launisch meist, leicht verdrossen und nur durch unsere äußerste Artigkeit oder durch überraschend angenehme Post von auswärts zu gnadenvollen Scherzen zu bewegen: angefangen mit der aller-aller-ersten, der Ur-Königin, der vom Beginn der Zeiten, der prähistorischen Kindsanna, von deren blauen Backen nur die Hauschronik, nicht mein Gedächtnis mir sagt, – bis zur schaurigen Muhme Zilli, Wärterin von Elisabeth und Michl, aber auch uns noch halb vorgesetzt, mit falschem Zopf, falschem Zahn und der lamentierend gellenden Stimme der Tauben. (Warum verstand sie nur, wenn sie nicht verstehen sollte? Redete ich sie mal unziemlicherweise als «Fräulein Stinkmeier» an – gleich kreischte sie schwäbisch: «Ha - was hast g'sagt?» und keine Silbe war ihr entgangen.) Zwischen diesen: die Langbeinige, die wir Betty-Lilie nannten; Fräulein Amalie mit rotem Haar und harter, sommersprossiger Miene; Mademoiselei aus Düsseldorf, die im Gehen zu stricken pflegte und weniger leicht aufbrausend als manche andere, dafür von aufreizendster Kühle war; die dicke Hermine, die in meiner Erinnerung von einer etwas larmoyanten, ja hysterischen Zärtlichkeit scheint. Jede von ihnen unterscheidet sich auf eine so majestätisch eigenwillige Art von der anderen, wie sich Maria Stuart von Maria Theresia, die Pompadour von der Großen Katharina abhebt. Wir litten unter jeder von ihnen, und wir liebten jede. Betty-Lilie mit ihrer ruchlosen Vergnügungssucht, Mademoiselei mit ihrem empfindlichen Düsseldorfer Familienstolz, Fräulein Amalie mit ihrem erbarmungslosen Egoismus: sie alle waren überreich an anspruchsvollen und fatalen Eigenschaften, die wir als gottgegeben hinnahmen, meist demütig, selten rebellisch. Jede von ihnen vermochte uns einzureden, daß sie noch verhältnismäßig gütig sei und daß erst mit ihrer Nachfolgerin das wirklich bitterharte Leben beginnen würde. Wir glaubten es so sehr, daß wir ihren einerseits doch ersehnten Weggang wie das Ende aller Dinge fürchteten – denn was würde dann kommen? – Ebenso unbedingt glaubten wir, daß wir wahre Teufel und Mißgeburten seien im Vergleich zu den vorigen Zöglingen des Fräuleins, die uns als kleine Wunder an gescheiter Liebenswürdigkeit und braver Adrettheit hingestellt wurden. Die jungen Barone Tuchers zum Beispiel, die so lange Mademoiselei anvertraut gewesen waren (warum hatte sie sich jemals von ihnen getrennt?) – was für ausnehmend kluge, sanfte und wohlgekämmte Bürschchen mußten es gewesen sein. Sie trugen die appetitlichsten und propersten «Gilets » (was in mir immer eine Ideenverbindung zu feinstem, säuerlich schmackhaftem Johannisbeer-Gelee wachrief) –: so weit würden wir es nie bringen. Daß Klein-Tuchers so wohl geraten konnten, lag natürlich auch teilweise an gewissen vorzüglichen pädagogischen Qualitäten des alten Baron Tucher, die Mademoiselei unserem Papa nicht nachrühmen mochte. «Der Baron Tucher, der war doch blind», begann das Fräulein ihre klassische Erzählung vom strengen, aber gerechten Vater. «Und wenn einer von den Jungen nun was ausgefressen hatte, ließ er sich den Rohrstock vom Schrank runter langen, und man mußte ihm das Bürschchen übers Knie legen –» Das Bild dieses behinderten, aber unnachsichtigen alten Edelmannes hat sich mir ganz unauslöschlich eingegraben.
Die Macht der Kinderfräuleins wuchs dadurch ins Unermeßliche, daß unsere Mutter, in diesen Jahren viel krank, mehrfach längere Zeit in Davos und Arosa sein mußte. In solchen Monaten und halben Jahren herrschten die launischen Damen fast unumschränkt über uns, da unser Vater, wenngleich sehend, nichts von dem erzieherischen Furor des von Tucher an sich hatte.
Wie unternehmungslustig viele von den Königinnen waren! Nahmen sie uns nicht in die Wohnung ihrer Verwandten in der Münchener Altstadt, damit wir den klassischen Schefflertanz aus einem gutgelegenen Fenster sehen könnten? – Von Tölz aus machten sie nicht nur Spaziergänge, sondern schon richtige Ausflüge mit uns; ins Isartal und auf die leichteren Berge der Gegend, auf den Blomberg, wo man Milch im Blomberg-Häuschen trank. War es nicht auch ein Kinderfräulein, das uns auf den Friedhof führte, als der Bäckergeselle im Klammerweiher ertrunken war? Der Herzschlag hatte ihn getroffen, weil er direkt nach dem Mittagessen ins Wasser sprang – wie man uns warnend vermeldete. Nun lag er wächsern zwischen den weißen Blüten, und wir entsetzten uns vor ihm. Ja, es muß die bürgerliche Düsseldorferin gewesen sein, die uns diese schauerliche Sensation verschaffte. Der Bäckergeselle trug ein schwarzes Tuch über dem Mund – weil er so gedunsene Lippen hatte, erklärte man uns. Ich glaube, daß wir noch mehr Staunen als Furcht empfanden. Das Unvorstellbare – der Tod – wird durch den Anblick einer Leiche nicht um einen Grad plausibler oder glaubwürdiger. Die sind schon so fremd, die da zwischen den Blumen liegen, so weit entfernt, nichts mehr haben wir mit ihnen zu schaffen. – Übrigens habe ich seitdem nur noch einen einzigen Toten gesehen; es war eine Lehrerin, Fräulein Zumbusch, die in dem Internat starb, auf dem ich war. Meine Gefühle, als ich an ihrer Bahre stand, unterschieden sich nicht so sehr von denen, die ich am offenen Sarge des Tölzer Bäckergesellen empfand. Durch den Anblick der wächsernen Puppen wurde meine Beziehung zum Tode nicht beeinflußt, soweit ich es feststellen kann. Daß wir einmal so daliegen werden, vermag unsere Phantasie sich nicht vorzustellen.
Ein großes und schweres Kapitel wäre über die Angst zu schreiben, von welcher das Kind nachts, und nicht nur nachts, angepackt wird. Sicher ist mir, daß in diesen schauerlich tiefen Ängsten atavistisches Sich-Erinnern an Zustände des Grauens liegt, die in frühen Menschheitsepochen mit den Zuständen der Lust und Beutegier abwechselten. Die Angst-Masse, die wahrscheinlich gleichsam die unterste Schicht jeder kindlichen Seele bildet, reagiert nicht so sehr auf den Gedanken des Todes – der für das Kind mehr unfaßlich und einfach unglaubwürdig denn fürchterlich ist – als auf das Geheimnis des Lebens selber, das uns zum Beispiel aus der Dunkelheit so lautlos-deutlich ansprach und entsetzte. So abgrundtief könnte unsere Angst bei keinem Schiffsuntergang und keiner Geistererscheinung mehr werden wie jene, mit der wir, sechs-, acht- oder zehnjährig, den Geräuschen der Dunkelheit nachhorchten, wenn wir einschlafen sollten. Hat da nicht etwas geknackt? Die Pein, mit der sich unser Herz beim Knacken zusammenzieht, kommt aus tieferen Gründen unseres Wesens als alle Beteuerungen der Not oder der Liebe, die wir seitdem gestammelt haben. Denn diese Pein bedeutet: Wir sind ausgesetzt in eine Schöpfung, von der wir nichts wissen; die Laune eines grausamen Sturmes kann den Planeten zerschmettern, auf dem wir uns regen; aus dem Dunkel kann der Böse Geist treten und uns auslöschen oder uns forttragen; wir sind nichts, wir sind alleine mit dem Geheimnis – alleine mit dem Geheimnis – nur die Angst ist mit uns – wir, allein mit der Angst – –
Sehr gräßlich war auch das Erschrecken über das eigene Spiegelbild, besonders wenn es uns nicht aus der Klarheit eines gerahmten Spiegels, sondern trübe und verschwimmend aus einem abendlichen Fensterglas entgegenschaute. Die Angst vor der Spaltung gehört zur Angst vor der Einsamkeit und vorm Dunkel. Jede Schizophrenie ist im Kinde vorbereitet. Wenn ich beim Zeichnen oder Schreiben den Kopf hob und plötzlich meine eigene Stirn, mein eigenes Haar, meinen schweigenden Mund im dunklen Glas erkannte – welch eiskalte Hand preßte da mein Herz zusammen, so daß ich es knirschen hörte vor Angst? Wer ist das? Das bin doch ich! Aber wer bin dann ich? Wo bin dann ich? Dann bin ich ja zwei – – als Kind, allein mit seinem Spiegelbild in einem halbdunklen Zimmer gelassen, hat man alle Verzweiflungen des Irrenhauses kennengelernt.
Natürlich gab es auch greifbarere, verständlichere Beängstigungen, aber sie scheinen mir harmlos gewesen zu sein, verglichen mit den unfaßlichen. Die Angst vor dem Gewitter war manchmal schlimm – vor allem in Tölz, wo die Unwetter gar nicht mehr aufhören wollten zu toben – oder die Angst vor den bösen Männern, die sich hinter den Bäumen der Alleen versteckten, um uns mörderisch aufzulauern. Auch Träume konnten abscheulich werden, aber doch nie so arg wie die Angst vor der Dunkelheit, wenn man wach lag. Eine Zeitlang träumte ich in Tölz regelmäßig von dem Mann, der mit dem Kopf unterm Arm, klapprig und verhüllt, auf mich zukam. Aber mein Vater hatte mir den guten Rat gegeben, ihm einfach zu sagen: «Mach sofort, daß du wegkommst. Mein Papa hat ausdrücklich verboten, daß du mich besuchst!» Ich tat es und, sieh da, er verschwand.
Am meisten von uns allen fürchtete sich Golo. Er konnte weiß, steif und stumm werden vor tiefster Angst, er schnatterte mit den Zähnen und bekam blaue Lippen. Schon als kleines Kind schaffte er sich die Gespenster, vor denen er sich recht gräßlich fürchten konnte. Das schlimmste von ihnen hieß die «Me-Me», die in der Wand klopfte und im Finsteren raschelte (ich habe sie mir immer als eine Art von monströs vergrößerter Fledermaus vorgestellt). Auch die Freunde, die er sich als Umgang ersann, hatten meist nicht gerade anheimelnde Berufe. Vom «Scharfrichter Wilhelm» sprach er zwar als von einem sehr flotten und lieben Burschen, aber schließlich ist es doch auffallend, wenn ein Kind in seinen Träumen sich täglich von einem Henker zu Spazierfahrten abholen läßt. Viel später noch, elf-, zwölf- und dreizehnjährig, konnte man ihn kaum dazu bewegen, allein in ein dunkles Zimmer zu gehen, die Angst vor seinem Spiegelbild war ihm unüberwindlich; und als er schon auf dem Gymnasium war, ließ er sich noch peinlich beunruhigen, wenn ich langsam und drohend genug zu ihm sagte: «Ich bin nämlich eigentlich gar nicht der Klaus – die ganze Zeit habe ich mich verstellt – ich bin nämlich eine Hexe –!!» Dann wandte er ganz gequält das Gesicht und wimmerte: «Laß doch, laß doch nur – du weißt doch, ich mag das nicht – – » Mir scheint, daß eben diese seine unstillbare und ständig nagende Lebensangst es war, die ihn später, als er sie durch stärkste intellektuelle Gaben und große Willensanspannung bändigen konnte, zur Philosophie brachte, in der sie produktiv werden durfte. –
Wie wunderbar wir gespielt haben! Mit den Puppen war mehr anzufangen als mit dem Dichter- und Komponistenquartett, dem «Villanor»-Baukasten, den Mühlesteinen oder der Eisenbahn. Beim Dichterquartett konnte man freilich, danach gefragt, ob man Schillers «Jungfrau von Orleans» vorrätig habe, mit feinstem Spott antworten: «Bedaure ganz außerordentlich – aber vielleicht kannst du mir mit Grillparzers ‹Medea› aufwarten!» – und beim Mühlespielen durfte man den Partner durch die infame Zwickmühle wahrhaftig grün ärgern; aber die Puppen wurden wirklich lebendig; das bedeutete natürlich einen ungeheueren Vorteil. Ja, Bobbelchen, Madamchen und all die anderen lebten, sie hatten sogar die kompliziertesten und größten Schicksale. Sie zankten sich, sie bekamen Kinder, sie erwarben Vermögen, verloren sie, unternahmen Reisen, litten an bösen Krankheiten. Sie hatten Lieblingsgerichte, so daß sie im Chore riefen: «Darum – laßt uns – Wurstbrot – schmatzen –»; einige von ihnen waren so eitel, daß man ihnen ständig neue Kostüme schneidern mußte, andere schienen boshaft und aufsässigen Charakters. – Ich weiß, daß ich mit zehn und elf Jahren noch mit Puppen spielte. Freilich wurden die kleinen Stoff- und Zelluloidgebilde selber beinah nebensächlich, während die großen Geschichten, die sich um sie spannen, immer selbständiger wuchsen.
Dieser Kreis der Puppengeschichten stand in einem engen, wenn auch komplizierten Zusammenhang mit dem großen Spiel von «Gro-Schie» oder dem Spiel von Herrn Steinrück und Löbenzahn. – Das Spiel «Gro-Schie» bestand darin, daß unser Haus und der ganze Garten sich in einen enormen Ozeandampfer verwandelte, wobei der Garten zum Schiffsdeck, die Zimmer zu den Kabinen wurden. Die schiffstechnischen Einzelheiten dieses schönen Spiels waren angeregt durch die Lektüre eines Romans, den wir ganz herrlich fanden und fast auswendig wußten: «Kapitän Spieker und sein Schiffsjunge». So kannten wir uns aus: Unser Vater war der Kapitän, der sich selten zeigte, aber in der «Betriebskabine» alles lenkte; Mielein wurde Wirtschaftsdame und hieß feinerweise Gräfin Baudessin. Erika und Moni waren Passagiere erster Klasse, desgleichen Golo und ich. Während Erika und Moni aber eben nur einfach reisende Ladies waren, hieß ich Herr Steinrück, Golo Herr Löbenzahn, wir waren beide steinreiche Sonderlinge und miteinander befreundet. Herr Löbenzahn, wenngleich auch seinerseits reich, schrullenhaft und von großer Welt, stand doch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu Herrn Steinrück, der sich allerlei mit ihm erlauben konnte. Herr Steinrück war Bobbelchens Vater und Bobbelchen war leichtlebig, zu Herrn Steinrücks Sorge. So verflochten sich die Puppenschicksale mit den Schicksalen der Groß-Schiff-Bewohner. Bobbelchen und Madamchen ließen sich schrecklich gehen, während Papa Steinrück seine Weltreise machte. Darüber sprach der würdige alte Millionär mit Freund Löbenzahn, wenn die beiden hochvermögenden Käuze auf Deck promenierten. Die Wiesen waren das Meer. Wenn wir vormittags spazieren gehen mußten, wurde eine «Landung» eingelegt; der Wiesenweg in den Ort verwandelte sich in eine Palmenallee vonHonolulu, und wir besichtigten das ehrliche alte Tölz wie Bombay.
Allen am Gro-Schie-Spiel Beteiligten wuchs eine gewisse Macht zu, die sie oft aufs unfairste ausnutzten. Dann natürlich konnte man dem anderen alles verderben, indem man plötzlich dem fatalen «Nichts-mehr-möga» (der Formel des Verkracht-Seins, die wir bei jeder Gelegenheit ausstießen) das grausam entzaubernde «Gro-Schie-aufgehoben» hinzufügte. Dann war alles zerstört. «Ach, das ist doch gar nicht Gräfin Baudessin, sondern Mielein –», sagte Erika, die uns zuweilen damit folterte, daß sie «kühl» wurde, ein Zustand von unangreifbarer Schnippischkeit und eisig höflicher Aggressivität – und sie trat höhnisch auf die Wiese hinaus, die doch das Meer war. Wie abscheulich, daß sie nun nicht versank! –
Mehrere Jahre nachher, im Sommer 1918, wurde der ganze Schicksalskomplex derer um Steinrück und Löbenzahn sowie ihrer Kinder und Kindeskinder aufgeschrieben – da ja immer in späteren Epochen die Mythen der Frühzeit festgehalten und literarisch verkleinert werden. Ein großer Kreis von Personen agierte mit in diesem «bürgerlichen Epos», das, einfach durch die Ausmaße, welche es annahm, etwas von einem kindlichen Familien- und Gesellschaftsroman im großen Stil des XIX. Jahrhunderts bekam. Eine wichtige Rolle spielte, neben Bobbelchen, Komischhasi, Adoptivsohn Löbenzahns, der an frivoler Genüßlichkeit dem Steinrück-Sprößling nichts nachgab (in Wirklichkeit war er ein weißes Hasenpüppchen, aus Plüsch gefertigt); oder Fritz Bremer (in Wahrheit ein Bogenhausener Bübchen, mit dem wir viel zankten und spielten), der auf folgende Weise eingeführt wird: «Zu dem engeren Bekanntenkreis Steinrücks und Löbenzahns gehörte Herr Fritz Bremer, ein beliebter Münchener Schriftsteller, der in den weitesten Kreisen als ‹Fiesefusibema› bekannt war. Es war ein reicher kleiner Herr mit Froschaugen, der immer Zylinder trug, der gut aß und immer mit einem Delikateßladen in Verbindung stand. Er hatte mehrere Romane und ein Schauspiel verfaßt, letzteres hieß ‹Die olympischen Weiber›, und er war schon immer drei Tage vorher geschminkt, wenn sie aufgeführt wurden, im Falle er sich verneigen müßte.» – Wichtig war weiterhin Herr Döl, eine recht ramponierte und zerschundene Porzellanpuppe; der III. Band, I. Kapitel beginnt: «Warum soll ich Tatsachen bemänteln und Wahrheiten verheimlichen? Döls Ehe mit Ria war schlecht. – Die Sache hatte gleich bei der Hochzeit begonnen. Sie aßen im Speisehaus zu Mittag. Sie bestellte eine Gans – und sie aß den ganzen Vogel. Er wurde rot vor Zorn. ‹Aber am Hochzeitstag –› dachte er, und so schwieg er. ‹Geh in die Küche und eß Weißkraut!› sagte sie herrisch. Dann ging sie. Das Geld hatte sie – so mußte er nüchtern nach Hause. Er dachte, das wären nur so vorübergehende Grillen. Aber, Prost die Mahlzeit – er hatte sich getäuscht.» – So sehen wir diese große Anzahl von Personen lieben, hassen, altern und wirklich beinah etwas wie ein grotesk primitives Schicksal erfüllen. Am Schluß, nach Bobbelchens Tod, erhebt sich Döl, der von Ria Geschiedene, zu einer festlichen Trauerrede, um so zu schließen: «Der Tod riß einen Teuren aus der Mitte seiner Freunde. Ich traure um ihn und vergoß manche Träne. Doch – stirbt mit ihm der Name Steinrück aus? Nein! Denn er hat einen gesunden Sohn hinterlassen, der jetzige Repräsentant dieser würdigen Familie. Und da auch ich die Ehre habe, in meiner Ehe mit der Baronin Lonx mit einem Sohn gesegnet worden zu sein, so besteht denn fort – Steinrück und Löbenzahn.»
Von dem Mythenkreis der Löbenzahn-Steinrück ganz unabhängig entstanden, aber durch die Puppenwelt in einer gewissen lockeren und ungenauen Verbindung zu ihm stehend, entwickelte sich die Welt der Üsen, deren Heldentaten und Aventüren später gleichfalls episch fixiert und in mehreren blauen Schulheften aufgeschrieben wurden, so daß die «Geschichte der Üsen» etwa der «Ilias» und «Odyssee» entspricht, wenn «Steinrück und Löbenzahn» den Platz der «Rougon Macquart» einnehmen.
Das Wort «üsis» spielte eine enorme Rolle in unserem Sprachschatz (und spielt sie übrigens heute noch). Es ist in seiner Herkunft und seiner Bedeutung nicht ganz leicht zu erklären. Ursprünglich von «putzig» abgeleitet und über «usig», «üsig» zu seiner endgültigen Form «üsis» sich entwickelnd, wurde es zunächst auf Puppen und auf Tiere angewendet. Es bezeichnet auf eine vage und zärtliche Weise alles, was ungeschickt, rührend, bemüht, großäugig-drollig, ungelenk-sympathisch auf uns wirkte. Kälber oder Füllen konnten üsis sein, Puppen oder kleine Kinder mit erstauntem, hilflosem Ausdruck im Gesicht; in seltenen Glücksfällen sogar Erwachsene. – Die Gegensatzbegriffe zu üsis waren «wuffig» einerseits, «klie-klie» andererseits. «Wuffig» waren vor allem gewisse Kinderfräuleins, etwa jene, die im Gehen strickten und dazu mundfaul schalten. Wuffig bedeutete: blasiert, «kühl», dabei aggressiv; anspruchsvoll, ja, tyrannisch auf eine gelangweilt lässige und müde Art. Wuffig im allerpeinlichsten Grade war Mademoiselei und einige ihrer Kolleginnen, die wir im Herzogpark trafen, wo sie andere Zöglinge hüteten und quälten: Fräulein Klara und Fräulein Berner. «Klie-klie» hingegen waren die Gassenbuben, die uns auf der Straße nachschrien, wenn wir zu viert, in den bunten «Künstlerkleidern» und die vielen Puppen im Arm, spazierengehen mußten.