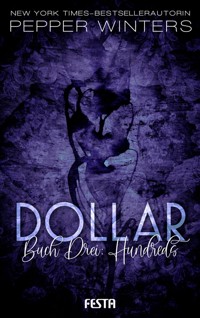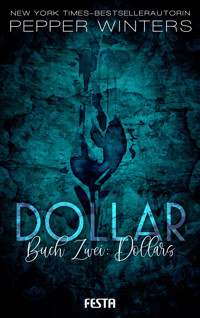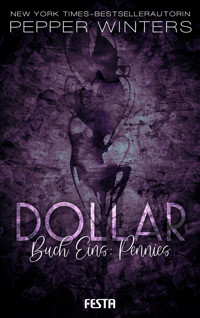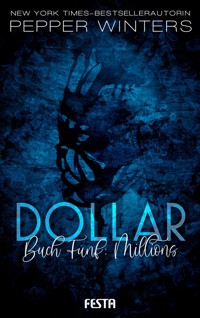6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Truth and Lies
- Sprache: Deutsch
Vom Nobody zum King of Wall Street - doch seine Geheimnisse könnten ihn alles kosten ...
Ein Leben im goldenen Käfig - dazu ist die junge Noelle Charlston verdammt. Doch eines Abends bricht die Erbin einer noblen Kaufhauskette aus und gerät prompt in Lebensgefahr. Ein geheimnisvoller Fremder rettet sie. Als sie Jahre später Penn Everett trifft - einen erfolgreichen Geschäftsmann -, entwickelt sie Gefühle, die sie bisher nur einmal verspürt hat: in der Nacht, die ihr Leben für immer veränderte. Aber Penn spielt nicht mit offenen Karten, und Noelle muss sich fragen: Ist der undurchsichtige Businessman Freund oder Feind?
"Sinnlich und fesselnd - man kann die Seiten gar nicht schnell genug umblättern. Pepper Winters hat sich selbst übertroffen!" NEW-YORK-TIMES-BESTSELLER-AUTORIN MEGHAN MARCH
Auftakt des "Lies & Truth"-Duetts von Bestseller-Autorin Pepper Winters
Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Crown of Lies" erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchProlog1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. Kapitel25. Kapitel26. Kapitel27. Kapitel28. Kapitel29. Kapitel30. Kapitel31. Kapitel32. Kapitel33. Kapitel34. Kapitel35. Kapitel36. KapitelDie AutorinDie Romane von Pepper Winters bei LYXImpressumPEPPER WINTERS
King of Lies
Roman
Ins Deutsche übertragen von Ralf Schmitz
Zu diesem Buch
Die junge Noelle Charlston lebt in einem goldenen Käfig. Von Kindesbeinen an wurde sie dazu erzogen, das Kaufhausimperium ihres Vaters zu übernehmen. Sie kennt nur Pflichten und Verantwortung, hat keine Freunde, weiß nicht, was Freiheit bedeutet, und hat nie die Lippen eines Mannes auf ihren gespürt. Doch am Abend ihres neunzehnten Geburtstags bricht sie aus. Nur einmal allein durch die Straßen von New York streifen, tun, wozu sie Lust hat, unbeschwert das Leben genießen. Aber in einer dunklen Gasse zerplatzt ihr Traum, als sie von zwei Männern überfallen und fast getötet wird. Zum Glück taucht ein Unbekannter auf und rettet sie. Er zeigt Elle sein New York und bereitet ihr eine unvergessliche Nacht. Noch Jahre später klingen die Ereignisse in ihr nach, und sie hat nie aufgegeben, den Mann ohne Namen zu suchen. Da stellt Elles Vater ihr Penn Everett vor. Penn ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, doch er scheint keine Vergangenheit zu besitzen. Niemand weiß Näheres über den undurchsichtigen Businessman, der New York im Sturm erobert hat. Und obwohl Elle sich von ihm fernhalten will, fühlt sie sich doch zu ihm hingezogen und entwickelt Gefühle, die sie nur ein einziges Mal in ihrem bisherigen Leben gespürt hat – in der Nacht, die ihr Leben für immer veränderte …
PROLOG
Jedes Mädchen erfährt im Leben Verrat.
Verrat durch geliebte und durch unbekannte Menschen. Und durch jene, für die wir uns entschieden haben. Aber wo Täuschung ist, da ist auch Vertrauen. Und manchmal begegnet uns das eine im Gewand des anderen.
So war es mit ihm.
Der Mann, der zuerst meinen Körper und dann mein Herz stahl, erwies sich als wahrer Meister der Verstellung.
Ich glaube, ein Teil von mir wusste immer schon, was er vor mir verbarg. Ich habe ihm nie ganz getraut, und vielleicht war das der Grund, weshalb ich trotz seiner Täuschungen auf ihn hereinfiel.
Doch dann stürzte sein Kartenhaus in sich zusammen.
Und es war an mir, zu entscheiden, wie ich darauf antworten sollte: mit
Vertrauen
oder
Verrat.
1. KAPITEL
»Du kannst deine Tochter am Wochenende nicht einfach so mit zur Arbeit bringen, Joe.«
»Sagt wer?«
Steve verschränkte die Arme vor der Brust und versuchte, streng zu wirken, aber seine Mühe war vergebens. »Sagst du selbst.«
Ich schlang die Arme um meinen in Rüschen gehüllten Oberkörper, mein Blick flog wie ein Volleyball zwischen Dad und dem Mann, der ihm bei der Leitung seiner Firma half, hin und her. Mit durchgedrücktem Rücken wartete ich darauf, dass sie wütend die Stimmen erhoben, aber ihre nicht mehr jungen Gesichter blieben fröhlich.
Seit Moms Tod vor vier Jahren reagierte ich empfindlich auf Wutausbrüche. Ich hasste es, wenn Dad laut wurde oder Leute sich vor aller Augen stritten.
Dad legte einen Arm um meine mageren Schultern und zog mich an sich. »Und wann genau soll ich gesagt haben, dass ich meine liebe Tochter samstags nicht mit zur Arbeit bringen kann, Steve?«
Steve zwinkerte mir zu. Seine dunkelblonden Haare waren kurz geschoren, der Schnurrbart dafür umso buschiger. »Als du die Hausordnung für deine Firma geschrieben hast, Joe. Es steht im Kleingedruckten.«
Ich wusste, dass sie nur Spaß machten – auch wenn ich das Spiel nicht verstand. Ich war schon an sämtlichen Wochentagen im Büro gewesen. Auch samstags und sonntags. Aber weil sie erwarteten, dass ich ihnen ihre kleine Komödie abkaufte, tat ich ihnen den Gefallen.
Ich erlaubte mir, mich jünger zu geben, als ich mich fühlte – eigentlich war ich noch ein Kind und sollte noch nicht viel von den Angelegenheiten Erwachsener verstehen.
Moms Tod und die Tatsache, dass ich schon als kleines Mädchen viel Zeit in der Firma verbracht hatte … beides zusammen hatte dazu geführt, dass ich vor allem zwei Ziele verfolgte: in die Pubertät zu kommen und erwachsen zu werden. Meist wurde ich bereits als Erwachsene behandelt und benahm mich auch so, heute aber machte es mir nichts aus, jünger zu tun, weil ich zur Abwechslung mal tatsächlich jünger sein wollte.
Ich wollte weinen dürfen, weil der Tag heute eine Riesenenttäuschung war, und wenn ich ein Kind war, durfte ich meinen Kummer zeigen. Als Erwachsene musste ich ihn in mich hineinfressen und so tun, als machte mir das alles nichts aus.
Der Grund meiner Traurigkeit war total blödsinnig. Eigentlich sollte es mich nicht so sehr aus der Fassung bringen – eigentlich wusste ich es doch besser. Doch Dad hatte unsere dumme Geburtstagstradition vergessen, und jetzt wusste ich nicht, wie ich ihm sagen sollte, wie traurig ich darüber war, ohne wie ein schmollendes Kind zu wirken, das nicht zu schätzen weiß, was es alles hat.
»Hausordnung?«, meldete ich mich zu Wort und sah zu Dad hoch. »Du hast eine Hausordnung geschrieben, so wie die in der Schule? Stehen in deiner genauso spießige und strenge Vorschriften darüber, wie lang die Socken sein dürfen und wie die Uniform aussehen muss?« Mit einem Blick auf Steves ungebügeltes Hemd und die zerknitterte Hose rümpfte ich die Nase. »Und wenn das so ist, warum bist du nicht entsprechend angezogen?«
Dad trug eine frisch gebügelte Hose, eine graue Weste und einen Blazer mit Marinestreifen an den Ärmeln. Manschetten und Bügelfalten saßen militärisch korrekt.
Unter all den anderen Anzugträgern in seinem Hochhaus stach er deutlich heraus, vor allem im Vergleich mit Steve in dessen knittriger Pracht.
Was nichts Neues war.
Dad achtete, solange ich zurückdenken konnte, stets auf eine makellose Erscheinung. Sogar auf den Fotos, auf denen er mich nach meiner Geburt, noch im Krankenhaus, auf dem Arm hielt, trug er einen dreiteiligen Anzug und eine Chrysantheme (Moms Lieblingsblume) im Knopfloch.
Steve kicherte. »Du musst eine Schuluniform tragen, Elle?«
Er wusste es. Er hatte mich nach der Schule schon in meiner verhassten karierten Herrlichkeit gesehen.
Ich nickte. »Ich hasse sie. Sie kratzt und ist hässlich.«
»Aber du siehst so bezaubernd darin aus, Bell Button.« Dad drückte mich. Insgeheim liebte ich es, wenn er mich in den Arm nahm (vor allem, seit wir sonst niemanden mehr hatten), aber nach außen musste ich natürlich den Ruf einer Zwölfjährigen verteidigen.
Ich spielte weiter mit und leierte: »Da-ad, du hast versprochen, mich nicht mehr so zu nennen.«
Er zuckte übertrieben zusammen. »Ups, hab ich vergessen.« Dann tippte er sich an die Schläfe. »Ich bin ein alter Mann, Elle. Ich kann nicht an alles denken.«
Ich stupste ihn mit der Schulter an. »Deshalb hast du wohl auch vergessen, dass in deiner Hausordnung steht, dass Töchter am Wochenende nicht erlaubt sind.«
»Genau«, strahlte er.
»Und dass ich heute Geburtstag habe?«
Ups.
Eigentlich hatte ich das nicht sagen wollen. Aber es hatte sich schon den ganzen Vormittag aufgestaut. Ich gab mir Mühe, so zu tun, als wäre es ein Scherz gewesen, aber ganz konnte ich nicht verbergen, dass ich verletzt war. Er hatte meinen Geburtstag noch nie vergessen. Sonst hatte er mich immer mit einem kleinen Geschenk geweckt und dann mit mir unternommen, was immer ich mir für den Nachmittag wünschte.
Aber nicht heute.
Ich war zwölf geworden, und es hatte weder Kuchen gegeben noch Kerzen – nicht mal eine Umarmung zum Geburtstag.
Stattdessen hatte er Toast gemacht, mich angewiesen, mich schick zu machen, und mich anschließend zur Arbeit mitgeschleppt. Er nahm mich häufig mit ins Büro, aber heute hatte ich auf einen gemeinsamen Ausflug in den Central Park oder wenigstens auf ein Mittagessen bei meinem Lieblingsthailänder gehofft.
Ist Spaß ab jetzt nicht mehr erlaubt?
Musste ich mir nun, da ich älter war, mein eigenes Geld verdienen, wie er es immer gesagt hatte? Fand er, dass es Zeit war, etwas aus meinen paar Jahren Schulbildung zu machen?
Ich dachte immer, das hätte er nur im Scherz gesagt.
Aber dieses ganze Rollenspiel war ja nur ein Scherz. Mein Herz setzte einen Schlag aus und versuchte mit aller Macht, das alles zu begreifen.
Steve schnappte nach Luft. »Du hast den Geburtstag deiner Tochter vergessen?«, mokierte er sich kopfschüttelnd. »Schäm dich, Joe.«
»Pass bloß auf. Ich kann dich jederzeit vor die Tür setzen.« Dad verzog das Gesicht, um sich das Lachen zu verkneifen. Doch dann gab er es auf und erlaubte sich ein breites Grinsen. »Aus dem Grund habe ich gegen die Hausordnung verstoßen und meine Tochter an einem Samstag zur Arbeit mitgebracht.«
Ich erstarrte, unfähig, das Glückgefühl zu unterdrücken, das in mir aufwallte.
Moment … heißt das, er hat es gar nicht vergessen?
»Was … damit sie hier schuftet?« Steve machte große Augen. »Da hättest du wenigstens warten können, bis sie dreizehn wird.« Er zwinkerte mir wieder zu. »Damit sie ein bisschen was von der Welt sieht, bevor sie hier festgekettet wird.«
»Dafür bleibt ihr noch genug Zeit.« Er drückte mich noch mal, dann marschierte er los und zog mich mit sich fort. »Komm mit, Bell Button!«
Ich verdrehte die Augen. »Schon wieder Bell Button.«
»Find dich damit ab.« Er gluckste, und das Neonlicht schimmerte auf seinem ergrauenden Haar, während wir durch den breiten Flur schlenderten. In den Fenstern funkelten die Lichter von Downtown Manhattan. Die in der hochherrschaftlichen Höhe der siebenundvierzigsten Etage gelegenen Büros des CEO und des Managements von Belle Elle beeindruckten mich jedes Mal, und zugleich fand ich sie beängstigend. Nebst diesem Gebäude gehörten Dad noch ein paar andere. Meine Mitschülerinnen tratschten oft darüber, wie stinkreich er sei. Ich wusste, wie viel Kraft und Zeit er in sein Unternehmen investierte, und war sehr stolz auf ihn. Aber ich fürchtete mich davor, was er nun, da ich älter war, von mir erwarteten mochte.
Mein Leben hatte sich schon vor Jahren verändert. Zwei Monate nach dem Tod meiner Mutter war meine Kindheit zu Ende gewesen, als mir klar wurde, wie sehr sich unser Leben von dem Moment angewandelt hatte. Es gab keine Märchenstunden und Gutenachtgeschichten mehr.
Weder Aladdin noch Die Schöne und das Biest.
Keine Illusionen mehr.
Stattdessen zeigte Dad mir die Geschäftsbücher und die Kleider der Saison. Er trug mir als Hausaufgabe auf, mich mit unserer Website vertraut zu machen, und brachte mir bei, wie ich entschied, ob es sinnvoll war, im Einkauf zwei Dollar für ein Kleid zu investieren, das uns im Verkauf neunzehn einbrachte. Ich lernte, Miete, Steuern, Löhne und andere Betriebskosten zu berechnen und herauszufinden, ob das Kleid überhaupt Gewinn abwarf (wie sich zeigte, brachte es nach den Ausgaben gerade noch zwanzig Cent pro Verkauf und damit zu wenig für einen tragfähigen Profit).
Die Firma beherrschte seit frühester Kindheit meinen Alltag und meine Gedanken. Und jetzt schien sie sogar meinen Geburtstag zu bestimmen. Dad blieb vor seinem Büro stehen und hielt mir die Tür weit auf, damit ich hindurchschlüpfen konnte. Während er die Tür schloss, ging ich zu seinem Schreibtisch. Ich liebte seinen Schreibtisch. Er erinnerte mich an einen uralten Baum, der jahrelang vor unserem Stadthaus gestanden hatte, bis er eines Tages gefällt werden musste.
Ich warf mich in Dads bequemen Ledersessel, wirbelte damit herum und stieß mich ab, um mich auf der zweiten Runde noch schneller zu drehen.
»Elle.« Dad verschwamm vor meinen Augen. Er war nicht sauer. Ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht, und er gluckste. »Gleich wird dir schlecht.«
Ich pflanzte die Hände auf den Schreibtisch und kam abrupt zum Stehen. »Nein, bestimmt nicht. Schon vergessen? Seit den Ballettstunden komme ich nicht mehr so leicht aus dem Gleichgewicht.«
Er nickte. »Ich weiß. Du warst ein wunderhübscher Schwan in der Schwanenprinzessin.«
Ich lächelte und verzieh ihm, dass er meinen Geburtstag verschwitzt hatte, weil es mir nämlich genügte, Zeit mit ihm zu verbringen. Wo genau das war, spielte keine Rolle, solange nur aus ihm und mir ein Wir wurde. »Soll ich heute ein paar von den Kindersachen anprobieren?« Ich fläzte mich in seinen Sessel. »Oder aus Mädchensicht bei der Schaufensterdekoration helfen?« All das hatte ich gelernt und war schon sehr gut darin.
Die Firma – Belle Elle – gehörte der Familie meines Vaters schon länger, als ich zurückdenken konnte. Einer meiner Ur-, Ur-, Ur- und endlos so weiter Urgroßväter hatte seinen kleinen Laden nach seiner Frau Belle Elle genannt. Elizabeth Eleanor, Spitzname Belle Elle. Das wusste ich, weil sich etliche Ahnenforscher und Zeitungsartikel mit meiner Familie beschäftigt hatten. Ein weiterer Bestandteil meiner Hausaufgabe: so viel über unser Erbe in Erfahrung zu bringen, wie ich konnte, denn in dieser Welt, in den USA, die keine königliche Familie vorzuweisen hatten, galten wir in manchen Kreisen als eine Art Aristokraten. Alteingesessene Bürger eines Reichs, das schon seit der Kolonisierung existierte. Ein Reich, das immer weiter wuchs und nahezu alles im Angebot hatte, von einfachen Mänteln und Hüten für Herren und Sonnenschirmen und Schals für Damen bis hin zu vollständiger Oberbekleidung, Haushaltswaren, Freizeitartikeln und Schmuck für jedes Alter.
Belle Elle war die größte Einzelhandelskette in den USA und Kanada. Und eines Tages würde sie mir gehören.
Als Zwölfjährige, die am liebsten kindergroße Schaufensterpuppen einkleidete, sobald die Kunden vor die Tür gesetzt waren, dem Personal half, die Fenster neu zu dekorieren, und manchmal Modeschmuck mit nach Hause nahm, da ihr Vater jederzeit problemlos ein, zwei Ketten abschreiben konnte, geriet ich über den Gedanken ziemlich aus dem Häuschen. Doch die Frau, zu der ich allmählich wurde – und die stündlich auf diese Zukunft vorbereitet wurde –, hatte schlicht Schiss davor.
War ich denn wirklich imstande, ein solches Unternehmen zu leiten?
Und war das überhaupt mein Lebensziel?
»Ich habe deinen Geburtstag nicht vergessen.« Dad faltete die Hände vor seiner Weste. »Aber das wusstest du ja längst, weil du meine Tochter und das klügste Mädchen der Welt bist.«
Ich lächelte und senkte beschämt den Kopf. Sein Lob wärmte und tröstete mich immer. Ich würde ihm nicht verraten, dass ich mich ernstlich gesorgt hatte.
Ich hab echt gedacht, du hast es vergessen.
Er fuhr fort: »Heute ist ein ganz besonderer Tag. Und das nicht nur, weil du heute zur Welt gekommen bist.« Er pflückte einen Fussel von seinem Blazer. Jeder Zentimeter der mächtige CEO und nicht der liebevolle Vater, den ich kannte.
Wohin wir auch gingen, immer trug er einen Anzug. Er hielt auch mich dazu an, stets strenge, gestärkte weiße Blusen, Kleider oder schnieke Hosen zu tragen. Eine Jeans hatte ich nie besessen.
Aber vielleicht bekam ich heute ja eine geschenkt.
Ich saß ruhig und stumm da und wartete darauf, dass er weitersprach.
»Ich habe dich mit hierhergenommen, um dir zwei Geschenke zu machen.«
Puh, er hat es echt nicht vergessen.
Ich versuchte, meine Ungeduld nicht zu zeigen. Ich wusste, wie ich meine wahren Gefühle tarnen konnte. Ich war vielleicht noch ein Kind, aber ich war zur Erbin geboren und hatte gelernt, in jeder Lebenslage, ob gut oder schlecht, ungerührt zu wirken.
»Schau mal nach rechts.«
Ich gehorchte und griff nach dem schwarzen Hefter, der immer dort lag. Dad brachte ihn immer vollgestopft mit wichtigen Papieren mit nach Hause und nahm ihn anschließend voller noch wichtigerer Dokumente wieder mit ins Büro. Ich durfte ihn nur anfassen, wenn er dabei war – und auch dann nur, wenn ich ihn Dad reichen sollte.
Als meine Finger über das weiche Leder glitten, zögerte ich.
Dad lächelte. »Nur zu, du darfst ihn öffnen.«
Ich zog den Ordner heran und schlug ihn auf. Wie immer lagen knisternde, mit zahlreichen schwarzen Zeilen in Erwachsenensprache bedeckte Blätter darin.
»Was steht obendrüber?« Er öffnete den mittleren Jackenknopf und lehnte sich gegen die Schreibtischkante. Seine hohe Gestalt überragte mich, was mir jedoch nicht unangenehm war. Er erinnerte mich an eine Weide im Central Park, unter der ich es mir an den seltenen Tagen, an denen Dad nichts zu tun hatte, gerne gemütlich machte und ein Nickerchen hielt.
»Letzter Wille von Joseph Mark Charlston.« Mein Blick flog zu ihm. »Dad … du wirst doch nicht …«
Er tätschelte mir die Hand. »Nein, Bell Button. Noch nicht. Aber man kann nie vorsichtig genug sein. Bis letzte Woche ging die Leitung unseres Familienbetriebs laut Testament bis zu deiner Volljährigkeit noch an Steve über. Allerdings war mir nie wohl bei dem Gedanken, diese Verantwortung jemandem zu übertragen, der nicht zur Familie Charlston gehört.«
Ich biss mir auf die Lippe. »Warum sagst du das?«
Er zog einen Füller aus dem kleinen goldenen Halter auf dem Schreibtisch. »Weil ich das Testament geändert habe. Ich habe nicht vor, diese Welt so bald zu verlassen, mach dir also deshalb keine Sorgen. Und du, meine Liebe, bist für dein Alter ungewöhnlich klug, deshalb weiß ich, dass du mit alldem locker fertig werden wirst. Was ich dir über unsere Verfahren, die Fabriken und die Zusammensetzung der Mitarbeiter beigebracht habe, werde ich weiter vertiefen. Und sobald du so weit bist, trete ich zurück, und du wirst CEO.«
Mir fiel die Kinnlade runter. Das hörte sich hart an. Wann genau sollte ich denn dann noch zur Schule gehen und mit Leuten Freundschaft schließen, die nicht in der Kosmetikabteilung arbeiteten? (Dort hing ich ab, wenn mein Dad lange arbeiten musste.)
Aber das konnte ich doch nicht sagen. Er hatte nur mich. Und ich hatte nur ihn. Wir mussten zusammenhalten.
Mein Herz raste und verlangte trotz seiner Beteuerungen Gewissheit, dass er mich wirklich nicht allein lassen würde. »Aber du stirbst nicht?«
Er schüttelte den Kopf. »Wenn es nach mir ginge, nie. Ich will dir hiermit keine Angst einjagen, Elle, sondern dir nur zeigen, wie stolz ich auf dich bin. Aber ich will nicht leugnen, wie dankbar ich bin, dein Erbe eher früher als später in deine Hände legen zu können, weil ich tief im Herzen weiß, dass du Belle Elle in noch größere Höhen führen wirst, als ich es je konnte.« Er gab mir den Füllfederhalter. »Du musst jede Seite paraphieren und am Ende unterschreiben.«
Ich hatte schon von klein auf so viele Verträge unterzeichnet, dass ich wusste, wie man das machte. Für Aktien, die er in meinem Namen erworben hatte, ein Haus, das er in einem Staat kaufte, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte – sogar für ein seltenes Gemälde von einem Auktionshaus in England.
Ich beugte mich über die Papiere, schloss die Finger um den Füller und achtete nicht auf das plötzlich einsetzende Zittern. Dieses Dokument vor mir unterschied sich äußerlich in nichts von irgendeinem anderen, und doch bedeutete es so viel mehr. Mein Leben. Es war mehr, als einfach nur Geburtstag zu feiern. Dies hier würde jeden Tag bestimmen, jeden Augenblick, es war das letzte Wort, das über mich gesprochen wurde, bis ich so alt war wie mein Vater. Ich war nicht in der luxuriösen Lage, mir aussuchen zu können, ob ich Ärztin oder Astrophysikerin werden wollte. Ich würde nicht als Schwimmerin bei den Olympischen Spielen antreten (wobei meine Trainerin mich ohnehin eher für einen Wackerstein als für einen Delfin hielt). Ich würde immer nur Noelle Charlston sein, Erbin von Belle Elle.
Mein Herz schlug seltsam dumpf, als ich die Feder aufsetzte.
»Oh, Moment noch.« Dad drückte eine Taste der Gegensprechanlage und rief seine Vorzimmerdame. »Margaret, können Sie bitte kurz hereinkommen?«
Sofort trat eine hübsche Rothaarige mittleren Alters ein. In dieser Firma unterschieden sich die Wochenenden durch nichts von den übrigen Wochentagen. »Ja, Mr Charlston?«
»Ich benötige Sie als Zeugin.«
Sie sah mich lächelnd an, sagte aber nichts, während ich die siebzehn Seiten durchblätterte, jede paraphierte und schließlich tief Luft holte und mit meinem Namen unterschrieb. Im selben Moment drehte Dad das Dokument grinsend zu Margaret um. »Und jetzt Sie. Unterschreiben Sie bitte als Zeugin.«
Ich gab ihr den Füllfederhalter.
»Danke, Elle.« Sie nahm ihn.
Mein Spitzname (nicht Bell Button – wie dieser Spitzname zustande gekommen war, blieb ein Geheimnis. Dad behauptete, es hätte etwas damit zu tun, dass ich als Kind Knöpfe geliebt hätte, und weil Bell sich auf Elle reimte) erinnerte mich daran, dass ich über Umwege nach der ersten Frau in der Firma benannt worden war. Die Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann ein Imperium erschaffen hatte, bevor er einer Lungenentzündung erlegen war, und danach noch vierzig weitere Jahre geherrscht hatte. Elizabeth Eleanor. Die erste Belle Elle.
Margaret kritzelte ihre Unterschrift und gab den Vertrag meinem Vater zurück.
Er unterzeichnete mit äußerster Konzentration und spürbarer Erleichterung als Letzter.
»Wäre das alles, Mr Charlston?«, fragte Margaret.
»Ja, vielen Dank.« Mein Vater nickte.
Sie winkte mir kurz zu, zog sich ins Vorzimmer zurück und ließ mich mit meinem Vater allein.
Er sah von seiner Unterschrift auf und betrachtete mich mit Augen, die so viel älter waren als meine eigenen. Seine Miene verdüsterte sich. »Was ist? Was hast du?«
Ich zuckte mit den Schultern und gab mir Mühe, sorglos zu wirken und nicht daran zu denken, wie groß mir die Fußstapfen vorkamen, in die ich treten sollte. »Nichts.«
Er legte die Stirn in Falten. »Du wirkst … ängstlich.«
Das bin ich auch.
Ich habe Angst vor einer Welt, in der es dich nicht mehr gibt und ich die ganze Verantwortung trage.
Ich habe Angst davor, nicht die Tochter zu sein, für die du mich hältst.
Aber das konnte ich ihm unmöglich sagen. Dies hier war meine Pflicht. Mein Geburtsrecht. Trotz meiner Jugend und geringen Lebenserfahrung war ich klug genug zu wissen, dass Belle Elle mein Schicksal war.
Ich lächelte. »Nein, bin ich nicht. So seh ich nun mal aus.«
Er gluckste. »Alles klar, So-siehst-du-nun-mal-aus. Wenn du nicht damit zufrieden bist, dass ich dir zum Geburtstag dein Erbe überschreibe – damit du immer in gesichertem Wohlstand leben kannst –, wirf mal einen Blick unter den Schreibtisch.«
Glückliche Schmetterlinge verscheuchten die ängstlich flatternden Motten aus meinem Bauch. »Soll das heißen … du hast noch etwas?«
Aus seinen funkelnden Augen sprach väterliche Liebe. »Natürlich habe ich noch etwas. Sieh nach!«
Ich schob den Sessel zurück und spähte zwischen meinen baumelnden Beinen hindurch. An der Wand stand eine Schachtel mit einer großen violetten und silbernen Schleife.
Die Furcht vor der Verantwortung und die unheimliche Verpflichtung, mein Leben schon jetzt bis ins kleinste Detail festlegen zu müssen, waren urplötzlich verflogen. Aufgeregt hüpfte ich im Sessel auf und ab. »Du hast ein Geschenk für mich!«
Er beugte sich vor und küsste mich auf den Scheitel. »Du bist meine ganze Welt, Elle. Ich werde den Tag, als du in mein Leben kamst, niemals vergessen. Und ich würde es mir im Traum nicht einfallen lassen, dich langweilige Papiere unterschreiben zu lassen, ohne dir zum Geburtstag auch etwas zu schenken, das dir wirklich Spaß macht.«
»Vielen, vielen Dank«, rief ich strahlend und kämpfte gegen die Ungeduld an. Ich wollte mein Geschenk endlich auspacken.
»Du weißt doch noch gar nicht, was es ist.«
»Mir egal. Es gefällt mir jetzt schon.« Mein Blick klebte an der Schachtel, ich konnte es kaum erwarten, zu sehen, was darin war.
Er hatte ein Einsehen und sagte: »Na los, mach es auf!«
Dazu musste er mich nicht zweimal auffordern.
Ich sprang aus dem Sessel, kroch auf allen vieren unter seinen riesigen Schreibtisch und zerrte gespannt an der Schleife, bis sie endlich abging und das Band sich auf dem Teppich kräuselte. Dann nahm ich den Deckel ab und spähte in die Schachtel.
Zuerst konnte ich im Dunkel unter dem Schreibtisch nicht viel erkennen, doch dann erschien ein winziges graues Gesicht.
»Oh!« Mein ganzer Körper wurde von Aufregung und grenzenloser Liebe geschüttelt. »Oh! Oh!« Ich griff in die Schachtel und zog das süßeste Wollknäuel daraus hervor, das ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte. Plumpste auf den Hintern und nahm das Kätzchen in die Arme. »Du schenkst mir eine Katze?«
Dad kam, schob den Sessel zur Seite und ging vor mir in die Hocke. »Ja.«
»Aber du hast doch gesagt, ich darf keine Haustiere haben. Weil wir dafür zu viel zu tun haben.«
»Tja, da habe ich meine Meinung wohl geändert.« Dann wurde er ernst. »Ich weiß, welche Verantwortung ich dir aufbürde, Elle. Und ich weiß, wie schwer es ist, das alles so richtig zu begreifen, wenn man noch so jung ist wie du und das Leben gerade erst richtig anfängt. Es tut mir leid, dass du nicht so frei bist wie einige deiner Freundinnen. Ich war immer streng zu dir, aber nur, weil du so ein gutes Mädchen bist. Ich dachte, ich gebe dir zur Abwechslung mal etwas, das du dir wirklich wünschst.«
Ich drückte das Kätzchen fester. Es entwand sich mir nicht und schlug auch nicht nach mir wie die Katze in der Zoohandlung, in die ich mich eines Tages heimlich hineingeschlichen hatte, als mein Vater gerade abgelenkt war. Dieses Kätzchen schnurrte und stupste mich mit dem Köpfchen unters Kinn.
Tränen traten mir in die Augen. Liebe staute sich in mir und floss über. Irgendwie liebte ich dieses kleine Bündel genauso wie meinen Dad, dabei hatten wir uns gerade zum ersten Mal gesehen.
Die Liebe wurde rasch von Dankbarkeit überschattet. Ich setzte das Kätzchen ab, kroch, so schnell ich konnte, zu meinem Dad und stürzte mich in seine Arme.
»Danke.« Ich küsste seine raue Wange. »Danke!«
Er lachte. Und als er mich in die Arme schloss, roch er so tröstlich nach Lavendelseife. Dieselbe Seife, mit deren Geruch Mom früher das ganze Haus verpestet hatte, wenn sie eine neue Charge siedete.
»Tausend Dank. Ich liebe den Kleinen.«
Das Kätzchen tapste zu uns und erkletterte den gemeinsamen Schoß, den unsere Beine bildeten.
Dad schüttelte den Kopf. »Es ist ein Mädchen. Sie ist zwölf Wochen alt. So wie du zwölf Jahre.« Er löste die Umarmung, und ich hob das Kätzchen auf und verbarg das Gesicht in seinem duftenden grauen Fell.
»Wie willst du sie nennen?«
Ich runzelte die Stirn und dachte über diese wichtige Frage nach. »Silver?«
»Silver?«
Ich küsste den kleinen Katzenkopf. »Ihr Fell sieht aus wie Silber.«
Dad lachte. »Dann passt der Name perfekt.«
»Nein, warte, Salbei ist besser.«
»Salbei?«
»Ich möchte sie Salbei nennen.«
Er musste nicht wissen, dass ich mich gut an die meisten Kräuter und aromatherapeutischen Öle erinnerte, aus denen Mom Lotionen und Seifen gemacht hatte. Salbei war das letzte Kraut gewesen, über das sie mich belehrt hatte, und die Blätter trugen einen silbernen Flaum. Wenn ich an den Tag dachte, schien sie mir näher und nicht mehr so weit weg im Himmel zu sein.
Ich bekräftigte meine Entscheidung mit einem energischen Nicken. »Ja, ihr Name ist Salbei.«
Er zog mich wieder an sich und küsste mich auf den Scheitel. »Wie du willst. Ich hoffe nur, dass sie sich genauso gut um dich kümmert wie du dich um sie.«
Ich rieb meine Nase an der kalten, feuchten Nase des Kätzchens, das bei der seltsamen neuen Empfindung zu zittern begann. »Das wird sie. Sie wird mich jeden Tag zur Arbeit begleiten.« Ich bückte mich und wiegte meine neue beste Freundin im Arm. »Geht das? Kann sie mit mir zur Arbeit kommen?«
Wieder verdüsterte sich Dads Miene. Was er gesagt hatte, stimmte: Er war streng zu mir. Aber auch streng zu sich selbst. Er vermisste meine Mutter ebenso sehr wie ich. Dachte er womöglich, ich würde ihn nun, wo ich ein Haustier hatte, nicht mehr so lieben wie bisher?
Ich streckte die Hand nach seiner Sandpapierwange aus. »Ich liebe dich.«
Da kehrte das Licht in seine grauen Augen zurück. Er umarmte mich auf seinem Schoß, sodass unser kleines Trio einen Moment lang zu einer Einheit verschmolz. »Ich liebe dich auch, Elle. Und du musst mich nicht erst fragen, wenn du Salbei zur Arbeit mitbringen willst. Sie gehört dir. Solange sie sich nicht im Verkauf herumtreibt, kannst du tun, was immer du möchtest, und sie ins Büro mitbringen.«
Ich seufzte glücklich, während Salbei die Gipfel erkundete, die unsere Knie bildeten. »Du bist der beste Dad aller Zeiten.«
Sein Lächeln verblasste, und der glückliche Augenblick löste sich auf. Er schüttelte den Kopf. »Nein, das bin ich nicht, Elle. Ich weiß, ich kann dir niemals deine Mutter ersetzen, und ich weiß, wie viel es verlangt ist, dass du in so jungen Jahren die Führung der Firma übernehmen sollst, aber ich liebe dich mehr als alles auf der Welt und bin so dankbar, dass es dich gibt.«
Was er sagte, wog schwer für eine Zwölfjährige. Und das Gewicht seiner Worte wurde mit den Jahren nicht leichter. Dieser Geburtstag grub sich mir aus zwei Gründen tief ins Gedächtnis.
Erstens, weil ich dank Salbei nie wieder allein sein würde.
Und zweitens, weil Dad wusste, was er mir zumutete, und es trotzdem tat.
Ich glaubte damals, Belle Elle bereits mit Leib und Seele zu gehören.
Doch ich täuschte mich.
2. KAPITEL
Sieben Jahre später
Wer hätte geahnt, dass mein neunzehnter Geburtstag so traurig sein würde?
Ich schniefte gegen eine Träne an, während ich zur Vorbereitung des MMM – auch bekannt als Montag-Morgen-Meeting – die Zahlen des Monatsendes in die Tabelle eingab.
Ich saß nun schon seit halb acht im Büro – so wie jeden Tag, seit ich mit sechzehn von der Highschool abgegangen war. Ich hatte die Schule verlassen, weil ich sämtliche Tricks und Kniffe gelernt hatte, die meine Lehrer im Repertoire hatten, und weder die Zeit hatte noch das Bedürfnis verspürte, eine Universität zu besuchen, bevor mich mein Geburtsrecht mit Haut und Haar verschlang.
Belle Elle war meine Universität, auf die ich schon mein ganzes Leben ging, Tag und Nacht und auch an den Wochenenden. Soweit es mein Wissen und meine Fähigkeiten betraf, war ich durchaus in der Lage, die Firma zu leiten, noch bevor ich zwanzig wurde.
Dafür hatte mein Vater gesorgt.
Ich war kein kleines Mädchen mehr, das sich nach dem ungebundenen Leben der Gleichaltrigen verzehrte. Sondern eine schicksalsergebene junge Frau, auf deren Schultern die Verantwortung für den Lebensunterhalt Tausender Mitarbeiter ruhte. Es lag an mir, dafür zu sorgen, dass Belle Elle wie geschmiert lief und genug Gewinn abwarf, um die Lohntüten zu füllen, sodass kein Mitarbeiter arbeitslos wurde.
Meine harte Arbeit und die Überstunden wurden mir mit ordentlichen Gewinnen und der erstaunlichen Expansion unserer Firma vergolten. Ich zog meine Befriedigung aus günstigen neuen Verträgen und niedrigeren Produktionskosten. Partys und Affären blieben mir fremd, weil ich morgens zu früh mit der Arbeit begann, um abends lange auszugehen.
Ich lebte nur noch für Waren und Bilanzen.
Und es ging mir gut dabei.
Ein anderes Leben kannte ich nicht. Ich hatte kein Recht, mich zu fühlen wie ein Tier in der Falle. Ich hatte einen fantastischen Vater, eine rosige Zukunft und auch sonst alles, was man sich nur wünschen konnte. Mir war so viel gegeben worden. Doch der Preis für diese Macht und Herrlichkeit war das Fehlen zahlreicher Dinge, die ich nie genossen hatte.
Ich hatte keine Freunde, denn wer wollte schon mit einer Streberin abhängen, die keine Ahnung hatte, wie man sich amüsierte? Ich ging niemals allein in die Stadt, weil es in der Welt viel zu gefährlich zuging. Ich war nie in irgendeinen Schlamassel geraten oder hatte über die Stränge geschlagen. Ich war ständig von Leibwächtern, Fahrern und Managern umzingelt.
Die Mädchen, mit denen ich zur Schule gegangen war, taten nur so, als würden sie mich mögen, weil ich ihnen Prozente auf Klamotten und Schuhe gewährte. In der Woche vor dem Abschlussball war ich sogar zum beliebtesten Mädchen der Schule avanciert und hatte die Mädchen in den Umkleidekabinen von Belle Elle tuscheln hören … wie viel sie sparten, welchen Rabatt ich ihnen gab, wenn sie mir nur, was unsere angebliche Freundschaft betraf, dreist genug ins Gesicht logen.
Und die Jungs hatten Angst vor mir, weil ich mich so erwachsen ausdrückte und in Mathe lieber Echtzeittabellen knackte, als mich mit den Gleichungen an der Tafel abzugeben.
Ich war nie allein, aber ständig einsam.
Wäre Salbei nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich längst das Weite gesucht. Aber ich konnte sie nicht im Stich lassen, und meinen Vater konnte ich schon gar nicht im Stich lassen.
Sie brauchten mich.
Alle brauchten mich.
Kaum dachte ich an das kleine Fellknäuel, da tauchte es auch schon auf. Die schlanke, hübsche Katze sprang auf meinen Schreibtisch, stieß dabei den alten Tic-Tac-Behälter mit den Büroklammern um und schlug auch noch danach.
Sofort fiel die Anspannung von mir ab, und die Rückenschmerzen, die mich plagten, weil ich mich zu lange über die Arbeit gebeugt hatte, ließen nach. »Dir auch einen guten Abend«, sagte ich.
Die Katze miaute und verzog ihr niedliches graues Gesicht, als missbilligte sie, dass ich wieder einmal bis spät in die Nacht gearbeitet hatte.
Sie wich mir, seit Dad sie mir geschenkt hatte, nicht von der Seite. Nur zur Schule hatte sie mich nicht begleitet, aber da es damit seit ein paar Jahren vorbei war, glich sie nun einem stummen, silbernen Schatten, der mir überallhin folgte. Sie legte sich wie ein lebendiger Schal um meinen Hals oder trottete mir hinterher zu Meetings mit Männern, die dreimal so alt waren wie ich und zu Beginn meiner Herrschaft versucht hatten, mich über den Tisch zu ziehen und lächerlich zu machen. Doch sie hatten bald gelernt, dass ich zwar jung war, die Firma aber besser kannte als irgendeiner von ihnen.
Belle Elle war mir Mutter, engste Freundin und Freund zugleich.
Die Firma war meine Welt.
Ich nahm die schwarz eingefasste Lesebrille ab, die zu tragen ich mir angewöhnt hatte, wenn ich stundenlang auf einen Laptop starrte, fasste Salbei um die Mitte und hob sie auf meinen Schoß.
Sie schnurrte vernehmlich und stieß den Kopf gegen meine Brust. Ich küsste ihren Nacken und vergrub die Nase in ihrem Fell, das weich war wie aus Mondlicht gesponnene Fäden; einzig ihr Schnurren vermochte es, mich die ständige Sorge und Mutlosigkeit vergessen zu lassen.
»Du weißt, wie es mir geht, nicht?«
Das Schnurren wurde lauter.
»Bin ich ein schlechter Mensch, weil ich mich so in die Enge getrieben fühle?«
Sie verzog das Gesicht.
»Ich tue alles, was von mir erwartet wird. Ich übernehme widerstandslos immer mehr Bereiche der Firma. Ich liebe meinen Vater mit jeder Faser meines Herzens. Es ist mein Lebenssinn, ihn stolz zu machen. Ich verfüge über Selbstwertgefühl, Reichtum und die Gewissheit, niemals um etwas bitten zu müssen.« Ich drückte mein Gesicht tiefer in ihr Fell und kämpfte gegen das ungebetene Selbstmitleid an. »Weshalb fühle ich mich dann so verloren, Salbei? Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass es noch so viel mehr außer der Arbeit geben müsste?«
Sie miaute, sprang von meinem Arm auf den Schreibtisch, lief über die Tastatur und produzierte lauter Buchstaben in Tabellenfeldern, in die nur Zahlen hineingehörten. Ich versuchte, Wut zu empfinden und mit ihr zu schimpfen, weil sie mir gerade zehn Minuten zusätzlicher Arbeit aufgehalst hatte, um den Unsinn zu löschen und mich zu vergewissern, dass die eben eingegebenen Zahlen noch stimmten.
Aber ich konnte es nicht.
Weil die Arbeit mein Leben war und mein Leben die Arbeit. Ich musste ja sowieso nirgendwohin, niemand wartete auf mich – nichts und niemand verlangte irgendetwas von mir, außer Belle Elle.
»Vielleicht ist das ja mein eigentliches Problem?«
Salbei zuckte mit dem Schwanz.
»Vielleicht sollte ich die Arbeit zur Abwechslung mal vergessen und etwas vollkommen anderes machen.« Ich stand auf und blickte durch die vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster auf New York hinunter. Lichterglanz, Autos, Fußgänger, die wie Käfer in Lichtkegel traten und wieder im Dunkel verschwanden, manche klein, andere groß, doch alle auf dem Weg zu einem Ziel.
Wie es wohl wäre, mich unter sie zu mischen? Jeans zu tragen (seufz) und an einem Imbissstand zu essen (oh nein)? Auf mich allein gestellt, statt von meinem Fahrer und Leibwächter abhängig zu sein?
Steht es mir nicht zu, herausfinden, was das Leben sonst noch zu bieten hat, bevor ich alles andere aufgebe?
Schließlich war heute mein neunzehnter Geburtstag.
Nun war ich alt genug für Sex, nicht aber für Alkoholgenuss.
Alt genug, um ein milliardenschweres Unternehmen zu leiten, aber nicht alt genug, um allein in einer Stadt herumzustromern, die mir tausend Abenteuer versprach.
Meine Finger flogen zu meinem Hals und griffen nach der wunderschönen Kette mit dem Saphir, die mein Vater mir heute früh geschenkt hatte. Wir hatten beide unter Zeitdruck gestanden, trotzdem hatte er die Köchin fortgeschickt, und wir hatten gemeinsam Buttermilchteig angerührt und Blaubeerpfannkuchen improvisiert, bevor er mir sein Geschenk überreichte.
Es war ein wunderbarer Morgen gewesen, und ich schätzte seine Gesellschaft, die Pfannkuchen und die Halskette sehr, trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass etwas fehlte.
Meine Mutter fehlte. Natürlich.
Aber auch noch etwas anderes.
Jemand anderes … ein zweibeiniger Freund statt einer vierbeinigen Freundin.
Nach einer trauten Stunde waren mein Vater und ich zur Arbeit gefahren und hatten uns in den Ansprüchen unserer Herrin und Meisterin verloren.
Ich wusste nicht, ob auch mein Vater zu so später Stunde noch im Büro war. Ebenso wenig wusste ich, ob er es mitbekommen würde, wenn ich mich davonstahl, um für diese eine Nacht einmal ein Mädchen aus einer anderen Welt zu sein.
Moment mal. Was?
Die Idee war wie aus dem Nichts über mich gekommen. Es war eine furchtbare Erkenntnis, dass ich zu dem Verrat bereit war, mich hinter dem Rücken meines Vaters hinauszuschleichen. Und doch war die Vorstellung … auf verlockende Weise erregend.
Du könntest es versuchen … wenigstens einen Abend lang.
Und was genau?
Der fünfzackige Saphirstern stach mir in die Finger, während ich in die übervölkerte Straßenschlucht hinabblickte.
Eine unter vielen sein.
Tun, was alle tun.
Gehen, wohin alle gehen.
Frei sein.
Mein Herz schlug gegen meine Rippen, und die Idee nahm langsam Gestalt an.
Der morgige Tag würde ganz und gar Belle Elle gehören. Und heute Nacht? Heute Nacht war mein neunzehnter Geburtstag, und ich hatte mir selbst noch kein Geschenk gemacht.
War es denn möglich?
Brachte ich wirklich den Mut auf, meine Welt und alles, was ich kannte, hinter mir zu lassen, um von etwas zu kosten, das ich niemals besitzen konnte?
Konnte ich etwas suchen, wovon ich nicht wusste, wo es zu finden war?
Salbei schlängelte sich um meine Knöchel, ihr Kopf stieß mich beifällig an. Zumindest kam es mir so vor, weil ich mir plötzlich nicht vorstellen konnte, es nicht wenigstens zu versuchen.
Die Gefängnistore, hinter denen ich mein bisheriges Leben verbracht hatte, knarrten rostig und quietschten missbilligend, als sie sich langsam auftaten. Mir blieben noch ein paar kurze Stunden, bis die Uhr Mitternacht schlug und der Zauber meines Geburtstags verflog.
Jetzt oder nie.
Heute Nacht würde ich diesem Drang nachgeben und zum ersten Mal Freiheit erfahren.
Und morgen würde ich meine kindische Reue vergessen und mir bereitwillig die Krone der Kaiserin von Belle Elle aufsetzen lassen.
3. KAPITEL
Mein erstes Ziel war die Verkaufsebene von Belle Elle.
Da dieser Standort unser Flaggschiff war, nahm der Verkauf mehrere Stockwerke des Wolkenkratzers ein. Wir boten alles von erstklassigen technischen Geräten bis zu Spielzeug für Kleinkinder an sowie alles Erdenkliche dazwischen, und ich kannte hier jeden Winkel. Schließlich hatte ich einen Großteil meines Lebens mit der Dekoration der Schaufenster und Fragen rund um das Warenangebot zugebracht.
Aber nicht heute Nacht.
Heute war ich nicht geschäftlich hier.
Ich nahm den Aufzug nach unten, benutzte meine Schlüsselkarte und gab den Zugangscode ein, um keinen Alarm auszulösen. Das Geschäft hatte seine Pforten vor einer Stunde geschlossen, sodass mich nur die stille Welt von Baumwoll- und Seidenstoffen willkommen hieß.
Ich huschte auf roten High Heels an Hosenanzügen und Haute Couture vorbei auf kürzestem Weg zur Teenager-Abteilung. Seit ich Dads Testament unterschrieben hatte – eigentlich sogar schon davor – kleidete ich mich wie eine Erwachsene. T-Shirts oder Jeans hatte ich nie besessen. Nie hatte ich ein Kleidungsstück mit einem populären oder obszönen Aufdruck getragen wie die anderen Jugendlichen auf meiner Schule. Und nie hatte irgendwas weniger als vierhundert Dollar gekostet.
Aber das würde sich jetzt ändern.
Ich wühlte mich durch strassbesetzte Jeans und schulterfreie Oberteile, die nebeneinander an Stangen hingen, ertappte mich jedoch dabei, aus dem Augenwinkel die Auslagen und die Stellung der Schaufensterpuppen kritisch zu mustern, statt mir ernsthaft ein Outfit auszusuchen.
Schluss damit!
Du bist jetzt Kundin, nicht die Chefin.
Ich zwang mich dazu, durchzuatmen und die Schultern zu lockern, und trat an den Tisch mit den preisreduzierten Jeans. Griff nach der säuberlich gefalteten Hose oben auf dem Stapel und schüttelte sie aus. Sie war himmelblau, eng geschnitten und hatte silbern bestickte Taschen. Ich gab mir Mühe, nicht an die Stückkosten der in Taiwan gefertigten Hosen zu denken. Wie ich den Kauf Anfang letzten Jahres angeordnet hatte, um sie in dieser Saison anbieten zu können. Dass wir auch im Ausverkauf noch daran verdienen würden, weil das in der Natur der Sache lag. Den Preis hoch ansetzen und dann allmählich nachlassen, bis die Lager geräumt waren und unsere Gewinne geringer wurden, aber nie ganz verebbten.
Argh, Schluss jetzt!
Du bist heute Nacht keine Erbin. Nur Elle. Eine Neunzehnjährige, die alle Regeln brechen und ausreißen will.
Was würde David, mein Fahrer, sagen, wenn ich ihn nicht in ein paar Stunden anrief, damit er mich nach Hause fuhr? Und was Dad, wenn ich es heute Nacht krachen ließ und erst bei Tagesanbruch heimkommen würde?
Spielt das eine Rolle?
Du musst es nur für dich tun.
Du bist jetzt erwachsen.
An diese Gedanken klammerte ich mich, stibitzte die Jeans, dazu ein schwarzes und cremefarbenes schulterfreies Top von der Stange daneben, schnappte mir noch einen schwarzen Seidenschal von dem Podest mit den Neuzugängen und wechselte in die Schuhabteilung.
Wenn ich bis Mitternacht in New York herumlaufen wollte, benötigte ich bequemes Schuhwerk.
Die blutroten Hochhackigen hatten ausgedient.
Als mir ein Regal mir kürzlich bestellten Turnschuhen ins Auge fiel, entschied ich mich für ein weißes Paar mit rosa und goldenen Streifen – an die für mich als Galionsfigur eines milliardenschweren Unternehmens unter normalen Umständen niemals zu denken gewesen wäre.
Ich trug, solange ich zurückdenken konnte, Schuhe mit Absätzen. Nur mit dem Unterschied, dass die Absätze, als ich klein war, noch etwas flacher gewesen waren, während ich heute himmelhohe Stilettos trug.
Als ich meine neue Garderobe in eine Umkleidekabine trug, ertappte ich mich erneut dabei, die Riegel an den Türen und die leichten Unregelmäßigkeiten des Spiegels aus minderwertigem Glas zu begutachten. Das Einkaufserlebnis bei uns durfte durch nichts geschmälert werden.
Ich notierte mir im Geiste, die Spiegel bei der nächsten Umgestaltung dieser Abteilung komplett ersetzen zu lassen.
Ich schlüpfte aus meinem Bleistiftrock, zog die schwarze Bluse aus, rollte die Strümpfe hinunter und betrachtete stirnrunzelnd meine nur noch mit Unterwäsche bekleidete Gestalt. Die schwarzen B-Körbchen hoben meinen Busen beträchtlich – aber würden die Träger nicht nuttig wirken, wenn sie unter dem Oberteil hervorlugten?
Ich hatte keine Erfahrung mit derartiger Kleidung, obwohl ich schon an zahllosen Laufstegen gesessen und eigenhändig die neueste Mode ausgewählt hatte.
Nun stell dich nicht so an!
Ich arbeitete mich in die enge Jeans, zog das Oberteil über den Kopf und drapierte den Seidenschal um meinen Hals. Achtete darauf, dass er locker hing und den an meinem Hals funkelnden blauen Stern nicht verbarg.
Bah, nein.
Ich riss den Schal wieder ab und hängte ihn über die Tür.
Den brauchte ich nicht.
Ich berührte den Saphirstern. Es würde meinen Vater umbringen, wenn er erfuhr, wie unglücklich ich war, obwohl er mir alles gegeben hatte. Wie sollte ich ihm die Leere in meinem Innern erklären, wo ich doch, von außen betrachtet, mit allem gesegnet war, was man sich nur erträumen konnte? Und wie konnte ich zugeben, dass ich gehört hatte, wie er sich neulich mit Steve über mein Liebesleben unterhalten hatte? Wie er sich gefragt hatte, ob es nun an der Zeit war, mich den begehrtesten Junggesellen von New York vorzustellen, um mir eine willige rechte Hand bei der Leitung von Belle Elle auszusuchen?
Erschauernd tauschte ich die High Heels gegen weiße Turnschuhe ein. Der Gedanke, mein Leben einem Unternehmen zu widmen, das es schon immer gegeben hatte, war eine Sache; die Vorstellung jedoch, mein Leben mit einem Mann zu teilen, der mich niemals verstehen würde, stieß mich zutiefst ab.
Da hörte ich ein Miauen, gefolgt von einem Silberstreif, als Salbei unter der Tür der Umkleidekabine hindurchhuschte.
Ich musterte sie finster. »Was machst du denn hier?«
Es war wohl ein Fehler gewesen, ihr beizubringen, gegen die Tasten neben dem Aufzug zu springen. In ihrer Gabe, mich überall im Gebäude aufzuspüren, glich sie Houdini, ob ich sie nun im Büro zurückließ oder in eine Besprechung mitnahm.
»Du weißt doch, dass du im Verkauf nichts zu suchen hast.«
Sie zuckte mit dem Schwanz und sprang auf den Hocker, wo ich meinen Rock abgelegt hatte. Wieder miaute sie, dann leckte sie sich die Pfote.
»Und dass du heute Nacht nicht mitkommen kannst, weißt du genauso gut.«
Ihr Kopf fuhr hoch, als hätte ich einen entsetzlichen Fluch ausgesprochen.
Sie spreizte die Krallen, leckte die Zwischenräume und forderte mich augenscheinlich heraus, diese Blasphemie zu wiederholen.
Ich ignorierte ihre demonstrative Katzenverärgerung und schob sie von meiner Teenager-Uniform runter. »Du hast mich schon verstanden, Salbei. Tu also nicht so.« Ich hob mein Kleiderbündel auf, warf noch einen Blick in den Spiegel und fand mich ausreichend jugendlich. Wie die Chefin von Belle Elle sah ich jedenfalls nicht mehr aus.
»Gut«, nickte ich und schüttelte meine blonde Mähne, die mir über den Rücken bis auf die Taille fiel. Dad nörgelte dauernd, ich solle mir die Haare abschneiden lassen, doch die blieben mein einziger rebellischer Akt. Die Länge war nicht praktisch, und meistens ließ ich meine Mähne an der Luft zu wirren Locken trocknen. Der einzige Teil der sonst so regelkonformen CEO, der sich seine Wildheit bewahrt hatte.
Ich lief in den Verkauf zurück, langte unter eine der Kassen, griff mir eine Einkaufstüte und stopfte meine teuren Klamotten hinein. Dann legte ich die glänzende Tüte sorgfältig zusammen und schob sie unter die Kasse zu den Aktenmappen mit den täglichen Ausgaben und Checklisten.
Zwei Dinge noch, dann wäre ich so weit.
Ich brauche eine Jacke, schließlich könnte es kalt werden. Und Bargeld.
Ich hatte meine Handtasche oben im Büro liegen gelassen. Sie mitzunehmen hätte jedoch auch nichts geändert.
Ich hatte kein Bargeld. Wenn ich etwas brauchte, besorgte meine Assistentin es für mich. Ich besaß nur eine Kreditkarte für den Notfall (die ich allerdings niemals benutzte) und meinen Ausweis für die öffentlich nicht zugänglichen Bereiche des Gebäudes.
Salbei war mir aus der Umkleidekabine gefolgt und streifte nun durch die Gänge. Sie lenkte meine Aufmerksamkeit auf einen kleinen Tisch mit flippigen Geldbörsen. Da ich bereits Jeans, Oberteil und Schuhe gestohlen hatte, kam es auf eine Geldbörse vermutlich auch nicht mehr an.
Und verdammt, wo ich schon mal dabei war, konnte ich mir auch noch Taschengeld nehmen. Heute Nacht würde voraussichtlich niemand etwas für mich kaufen.
Ich öffnete die Registrierkasse mit meinem Universalschlüssel und betrachtete mein Startkapital. Es gab keine großen Scheine, nur das nötige Kleingeld für das anstehende Tagesgeschäft. Die Tageseinnahmen wurden immer sofort gezählt, gebündelt und bis zum Transport zur Bank in unserem Tresor aufbewahrt.
Egal.
Dreihundert Dollar in Zwanzigern würden genügen.
Ich nahm das Geldbündel und kritzelte auf ein Post-it: Noelle Charlston hat 300 Dollar aus der Kasse entnommen. Lassen Sie sich die Summe für das Vormittagsgeschäft bitte von ihrer Assistentin erstatten: Fleur Hemmings, Durchwahl -4456.
Ich legte die Notiz in das Fach, dem ich die Scheine entnommen hatte (damit niemand statt meiner wegen des Fehlbetrags belangt wurde), schloss die Kasse und ging zu dem Tisch mit den Geldbörsen. Ich entschied mich für einen Graffiti-Totenkopf auf schwarzem Hintergrund und steckte das Geld in die Börse. Einsamkeit und Verlorenheit ließen allmählich nach und wichen beklommener Erregung.
Ich zeigte Salbei die Totenkopfbörse. »Siehst du? Wenn ich will, kann ich auch rebellisch sein.«
Sie leckte sich mit bebenden Schnurrhaaren übers Maul.
Ich trat um sie herum und lief schnurstracks zum letzten Posten auf meiner Liste.
Ich hatte noch nie etwas anderes als Tausend-Dollar-Kaschmirmäntel getragen. Heute Nacht jedoch würde ich …
Ich schnalzte mit den Fingern und dachte über die Wahl meiner Jacke nach.
Heute muss es eine Bomberjacke aus schwarzem Kunstleder sein, von der Stange, für neunzehn Dollar neunundneunzig.
Ich nahm die Jacke und befühlte das billige Material. So eine hatte ich immer schon haben wollen. Als ich sie anzog, überrollten mich mehrere widerstreitende Gefühle zugleich: zum einen ein tiefer Schreck und der Impuls, alles auf der Stelle wieder dorthin zu bringen, wo es hingehörte, und zugleich der ungeduldige Drang, endlich mit der Erkundung von Big Apple zu beginnen.
Ich hatte Angst.
Ich war gespannt.
Ich hatte es so satt, ständig umsorgt zu werden und nur eines wirklich gut zu können.
Höchste Zeit, daran etwas zu ändern.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.« Ich schob die Geldbörse in die Innentasche der Bomberjacke, hob Salbei auf und rieb meine Nase an ihrer. »Ich liebe dich, aber du kannst nicht mitkommen.«
Sie verzog ihre kleine Schnute.
»Guck mich nicht so an. Ich bleibe nicht lange weg.«
Sie miaute traurig.
Es zerriss mir das Herz, doch ich wappnete mich gegen ihre Vorwürfe und ging zu den Aufzügen. In den Turnschuhen konnte ich viel besser laufen als auf hohen Absätzen. Kein Wunder, dass die Leute sie modischen Schuhen vorzogen.
»Tut mir leid, Salbei, aber es ist nur für heute Nacht.« Mit einer Hand hielt ich sie fest und rief mit der anderen zwei Aufzugkabinen.
Eine nach oben, eine nach unten.
Der Lift nach oben kam zuerst, also ließ ich Salbei hineinplumpsen. Ich schenkte ihr noch ein Lächeln, dann drückte ich die oberste Büroetage. »Lauf zurück und mach es dir in deinem Körbchen gemütlich. Dann wirst du gar nicht merken, dass ich fort war.«
Als die Türen sich langsam schlossen, miaute sie noch einmal.
Ich flüsterte: »Schau mich nicht so an. Das tut zu weh.«
Als sie verschwunden war, schlang ich die Arme um meinen Leib und fühlte mich verlassen und von Entsetzen erfüllt.
Warum tue ich das bloß?
Besser, ich vergaß das Ganze und fuhr nach Hause.
Doch dann ertönte die Glocke des Fahrstuhls nach unten, der darauf wartete, dass ich mir ein Herz fasste und es auf eine Nacht jenseits von Belle Elle ankommen ließ.
Zögernd, ängstlich betrat ich die Kabine und wappnete mich mit der Bereitschaft, jemand anders zu werden.
Und frei zu sein.
4. KAPITEL
Alles schien sich verändert zu haben.
Weil sich alles verändert hat.
Die Luft schmeckte kräftiger. Der Verkehr brauste lauter. Es schien kälter geworden zu sein. Selbst das billige Vinyl um die Schultern und die bequemen Turnschuhe an den Füßen fühlten sich anders an.
Nach neunzehn Jahren machte ich zum ersten Mal mit der Welt Bekanntschaft, ohne dass mich Glanz und Pomp und strenge Regeln vom Leben abschirmten.
Ich atmete tief ein und musste husten, als ein Taxi seine Abgase herauskotzte. Das Brennen im Hals hatte so wenig mit der gefilterten Luft im Inneren des Belle-Elle-Gebäudes zu tun, dass ich nicht angewidert das Gesicht verzog, sondern begeistert grinste.
Das Geld in meiner Börse knisterte und wollte ausgegeben werden, der Ausweis steckte in meiner Tasche, um mich daran zu erinnern, wer ich war und wie verantwortungslos ich mich benahm.
Ich hatte kein Handy dabei; Dad konnte mich nicht erreichen. So konnte ich niemanden kontaktieren oder Hilfe rufen, falls ich mich verirrte oder in Schwierigkeiten geriet.
Doch ich war bereit, das Risiko einzugehen, um mal aus den vorgegebenen Bahnen auszubrechen und ein wenig zu leben.
Zu behaupten, ich hätte mich nicht erfrischt gefühlt, wäre gelogen gewesen, andererseits war ich jedoch bis ins Mark erschrocken.
Die ersten Schritte, mit denen ich mich von Belle Elle entfernte, verursachten mir körperliche Schmerzen. Der Verrat an meinem Vater schmerzte so sehr, dass ich mich wie ausgehöhlt fühlte; nicht einmal die Erregung, etwas Neues zu unternehmen, konnte die Leere füllen.
Ein paarmal wollte ich es mir anders überlegen und wieder umkehren. Dann blieb ich stehen, drehte mich und betrachtete das hoch aufragende Gebäude, von dem aus unser Riesengeschäft geleitet wurde.
Dann rief ich mir ins Gedächtnis, dass ich nie erfahren würde, wie es war, ein normaler Mensch zu sein, wenn ich jetzt aufgab und umkehrte. Also verdrängte ich die Angst, drehte mich wieder um und setzte einen Fuß vor den anderen. Näherte mich langsam dem Reich von Downtown New York.
Fremde rempelten mich an, Touristen baten mich, sie zu fotografieren, Straßenhändler schrien mir ihr Angebot ins Gesicht.
Allmählich löste das Übermaß neuer Eindrücke meine Scham darüber, mich einfach davongeschlichen zu haben, auf und zwang mich, auf jede Kleinigkeit achtzugeben.
Ich lief stundenlang herum.
Schaute.
Atmete.
Zur Abwechslung ließ ich mich mal vom Leben treiben. Ich wusste nicht, wohin ich ging oder wie ich wieder zurückkommen sollte, trotzdem ließ ich mich von meinen Füßen in die Irre tragen, weil ich mir ja jederzeit ein Taxi nach Hause nehmen konnte. Schließlich kannte ich meine Adresse – so wohlbehütet war ich auch wieder nicht. Ich konnte mir jedes beliebige Ziel leisten und am Ende meines Abenteuers einfach in ein Taxi springen und in eine neue, vertiefte Existenz heimkehren. Mit einem Geheimnis, das ich glücklich für immer hüten würde.
Irgendwann musste ich mich tatsächlich verirrt haben und im Kreis gelaufen sein, und als ich wieder am Times Square ankam, wandte ich mich diesmal nach rechts statt nach links und ließ mir weiter von der Stadt zeigen, was ich bisher verpasst hatte.
Blitzende Reklametafeln wollten mir einreden, dass ich den neuesten Jeep oder Hummer brauchte.
Hollywood-Stars und -Sternchen zeigten mir als LED-Erscheinungen Ausschnitte ihrer neuen Filme. Madame Tussauds versprach auf ewig in Wachs gebannte Wunder, und Ripley’s Believe It or Not! lockte mit allem, was der Alltag nicht zu bieten hatte.
Im Schaufenster eines Andenkenladens verrieten mir die Armbanduhren an winzigen Freiheitsstatuen, dass ich schon seit einiger Zeit unterwegs war.
Schon zweiundzwanzig Uhr.
Um diese Zeit wäre ich sonst längst zu Hause, hätte auf dem Laufband trainiert und geduscht. Ich würde noch ein paar dringende Mails beantworten und dann ins Bett kriechen, um noch ein paar Seiten in einem neuen Liebesroman zu lesen, bis mir die Augen zufielen und der E-Reader in meinem Gesicht landete.
Aber nicht heute.
Heute lächelten oder schrien mich Fremde an – je nachdem, ob sie etwas von mir wollten oder ob ich ihnen in die Quere kam. Unfähig, mich dem Rhythmus der bunt gemischten Menschenmenge anzupassen, der ich mich angeschlossen hatte, ging ich entweder zu schnell oder zu langsam. In meiner Plastikjacke wurde mir heiß, und mir wurde klaustrophobisch zumute, weil ich mit all den schwitzenden Menschen hier zwischen den Häuserzeilen eingepfercht war. Meine Füße schmerzten, und ich hatte Hunger.
Trotzdem lenkte mich nichts von all diesen befreienden, Ehrfurcht gebietenden neuen Eindrücken ab.
Als ich um die nächste Ecke bog, entdeckte ich einen Imbisswagen, der das beste mexikanische Essen diesseits der Grenze versprach. Stand auf meiner Liste nicht auch, an einem Straßenverkauf etwas zu essen zu kaufen?
Dir wird bestimmt schlecht.
Ja, schon möglich. Eine Lebensmittelvergiftung wäre jedoch ein weiteres Abenteuer, das mir bisher verwehrt geblieben war. Ich zog die Geldbörse aus der Tasche und stellte mich hinten an. Als ich an der Reihe war, reckte ich den Hals, um den Typen in seiner fettfleckigen Schürze anzuschauen, der mich anzüglich musterte.
»Was darf’s denn sein?« Er kaute Kaugummi und drehte ungeduldig einen Bleistift zwischen den Fingern.
Ich kniff die Augen zusammen und studierte das Angebot auf der Tafel hinter ihm. »Äh, was können Sie denn empfehlen?«
»Empfehlen?«, wiederholte er spöttisch. »Sehe ich aus, als hätte ich Zeit, lange mit dir zu palavern, Süße?« Dabei deutete er mit dem Bleistift auf die Schlange hinter mir. »Nun mach schon hin! Da warten noch andere zahlende Kunden.«
Ich zog einen Zwanziger aus meiner Geldbörse. »Ich möchte irgendwas mit Hühnchen.« Ich gab ihm das Geld. »Oh, und nicht zu scharf. Scharf mag ich nicht.«
»Alles klar.« Er schnaubte. »Hühnchen ohne Geschmack. Langweiliges Mädchen, langweilige Bestellung.«
Ich verspannte mich. »Wie bitte?«
Er musterte mich von oben bis unten. »Zisch ab, Prinzessin! Dein Essen ist in fünf Minuten fertig. Kannst du dir an der Ausgabe da drüben abholen.« Damit warf er mir einen schmutzigen Zehner hin. »Dein Wechselgeld.«
Ich schloss die Finger um den Schein. Ärger und Kränkung brannten wie Säure in mir. So hatte noch nie jemand mit mir gesprochen. So etwas traute sich niemand.
Dass er mich langweilig genannt hatte und ich ihm vollkommen beipflichtete, machte mich sogar noch wütender. Ich knüllte das Geld zusammen und warf es ihm an den Kopf. »Wissen Sie was? Legen Sie noch einen mit Fleisch oder so dazu. Extrascharf!«
Bevor er mich weiter beleidigen konnte, ging ich schnell zum Ausgabefenster.
5. KAPITEL
Das Fleisch war eine blöde Idee gewesen.
Nachdem ich mein Abendessen entgegengenommen hatte, schlenderte ich zum Times Square, wo ein paar Tische und Stühle für Spaziergänger aufgestellt worden waren. Der Tisch war schmierig, der Stuhl wackelig, trotzdem war ich noch nie so über eine Mahlzeit hergefallen.
Als ich den in Alufolie gewickelten Burrito auspackte, stieg mir köstlicher Dampf in die Nase. Entschlossen, den schmierigen Kerl eines Besseren zu belehren, biss ich herzhaft ins Fleisch, kaute und grinste.
Gar nicht mal so übel.
Dann kam die Schärfe.
Meine Zunge schrumpfte.
Das mexikanische Essen traf mich wie ein Tritt in den Bauch. Die Schärfe nahm rapide zu, mir verging das Grinsen, ich schnappte nach Luft und verbrannte in Höllenqualen.
Wasser!
Oh mein Gott, ich brauche Wasser!
Mir liefen Tränen über die Wangen. Ich schnappte meine beiden Burritos, sprang vom Tisch auf und rannte zu einem Kiosk hinüber, dessen blinkende Reklame eiskaltes Wasser und Cola versprach.
Ich flitzte hinein, riss die Glastür des Kühlschranks auf, griff mir eine Flasche Wasser, schraubte den Verschluss ab und stürzte das Wasser in drei Sekunden hinunter. Doch das Feuer verbrannte mir noch immer Lippen und Zunge.
Japsend griff ich nach einer Schokomilch.
Ich kämpfte mit dem Deckel, schaffte es endlich und nahm ein paar gierige Schlucke. Die vollfette Milch dämmte die Feuersbrunst ein wenig ein. Ich stieß ein erleichtertes Seufzen aus.
»Du hast hoffentlich vor, das zu bezahlen.« Eine Verkäuferin mit pinkfarbenen Haaren sah mich mit hochgezogenen Brauen an.
Ich fuhr mir mit dem Handrücken über die Lippen (was ich im richtigen Leben natürlich nie tun würde), nickte und nahm mir noch eine Flasche Wasser, wobei ich es irgendwie schaffte, meine fast unberührten Burritos nicht fallen zu lassen. »Ja, klar, sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass die so scharf sein würden.«
Sie grinste. »Ach du Scheiße, hast du etwa Pete geärgert?«
»Pete?« Ich stellte die beiden Wasserflaschen auf das Fließband, eine leer, eine voll, und dazu die halb geleerte Schokomilch.
Die Verkäuferin zog alles über den Scanner. »Ja, der Typ, dem der mexikanische Imbiss gehört.« Sie kicherte. »Er macht klasse Tacos, aber seine scharfe Soße ist die Hölle.«
Ich fuhr mir mit der Zunge über die immer noch brennenden Lippen. »Das habe ich mir wahrscheinlich selbst zuzuschreiben.« Lächelnd zuckte ich mit den Schultern. »Ich gehe nicht so häufig aus. Deshalb war mir nicht klar, dass man sich mit Imbissbesitzern besser nicht anlegt.«
Sie packte meine Sachen in eine Tüte. »Tja, das weiß eigentlich jeder. Am wenigsten allerdings sollte man sich mit den Street Kings anlegen.«
Ich zog einen Zwanziger aus meiner Börse. Sie nahm ihn, öffnete die Registrierkasse und gab mir das Wechselgeld. Dass sie ohne Anspannung oder Vorbehalt mit mir sprach, machte mich lockerer.
Ich sprach sonst nur mit Frauen, die bei mir angestellt waren. Niemand machte in meiner Gegenwart Witze oder sagte mir, was ich tun sollte, aus Angst, ich könnte sie feuern. Und wer meine Freundschaft suchte, tat es nur wegen einer Beförderung oder Gehaltserhöhung.
Aber ich roch Heuchelei wie einen verfaulten Apfel.
Nach einem weiteren Lächeln setzte die Befangenheit ein. Ich wusste nicht, wie man einen freundlichen Wortwechsel beendete oder wann man passenderweise ging, nachdem man etwas gekauft hatte.
Aber das Mädchen bewahrte mich davor, wie eine Idiotin dazustehen. »Tja, dann gute Nacht. Und leg dich mit niemandem mehr an, hörst du?«
Ich nickte. »Alles klar. Danke für deine Hilfe.«
»Kein Ding.« Sie winkte mir andeutungsweise zu und verschwand dann, um ein Regal mit Chipstüten zu füllen.
Ich überzeugte mich, dass ich noch beide Burritos und meine kostbaren Löschmittel hatte, um Petes Feuer speiende Rache heil zu überstehen, verließ den Laden und betrat die durchgeknallte Welt der Konsumenten und Touristen.
Ich schlingerte durch die Menge, um mich wieder hinzusetzen und den harmloseren Hühnchen-Burrito zu probieren, fand meinen Tisch jedoch von einer Familie mit drei kleinen Kindern okkupiert, die mit glasigen, müden Augen in die grell leuchtenden Neonlichter blinzelten.
Auch alle übrigen Tische waren besetzt.
Na prima.