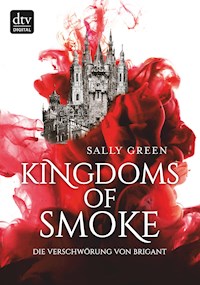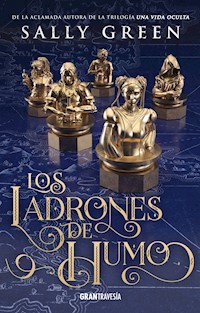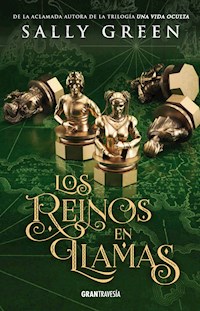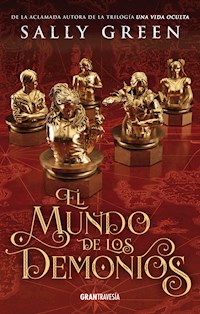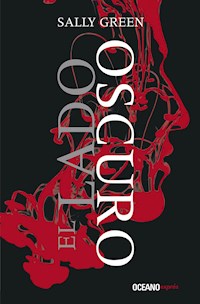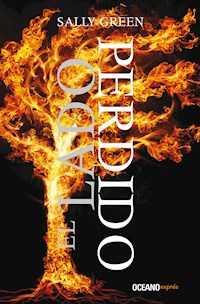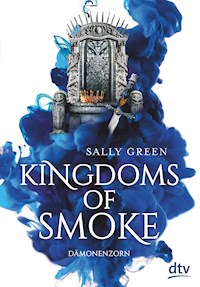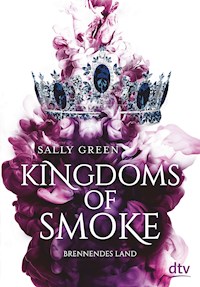
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Kingdoms-of-Smoke-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Abschluss der epischen Fantasy-Trilogie Catherine muss als neue Königin von Pitoria das Land gegen die durch Dämonenrauch scheinbar unbesiegbare Armee ihres Vaters verteidigen – und die Frage beantworten, wem sie ihr Herz und ihre Zukunft schenkt: Ambrose, dem bei seiner Mission auf das Nördliche Plateau sein Überleben gleichgültiger ist denn je, oder Tzsayn, der sie besser versteht als jeder andere? Catherines Cousin Edyon findet sich in Calidor allein in einem Netz aus Intrigen und Ränkespielen wieder, nachdem March für seinen Verrat verbannt wurde. Und Tash verfügt plötzlich über Fähigkeiten, die bisher den Dämonen vorbehalten waren. Doch die Macht, die der Dämonenrauch verleiht, verlangt nach einem Preis und bringt alle, insbesondere Catherine, in große Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
»Krieg ist keine Kunst, sondern eine Aneinanderreihung grober Fehler.«
Catherine muss Pitoria gegen eine scheinbar unbesiegbare Armee verteidigen – und die Frage beantworten, wem sie ihr Herz schenkt: Ambrose, dem bei seiner Mission sein Überleben gleichgültiger ist denn je, oder Tzsayn, der sie besser versteht als jeder andere? Edyon findet sich in Calidor allein in einem Netz aus Intrigen und Ränkespielen wieder, nachdem March für seinen Verrat verbannt wurde. Und Tash muss sich auf eigene Faust in der Welt der Dämonen durchschlagen. Doch die Macht, die der Dämonenrauch verleiht, hat ihren Preis und bringt sie alle in große Gefahr …
Für Anna, Hannah, Indy, Jack, Joy, Lily, Lucy, William und Zoe
Krieg ist nicht das Spiel des armen Mannes.
M. Tatcher: Krieg – Die Kunst des Siegens
Die Kunst des Krieges? Unsinn. Krieg ist keine Kunst, sondern eine Aneinanderreihung grober Fehler.
Königin Valeria von Illast
Harold
FALKENFELD,NORDPITORIA
Ein Mädchen sitzt, still und schweigend,
wartet auf des Prinzen Befehl,
hübsch ist sie, in Demut sich neigend.
Traditionelles brigantisches Lied
Es war ein herrlich warmer und sonniger Nachmittag. Der junge Prinz Harold spazierte am Rand des Waldes entlang und summte vor sich hin, während er das alte Volkslied umdichtete.
Die Prinzessin wartet, tückisch und schweigend,
bereit für den tödlichen Stoß.
Hübsch ist sie, die Gnade vermeidend.
Prinz Boris reitet, stolz und ohne Not.
Dann durchbohrt ihn der rasende Speer.
Und er fällt vom Pferd, endlich tot.
Harold tritt vor, bereit für die Kron’,
königlich und voller Mut,
auf dem Weg zu seines Vaters Thron.
Harold blieb stehen und legte die rechte Faust über sein Herz, als stünde er bereits vor dem versammelten Hof und würde offiziell zum Kronprinzen von Brigant ernannt werden.
Auf dem Weg zu seines Vaters Thron …
In dem alten Lied ging es um eine reine, unschuldige junge Frau, die darauf wartet, dass ein Mann ihrem Leben einen Sinn verleiht. Boris hatte es oft gesungen, wenn er betrunken war.
»Tja, Bruder, unsere Schwester hat zweifellos meinem Leben einen Sinn verliehen.«
Der knallrote Tupfen einer winzigen wilden Erdbeere, die unten am Boden wuchs, stach Harold ins Auge und er pflückte die kleine Frucht. Sie war köstlich süß und er suchte nach mehr, wobei er nur die reifsten Früchte abrupfte und den Rest zertrampelte. Er trat hinaus aus dem Wald in den strahlenden Sonnenschein und leckte sich den Saft von seinen rot gefärbten Fingern. Das Schlachtfeld vor ihm lag immer noch unter einer Wolke aus grauem Rauch, die sich allmählich lichtete, sodass die Überreste des Gefechts sichtbar wurden: Leichen, verwundete Pferde, Waffen; Speere steckten kreuz und quer in der verbrannten Erde. Harold legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und genoss die Sonne auf seinem Gesicht. Er fühlte sich gesegnet.
»Was! Für! Ein! Tag!«
Die Worte hallten laut in der Stille wider und schienen über ihm zu verweilen.
»Was für ein herrlicher Tag!«, rief er noch einmal. Er empfand eine tiefe Ehrfurcht – über seine Stellung und darüber, wie sie ihm zugefallen war und wie gut sich alles anfühlte.
Aber niemand antwortete ihm. Alles war still, bis auf ein weit entferntes Kreischen – vielleicht von einem verwundeten Pferd oder einem Soldaten, obwohl es ein Ton war, wie ihn kein Lebewesen ausstoßen sollte.
Mitten auf dem Schlachtfeld standen zwei verbrannte Karren – auf dem einen hatte man Prinzessin Catherine, Harolds Schwester, transportiert, auf dem anderen Prinz Tzsayn. Die Maultiere, die vor die Karren gespannt gewesen waren, lagen – immer noch angeschirrt – verdreht und verkohlt auf dem Boden. In der Mähne des einen Tiers, dessen Kopf nach hinten verrenkt war, flackerten immer noch kleine Flammen; bei dem anderen war ein Bein nach oben gereckt. Harold hatte die Karren gemeinsam mit seinem Vater und Boris inspiziert, nachdem sie zusammengezimmert worden waren. Damals hatten sie ihn beeindruckt, aber jetzt waren sie klein und unbedeutend, wie alles andere auch.
In dem Rauch tauchten pitorianische Soldaten auf und gingen mit gesenkten Köpfen langsam das Feld ab. Wahrscheinlich suchten sie nach Verwundeten. Einer von ihnen schaute zu Harold hin.
Harold hielt dem Blick stand. Wollte der Mann ihn angreifen?
Nein. Der Pitorianer hatte seine Aufmerksamkeit bereits wieder dem Schlachtfeld zugewandt, und er und die anderen Soldaten gingen mit vorsichtigen Schritten weiter. Vielleicht hielten sie Harold für einen von ihnen oder vielleicht hatten sie genug vom Kämpfen. Aber in Harolds Kopf nagte die Vorstellung, dass sie in ihm womöglich nur den vierzehnjährigen Jungen sahen – keinen Soldaten, keine Bedrohung.
Sie würden sich wundern. Sie alle würden sich noch wundern.
Harold hatte nicht gewusst, dass die Pitorianer so gute Krieger waren; sie hatten die Schlacht mühelos und mit nur wenigen Verlusten für sich entschieden. Harold war dabei gewesen, als sein Vater und sein Bruder den Angriff auf Pitoria planten. Er hatte versucht, Fragen zu stellen, aber Boris hatte ihn wie üblich angefahren, er solle sie »nicht ständig unterbrechen«. Also hatte Harold geschwiegen und im Stillen überlegt, wie er selbst die simple Taktik seines Vaters, seine ganze Armee nach vorne zu werfen, kontern würde.
Lord Farrow, dem pitorianischen General, war es jedenfalls gelungen, seine Trümpfe auszuspielen. Und Harolds Vater hatte seinen Feind gnadenlos unterschätzt; er war der Annahme erlegen, dass der in der Kriegskunst unerfahrene Farrow einfach zu überwältigen sein würde. Harold hatte Farrow bei den Verhandlungen über das Lösegeld für Prinz Tzsayn kennengelernt. Der pitorianische Lord war eitel und gierig, aber Harold hatte auf den ersten Blick erkannt, dass er weder dumm noch faul war. Farrow hatte überall auf dem Schlachtfeld Gräben ausheben lassen, die mit Pech gefüllt waren. Diese Gräben in Brand zu stecken – und damit auch die feindlichen Soldaten – , war eine einfache Möglichkeit gewesen, die Armee der Briganter in Schach zu halten. Zugegeben, es war kein echter Sieg, weil sich die Briganter zurückziehen konnten, aber die Pitorianer hatten die Lage unter Kontrolle gehabt. Wieder einmal hatte König Aloysius seinen Gegner unterschätzt, genau wie damals, im letzten Krieg, seinen Bruder, Prinz Thelonius. Er hatte einen Narren aus sich gemacht. Und Boris war keinen Deut besser.
War keinen Deut besser gewesen.
Ein Lächeln umspielte Harolds Lippen.
»Vater hat die Pitorianer unterschätzt, und du, lieber Bruder, hast unsere ziemlich beeindruckende Schwester unterschätzt.«
Harold hatte gesehen, wie Boris und Viscount Lang mit Catherine redeten, als sie auf dem Karren gefesselt gewesen war. Selbst in Eisenketten hatte Catherine in ihrem weißen Kleid unter der glänzenden Rüstung noch prachtvoll ausgesehen. Boris hatte sie vermutlich beleidigt, aber Lang war noch einen Schritt weitergegangen: Er hatte Catherines Brustpanzer berührt, direkt über ihrem Busen. Das hätte Boris nicht zulassen dürfen. Lang war ein Trottel und Catherine eine Prinzessin. Aber jetzt war Lang tot und Boris auch. Harold hatte Boris’ letzte Augenblicke in diesem Leben miterlebt: wie sich der Speer aus Catherines Hand löste, dann den kurzen Blick voller Überraschung und Verwirrung auf Boris’ Antlitz. Harold hätte beinahe laut gelacht. Und dann dieses Hochgefühl, als Boris – tödlich verwundet – zu Boden fiel.
Und jetzt war Harold der Anwärter auf den Thron.
»Danke schön, Schwester.« Harold lächelte, während er zum pitorianischen Lager schaute, wohin Catherine nach der Schlacht geflohen war. Harold hatte sie schon immer mehr gemocht als seinen Bruder. Sie war clever und einfallsreich. Aber aus eigener Kraft hätte sie den Speer nicht so weit schleudern können. Sie musste Dämonenrauch inhaliert haben.
Vor ein paar Tagen hatte Harold den violetten Dämonenrauch selbst zum ersten Mal ausprobiert. Er war deswegen ziemlich nervös gewesen. Sein Vater verachtete alles, was die »Natur verdarb«, wie er sich ausdrückte, selbst Wein oder Bier, und Boris hatte Harold davor gewarnt. »Das Zeug macht dich wirr im Kopf – und seien wir ehrlich, da oben bist du schon wirr genug.« Harold war sich der Tatsache bewusst, dass sein Geist anders funktionierte als der normaler Leute. Aber wer wollte schon normal sein? Und wer wollte tun, was Boris befahl? Im Lager der Briganter gab es eine Reihe von Jungen, die Dämonenrauch hatten und die dem Sohn des Königs nur zu gerne etwas davon abgaben.
Harold hatte nur eine winzige Menge des Rauchs eingeatmet, aber ihm war sofort klar gewesen, dass sein altes Leben hinter ihm lag. Der Rauch hatte ihn verwandelt. Harold war klein und schlank – er kam eher nach seiner Mutter als nach seinem Vater, sehr zu dessen Enttäuschung – , aber der Rauch machte ihn schneller und stärker als den stärksten Mann in der ganzen Armee. Jetzt kannte er auch den Grund, warum Boris nicht wollte, dass Harold den Rauch kostete: Er hatte Angst gehabt, dass sein kleiner Bruder stärker werden würde als er. Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. Boris war tot und Harold konnte tun und lassen, was er wollte.
»Und ich werde es viel besser machen als du, Bruder«, murmelte er. »Ich werde schon mit vierzehn meine eigene Truppe haben.«
Boris war fünfzehn gewesen, als er zum ersten Mal Soldaten befehligte.
Harold wusste genau, welche Truppe er wollte – und zwar ganz bestimmt nicht Boris’ Männer – diese Trottel! Harold wollte die Brigaden der Jungen. Er hatte sie im Training beobachtet, hatte miterlebt, wie der Rauch die Kinder veränderte …
»Hey, du.«
Es war einer der blauhaarigen pitorianischen Soldaten, die nach Verwundeten suchten. Er war zwar nicht allein, aber seine Kameraden waren ein ganzes Stück hinter ihm.
Harold lächelte und winkte. »Hallo.«
»Was machst du hier?«
Harold erwiderte in seinem besten Pitorianisch: »Ich bewundere die Aussicht.« Der Mann kam näher und Harold erkannte, dass sein Gesicht unter dem blau gefärbten Haarschopf ziemlich hässlich war – mit dicken Lippen und einer breiten, niedrigen Stirn. »Und du ruinierst sie.«
»Du bist Briganter, stimmt’s, Junge? Du solltest nicht hier sein. Du solltest jetzt gehen.«
»Ich bin in der Tat ein Briganter. Ich bin Harold Godolphin Reid Marcus Melsor, zweiter Sohn von Aloysius von Brigant, der zukünftige König von Brigant, Pitoria, Calidor und jedem anderen Ort, der mir gefällt, und ich bin in ausgesprochen guter Stimmung, obwohl ich den hässlichsten Mann von ganz Pitoria vor der Nase habe. Und ich gehe, wohin es mir gefällt. Und zwar …« Harold zog sein Schwert. »… deswegen.«
Und damit rannte er auf den Pitorianer zu. Kurz vor ihm schlug er einen Salto und schwang sein Schwert, während er sich in der Luft drehte. Er fühlte die Kraft des Rauchs. Sein Schwert war so leicht und fügsam wie eine Feder. Das alles war ein Tanz und am liebsten hätte Harold laut gelacht, als sein Schwert das Bein des Soldaten sauber oberhalb des Knies abtrennte. Harold landete mühelos auf beiden Füßen, als der Mann zu Boden sank. Dann lag er auf dem Rücken und starrte in den Himmel, während sich sein dicklippiger Mund geräuschlos öffnete und schloss, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Die anderen beiden Pitorianer schrien erschrocken auf und rannten auf ihren Kameraden zu, wobei sie ihre Schwerter zogen. Harold kam es so vor, als würde sich alles unendlich langsam auf ihn zubewegen. Er grinste den Männern entgegen und breitete die Arme aus, wobei er sich fragte, ob sie ihn wohl angreifen würden. Aber sie blieben stehen und schauten sich nervös um.
Harold rief: »Ihr habt doch nach Verwundeten gesucht, nicht wahr? Jetzt habt ihr einen gefunden. Ihr solltet dem armen Kerl helfen, sonst verblutet er noch.«
Einer der Männer eilte vorwärts und kniete sich neben den Fischmaulmann.
»Warum hast du das getan? Die Schlacht ist doch vorbei«, sagte der andere.
Was für langweilige Fragen. Harold überlegte, ob er überhaupt antworten sollte.
»Um euch zu zeigen, wozu ich fähig bin. Und jetzt, da ihr mir zuhört, möchte ich euch eine Botschaft für meine Schwester mitgeben, für Prinzessin Catherine. Sagt ihr, dass Tzsayn und Farrow heute den Sieg für sich beanspruchen können, aber noch einmal werden sie nicht gewinnen. Das nächste Mal wird meine Armee der Jungen jeden einzelnen pitorianischen Soldaten in die Knie zwingen.«
Mit diesen Worten drehte sich Harold um und lief so schnell wie der Wind in den Wald zurück. Die Soldaten machten keine Anstalten, ihn zu verfolgen, sondern kümmerten sich um ihren verwundeten Freund. Und über den schmauchenden Feldern, über dem Fluss und den feindlichen Heerlagern – über der ganzen Landschaft – zogen sich die Wolken zusammen. Am späten Nachmittag ging der erste Sommerregen nieder.
Catherine
HEERLAGER,NORDPITORIA
Für die Lebenden endet der Krieg niemals, nur für die Toten ist er vorbei.
Pitorianisches Sprichwort
Ein kurzer Schrei durchbrach die Stille der Nacht. Die Königin drehte sich im Halbschlaf in ihrem Bett um. Alle Nächte waren erfüllt von seltsamen Geräuschen und Schreien aus den klaffenden Mündern von Menschen und Dämonen.
Es war nur ein Traum …
Mit ihren Träumen wurde sie fertig, die lösten sich bei Tagesanbruch in Wohlgefallen auf, aber nur selten wachte sie nachts aus einem Traum auf und jetzt war sie halb wach.
Vielleicht das Bellen eines Fuchses …
Obwohl es im Lager keine Füchse gab.
Oder ein Soldat hat seinem Kameraden etwas zugerufen …
Ja, vielleicht war es das.
Catherine schlug die Augen auf.
Über sich sah sie im Dämmerlicht die schlaffe Zeltleinwand. Der Regen, der eine Woche lang niedergegangen war, hatte endlich aufgehört. Zurück blieben Pfützen in den Ecken des königlichen Prunkzeltes und eine Feuchtigkeit in der Luft, die alles durchdrang. Schwarze Schimmelflecken überzogen jeden Gegenstand in ihrem Zelt; gewebte Trennwände, Seidenvorhänge, sogar die Bettlaken verwandelten sich in schwarze Fetzen.
Draußen näherte sich das Licht einer Laterne und warf zitternde, flache Schatten, begleitet von gedämpften Stimmen.
Savage und seine Assistenten.
Wieder ein Schmerzensschrei, und Catherine schoss aus dem Bett und warf gerade ihren Umhang über, als Tanya hereingerannt kam. Obwohl Catherines Zofe kein Wort sagte, sprach ihre Miene Bände: Tzsayn ging es schlechter.
Catherine schob sich durch den Doppelvorhang des Prachtzeltes, der ihre »Gemächer« von denen des Königs trennte. General Davyon war bereits da, stand neben dem Bett und hielt Tzsayn fest, der gegen ihn ankämpfte und wild um sich schlug. Sein Blick fiel auf Catherine und er schrie laut ihren Namen. Catherine rannte zu ihm, in der Gewissheit, dass jeder Augenblick seine Panik vergrößerte. Sie packte Tzsayns Hand und hielt sie fest.
»Ganz ruhig«, sagte sie sanft. »Ich bin es.«
»Du bist da? Du bist bei mir?« Er starrte sie an, als ob er überlegen müsste, wer sie war.
»Ja, ich bin da. Ich bin bei dir.«
»Aber sie haben dich geholt. Die Briganter. Ich dachte, ich hätte dich verloren.«
»Nein. Ich bin ihnen entkommen … auf dem Schlachtfeld. Erinnerst du dich?«
Tzsayn starrte und starrte. Dann traten Tränen in seine Augen und er blinzelte, um sie am Fließen zu hindern.
»Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Ich dachte … dieser Mann.«
Dieser Mann. Immer wieder. Dieser Mann. Es war Noyes, den er meinte, daran gab es für Catherine keinen Zweifel, obgleich Tzsayn nie seinen Namen nannte. Aber er war derjenige, der Tzsayn und seine Männer gefoltert hatte und der nun Nacht für Nacht den König heimsuchte.
»Es war nur ein Traum, ein schlimmer Traum. Du hast Fieber, mein Liebster. Bitte leg dich wieder hin. Mir ist nichts geschehen. Aber ich will, dass auch du außer Gefahr bist.«
Catherine setzte sich neben das Bett und hielt Tzsayns Hand, während Doktor Savage milchige Medizin in einen Becher goss, aber als er ihn seinem Patienten an die Lippen setzen wollte, schlug Tzsayn den Becher weg.
»Ich will das verdammte Zeug nicht. Lasst mich in Ruhe!«
Aber Davyon schüttelte den Kopf, und der Gehilfe des Doktors hielt Tzsayns Schultern fest, während Savage dem Prinzen die Medizin in den Mund schüttete. Tzsayn spuckte und fluchte, aber dann fiel er wieder auf sein Kissen, immer noch Catherines Hand umklammernd.
Als der König sich wieder beruhigt hatte, zog Savage die Bettdecke weg, um nach Tzsayns Wunde zu sehen. Wenn er das tat, betrachtete Catherine normalerweise die unversehrte Seite von Tzsayns Gesicht – seine weiche Haut, den Wangenknochen und die gewölbte Augenbraue – , aber diesmal zwang sie sich hinzuschauen, als Savage den Verband abnahm.
Ein kurzer Blick, mehr hielt sie nicht aus. Unterhalb des Knies war Tzsayns Bein ein einziger Klumpen aus blutigem Fleisch und Eiter. Sein Fuß war so geschwollen wie ein Kürbis.
Catherine wandte sich zu Savage und Davyon um.
»Was geschieht mit ihm? Es wird immer schlimmer!«
Savage schüttelte den Kopf. »Die Verbrennungen, die er in der Kindheit erlitten hat, sorgen dafür, dass diese neuen Brandwunden schlechter heilen.«
Nach der Schlacht auf dem Falkenfeld sah es so aus, als würde sich Tzsayn eigentlich recht gut erholen, aber nach zwei Tagen hatte sich sein Bein entzündet und war angeschwollen. Seitdem vernebelte ein Fieber seinen Geist. Catherine hatte ihre Blessuren aus der Schlacht gut weggesteckt. Auf ihrer Hand prangte eine tiefe Narbe von dem Eisendorn, mit dem sie an den Karren gefesselt gewesen war, aber eine Prise Dämonenrauch nach den Kämpfen hatte sie vollständig geheilt.
Wenn es nur auch bei Tzsayn funktionieren würde, dachte sie. Aber er war zu alt, der Dämonenrauch zeigte bei ihm keine Wirkung mehr.
Catherine hatte körperliche Narben davongetragen, aber ihr Gewissen war rein. Sie hatte ihre Tat verarbeitet. Sie war nicht stolz darauf, dass sie ihren eigenen Bruder getötet hatte, aber sie schämte sich deswegen auch nicht. Es war eine Notwendigkeit gewesen. Männer töteten ständig, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, aber sie hatte ihre Handlungsweise mit der Logik eines Richters unter die Lupe genommen und keinen Zweifel daran, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Boris war ein böser Mensch gewesen und ihr Vater hatte ihn dazu gemacht. Vermutlich trug auch Aloysius’ Vater die Schuld daran, was aus Aloysius geworden war, genau wie sein Vater vor ihm und so weiter und so fort, die ganze königliche Blutlinie hindurch. Aber das Übel musste ausgerottet werden. Und wenn die Männer es nicht konnten oder wollten, würde Catherine es tun. Boris zu töten, war nur der Anfang gewesen. Damit war es nicht genug, das wusste sie. Sie würde alles tun, um ihren Vater daran zu hindern, noch mehr Tod, Zerstörung und Elend über die Welt zu bringen. Das war ihr großes Ziel, und es bedrückte sie nicht, sondern beflügelte sie.
Sie würde wie eine Königin handeln – nein, sie würde eine Königin sein: Königin Catherine von Pitoria. Ihre Behauptung, mit Tzsayn verheiratet zu sein, war eine Lüge. Als Gefangener von Aloysius hatte Tzsayn nichts davon gewusst, aber nach seiner Freilassung hatte er mitgespielt. Genau wie Davyon, Tanya und sogar Ambrose, und deshalb war sie im Grunde genommen die Königin – mit allen Aufgaben und Verantwortungen, die diese Stellung mit sich brachte.
Glücklicherweise waren alle, die in den verräterischen Plan verwickelt gewesen waren, Catherine im Austausch für Tzsayn ihrem Vater auszuliefern, zur Rechenschaft gezogen worden. Gleich nach der Schlacht legte man Lord Farrow samt seiner Generäle und Gefolgsleute in Ketten. In der kurzen Zeit, in der Tzsayn bei klarem Verstand gewesen war, ließ er keinen Zweifel daran, dass Lord Farrow des Verrats angeklagt werden würde – und die meisten waren sich sicher, dass ein Schuldspruch und das Todesurteil auf ihn warteten.
Doch dann ergriff das Fieber Besitz von Tzsayn und die ganze Verantwortung für die Armee und das Land ging auf die Königin über. Diese Verantwortung – manches davon Kleinigkeiten, manches schier unüberwindliche Aufgaben – beschäftigte Catherines Gedanken Tag und Nacht. Entscheidungen mussten getroffen werden, was die Armee anging: Nahrung, Pferde, Waffen, Geld.
Geld …
Pitorias Vermögen war in das Lösegeld für Tzsayn geflossen und befand sich jetzt im Besitz der Briganter. Die Steuern waren erdrückend hoch. Geld – besser gesagt: der Mangel an Geld – stellte eine ernste Bedrohung dar. Das – und der Krieg.
Von dem einen haben wir zu wenig und von dem anderen viel zu viel.
Catherine strich über Tzsayns Stirn. Er schlief jetzt und sah friedlich aus, aber Catherine wusste, dass sie selbst jetzt nicht mehr einschlafen konnte. Sie könnte etwas Dämonenrauch nehmen, der die wunderbare Eigenschaft besaß, sie sowohl zu entspannen als auch zu stärken. Aber Tanya war ebenfalls wach und würde aus ihrer Missbilligung keinen Hehl machen, wenn sie sah, wie ihre Herrin Dämonenrauch inhalierte. Catherine musste erkennen, dass eine Königin sogar noch weniger Privatsphäre als eine Prinzessin für sich beanspruchen konnte. Die Vorstellung, Zeit für sich selbst zu haben, und zwar allein und unbeobachtet, kam ihr wie ein unerfüllbarer Wunschtraum vor. Sie ging nach draußen, mit Tanya dicht auf den Fersen. Davyon, der wie immer ein grimmiges Gesicht machte, stand vor dem Zelt und starrte in die Ferne. Der Himmel war wolkenlos und im Osten zeigte sich das erste Licht des Morgens.
»Wenigstens regnet es nicht mehr«, sagte Catherine.
»Ja, eine Sache, über die wir uns freuen können«, nickte Davyon.
Catherine dachte an den Stapel mit Papieren auf ihrem Schreibtisch, konnte sich aber nicht dazu überwinden, sofort damit anzufangen.
»Ich möchte einen Spaziergang machen.«
»Natürlich, Euer Majestät. Innerhalb des königlichen Bereichs? Oder …«
»Nein, einen richtigen Spaziergang. An der frischen Luft. Zwischen Bäumen.«
Früher wäre Catherine unbeschwert losgeritten, nur begleitet von Ambrose zu ihrem Schutz, und das hätte sie auch jetzt zu gerne getan. Aber was sie wollte und was sie durfte, waren zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Das Letzte, was sie im Augenblick gebrauchen konnte, war ein Wiederaufflammen der Gerüchte über ihre Beziehung zu ihrem Leibgardisten. Außerdem lag Ambrose immer noch auf der Krankenstation und erholte sich von seiner Verwundung aus der Schlacht. Bei diesem Gedanken empfand sie Schuldgefühle. Viele ihrer Soldaten waren verwundet worden. Sie sollte sie unterstützen. »Ich werde ins Lager gehen. Ich will nach meinen Soldaten sehen.«
Davyon runzelte die Stirn. »Dann muss Euch die königliche Garde begleiten.«
»In meinem eigenen Heerlager?«
»Ihr seid die Königin. Es könnten Attentäter unterwegs sein«, murmelte Tanya so laut und vernehmlich, wie nur sie es konnte. »Und falls Ihr es vergessen habt: Gleich auf der anderen Seite liegt das feindliche Heerlager.«
»Na schön«, sagte Catherine. »Ruft die königliche Garde zusammen.«
Davyon verbeugte sich. »Ich werde Euch ebenfalls begleiten, Euer Majestät.«
»Wollt Ihr Eure Rüstung anlegen, Majestät?«, fragte Tanya.
»Warum nicht?« Catherine seufzte. »Ich bin sicher, der zusätzliche Schutz wird Davyon beruhigen. Lasst uns glänzen.«
Obwohl ihr ganz und gar nicht nach Glänzen zumute war.
Als die Sonne über dem Lager aufging, machte sich Catherine in einem weißen Kleid unter ihrer blank polierten Rüstung auf den Weg, das Haar um ihre Krone geflochten und hinten auf dem Rücken offen herabhängend. Begleitet wurde sie von Davyon (dessen Lächeln wie festgeklebt wirkte), Tanya (mit ernster Miene und einem blauen Kleid mit einer eng geschnittenen weißen Jacke, die Catherine noch nie an ihr gesehen hatte) und zehn königlichen Leibgardisten, alle mit weiß gefärbten Haaren.
Catherine merkte, wie sich ihre Laune hob, als sie die Wachen mit Namen begrüßte. Bei einem blieb sie stehen und fragte: »Wie geht es Eurem Bruder, Gaspar?«
»Besser, Euer Majestät. Danke, dass Ihr den Doktor zu ihm geschickt habt.«
»Ich bin froh, dass ich helfen konnte.«
Catherine hatte seit der Schlacht den geschützten königlichen Bereich des Lagers nicht verlassen. Sie hatte Besprechungen abgehalten und sich um Tzsayn gekümmert. Als sie jetzt die hohe Wand aus königlichen Zelten hinter sich ließ, sah sie die pitorianische Armee vor sich. Ihre Armee.
Das Lager erstreckte sich, so weit sie blicken konnte, und obwohl es sich schon vorher an genau derselben Stelle befunden hatte, erkannte sie es kaum wieder. Im Heerlager herrschte immer ein gewisses Durcheinander, ein Chaos aus Zelten, Pferden und Menschen, Hühnern und Ziegen. Aber vor einigen Tagen hatte sich dieses Durcheinander noch auf einer weiten grünen Grasfläche abgespielt. Heute, nach sieben Tagen Regen und dank Tausender trampelnder Stiefel, war kein Grashalm mehr zu sehen, nur noch dicker Schlamm, hier und da durchbrochen von Pfützen mit braunem Wasser, über denen Wolken winziger Mücken hingen wie Rauch im Morgenlicht.
»Moskitos«, klagte Tanya und schlug sich gegen den Hals. »Gestern wurde mein ganzer Arm zerstochen.«
Davyon wählte eine Route durch das Lager, die möglichst trocken war, aber während sie zwischen den Zelten hindurchgingen, hing außer den Moskitos noch etwas anderes in der Luft: der Geruch – nein, der Gestank – nach menschlichen und tierischen Fäkalien.
Catherine legte die Hand über ihr Gesicht. »Dieser Geruch ist … überwältigend.«
»Ich kenne Jauchegruben, die lieblicher duften«, bemerkte Tanya.
Weiter unten auf der Wiese standen einige der Zelte im Wasser. Soldaten wateten knöcheltief im Schlamm, umschwirrt von unzähligen Moskitos.
»Warum haben sie ihre Zelte nicht verlegt?«, fragte Catherine Davyon.
»Es sind die Männer des Königs. Sie müssen in der Nähe des Königs lagern.«
»Sie müssen trocken lagern.«
»Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so lange regnen würde, aber die Männer sind abgehärtet. Es ist ja nur Wasser, Euer Majestät, und – wie Ihr ja selbst sagtet – es hat jetzt aufgehört zu regnen.«
Catherine ging platschend zu einer Gruppe Soldaten auf einer kleinen Erhebung, die wie eine Insel über das Wasser hinausragte. Ihre Stiefel waren dick mit Schlamm verkrustet. Die Männer salutierten und lächelten.
»Wie kommt ihr mit dem Regen zurecht?«, fragte Catherine.
»Wir kommen mit allem zurecht, Euer Majestät.«
»Nun, ich kann fühlen, wie das Wasser meine Stiefel durchnässt, und ich bin erst seit Kurzem hier draußen. Sind eure Füße nicht die ganze Zeit nass?«
»Nur ein bisschen, Euer Majestät«, gab einer zu.
Aber ein anderer wagte sich weiter vor. »Vollkommen durchnässt, und zwar seit Tagen. Meine Stiefel verfaulen allmählich. Joshs Füße sind schwarz geworden und Aryn hat das Rote Fieber bekommen. Wir werden ihn wohl verlieren.«
Catherine wandte sich zu Davyon. »Das Rote Fieber?«
Davyon verzog das Gesicht. »Eine Krankheit. Die Ärzte tun, was sie können.«
Catherine dankte den Männern für ihre Aufrichtigkeit und machte sich wieder auf den Weg. Als sie außer Hörweite waren, zischte sie Davyon an.
»Die Männer sterben am Fieber? Das hätte ich wirklich nicht von Euch erwartet, General! Wie viele sind erkrankt?«
Davyon ließ nur selten ein Gefühl erkennen und jetzt war seine Stimme eher müde als wütend. »Etwa jeder Zehnte zeigt Symptome. Ich wollte Euch damit nicht belästigen.«
Catherine hätte beinahe geflucht. »Das sind meine Männer, meine Soldaten. Ich will wissen, wie es ihnen geht. Ihr hättet mich informieren sollen. Ihr hättet das Lager verlegen lassen sollen. Tut es heute, General. Wir können nicht sicher sein, dass der Regen nicht wieder einsetzt. Und selbst wenn nicht – dieser Ort ist eine Hölle aus Fliegen, Krankheit und Dreck.«
Davyon verbeugte sich. »Sobald Ihr wieder sicher in Eurem Zelt seid, werde ich damit anfangen, die …«
»Ihr werdet jetzt gleich damit anfangen. Ich habe zehn Leibgardisten zu meinem Schutz, Davyon, ich brauche nicht auch noch Euch. Und es will mir scheinen, dass ich eher ertrinken oder am Fieber sterben werde als durch den Pfeil eines Attentäters.«
Mit schmalen Lippen verbeugte sich Davyon ein zweites Mal und wandte sich ohne ein weiteres Wort ab. Catherine setzte ihren Weg durch das Lager fort und blieb immer wieder stehen, um mit ihren Weißen und Tzsayns Blauen ein Wort zu wechseln. Die meisten Männer freuten sich, sie zu sehen, und alle fragten nach ihrem König.
»Wir wussten, dass er den Brigantern entkommen würde. Wenn einer das schaffen kann, dann er.«
Catherine lächelte und versicherte ihnen, wie stolz Tzsayn auf seine Männer war, auf ihren Mut und ihre Treue. Offensichtlich wusste niemand etwas von Tzsayns Krankheit, und es war besser, wenn es so blieb.
Am nördlichen Rand des Lagers blieb sie stehen. Von hier aus konnte man das Falkenfeld überblicken. Kaum etwas deutete noch darauf hin, dass hier die Armeen von Brigant und Pitoria eine Schlacht ausgefochten hatten. Der Fluss war über seine Ufer getreten und hatte alles überschwemmt. Nur ein Holzpfahl ragte noch schief aus dem braunen Wasser – der Rest des Karrens, auf dem Catherine gefesselt gewesen war und der irgendwie sowohl Feuer als auch Fluten überlebt hatte. Am anderen Ufer, wo vor der Schlacht die Armee ihres Vaters gelagert hatte, erstreckte sich eine leere Grasebene. Die Briganter hatten sich bis nach Rossarb zurückgezogen, etwa einen halben Tagesritt nördlich von hier. Niemand wusste, wann – oder ob – sie wieder angreifen würden. Aber immerhin besaß ihr Vater mehr Verstand, als seine Männer in einem Sumpf lagern zu lassen.
Während Catherine ihre Umgebung in Augenschein nahm, verkrampfte sich ihr Magen. Auf den Karten, die sie in den Besprechungen mit ihren Generälen begutachtete, erschien ihr alles irgendwie entrückt, aber hier spürte sie das volle Ausmaß ihrer misslichen Lage.
Catherine war ihrem Vater zwar entkommen, aber Aloysius hatte fast alles bekommen, was er sich durch diese Invasion erhofft hatte: Gold – das Lösegeld für Tzsayn – , um seine Armee zu finanzieren, und Zugang zu dem Dämonenrauch auf dem Nördlichen Plateau. Seine Armee hatte sich zwar zurückgezogen, aber er war nicht besiegt. Ihre eigenen Männer dagegen versanken im Schlamm und erlagen dem Roten Fieber.
Catherine biss die Zähne zusammen. Sie wünschte, Tzsayn könnte ihr helfen, aber im Augenblick war sie auf sich allein gestellt.
Ambrose
HEERLAGER,NORDPITORIA
In der Krankenstation war es kühl. Der frühmorgendliche Chor aus Stöhnen, Husten und Schnarchen war gedämpften Gesprächen gewichen, gespickt mit Flüchen und leisen Hilferufen. Ambrose lag auf seinem Feldbett auf der Seite und schaute zum Eingang. Mit aller Kraft wünschte er sich, dass die nächste Person, die hereinkam, Catherine sein würde. Er sah nahezu vor sich, wie sie ihn bei ihrem Eintreten anlächeln und schnell zu ihm kommen würde. Ihre Zofen würden ihr nicht folgen können, wie früher, wenn sie sich bei den Ställen des königlichen Schlosses von Brigane mit ihm traf. Dann nahm sie seine Hand und er beugte sich darüber und küsste sie. Mit seinen Lippen berührte er ihre Haut und atmete ihren Duft ein.
Der Mann hinter Ambrose hustete keuchend und spuckte dann aus.
Ambrose war seit einer Woche hier. Anfangs war er sich sicher gewesen, dass Catherine ihn besuchen würde, aber jetzt war diese Sicherheit gewichen. Seine Tage waren erfüllt mit Gedanken an sie, mit Erinnerungen an die Zeit, die er mit ihr verbracht hatte, von den Anfängen in Brigant, als er mit ihr am Strand entlanggeritten war, bis zu jenen herrlichen Tagen in Donnafon, als er sie in den Armen gehalten, ihre zarte Haut gestreichelt und sie geküsst hatte – ihre Hände, ihre Finger, ihre Lippen.
Ein Mann am anderen Ende des Raums stieß einen Schmerzensschrei aus.
Was dachte er sich bloß? Catherine sollte nicht hierherkommen. Dies war ein elender Ort, voller Krankheit. Er war derjenige, der hier raus und zu ihr gehen musste. Aber dazu musste er erst einmal laufen können. In der Schlacht auf dem Falkenfeld hatte er sich Verwundungen an Schulter und Bein zugezogen. Er kannte Soldaten, die weit schlimmere Verletzungen überwunden hatten, und er wusste von Männern, die schon bei weniger schwerwiegenden Wunden aufgegeben hatten und gestorben waren. Gleich nach der Schlacht hatte er einen Moment lang geglaubt, er könne nicht durchhalten, aber das Gefühl der Verzweiflung war gewichen und er wusste, dass er niemals aufgeben würde. Er würde kämpfen, für sich selbst und für Catherine.
Ambrose setzte sich im Bett auf und machte seine Übungen. Langsam beugte und streckte er den rechten Arm, wie der Arzt ihn angewiesen hatte. Dann ließ er seine verbundene Schulter kreisen. Es tat weh und er musste die Bewegungen langsam ausführen.
Auf dem Falkenfeld hatten sie einen Sieg feiern können, aber der Krieg war noch lange nicht vorbei. Und was Ambrose anging – bei dem Versuch, Catherine zu retten, war es ihm lediglich gelungen, Lang zu töten. Er hatte gegen Boris kämpfen wollen, war aber von den Brigantern überwältigt worden. Es war Catherine gewesen, die ihn gerettet hatte. Durch Dämonenrauch gestärkt, hatte sie einen Speer geschleudert und damit Boris’ Brust durchbohrt. Für Ambrose musste sie ihren Bruder töten. Was für ein Gefühl ist das wohl? Den eigenen Bruder umzubringen … Ambrose konnte es sich einfach nicht vorstellen. Sein Bruder Tarquin war das genaue Gegenteil von Boris gewesen. Allerdings waren beide jetzt tot. Und Ambrose hatte keine Ahnung, wie es Catherine dabei erging. Warum ist sie nicht gekommen? Ist sie selbst krank? So viele Fragen und keine Antworten.
»Verdammt!« Er schrie auf, als er seinen Arm zu heftig schwang und ein scharfer Schmerz durch seine Schulter zuckte.
Er musste raus aus dem Bett. Er musste raus aus dieser Krankenstation! Dieser Ort war furchtbar. In jedem Bett lag ein Mann, aber nur wenige waren in der Schlacht verwundet worden. Die meisten litten an dem Fieber, das im Lager grassierte. Das Rote Fieber nannten sie es, weil das Gesicht der Kranken krebsrot wurde, während sie sich die Seele aus dem Leib husteten. Viele waren in der Nacht gestorben, ihre Betten verwaist – aber Ambrose wusste, dass schon bald wieder neue Kranke auf die alten, schmutzigen Laken gelegt werden würden. Es war ein Wunder, dass er selbst sich noch nicht angesteckt hatte.
Ambrose drehte sich um, bis er beide Füße auf den Boden stellen konnte. Mithilfe einer Stuhllehne richtete er sich auf, aber als er mehr Gewicht auf sein linkes Bein legte, zuckte er zusammen und geriet leicht ins Schwanken. Das Bein war schwach, aber der Schmerz erträglich. Er könnte aus der Krankenstation laufen, wenn er es darauf anlegte. Die Ärzte hatten den Pfeil aus seiner Wade entfernt und die Wunde sorgfältig vernäht. Die meisten Doktoren hätten das Bein bei einer solchen Verletzung amputiert, aber Tzsayns Ärzte hatten umsichtig gehandelt, ihn operiert, ihm Kräutermedizin verschrieben und Kompressen aufgelegt.
Die besten Ärzte – von Tzsayn.
Die beste Medizin – von Tzsayn.
Das beste Essen – von Tzsayn.
Die besten Kleider, das beste Bettzeug und … alles.
Alles außer einem einzigen Wort von oder über Catherine. Hielt Tzsayn sie von ihm fern? Es musste eine Erklärung dafür geben.
»Ihr seht gut aus, Sir Ambrose.«
Ambrose war so in Gedanken versunken gewesen, dass er nicht bemerkt hatte, wie Tanya eingetreten war. Er schaute zum Eingang, in der Hoffnung, dass als Nächstes Catherine kommen würde.
»Einer der Ärzte bat mich, Euch dies zu geben. Zur Stärkung oder so etwas Ähnliches.« Tanya hielt ihm eine Schale mit Haferbrei hin und bemerkte dann seinen Blick. »Mehr habe ich nicht für Euch. Ich bin allein gekommen.«
Ambrose nickte knapp und versuchte, seine Enttäuschung zu verbergen. »Es ist schön, Euch zu sehen, Tanya.« Er griff nach der Schale, verlor dabei aber sein Gleichgewicht und packte die Stuhllehne, wobei er wiederum seinen verletzten Arm belastete, was dazu führte, dass er vor Überraschung über den Schmerz aufstöhnte. So lässig, wie er konnte, setzte er sich auf die Bettkante.
Tanya musste ein Lachen unterdrücken.
Ambrose funkelte sie an. »Lacht Ihr immer über verletzte Soldaten?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nur wenn sie ihre Haare in diesem unmöglichen Grün gefärbt haben.«
»Ach, das. Wir haben uns bei Farrows Männern eingeschlichen«, erklärte er und griff dabei nach seinen ungewöhnlich kurzen Locken, aber Tanya grinste nur noch mehr. »Na ja, wie auch immer, es lässt sich nicht auswaschen.«
»Dann müsst Ihr es anders färben, das ist die einzige Möglichkeit.« Sie setzte sich neben ihn auf das Bett und beugte sich zu ihm hin. Leise sagte sie: »Aber welche Farbe werdet Ihr wählen? Weiß für die Königin? Oder Blau für den König?«
»Blau? Die Farbe des alten Königs war Purpur. Muss Tzsayn nicht seine ganzen verflixten Klamotten und seine Körperbemalung ändern lassen, jetzt, wo sein Vater tot ist?«
»Nein, die königlichen Farben wechseln sich ab. Tzsayns Farbe bleibt Blau. Wenn er einen Sohn hat, wird dieser Sohn Purpur als Wappenfarbe tragen, so wie Tzsayns Vater. Aber ich denke sowieso, dass Ihr Weiß wählen werdet. Oder nehmt Ihr womöglich gar keine Farbe?«
»Können wir über etwas anderes als Haarfarben reden?«
»Ich habe nicht über Haare geredet, Sir Ambrose.«
Ambrose betrachtete Tanya genau. »Hat sie Euch geschickt? Warum kommt sie nicht selbst?«
»Weil die Königin weiß, dass es für ihre Stellung … unvorteilhaft wäre, mit Euch gesehen zu werden. Aber sie erkundigt sich täglich bei den Ärzten nach Eurem Befinden.«
»Sie hat die Ärzte geschickt? Nicht Tzsayn?«
»Sie schickt ihre Ärzte zu vielen ihrer Soldaten.«
»Ihr klingt wie eine Politikerin.«
»Gut. In dieser Umgebung muss man eine sein.«
»Und ist meine Herrin auch zur Politikerin geworden?«
Tanya schürzte die Lippen. »In der Tat. Aber mit Politik allein gewinnt man keinen Krieg. Sie braucht Männer, die ihr treu ergeben sind und den Kampf mit den Brigantern nicht scheuen. Sie braucht Eure Unterstützung, Sir Ambrose.«
»Die hat sie. Immer. Das wisst Ihr doch, Tanya.«
Tanya nickte, sagte aber nichts.
»Könnt Ihr mir mehr sagen?«, fragte Ambrose schließlich. »Geht es ihr gut? Als ich sie das letzte Mal sah, war sie an einen Karren gekettet. Nein, eigentlich sah ich sie das letzte Mal, als sie einen Speer auf mich geschleudert hat … na ja, nicht auf mich, sondern auf Boris. Lasst mich noch einmal von vorne anfangen. Geht es der Königin gut? Als ich sie das letzte Mal sah, tötete sie ihren Bruder.«
Tanya wandte für einen Moment den Blick von ihm ab. »Sie hat sich von den Wunden erholt, die sie durch die Eisenfesseln davongetragen hatte. Danke für Eure Fürsorge diesbezüglich. Ihr Bruder war ein Ungeheuer. Ich glaube nicht, dass ich mir zu viel herausnehme, wenn ich das so offen sage. Und sein Tod macht meiner Herrin nicht das Herz schwer.«
Bei der Erwähnung von Catherines Herz verspürte Ambrose den Wunsch, noch mehr zu erfahren, und er hörte sich fragen: »Und Tzsayn? Wie geht es ihm?«
»Auch er erholt sich von seinen Verletzungen.«
Ambrose zog die Augenbraue hoch. »Verletzungen?«
Tanya errötete und sagte: »Kleine Blessuren von seiner Gefangenschaft. Aber ich sehe ihn nicht oft, er ist ein beschäftigter Mann. König zu sein lässt einem nicht viel Freizeit.«
Aber wie oft sah Catherine ihn? Täglich?
Tanya schien sich wieder gefasst zu haben. »Wir sind immer noch im Krieg, Sir Ambrose. Der König hat viele Verpflichtungen, genau wie die Königin. Catherines Stellung hängt von vielen Dingen ab und Ihr gehört dazu. Sie braucht Eure Hilfe. Sie braucht Menschen, die kämpfen können, anführen, inspirieren.«
»Ich darf also wieder in ihre Nähe? Kann ich sie sprechen?«
Tanya schüttelte den Kopf. »Sie darf nicht mit Euch gesehen werden, Ambrose, und Ihr wisst, warum. Wenn Ihr es versucht, gefährdet Ihr den Ruf der Königin. Ihr gefährdet sie. Wenn sie Euch wichtig ist – und daran habe ich keinen Zweifel – , dann seid ihr Kämpfer, nicht ihr Liebhaber.«
»Damals, als wir über das Nördliche Plateau geflohen sind, wollte sie, dass ich beides bin.« Ambrose sprach leise, weil er nicht sicher war, ob er es Tanya gegenüber aussprechen durfte.
»Ja, das hat sie mir gesagt. Und in Donnafon habt Ihr jede Gelegenheit wahrgenommen, um zusammen zu sein. Und das hätte sie beinahe mit ihrem Leben bezahlt. Aber jetzt steht noch mehr auf dem Spiel, Ambrose. Jetzt geht es nicht nur um Catherines Leben, sondern um unser aller Leben. Sie ist unsere Königin. Ihre Ehre muss über jeden Zweifel erhaben sein, ebenso wie ihre Loyalität zu Pitoria.«
»Und ich bin zweifelhaft?«
»Ihr seid ein guter Mann und ein guter Soldat, Ambrose. Und das müsst Ihr beweisen.«
»Habe ich das nicht schon getan?«
Tanya lächelte. »Wir alle müssen uns wieder und wieder beweisen. Jetzt esst Euren Haferbrei, ehe er kalt wird.«
Edyon
CALIA,CALIDOR
»Das hier ist der Ablauf für deine Investitur.« Prinz Thelonius reichte Edyon eine Schriftrolle. »Alles ist vorbereitet. Überall in Calidor werden Festlichkeiten stattfinden. Ich könnte nicht glücklicher sein; du bist die Zukunft dieses Landes.«
Thelonius hatte Edyon bereits als seinen Sohn und Erben anerkannt, aber die Investitur war die formelle Zeremonie, bei der Edyon in seine Stellung und sein Amt eingeführt wurde: Er war nun ein Prinz, der Prinz von Abask, und – wichtiger noch – der Erbe des Throns von Calidor. Edyon warf einen Blick auf die Schriftrolle und überflog die einzelnen Punkte. Gemessen an der Tatsache, dass er die Zukunft des Landes war, wurde er kaum erwähnt.
»Danke, Vater. Ich werde alles genauso machen, wie es hier geschrieben steht. Aber weil wir gerade davon sprechen: Bei meiner Ankunft habe ich dir ein Schriftstück übergeben, einen Brief mit einer dringenden Botschaft für dich von König Tzsayn und Königin Catherine von Pitoria. Das war vor einer Woche. Der Brief beinhaltete eine Bitte um Hilfe. Ich denke, wir sollten antworten, und zwar möglichst schnell.«
Es kostete Edyon alle Willenskraft, um nicht laut »Jetzt sofort!« zu schreien, aber er dachte, dass sein Vater, den er erst vor einer Woche kennengelernt hatte, davon bestimmt nicht begeistert sein würde. Aber Jetzt sofort! war genau das, was nötig war. Als Edyon Pitoria verließ, hatten sie gerade herausgefunden, dass Aloysius den Dämonenrauch erntete. Wenn er genug Rauch besaß, um seine Jungenarmee damit zu versorgen, konnte ihn nichts und niemand mehr aufhalten. Sie durften keine Zeit verlieren. Thelonius hatte seinen Bruder, Aloysius von Brigant, im letzten großen Krieg besiegt, und alle rechneten damit, dass ihm dieses Kunststück auch ein zweites Mal gelingen würde.
»Du hast recht, Edyon. Und ich habe beschlossen, dass wir eine Delegation nach Pitoria schicken werden, die sich vor Ort über die Situation ein Bild macht.«
Eine Delegation! Das hörte sich nicht besonders ermutigend an. Edyon hatte gehofft, dass sein Vater eine ganze Armee schicken würde, wenn er das Ausmaß der Bedrohung begriff. Aber eine Delegation war besser als nichts und es war immerhin ein erster Schritt. Vielleicht konnten die beiden Länder dann enger zusammenarbeiten, könnten Informationen austauschen, Männer, Vorräte …
Der Lordkanzler, Lord Bruntwood, trat einen Schritt vor und sprach zu Thelonius: »Euer Hoheit, ich halte es für meine Pflicht, Euch an die Traditionen in Bezug auf den Umgang mit fremden Nationen zu erinnern. Außerdem gibt es da noch ein kleines Problem.«
Das Gesicht des Kanzlers verriet niemals seine wahren Gefühle; sein Lächeln war unterwürfig, sein Missfallen reserviert, sein Kummer fade. Und er kam Edyon immer so vor, als hätte er Blähungen, die er mit Gewalt unterdrückte.
Vielleicht ist das sein »kleines Problem«.
»Was für ein Problem?«, fragte Thelonius stirnrunzelnd.
»Gerede, Euer Hoheit. Gerüchte. Geschwätz. In Bezug auf Edyon.« Der Kanzler verzog das Gesicht, als ob die Winde in seinem Körper ihm großes Unbehagen bereiten würden.
»Nicht wieder irgendwelche Einwände gegen Edyons Legitimation, hoffe ich.« Das kam von Lord Regan, Thelonius’ bestem Freund, dem einzigen Menschen, dem er es anvertraut hatte, seinen Sohn ausfindig zu machen und ihn sicher nach Calidor zu bringen. Das allerdings war gründlich schiefgegangen, dank March …
Aber Edyon wollte jetzt nicht an March denken.
Der Kanzler wandte sich an Regan und erklärte: »Im Grunde genommen keine Einwände gegen ihn, lediglich Bedenken darüber, dass ein Präzedenzfall geschaffen wird.«
Regan nickte. »Ja, natürlich, keine Einwände, bloß Bedenken.«
»Und die haben wir bereits zerstreut. Wir schaffen keinen Präzedenzfall«, fiel Thelonius ein.
»Gewiss doch, Euer Hoheit«, beeilte sich der Kanzler zu versichern.
Das erste Hindernis auf dem Weg zu Edyons Anerkennung als legitimer Erbe war die Tatsache gewesen, dass Thelonius nicht mit Edyons Mutter verheiratet gewesen war. Eine Reihe von Lords waren besorgt darüber, dass andere Bastarde ebenfalls Ansprüche erheben würden, sollte Edyon den Thron besteigen. Sie hatten Angst, dass diese illegitimen Söhne Ländereien und Titel einfordern würden, von den Lords oder ihren legitimen Söhnen. Niemand würde mehr sicher sein. Das System würde zusammenbrechen. Chaos würde anstelle der Ordnung regieren.
Edyon hatte sich gefragt, wie sein Vater dieses Hindernis aus dem Weg räumen wollte, und angenommen, dass es Wochen oder sogar Monate der Planung und rechtlicher Diskussionen erforderte, aber sein Vater bereinigte die schwierige Situation mühelos. Thelonius behauptete, er hätte Edyons Mutter in Pitoria geheiratet, wo sie sich kennengelernt hatten. Einer schnellen Vermählung sei eine ebenso schnelle Scheidung gefolgt. Die Papiere seien verloren gegangen, aber Thelonius präsentierte ein Tagebuch aus dieser Zeit, in der die Ereignisse beschrieben wurden. Lord Regan, der vor achtzehn Jahren mit Thelonius in Pitoria gewesen war, wurde als Zeuge angerufen und bestätigte die Version. Und so war aus einer Lüge ohne große Umstände die Wahrheit geworden.
Edyon allerdings hatte Mühe, die Behauptungen seines Vaters zu bekräftigen. Überrascht musste er erkennen, dass er zwar mit Leichtigkeit bei allen anderen Gelegenheiten lügen konnte, nicht aber in Bezug auf seine Mutter oder seine eigene Geburt. Er war Thelonius’ illegitimer Sohn. Seine Eltern waren nicht verheiratet gewesen und dieser Umstand hatte sein ganzes Leben geprägt. Dadurch war er zu dem geworden, der er war, und Edyon hatte schon früh den Entschluss gefasst, sich deswegen nicht zu schämen. Als ihn der Kanzler aufforderte, Thelonius’ Version zu bestätigen, merkte Edyon, dass er seinem Vater im Höchstfall nicht widersprechen konnte. Er sagte: »Ich war nicht dabei. Ich war im Bauch meiner Mutter. Und sie hat nie mit mir darüber geredet.« Mehr brachte Edyon nicht zustande, denn das war keine Lüge, wenn auch nicht die ganze Wahrheit.
Edyons Vater hatte in dieser Hinsicht keine Skrupel, und eines Abends walzte er die Lüge sogar aus – zugegebenermaßen nach ein paar Gläsern Wein – , indem er von der Hochzeit erzählte, als habe sie wirklich stattgefunden. »Eine schlichte Zeremonie, mit den üblichen Versprechungen, an einem Strand, mit dem Meer im Hintergrund – die junge Liebe … Aber wir waren verheiratet.« Er hatte Edyon in die Augen geschaut und gelächelt. »Und jeder sieht doch, dass du mir wie aus dem Gesicht geschnitten bist. Deine Haltung, dein Körperbau – du bist so, wie ich vor zwanzig Jahren war. Es ist offensichtlich, dass du mein Sohn bist.« Und das war die Wahrheit. Wenigstens darüber gab es keine Diskussionen.
»Allerdings machen sich die Lords immer noch etwas Sorgen.« Die Stimme des Kanzlers unterbrach Edyons Gedanken.
»Ach, jetzt sind es also Sorgen«, murmelte Regan.
»Die Lords machen sich immer Sorgen.« Thelonius seufzte und setzte mit einem Blick zu Edyon hinzu: »Über Geld, über Macht, über die Zukunft.«
Und jetzt über mich.
»Und wir müssen aufpassen, dass wir ihre Sorgen nicht übergehen«, fuhr der Kanzler fort. »Der Brief, den Edyon aus Pitoria mitgebracht hat – die Bitte, unsere Streitkräfte mit denen Pitorias zu vereinen – , hat erneut die Befürchtung aufgebracht, dass Calidor seine Unabhängigkeit an einen stärkeren Nachbarn verlieren könnte. Es ist eine alte Angst, aber nur aufgrund ihres Alters nicht weniger machtvoll, Euer Hoheit. Die Lords sind der Meinung, dass eine Allianz mit Pitoria von Ungleichgewicht geprägt wäre, da Pitoria – das viel größere und bevölkerungsreichere Land – Calidor dominieren würde. Was als Hilfsaktion beginnt, könnte damit enden, dass wir überrannt und überwältigt werden.«
»Ein Argument, mit dem wir uns im letzten Krieg schon herumschlagen mussten«, sagte Thelonius.
»In einem Krieg, den wir allein ausgefochten und gewonnen haben«, setzte Lord Regan hinzu.
»Und diese Ängste sind zurückgekehrt, stärker als zuvor. Die Lords wollen eine Garantie dafür, dass Calidor unabhängig bleibt. Sie wollen Gewissheit, dass ihre Zukunft gesichert ist.« Der Kanzler schaute Edyon an und verzog das Gesicht zu einer merkwürdigen Grimasse. Die Winde waren offensichtlich zurückgekehrt. »Es geht das Gerücht, dass Edyon von König Tzsayn von Pitoria geschickt wurde, dass Edyons pitorianische Herkunft möglicherweise seine Loyalität zu Euch beeinflusst.«
»Dass Edyon ein Maulwurf ist? Ein Spion?« Thelonius wirkte geschockt.
»Niemand würde so weit gehen, Euer Hoheit«, versicherte der Kanzler. »Aber wir müssen Vorsicht walten lassen. Edyon braucht die Unterstützung der Lords. Glücklicherweise können wir das mit ein paar einfachen Maßnahmen erreichen.«
»Und was sind das für einfache Maßnahmen, Lord Bruntwood?«, wollte Thelonius wissen.
»Während seiner Investitur muss sich Edyon klar und deutlich zu Calidors Unabhängigkeit bekennen.«
Thelonius nickte. »Damit habe ich kein Problem. Das scheint mir vernünftig und eine gute Lösung zu sein. Bitte trefft die entsprechenden Vorbereitungen, Lord Bruntwood.«
»Gerne, Euer Hoheit.«
»Ist das alles?«
Die Blähungen des Kanzlers schienen immer schlimmer zu werden. »Leider nein. Ich glaube, darüber hinaus müssen wir dafür sorgen, dass niemand auf die Idee kommt, wir könnten mit Pitoria zusammenarbeiten. Während Euer Vorhaben, eine Delegation zu schicken – eine kleine Delegation – , durchaus auf Verständnis stoßen würde, darf sich dieser Austausch weder auf Waffen noch auf Truppen oder Ausrüstung beziehen.«
»Aber was ist mit dem Dämonenrauch?«, fragte Edyon. »Mit der Armee der Jungen?« Der Kanzler schien diesen Punkt nicht ernst zu nehmen.
»Bei allem Respekt, Euer Hoheit, schon eine kleine Delegation erscheint mir eine übertriebene Reaktion auf eine Horde unausgebildeter Bengel, die sich selbst als ›Armee‹ bezeichnen.«
»Aber der Rauch hat eine stärkende Wirkung«, beharrte Edyon. Er musste ihnen das Ausmaß der Bedrohung klarmachen, die unbedingte Notwendigkeit, etwas zu unternehmen. »Ich habe eine Flasche davon mitgebracht. Darf ich die Macht des Rauchs demonstrieren? Wenn die Lords sehen, wie er wirkt, würden sie gewiss besser verstehen, womit wir es zu tun haben.«
Thelonius nickte. »Das ist ein guter Vorschlag, Edyon. Ich bin derselben Meinung: Eine Demonstration vor den Lords wäre nützlich. Lord Regan wird dir helfen, die Sache auf die Beine zu stellen.«
Regan wirkte nicht glücklich über diesen Auftrag, aber er nickte zustimmend.
»Das alles erscheint mir völlig unnötig«, ließ sich der Kanzler vernehmen. »Sie greifen Pitoria an, nicht uns.«
»Noch nicht«, gab Edyon zurück. »Aber die Briganter sind unsere Feinde. Da werden mir die Lords doch wohl zustimmen, oder?«
»Aber gewiss, Euer Hoheit«, sagte der Kanzler. »Nur ist nicht der Feind unseres Feindes auch notwendigerweise unser Freund.«
»Noch ist er notwendigerweise unser Feind!«, schoss Edyon zurück. »Tzsayn ist ein guter Mann. Er würde uns weder betrügen noch infiltrieren oder überwältigen. Er ist nicht wie Aloysius. Er hat uns um Hilfe gebeten. Und im Gegenzug seine Hilfe angeboten. Gemeinsam können wir Aloysius bekämpfen und ihn besiegen.«
Thelonius legte Edyon die Hand auf den Arm. »Ich muss deine Sichtweise mit den Argumenten der Lords in Einklang bringen, Edyon. Wir müssen im Umgang mit Tzsayn größtmögliche Vorsicht und Autonomie walten lassen.«
»Richtig«, nickte der Kanzler. »Unsere Handlung darf für alle ersichtlich nur dem Wohle Calidors dienen. Pitorianische Truppen auf calidorianischem Boden zum Beispiel würden als Bedrohung wahrgenommen werden. Die Lords wissen, was geschah, als gerade einmal vierzig oder fünfzig brigantische Soldaten Zugang zum Königspalast in Tornia erhielten: Viele Edelleute wurden getötet.«
»Das waren Briganter, keine Pitorianer! Tzsayn hat nicht vor, unsere Edelleute zu töten. Das ist doch Unfug!«, rief Edyon.
»Tzsayn ist mit Aloysius’ Tochter verheiratet. Eine Ehe, die von Aloysius arrangiert wurde«, mischte sich Regan ein. »Ich würde ihr nur so weit trauen wie … na ja, wie man einer Frau eben trauen kann. Sie ist eine Marionette, das steht fest. Und wir haben Nachricht erhalten, dass Aloysius Tzsayn freigelassen hat. Tzsayn hat Aloysius gewiss mehr für seine Freiheit versprochen als bloß Gold. Vielleicht hat er ihm versprochen, uns in eine Falle zu locken.«
»Nein.« Edyon schüttelte den Kopf. »Nein, so ist Tzsayn nicht. Und Catherine hasst ihren Vater.«
»Catherine ist unmoralisch«, sagte Regan wegwerfend. »Es geht das Gerücht, dass sie ihren Bruder, Prinz Boris, getötet hat.«
»Dann ist sie ja wohl kaum die Marionette ihres Vaters, nicht wahr?«, bemerkte Edyon.
»Nun, ich bin nicht sicher, ob an diesem Gerücht etwas dran ist, aber wenn es stimmen sollte, stärkt das nicht gerade mein Vertrauen in sie«, erklärte Thelonius.
»Sie ist genauso rücksichtslos wie ihr Vater«, schnaubte Regan.
»Also will niemand etwas unternehmen?« Edyon schaute von seinem Vater zum Kanzler und dann zu Lord Regan. »Ihr lasst zu, dass die Pitorianer allein kämpfen und sterben, dass Aloysius den Dämonenrauch erntet, bis keine Armee auf der Welt sich ihm mehr widersetzen kann, und Ihr sitzt da und wartet darauf, dass er uns angreift. Das ist also Eure Vorstellung von der Zukunft? So wollt Ihr dieses Land verteidigen?«
Mit versteinerter Miene wandte sich Thelonius an Edyon. »Wage nicht, mir vorzuwerfen, ich würde meine Pflichten vernachlässigen, Edyon. Ich habe im letzten Krieg mit meinen Landsleuten gegen Aloysius gekämpft. Viele Männer haben ihr Leben verloren. Ich werde nicht das Risiko eingehen, unser Land an Aloysius zu verlieren. Und auch an sonst niemanden.«
Edyon wurde rot und er senkte den Blick. So hatte er sich das erste politische Treffen mit seinem Vater nicht vorgestellt.
Thelonius wandte sich nun an den Kanzler, die Stimme immer noch steif vor Ärger. »Wir werden eine kleine Abordnung aus Pitoria willkommen heißen – allerdings keine Soldaten – und wir werden selbst eine Delegation entsenden. Wir werden Informationen austauschen. Ihr habt recht, wir müssen uns vergewissern, wer unsere Freunde sind. Wir dürfen nicht zu vertrauensselig sein. Ich hatte gehofft, dass mein Sohn nach seinen jüngsten Erfahrungen in puncto Vertrauen klüger sein würde, aber anscheinend hat er bereits alles wieder vergessen.«
Edyon war klar, dass sein Vater auf March anspielte. March, der versucht hatte, Lord Regan zu ermorden. March, der Edyon an die Briganter hatte verkaufen wollen. March, der dafür verbannt worden war. Edyon hatte March geliebt und respektiert, ihm vertraut. Aber dann hatte er erfahren, dass March ihm gegenüber nicht aufrichtig gewesen war. »Nein, Vater, ich habe es nicht vergessen. Und das werde ich auch nicht. Niemals«, entgegnete er ernst.
Thelonius schaute Edyon an. »Dann vertraue mir und vertraue auf die Lords, die dich unterstützen.« Leiser, sodass nur Edyon ihn hören konnte, setzte er hinzu: »Unsere Lords sind wichtiger für dich als Tzsayn oder Catherine oder irgendeine ausländische Macht. Du musst zuallererst Calidor die Treue halten.«
Edyon nickte und neigte den Kopf. »Natürlich, Vater.«
March
AN DER GRENZEZWISCHEN CALIDOR UND BRIGANT
»Weitergehen. Dein neues Zuhause liegt gleich da vorn.«
March hatte kaum noch Kraft, um die Beine zu heben. Drei Tage hatte es gedauert, um von Calia zur Grenze zu laufen, und in der ganzen Zeit waren seine einzige Nahrung die Krümel gewesen, die ihm die Wachen zugeworfen hatten. Vor ihm erhob sich eine mächtige Steinmauer mit einem Wachturm obendrauf. Der Soldat stieß March mit dem stumpfen Ende seines Speers in den Rücken, um ihn anzutreiben. Im Näherkommen erkannte March, dass in die Mauer Steinstufen eingelassen waren. Kurz unterhalb des oberen Randes verlief ein Absatz, der zu dem Wachturm führte, wo vier Soldaten standen und zu ihm nach unten starrten.
Thelonius hatte diese Mauer nach dem letzten Krieg errichten lassen. Sie bestand aus massivem Stein, mit Festungsanlagen und Wachtürmen, um nach dem Feind Ausschau zu halten und Calidor zu schützen. Es gab auch Tore, eins im Osten und eins im Westen, aber March wusste, dass er keins dieser Tore benutzen durfte. Er war ein Verräter. Er hatte Anteil an dem Plan gehabt, Regan und Edyon zu töten. Die Tore würden ihm versperrt bleiben.
Er fing an, nach oben zu steigen. Die Stufen waren schmal und ihm war schwindelig vor Hunger und Durst.
»Mach voran, du Scheißhaufen!«, schrie der Soldat hinter ihm.
Das Wunderbare an seiner Erschöpfung war, dass March sich nicht um die Soldaten scherte. Ihm war alles egal. Es hätte ihn sogar kaum gekümmert, wenn er abgestürzt wäre. Er setzte einfach nur einen Fuß vor den anderen.
Und dann war er oben, am Rand der Mauer, und schaute auf die andere Seite. Nach Brigant. Das sah doch gar nicht so übel aus – grün, mit saftigem Gras, Büschen und Bäumen. Obwohl es nicht so einfach sein würde, dorthin zu gelangen. Auf der anderen Seite der Mauer gab es nämlich keine Stufen. March sah nach unten in den Abgrund, der in einem Brombeergestrüpp endete. Auf der anderen Seite des Gestrüpps stand eine niedrigere Mauer, die es ebenfalls zu überwinden galt, um nach Brigant zu kommen. Aber erst einmal musste er sich überlegen, wie er diese Mauer nach unten kam. Ansonsten konnte er sich auch gleich in den Abgrund stürzen und seiner Qual ein Ende machen. Aber noch war er nicht bereit, weder zum Klettern noch zum Springen. Stattdessen schaute er hinter sich nach Calidor. Zu Edyon.
In den letzten Monaten hatte er eine weite Reise zurückgelegt – quer durch Pitoria nach Dornan, um Edyon aufzuspüren, dann mit Edyon über das Nördliche Plateau nach Rossarb und wieder zurück, verfolgt von brigantischen Soldaten. Und jetzt erkannte er, wie sehr ihn Edyons Gesellschaft, sein Geist und seine Seele, aufrecht gehalten hatten. Er vermisste Edyon mehr, als er es sich je hätte vorstellen können. Er verließ Calidor und würde nie zurückkehren. Er würde Edyon nie wiedersehen. Wenn er Edyon bloß früher die Wahrheit gesagt hätte, wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Vielleicht hätte Edyon ihn angehört, vielleicht hätte er ihn verstanden.
»Steht dir der Sinn nach einem tränenreichen Abschied, Weißauge?«, polterte ein Soldat. »Tja, die Zeit ist um. Du bist auf unserer Mauer, und wenn du nicht freiwillig runterkletterst, werfen wir dich runter.«
March ahnte, dass die Soldaten ihre Drohung wahr machen würden. Nach einem letzten Blick zu Calidor – Edyons Land, jetzt Edyons Heimat – schwang er sein Bein über die Brüstung, gerade als der erste Soldat hinter ihm den Absatz erreichte, und ließ sich langsam hinab. Mit den Füßen tastete er nach Halt und fand kleine Ritzen, in die er seine Stiefelspitzen graben konnte. Er hangelte sich an dem rauen Stein abwärts, schrammte sich die Knie auf, schaffte es aber irgendwie, sich festzuklammern und nach unten zu klettern. Doch dann rutschte seine Hand ab und er hatte keine Kraft mehr. Halb sprang, halb fiel er das letzte Stück und landete auf Zweigen und Dornenranken. Über ihm brüllten die Soldaten vor Lachen. March schrie schmerzerfüllt auf, erkannte aber schnell, dass er sich nichts gebrochen hatte. Die Dornen hatten ihn zwar zerkratzt und sein Hemd zerrissen, aber ansonsten war er unverletzt. Er kämpfte sich über einen Haufen gesplitterter Zweige und Äste und sah, wie tief der Graben unter ihm war. Das Holz war nicht ohne Grund hier aufgeschichtet worden; er konnte das Pech riechen. Dieser Bereich, dieses Niemandsland zwischen der Grenzmauer von Calidor und der zweiten, niedrigeren Mauer in Richtung Brigant, war eine riesige Feuergrube, die nur darauf wartete, angezündet zu werden.
Er kämpfte sich zu der zweiten Mauer, in die wieder Stufen eingehauen waren – und auch hier wusste er, dass er auf der anderen Seite keine vorfinden würde. Er stieg nach oben, über den Rand und kletterte, so gut er konnte, nach unten. Dann stand er auf brigantischem Boden. Glücklicherweise waren keine Briganter in der Nähe. Er wusste nicht genau, wie die Briganter ihn behandeln würden, aber sie standen nicht in dem Ruf, freundlich und großherzig zu sein. Andererseits – konnten sie schlimmer sein als die calidorianischen Soldaten, die er hinter sich gelassen hatte?
March machte sich auf den Weg. Nur einmal blickte er zurück und sah die Mauern in der Ferne und die Soldaten als Scherenschnittbilder auf den Zinnen. Er folgte dem leicht abschüssigen Hang nach unten, weil er vermutete, dass er dort am ehesten auf eine Straße treffen würde, auf Menschen – und damit auf Nahrung. Die Entdeckung eines Bachs hob seine Laune. Er trank, wusch sich und kühlte seine Füße. Nachdem er sich ausgeruht hatte, folgte er dem Wasserlauf flussabwärts und erreichte schließlich eine gepflasterte Straße. Er hatte nichts dabei, in das er Wasser hätte füllen können, und so trank er noch einmal ausgiebig und nahm dann die Straße nach Osten.
Auf seinem Weg sah March kein Zeichen menschlichen Lebens, abgesehen von der Straße. Am Abend schaffte er es nicht, ein Feuer anzuzünden. Er hatte nichts, nicht einmal eine Decke, um sich zu wärmen. Zum Schlafen legte er sich einfach auf die nackte Erde. Wenigstens konnte er sich ausruhen, wann er wollte. Niemand beschimpfte ihn oder trat ihn. Doch mitten in der Nacht wachte er plötzlich mit klopfendem Herzen auf – immerhin war er in Brigant, im Land seiner Feinde. March kauerte sich am Boden zusammen und lauschte auf die Geräusche der Nacht, doch er konnte nichts hören, was Gefahr bedeutet hätte. Und das war der Moment, in dem die Tränen kamen. Er war allein, wirklich und wahrhaftig allein. Ohne Freunde, ohne Familie, ohne Heimat.
Er dachte an seine letzte Begegnung mit Edyon, in seiner Zelle in Calia. Edyon hatte ihm gesagt, March sei ihm ein wahrer Freund gewesen. Und seine wahre Liebe. Aber March hatte ihn betrogen. Und selbst da, als Edyon ihn mit seinen Gefühlen konfrontierte, hatte March Edyon nicht gestehen können, was er für ihn empfand. Er war sich nie ganz sicher gewesen, ob er Edyon wirklich liebte – bis es zu spät war. Die Tränen liefen über Marchs Wangen und er schloss die Augen. Im Geiste sah er sich Edyon gegenüber, stellte sich vor, wie er ihm sagte, dass er ihn liebte, wie er ihn küsste und um Verzeihung bat. Und in seinen Träumen küsste Edyon Marchs Tränen weg.
Am nächsten Morgen trottete March weiter, bis er einen kleinen Bauernhof etwas abseits der Straße entdeckte. Taumelnd stapfte er hin, um Essen zu erbetteln. Im Hof gab es einen Hühnerpferch, ein paar Ziegen und ein Schwein. Es war ein ärmliches Anwesen, aber March kam es himmlisch vor. Er klopfte an die Haustür, doch niemand öffnete ihm. Er musste essen, er musste einfach. Ein Ei und etwas Ziegenmilch würden ihn einen Tag lang durchbringen. Diese Kleinigkeit konnte der Bauer doch gewiss entbehren.
March schlüpfte in das Hühnerhaus und fuhr mit den Händen über die Regale. Er fand zwei Eier, die er vorsichtig in seine Taschen steckte. Mit leichten Schuldgefühlen ging er wieder hinaus, aber er brauchte noch mehr. Er brauchte eine Decke und einen Wasserschlauch. Das Haus lag still und verlassen da. Traute er sich, hineinzugehen?
»Entweder das – oder elend sterben«, murmelte er, als er die Tür öffnete und eintrat.