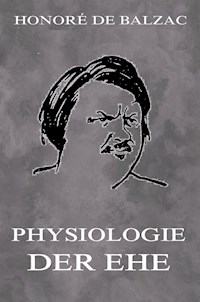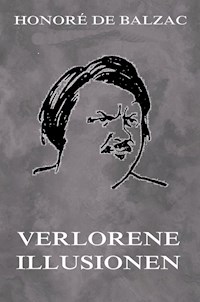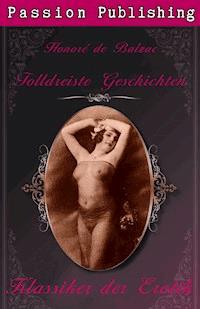
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Passion Publishing
- Kategorie: Erotik
- Serie: Klassiker der Erotik
- Sprache: Deutsch
Dreißig kurzweilige Geschichten über den Hochadel der französische Gesellschaft vom berühmten französischen Romancier. Balzac enthüllt Lust und Leidenschaft, Laster und Leiden und auf brillanter Art das gesamte Spektrum der Skandale und der Verdorbenheit. Dabei klagt er auch die Scheinmoral und den Geiz und Gier des Adels an. Selten gab es erotische Geschichten, die gleichzeitig so mystisch, so frivol, so politisch und so gesellschaftskritisch sind wie Balzacs dreißig "Tolldreiste Geschichten". Faszination pur!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 931
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BALZAC
Die dreißig tolldreisten Geschichten
Inhalt
ERSTES ZEHENT
PROLOG
DIE SCHÖNE lMPERlA
DIE LÄSSLICHE SÜNDE
Wie der gute Ritter Bruyn zu seiner Frau kam
Wie der zahnlose Seneschalk sich mit seiner Frau Jungfrauenschaft herumbiß
Welcher Gestalt eine Todsünde zu einer läßlichen Sünde wird
Welcher Gestalt und von wem die läßliche Sünde begangen wurde
DAS KÖNIGSLIEBCHEN
DER ERBE DES TEUFELS
DIE BELUSTIGUNGEN DES GUTEN KÖNIGS LOYS DES ELFTEN
DIE FRAU KONNETABLE
DER WAFFENBRUDER
DER LUSTIGE PFARRER VON RIDEL-ALZAY
DIE SCHÖNE FÄRBERIN
EPILOG DES ERSTEN ZEHENT
ZWEITES ZEHENT
PROLOG
DREI SCHNAPPHÄHNE
DIE FASTEN DES KÖNIGS FRANZISKUS
SELTSAME REDEN DER NONNEN VON POISSY
WIE DAS SCHLOSS VON RIDEL-ALZAY ERBAUT WURDE
WIE EINE SCHÖNE UND TUGENDSAME FRAU ZUR HURE GEMACHT WERDEN SOLLTE
DIE BRAUTNACHT DES MÖNCHS
EINE TEURE LIEBESNACHT
DIE PREDIGT DES LUSTIGEN PFARRERS VON MEUDON
Der Succubus
Prolog
I. Was das war, der Succubus † In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
II. Wie dem Teufel in Weibsgestalt nun der Prozeß gemacht wurde † ln nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Klageschrift
III. Wie es der Succubus angefangen hat, sich der Seele des alten Richters zu bemächtigen und welches die Folgen waren dieses neuen Hexenzaubers
DIE ABGESCHNITTENE WANGE
DRITTES ZEHENT
PROLOG
AUSDAUERNDE LIEBE
VON EINEM JUSTIZERICH, DER KEIN GEDÄCHTNIS HATTE FÜR DAS »DING AN SICH«
VON DEM MÖNCH AMADOR, DER NACHHER GLORREICHER ABT VON TULPENAU WURDE
DIE REUIGE BERTA
I. Wie Berta im Stand der Ehe eine Jungfrau blieb
II. Wie Berta erfuhr, was die Liebe sei und was sich alles daraus ergeben hat
III. Von dem furchtbaren Strafgericht, das über Berta hereinbrach. Ihre Sühne und ihr seliges Ende
WIE DAS MÄDCHEN VON PORTILLON SEINEN RICHTER ÜBERFÜHRTE
EINE HISTORIE, DURCH DIE BEWIESEN WIRD, DASS DAS GLÜCK NICHT SÄCHLICHEN, SONDERN WEIBLICHEN GESCHLECHTES IST
DER VAGABUND VON ROUEN
MISSLICHE UNTERHALTUNGEN DREIER PILGER
KINDERMUND
DIE HEIRAT DER SCHÖNEN IMPERIA
I. Wie sich Frau Imperia selber in den Netzen fing, mit denen sie sonst die verliebten Täuber zu fangen pflegte
II. Was für ein Ende diese Ehe nahm
ERSTES ZEHENT
PROLOG
Das ist ein Buch von starken Würzen, ein gepfeffertes Buch, kein Buch für den Milchsuppengaumen dummer Jungen. Ein Buch ist es für die Kenner kräftiger und saftiger Bissen, die vom Guten und Besten der Welt den Geschmack auf der Zunge haben, und ist ein Buch für solche Zedier am Spundloch des Lebens, die schon dem unsterblichen Franziskus Rabelais, unsrem Touraner Landsmann ewigen Angedenkens, die liebste Kumpanei und Jüngerschaft waren. Nicht daß der Autor sich einbildet, etwas andres zu sein als ein guter Touraner und etwas andres zu können, als den guten Gesellen dieses fetten und famosen Landes ein paar Schöpflöffel einer nicht alltäglichen Brühe zu kredenzen, dieses Landes, das fruchtbarer ist an gehörnten und hörnerpflanzenden Spaßvögeln als irgendein Land der Welt, darunter nicht wenige sind, vor denen unser ganzes Volk salutiert und noch einige Völker der Erde mit ihm, wie der Meister Courier selig, der nun niemand mehr kitzelt, oder Meister Verville mit seinem Buch »Wie die Welt will beschissen werden«, und andere, die jedermann kennt, den edlen Meister Cartesius ausgenommen. Denn der war ein fast düsterer Geist und hat seine Wolkenträume und Hirngespinste höher gestellt als die guten fetten Bissen und die klaren Tropfen, also daß die Waffelbäcker und Garköche der guten Stadt Tours nichts von ihm wissen noch hören wollen, und wenn man seinen Namen nennt, ein Gesicht machen, als ob sie sagen wollten: >Ist mir nicht vorgestellt.<
Dieses Buch gehört aber zu den Früchten, wie die lustigsten und ausgelassensten Stunden unserer guten alten Mönche sie hervorbrachten und wovon man hier und da in alten Klöstern und Schlössern noch Überbleibsel findet, wie in den weiland fetten Abteien Marmoustiers und Tulpenau, oder etwa auf Fidel-Alzeyt und Schloß Ravenstein-Weiberfreyt und sonst in verstaubten Typotheken jovialer Chorherren und alter Edeldamen, die manchmal ganze Sammlungen davon lebendig mit sich herumtragen. Sie haben die gute alte Zeit gekannt, wo man noch wußte, was Lachen heißt, und man nicht gleich jemand ängstlich ansah, ob ihm nicht ein Heuwagen aus dem Munde komme, wenn’s ihm herausplatzte und den Bauch schütterte, wie es heut bei jungen Dämchen Sitte ist, die so gravitätisch dasitzen, und deren Art zu unserm lustigen Lande paßt wie ein Nachtgeschirr auf das Haupt einer Königin.
Und da das Lachen ein Privilegium des Menschen ist – daran keine andere Kreatur teilnimmt, und wir Grund genug zur Traurigkeit haben in diesen Tagen der sogenannten politischen Freiheit, also daß wir den heiligen Philisterernst, der uns überall anglotzt, nicht auch noch durch Bücher zu vermehren brauchen -, habe ich geglaubt, ein ganz teufelsmäßig patriotisches Werk zu tun, indem ich meinen Zeitgenossen so ein Körbchen voll Lustigkeit schenkte. Wahrhaftig, die Zeit tut mir leid. Wie ein feiner grauer Staubregen rieselt die Langeweile auf uns hernieder und sickert in uns ein durch alle Poren mit ihrer schleimigen Feuchtigkeit, daß es kein Wunder ist, wenn alles die Gehirnerweichung kriegt und unsre alten Sitten zum Ammenmärchen werden, die Sitten von dazumal, wo uns die öffentlichen Angelegenheiten, oder wie man die Lumpereien nennen mag, nur so weit interessierten, als sie uns Stoff zu Spott und Lachen gaben. - Immer seltener werden sie, die alten Pantagruelisten, die keine Zeit hatten, dem König und dem lieben Gott ins Handwerk zu pfuschen, weil ihnen Lachen und Lustigkeit eine wichtigere Sache dünkte; mir scheint, sie sterben aus, und so befürchte ich, daß man die genannten Überbleibsel jener ehemaligen lustigen Breviere, ich fürchte, sage ich, daß man sie verketzern, verleumden und verschimpfieren, daß man sie anspeien und mit Kot bewerfen, daß man sie bepissen und bescheißen wird, was einem Menschen, der noch Respekt hat vor ehrwürdigen Trümmern, nicht Wurscht sein kann und nicht Schwartenmagen.
Wollt auch bedenken, ihr gelbsüchtig-galligen Kritiker, Phrasendrescher und Wortverdreher, die ihr nichts könnt, als die Aspirationen und Inspirationen anderer zu verdächtigen, wollet bedenken, sage ich, daß wir nur als Kinder lachen und daß uns mit der Zeit das Lachen ausgeht, wie einer Lampe das öl. Daraus könnt ihr sehen, daß man zum Lachen unschuldig und reinen Herzens sein muß. Wo ihr aber zusammengekniffene Lippen, hochgezogene Brauen, gerunzelte Stirnen, kurz, finstere Gesichter seht, da dürft ihr sicher sein, daß auch das Herz finster ist und voll Unrat. Nehmt an, dieses Buch sei eine Bildgruppe oder Statue; wollt ihr denn, daß der Autor sie verstümmeln und ihnen da und dort ihre natürliche Beschaffenheit rauben soll? Er wäre ein Esel in der siebenundzwanzigsten Potenz, wenn er auch nur ein Feigenblatt dranklebte, da solche Werke, ebenso wie dieses Buch, ja nicht für Mädchenpensionate bestimmt sind. Immerhin habe ich aus meinen Manuskripten zu meinem großen Ärger und Leidwesen manche kräftigen alten Wörter ausgestrichen, weil ich wohl weiß, daß an so vielen
Leuten nichts keusch ist als die Ohren. Mit Recht können solche Ohren verlangen, daß man Rücksicht auf sie nimmt. Wir wünschen nicht, daß eine jener tugendhaften Damen mit drei Liebhabern im Zorn über uns die schmalen Lippen kräusle. Und kein kleines Verbrechen wäre es, gewissen Jungfrauen ohne Jungfernschaft die Schamröte ins Gesicht zu treiben. Man muß den speziellen Lastern unserer Zeit Rechnung tragen. Auch ist ja die Umschreibung kitzliger als das nackte Wort. Wir sind aber mit der Zeit alt geworden. Lang gesponnene Albernheiten sind uns lieber als die kurzen Frechheiten unsrer Jugend, man kann länger dran saugen und nuckeln. Seid also nicht gar zu wütig gegen mich, geht nicht allzu verschwenderisch um mit euren faulen Eiern und stinkenden Äpfeln, lest auch meinetwegen mein Buch lieber bei Nacht als bei Tag, und vor allem gebt es keiner höheren Tochter in die Hand, das arme Buch könnte Schaden leiden an seiner Seele. Mich selber mögt ihr in den Erzgrund und -boden verfluchen. Um das Buch ist mir nicht angst, es hat denselben Quell und Ursprung wie so viele Dinge, die sich die Welt erobert haben, als zum Beispiel die königlichen Orden vom goldenen Vlies, vom heiligen Geist, der großbritannische Badeorden, der Orden vom Hosenband (honny soit, qui mal y pense) und andre hohe und weltberühmte Institutionen, unter deren Schutz und Schirm ich mich stelle.
>Also seid mir lustig und aufgeräumt, meine Lieben, und lest dies mit fröhlichem Sinn, daß sich eure Lenden und Eingeweide dabei wohl fühlen; wenn ihr mich aber verleugnet, nachdem ihr mich gelesen, so mög’ euch der Beelzebub reiten.<
Diese Worte sind von Meister Rabelais, vor dem wir alle ehrfurchtsvoll den Hut abziehen, als vor dem König der Wissenschaft und aller göttlichen und menschlichen Komödie.
DIE SCHÖNE lMPERlA
Als der Erzbischof von Bordeaux sich nach dem Konzil von Konstanz begab, hatte er in seinem Gefolge einen jungen Priester, einen Touraner, der von feiner, zierlicher Rede und gar einnehmendem Wesen war, denn er galt für einen Sohn der damals weit berühmten schönen Salome und des königlichen Statthalters. Der Erzbischof von Tours hatte ihn seinem Amtsbruder bei dessen Durchreise durch diese Stadt überlassen, quasi zum Geschenk gemacht; solche Geschenke sind unter Erzbischöfen üblich, die wohl wissen, daß, wenn einen die Theologie irgendwo juckt, man einen guten Theologen braucht, um sich kratzen zu lassen.
Und also kam der junge Priester zum Konzil und wurde im Hause seines Prälaten einquartiert, der ein Mann war von guten Sitten und hoher Wissenschaft Philipp von Mala, so war der Name des Priesters, war entschlossen, sich gut zu führen und seinem Beschützer gewissenhaft zu dienen; aber er sah auf diesem Konzil hochheiliger Gottesgelahrtheit viele Leute, die weniger ein gottesgelehrtes als gottesgeleertes und lästerliches Leben führen und darum nicht weniger, sondern mehr Indulgenzen, Goldgulden und Benefizien gewannen als die ändern, die sich eines würdigen und frommen Lebenswandels befleißigten.
Eines Nachts also, als seine Tugend einmal wieder schwere Anfechtungen zu bestehen hatte, flüsterte ihm der Teufel ins Ohr und Hirn, er solle doch nicht so dumm sein und Hunger leiden, während ihm der große Brotkorb vor der Nase hänge; könne doch jeder am Busen unsrer heiligen Mutter, der Kirche, sich satt trinken, ohne daß die Quelle je versiege, durch welches Wunder allein schon die Gegenwart Gottes in seiner Kirche bewiesen werde. Der junge Priester aus unsrem allzeit lustigen Touranerland ließ sich das gesagt sein. Er nahm sich vor, zu bankettieren wie die ändern und sich die deutschen Braten mitsamt der Sauce, Fasttage hin, Fasttage her, wohl schmecken zu lassen, wo sie nichts kosteten; denn der gute Jüngling war arm wie eine Kirchenmaus.
Da er sehr enthaltsam lebte, indem er sich seinen alten Erzbischof zum Muster nahm, der nicht mehr sündigte, weil er es nicht mehr konnte, und darum für einen Heiligen galt, hatte sein Fleisch fast immer böse Anfechtungen, und seine Seele wurde darüber voll Traurigkeit, um so mehr, als er nirgends jenen verführerischen Frauenzimmern ausweichen konnte, die so offen und freigebig ihre Reize zur Schau trugen, aber kalt waren wie Eis, wenn es sich um einen armen Teufel handelte, der keine drei Silberlinge im Beutel hatte. Sie waren aus der ganzen Welt zusammengekommen, um mit dem Licht ihrer Schönheit die Köpfe der versammelten Väter zu erleuchten. Und also war der junge Priester voller Verzweiflung, weil er kein Mittel fand, sich eine von den glänzenden Elstern zu zähmen, die sogar mit Kardinälen, mit Äbten, Hoch- und Großmeistern, Oberappellationsräten, Legaten, Bischöfen, Fürsten, Herzögen und Markgrafen oft so wenig Federlesens machten, wie wenn es arme Schreiber gewesen wären ohne einen Pfennig in der Tasche.
Oft, wenn er abends sein Gebet verrichtet hatte, dachte er es sich aus, wie er eine der Kostbaren anreden wolle; er komponierte sich selber eine Art Liebesbrevier mit Anreden und Antworten mit Antiphonen und Responsorien für alle Fälle. Und wenn er dann tags darauf nach der Vesper einer dieser Prinzessinnen begegnete, wie sie mit ihrer fleischlichen Üppigkeit sich in ihrer Sänfte breitmachte, von dienenden Pagen begleitet, gebläht von Stolz, da stand er mit offenem Mund verlegen wie ein Hund, der vergeblich nach einer Fliege jappt, und starrte nur idiotisch in das Feuer ihrer Augen, das ihm das Herz versengte, wie ein Licht die arme graue Motte.
Der Geheimschreiber des Erzbischofs, ein Edelmann aus dem Land der schwarzen Trüffeln, hatte ihm gestanden, daß die Väter der Kirche, Prokuratoren und Appellationsräte den Beutel weit aufmachen müßten, weil sie anders keinen Zutritt fänden bei den vornehmsten dieser verhätschelten Katzen, die nicht für irgendein Stück Heiligknochen noch Ablaßversprechen, sondern nur für Schmuck und Geschmeide in Gold und Edelstein guter Laune gemacht werden könnten, und von denen eine jede unter den Großherren und Fürsten des Konzils ihren besonderen Protektor habe. Da kam der arme Touraner, so sehr Nestling und unflügg er war, auf den Einfall, sich einen Schatz anzulegen, und er sammelte in seinem Strohsack all die Silberlinge, die ihm der gute Erzbischof für seine Schreibereien zukommen ließ, und hoffte eines Tages genug zu haben, um der Leibhure eines Rotmantels oder Kardinals ein wenig aufzuwarten. Das übrige stellte er Gott anheim. Seine Ausstattung war vom Kopf bis zu den Füßen so schäbig, daß man eine Ziege mit einer Nachthaube auf den Hörnern eher für ein Fräulein als ihn für ein Ebenbild Gottes gehalten hätte. Aber von der Begierde angestachelt, trieb er sich jede Nacht in den Straßen von Kostnitz herum, unbekümmert um sein Leben und ewig in Gefahr, die Hellebarde eines Landsknechts ins Gedärm zu bekommen. So lauerte er den Kardinälen auf, die nächtlich zu ihren Schönen schlichen.
Da sah er, wie in dem Haus die Wadiskerzen angezündet und alle Fenster und Kreuzstöcke hell wurden. Wenn er dann horchte, hörte er, wie die geweihten Äbte und andre sich lustig machten, wie sie vom Besten tranken und das geheime Halleluja der Liebe anstimmten, ohne sich viel aus der Musik zu machen, die man ihnen dazu aufspielte. Die Küche tat auch wahre Wunder und sorgte dafür, daß die Hora nicht langweilig wurde. Präludiert wurde mit fetten, kräftigen Brühen, die Metten wurden mit Schinken eingeläutet, dann kam die Bratenvesper, und verzuckerte Früchte und andere leckere Bissen machten als die Lauden den Beschluß. Nach langer tumultöser Fresserei und Sauferei trat dann Silentium ein. Die Pagen spielten mit Würfeln auf den Stufen der Treppe, die Maultiere, die auf der Straße warteten, schlugen und bissen nacheinander, um doch auch einen Zeitvertreib zu haben. Alles ging zum besten. Wahrlich, da war noch Glaube und Religion, und darum haben sie auch den Gevatter Hus verbrannt. Und der Grund dafür? Er wollte in die Schüssel langen, ohne daß ihn jemand aufgefordert hatte. Es ist ihm recht geschehen; warum wollte er auch ein Hugenotte sein, ehe die Hugenotten erst erfunden waren.
Um auf den allerliebsten kleinen Philipp von Mala zurückzukommen. Er erwischte wohl mandien Schlag und Rippenstoß, aber der Teufel flößte ihm Mut ein, indem er ihm zuflüsterte und ihn in dem Glauben und der Zuversicht stärkte, daß früher oder später die Reihe an ihn kommen müßte, Kardinal zu werden, wenigstens bei der Hure eines Kardinals. Die Begierde machte ihn tollkühn, gleich einem Hirsch in der Zeit der Brunst, so sehr, daß er sich eines Abends in das schönste Haus von Kostnitz einschlich, auf dessen hoher Staffel er öfter ein hochnäsiges Pack von Bedientenvolk bemerkt hatte: Stallknechte, Kammerdiener, Pagen, Läufer, die mit brennenden Fackeln ihre Herren erwarteten, als da waren Herzöge, Könige, Kardinäle und Erzbischöfe.
»Ah«, seufzte er, »die da muß wohl über alle Maßen schön und verführerisch sein.«
Ein bewaffneter Landsknecht ließ ihn durchschlüpfen, weil er glaubte, daß er zum Gefolge des Kurfürsten von Bayern gehöre, der gerade das Haus verlassen und vielleicht etwas vergessen hätte, was er durch seinen Kaplan wollte zurückholen lassen. Schnell und geschmeidig wie ein Windhund erstieg Philipp von Mala, vom Liebesteufel gepeitscht, die Treppe, und ein deliziöses Rüchlein von Spezereien brachte ihn, er brauchte nur seiner Nase nachzugehen, in die Nähe des Gemachs, wo gerade die Herrin mit ihren Frauen über ihren Schmuck und Anzug parlamentierte und beratschlagte. Ein jäher Schreck durchfuhr ihn. Wie ein Dieb, vor dem plötzlich die Häscher auftauchten, stand er da. Das Weibsbild war ohne Häubchen und Hemd, und die Dienerinnen und Zofen, damit beschäftigt, ihre Dame für die Nacht zu schmücken, hatten gerade den weißen Kern, ich will sagen ihren Körper, blink und blank aus seinen Hüllen herausgeschält, daß das arme Pfäfflein unter der Tür wie in einen Zauberspiegel zu blicken vermeinte und ein »Ah« ausstieß, das die ganze Not seiner Seele und seines Körpers verriet.
»Was willst du, Kleiner?« fragte die Kurtisane.
»Euch meine Seele bringen«, antwortete er, indem er sie mit den Augen verschlang.
»Komm morgen wieder her!«
Das klang höhnisch und wenig einladend; aber Philipp, rot bis über die Ohren, antwortete mit Anstand:
»Ich werde nicht verfehlen, schöne Frau.«
Sie brach in ein schallendes Gelächter aus. Philipp verstummte, blieb aber lüstern und behaglich stehen, immer die begehrlichen Blicke auf sie geheftet. Er schlug durchaus nicht die Augen nieder vor all den enthüllten Heimlichkeiten, wie etwa diesem aufgelösten üppigen Haar, das über den Rücken niederfloß, der schimmerte wie poliertes Elfenbein und zwischen den dunklen welligen Strähnen wollüstig aufleuchtete.
Sie trug auf der Stirn einen geschliffenen Rubin, der aber weniger Feuer ausstrahlte und Blitze warf, als ihre schwarzen Augen, in denen die Lachtränen schimmerten. Mutwillig warf sie ihren Schnabelschuh in die Höhe, der mit Gold gestickt war wie ein Meßgewand, dabei machte sie eine unzüchtig kitzlige Bewegung und zeigte einen Fuß, kleiner als der Schnabel eines Schwans. Sie war diesen Abend gut aufgelegt, sonst hätte sie das Tonsurmännlein zum Fenster hinausschmeißen lassen, ohne sich mehr um ihn zu kümmern als um ihren ersten Bischof.
»Er hat schöne Augen, Herrin«, sagte eine der Zofen. »Aus was für einem Mausloch ist er denn herausgeschlüpft?« fragte die andere.
»Das arme Kind!« spottete die Herrin, »seine Mutter wird ihn suchen, man muß ihn auf den rechten Weg zurückbringen.«
Der Touraner kam aber nicht aus der Fassung; er betrachtete mit Verzückung und Bewunderung das Bett von Goldbrokat, das diesen Leib voll Wollust in sich aufnehmen durfte. Dieser Blick, der von tiefer Wissenschaft der Liebe sprach, erregte die Phantasie der Dame; halb noch scherzend, halb schon verliebt in den Kleinen, wiederholte sie ihr »Morgen!« und entließ ihn mit einer Geste, vor der selbst Papst Johann sich geduckt hätte, um so mehr, da der Arme jetzt eine Schnecke war ohne Gehäuse, da das Konzil ihn soeben entpapstet hatte.
»Da habt Ihr, gestrenge Frau, schon wieder ein Gelübde der Keuschheit in sündige Begier verwandelt«, sagte eins der Weibchen.
Und das tolle Gelächter begann von neuem. Philipp aber schlich sich davon, er war betäubt wie ein berauschter Gimpel von dem Anblick dieser Kreatur Gottes, die weißer leuchtete und heftiger zum Zugreifen reizte als eine richtige Sirene, wenn sie just aus den Wellen des blauen Meeres auftaucht.
Er merkte sich die eingemeißelte Schilderei vor der Haustür, irgendein phantastisches Tier, und Seele und Leib voll Teufeleien und sündiger Gedanken kam er nach Hause zu seinem guten alten Erzbischof. Er stieg auf sein Zimmer hinauf und zählte die ganze Nacht seine Silberlinge, konnte aber nie mehr als vier herausbringen. Da das nun sein ganzer St. Habemus war, dachte er, die Dame werde wohl zufrieden sein, wenn er ihr alles gäbe, was er auf der Welt sein eigen nenne.
»Was ist denn mit Euch, Philipp?« fragte ihn der fromme Erzbischof, der auf das unruhige Wesen und das verstohlene Geseufz seines Schreibers aufmerksam geworden war.
»Ach, gnädiger Herr«, antwortete der arme Priester, »ich wundere mich, wie ein so zierliches und sanftes Wesen von Frau einem so schwer auf dem Herzen liegen kann.«
»Welche denn?« erwiderte der Erzbischof, indem er sein Brevier auf die Seite legte, das dieser Gute für die ändern betete.
»Beim Erlöser«, antwortete Philipp, »Ihr werdet böse auf mich werden, mein gnädiger Herr und Protektor, denn ich habe eine gesehen, die das Liebchen von wenigstens einem Kardinal ist. Und ich habe geweint, da es mir schien, daß mir mehr als ein verdammter Taler fehle, um die Harte auch nur halbwegs zur Mildtätigkeit zu bekehren und …«
Der Erzbischof verzog den Accentum circumflexum, der ihm auf der Nase saß, und sagte kein Wort, also daß der bescheidene Priester zitterte in seiner armen Haut und es bitter bereute, seinem Vorgesetzten gebeichtet zu haben. Aber da sagte der heilige Mann plötzlich: »Ist sie denn so teuer?«
»Oh«, rief der Jüngling, »sie hat sich von mancher Mitra die Borten abgetrennt und aus mehr als einem Krummstab die Rubine ausgebrochen.«
»Philipp«, antwortete der Erzbischof, »wenn du mir versprichst, nicht mehr an sie zu denken, will ich dir dreißig Silberlinge aus dem Schatz der Armen geben.«
»Gnädiger Herr, dabei würde ich zuviel verlieren«, sprach der junge Priester, dessen Kopf voll war von den Vorstellungen an die leckere Schüssel, die er sich versprach.
»O Philipp«, entgegnete ihm der gute Bordelenser, »du willst also dem Teufel in die Arme rennen und Gott mißfallen, wie unsere Kardinäle?«
Und der fromme Seelenhirt, innerlichst von Schmerz bewegt, wandte sich im Gebet an den heiligen Gatian, den Patron der Keuschen, und empfahl ihm das Heil seines Dieners. Diesen ließ er niederknien und forderte ihn auf, auch den heiligen Philipp, seinen eignen Patron, um seinen Schutz anzurufen. Aber das verflixte Pfäfflein flehte heimlich den Heiligen um eine ganz andre Hilfe an, nämlich ihm Kraft zu geben, daß er in Ehren bestehen möge, wenn die Schöne ihm morgen gnädig und barmherzig sein sollte. Der gute Erzbischof aber war sehr erbaut von dem inbrünstigen Gebet seines treuen Dieners, er rief: »Mut, mein Sohn, der Himmel wird dich erhören!«
Am ändern Tag, während der Erzbischof auf dem Konzil gegen die schamlosen Ränke und Frechheiten dieser Apostel der Christenheit vergebens ankämpfte, war Philipp von Mala damit beschäftigt, seine Silberlinge, die er unter dem Schweiße seines Angesichts verdient, für Bäder, Spezereien, kostbare Salben und andere Allotria auszugeben. Er salbte sich wie eine Braut am Hochzeitsmorgen, dann machte er sich auf in die Stadt, ob er auch das Haus seiner Herzenskönigin noch fände, und als er einen Vorübergehenden fragte, wem der Palast gehöre, lachte ihm der Mann unter die Nase und sagte: »Ist der dumme Kerl von heute, daß er noch nichts von der schönen Imperia weiß?«
Da war der gute Klerikus fast sicher,, daß er seine armen Silberlinge dem Teufel in den Rachen geschmissen hatte; der berühmte Name ließ ihn das Verzweifelte seines Unternehmens im hellsten Lichte sehen.
Imperia war bekannt in der ganzen Welt als die hochmütigste und launenhafteste Dame ihres Handwerks, Sie galt außerdem für die strahlendste Schönheit, und man sagte ihr nach, daß Kardinäle, Soldatenführer und andre rohe Leuteschinder und Volksunterdrücker sich von ihr nur so um den Finger wickeln ließen. Sie hatte zu ihrer eignen Verfügung tapfere Hauptleute, Bogenschützen und Kavaliere, die bereit waren, ihr in jeder Sache zu Befehl zu sein. Ein Zucken ihrer schönen Wimpern genügte, um einen jeden ermorden zu lassen, der es gewagt hatte, ihr auch nur ein Haar zu krümmen. Für ein halbes Lächeln brachte man ihr so viel abgeschlagene Menschenköpfe, wie sie haben wollte. Ein gewisser Herr von Baldricourt, ein Kriegshauptmann des Königs von Frankreich, fragte sie oft im Scherz, ob heut nicht jemand für sie umzubringen sei, und mancher Abt oder Erzbischof, der zugegen war, erblaßte bei dem Witz.
Nur mit den höchsten Kirchenfürsten nahm sie sich zusammen, sonst ließ sie alle Welt an ihrem Schnürchen tanzen und schwang lachend dazu ihre Rute, so groß war der Zauber ihrer gottverdammten Schönheit und die Anziehungskraft ihrer Liebespraktiken. Nie versagte diese Leimrute. Die Tugendhaftesten und Unempfindlichsten verfingen sich daran wie die Gimpel. Darum war sie auch mit Respekt umgeben, wie die wahren Damen und Prinzessinnen. Jedermann nannte sie Frau und Herrin. Und als einmal eine stolze und tugendhafte Dame sich bei dem Kaiser Sigismund deswegen beklagte:
»Ihr, würdige Frau«, antwortete er ihr, »rühmt Euch mit Recht, die Hüterin frommer Sitten zu sein, dafür ist Frau Imperia die Hüterin der weniger frommen, aber um so angenehmeren Sitten, die sich von der Göttin Venus herschreiben; eines schickt sich nicht für alle …« Wahrhaft christliche Worte, die den ehrenhaften Damen sehr zum Ärgernis gereichten, aber ganz mit Unrecht.
Philipp dachte an den berauschenden Trank seiner Augen in der vergangenen Nacht und fürchtete sehr, daß es bei diesem Vorgeschmack bleiben möchte. Da überkam ihn eine dumpfe Traurigkeit. Ohne an Essen oder Trinken zu denken, trieb er sich in der Stadt umher und harrte so der Stunde entgegen; denn er war viel zu wählerisch und feinschmeckerisch, um sich mit einer ändern zu begnügen, die leichter zugänglich gewesen wäre als Frau Imperia.
Die ungestüme Begierde peitschte ihn, ein vorweggenommener Stolz ließ ihn über sich selbst hinauswachsen; dann wieder glaubte er ersticken 'zu müssen an seiner Leidenschaft, und als die Nacht endlich gekommen war, schlich er sich wie ein Aal in das Haus derer, die sich in Wahrheit die Königin des Konzils nennen durfte; denn vor ihr beugten sich alle Autoritäten, alle göttlichen und menschlichen Wissenschaften, alle Lehrer und Väter der heiligen Kirche. Der Hausmeister, der ihn nicht kannte, machte gerade Miene, ihn zur Tür hinauszuschmeißen, aber eine Zofe, die oben an der Treppe erschien, tat ihm Einhalt:
»Meister Imhof«, rief sie, »das ist der Kleine unsrer Frau.«
Und der arme Philipp, rot und voll Seligkeit wie eine Brautnacht, stolperte berauscht die Treppe hinauf. Die Zofe nahm ihn bei der Hand und führte ihn in den Saal, wo die Herrin, vorläufig nur leicht geschmückt, sich in süßer Faulheit herumräkelte. Sie saß vor einem Tisch, der mit goldverbrämtem Samt bedeckt und ganz mit Schüsseln und Tellern und tausenderlei kostbaren Gefäßen überfüllt war. Neben antiken Trinkschalen standen zierliche venezianische Gläser und neben hohen geschliffenen Flaschen dickbäuchige Krüge alten Zyperweins. Hypokras und andere gewürzte Getränke dufteten aus riesigen Kannen neben ganzen Körben voll Spezereien und leckerer Süßigkeiten; Schüsseln voll grüner Kapern, geräucherte Schinken, gebratene Pfauen luden zu derberen Genüssen ein. Dem Priester wäre zu andrer Stunde das Wasser im Maul zusammengelaufen, doch ihm stand jetzt einzig der Sinn nach Frau Imperia. Sie merkte, daß er nichts sah außer ihr, und obwohl an die ketzerische Devotion der tonsurierten Häupter und ihre Andacht vor dem Altar des Strohsacks gewöhnt, fühlte sie sich dennoch sehr geschmeichelt; denn sie hatte sich wahrhaftig über Nacht in den armen Touraner verliebt, und auch den ganzen Tag war er ihr nicht aus dem Sinn gekommen.
Die Fenster waren geschlossen, die ganze Zurichtung und die Buhlerin selbst sahen danach aus, als ob sie mindestens einen Fürsten des Römischen Reiches erwarte. Dem Schlingel von Pfaffen, ganz in Ekstase vor der allerheiligsten Schönheit der Imperia, ging übrigens die Ahnung auf, daß weder ein Kaiser noch Burggraf, noch Kardinal und Papstkandidat heute abend gegen ihn aufkommen werde, gegen ihn, das arme Pfäfflein, das nichts in seiner Hosentasche und seinem Hosenlatz beherbergte als den Amor und den Teufel. Er benahm sich auch ganz wie ein großer Herr, warf sich in die Brust und machte eine höfische Verbeugung, die gar nicht linkisch ausfiel; die Dame warf ihm einen flammenden Blick zu, und mit einer einladenden Handbewegung:
»Setzt Euch neben mich«, sagte sie, »ich möchte wissen, ob Ihr Euch seit gestern verändert habt?«
»Nicht wenig«, antwortete er.
»Wieso?« fragte sie.
»Gestern«, erwiderte der Spitzbube, »gestern habe ich Euch geliebt…
heute lieben wir uns; ein armer Schwartenhals war ich gestern, und reicher als ein König bin ich heute.«
»Kleiner, Kleiner«, rief sie belustigt, »du hast dich wirklich verändert, aus einem simpeln Pfaffen bist du, wie ich sehe, ein geriebener Teufel geworden.«
Und beide setzten sich zusammen vor das Kaminfeuer, das gleichsam wie ein Widerschein ihrer innern Glut das Gemach mit wohliger Wärme erfüllte. Ans Essen dachten sie nicht, sie schnäbelten sich mit den Augen und rührten nicht an die Schüsseln.
Als es so den beiden gerade am schönsten behagte, entstand plötzlich ein wüster Lärm vor der Tür, wie wenn man sich draußen raufte und zankte.
»Herrin«, rief die Zofe, die in Eile hereinstürzte, »nun wird gleich eine andere Tonart anheben!«
»Was?« schrie die Buhlerin zornig und mit dem Ton eines übelgelaunten Tyrannen, den man stört.
»Der Bischof von Chur will Euch sprechen.«
»Hol’ ihn der Teufel!« rief sie, indem sie Philipp einen verliebten Blick zuwarf.
»Er hat durch den Spalt Licht gesehen und macht einen wahren Höllenlärm.«
»Sage ihm, daß ich Fieber habe, und du wirst nicht lügen; denn ich bin wahr und wahrhaftig krank an dem Pfäfflein hier, das mir den Sinn verrückt hat.«
Aber sie hatte ihre Rede, wobei sie die heiße Hand Philipps inbrünstig drückte, noch nicht zu Ende gebracht, als der dicke Bischof von Chur zorngerötet und pustend hereinpolterte. Seine Läufer folgten ihm, sie trugen eine riesige Lachsforelle, frisch im Rhein gefangen, auf einer Schüssel von eitel Gold, auch Spezereien in kunstreichen Schalen und tausend leckere Bissen nebst zauberkräftigen Essenzen und Likören, wie die Nonnen seiner Abtei sie zu bereiten pflegten. ,
»Schockschwerenot!« keuchte und schnaubte der Bischof, »ich kann es ab warten, bis mich der Teufel holt, mein süßer Schatz; wenn du mich aber etwa vor der Zeit zum Teufel schicken wolltest…«
»Euer Wanst wird eines Tages eine gute Degenscheide geben«, antwortete sie. Ihr Blick, kurz zuvor noch so sanft und lieb, wurde drohend wie ein gezückter Dolch.
»Und der Chorknabe da, kommt der schon für die Seelenmesse?« fragte der Bischof geringschätzig, indem er sein breites, rotes Gesicht dem zierlichen Philipp zuwandte.
»Gnädiger Herr«, erwiderte dieser, »die schöne Frau hat mich für ihre Beichte rufen lassen.«
»Oho! Bist du so unwissend im kanonischen Gesetz? Die Frauen zur Beichte hören, zu solcher Stunde der Nacht und an einem Orte, der den Bischöfen Vorbehalten ist… Auf, bleib bei deinem Leisten, Schuster, bleib bei deinen Nönnlein, Mönch; unter Strafe der Exkommunikation verbiete ich dir, hierher zurückzukommen.«
»Nein, bleibt!« schrie in flammender Empörung die schöne Imperia, die aber im Zorn noch schöner war als in der Liebe, schon deswegen, weil hier beides zusammen war, Liebe und Zorn. »Bleibt, mein Freund, Ihr seid hier zu Hause.«
Da erkannte er, daß er geliebt sei.
»Steht es nicht in Eurem Brevier und vor allem in den Evangelien, daß wir alle gleich sind vor Gott im Tal Josaphat?« fragte sie den Bischof.
»Das ist eine Erfindung des Teufels«, schrie der fette Koloß, »er hat die Bibel gefälscht; aber geschrieben steht es«, setzte er ruhiger hinzu, indem er nach der gedeckten Tafel schielte.
»Und also seid ihr beide auch gleich vor mir, die ich hier auf Erden eure Göttin bin«, erwiderte die Imperia. »Wenn es Euch aber nicht gefällt«, wandte sie sich an den Bischof, »so werde ich Euch eines Tages zwischen Kopf und Schultern mit aller Zärtlichkeit strangulieren lassen, das schwöre ich Euch bei der Allmacht meiner Tonsur, die mindestens so viel wert ist wie die des Papstes.«
Da es aber schade gewesen wäre, wenn man die Forelle hätte kalt werden lassen, und da ihr auch die goldene Schüssel, die Konfektschalen und die kostbaren Essenzen in die Augen stachen, lenkte die Buhldirne geschickt ein:
»Setzt Euch«, sagte sie, »esset und trinket.«
Ihrem Liebling gab das durchtriebene Weibsbild, das diese geistreiche Komödie nicht zum ersten Male aufführte, durch einen Wink zu verstehen, daß er nur keine Angst haben solle vor dem fetten Deutschen, der gar bald über dem Bacchus den Amor gründlich vergessen werde.
Die Zofe war dem dicken Bischof behilflich, sich am Tisch bequem zurechtzurücken. Philipp aber fand vor Wut kein Wort. Er sah bereits sein ganzes Glück in Rauch aufgehen und wünschte dem Schmerbauch von Prälaten mehr Teufel auf den Hals, als es Mönche auf Erden gibt.
Sie waren schon weit in der Mahlzeit vorgerückt, und der junge Priester hatte noch keinen Bissen berührt; ihn hungerte allein nach der Herrin des Hauses, er schmiegte sich eng an sie und brachte kein Wort über die Lippen. Um so beredter war er in jener Sprache, die die Damen verstehen - ohne Beistriche, ohne Punkte und Ausrufungszeichen, ohne Akzente, ohne große und kleine Buchstaben, ohne Tropen und Metaphern, ohne Glossen und Randbemerkungen und Illustrationen.
Der dicke Bischof, ein großes Leckermaul und sehr besorgt um das geistliche Gewand von geweihter Haut, in das ihn seine verstorbene Mutter eingenäht hatte, ließ sich von der zarten Hand der Herrin ein Glas nach dem ändern vollschenken, mit Zyperwein, mit Hypokras, mit Lacrimae Christi und was es sonst geben mochte. Als er gerade zum ersten Male laut rülpste, hörte man plötzlich auf der Straße den lauten Tumult einer Kavalkade. Die Menge der Pferde, die lauten >Hoho<, >Hollaho< und >Brr Brr< der Stallknechte zeigten an, daß mindestens ein Fürst im Begriff stand, den Tempel der Liebe zu stürmen.
So war’s, die Saaltür wurde aufgerissen, und der Kardinal von Ragusa, dem die Hausknechte nicht gewagt hatten in den Weg zu treten, trat breitspurig in das Gemach. Bei diesem Anblick zuckte die Buhlerin zusammen wie ein Hund, den man auf den Schwanz getreten, und ihrem Kleinen fiel das Herz in die Hosen; denn leichter war mit dem Teufel Kirschen essen als mit diesem Rotmantel, um so mehr, als man im Augenblick nicht wußte, wer am ändern Tag Papst sein werde, da die drei Prätendenten zur Beruhigung der Christenheit freiwillig auf die dreifache Krone verzichtet hatten.
Der Ragusa, ein ganz durchtriebener Italiener mit schönem schwarzem Bart, ein Schlaukopf ersten Ranges, der größte Kabalenmacher des Konzils, brauchte nur halb hinzusehen, um zu wissen, wo Barthel den Most holt. Im Nu war sein Plan bedacht, wie er hier manövrieren müsse, damit er mit seinem Appetit nicht zu kurz komme. Er war geil wie ein Mönch, und wenn man ihm seine Beute streitig machte, hätte es ihn wenig gekostet, sieben Nebenbuhler niederzustoßen und im Notfall seinen Splitter vom heiligen Kreuz zu verkaufen, was doch ein großes Sakrilegium gewesen wäre. Mit einem Wort rief er Philipp zu sich heran. Der arme Touraner war mehr tot als lebendig; er ahnte gleich, daß ihm der Teufel da eine böse Suppe eingebrockt habe.
»Was beliebt Eurer Eminenz?« sagte er kleinlaut zu dem fürchterlichen Kardinal.
Dieser nahm ihm am Arm, führte ihn nach der Treppe, und ohne erst nach einer Laterne zu rufen, bohrte er seine Augen in die des jungen Priesters.
»Bei der Mutter Gottes«, rief er, »du bist kein übler Geselle, und ich möchte nicht gezwungen werden, deinen Kopf darüber zu belehren, wie schwer dein Wanst ist...; eine solche Genugtuung könnte mich in meinem Alter eine fromme Stiftung und einen Beutel Dukaten kosten ...; also wähle: entweder dich mit einer Abtei zu verheiraten für dein ganzes Leben, oder mit Frau Imperia für diesen Abend und morgen zu sterben.«
Der arme Touraner war in Verzweiflung.
»Und wenn Ihr abgekühlt seid, gnädiger Herr, darf ich dann wiederkommen?«
Da hätte der Kardinal fast gelacht; er sagte aber streng:
»Wähle, das hänfene Halsband oder die Mitra!«
»Aber nicht wahr«, sagte das Pfäfflein boshaft, »eine große Abtei!«
Der Kardinal trat in den Saal, griff nach einem Schreibzeug und kritzelte auf einen Fetzen Papier eine Anweisung an den Botschafter von Frankreich.
»Gnädiger Herr«, erlaubte sich der Touraner zu bemerken, indem er den Namen der Abtei buchstabierte, »der Bischof von Chur hier wird aber nicht so schnell wegzukriegen sein wie ich, denn er hat mehr Abteien in seiner Diözese, als die Soldaten Kneipen haben in der Stadt. Übrigens ist er besoffen wie ein Landsknecht. Und seht, um Euch meinen Dank abzustatten für die herrliche Abtei, bin ich Euch wohl eine Warnung schuldig ... Ihr wißt, wie bösartig die verdammten schwarzen Blattern sind, die unheimlich um sich greifen und im letzten Jahr ganz Paris grausam verheert haben. Also sagt ihm, daß Ihr geradeswegs von Eurem alten Freund, dem Erzbischof von Bordeaux kommt, dem Ihr die Sterbesakramente gebracht. Ihr werdet sehen, wie er wegstiebt, gleich der hohlen Spreu, wenn ein Windstoß in sie fährt.«
»Oh!« rief der Kardinal, »du verdienst mehr als eine Abtei. Bei der Mutter Gottes, mein kleiner Freund, hier sind tausend Goldgulden für deine Reise nach der Abtei Tulpenau. Ich habe sie gestern im Spiel gewonnen, ich schenke sie dir.«
Die letzten Worte hörte die Löwin Imperia, und da zu gleicher Zeit Philipp von Mala verduftete, ohne daß er ihr auch nur einen letzten Blick der Huldigung und Liebe gegönnt, worauf sie so schmerzlich gewartet hatte, da fauchte sie wie ein Uhu, im Innersten ergrimmt über die Verzagtheit des elenden Priesters; denn noch war sie nicht genug Katholikin, um es ihrem Geliebten zu verzeihen, nicht kaltblütig in den Tod zu rennen, wenn es ihr zufällig ein Vergnügen machte. Der giftige und verächtliche Blick, den sie ihm nachwarf, hatte keine geringere Bedeutung als die eines Todesurteils.
Der Kardinal rieb sich die Hände. Dieser italienische Wüstling und Strohsackpurzier zweifelte keinen Augenblick, daß die Abtei in kürzester Frist wieder in seinen Händen sein werde. Der Touraner aber, unbekümmert um das alles, drückte sich in aller Stille, ließ die Ohren hängen und zog den Schwanz ein wie ein nasser Pudel, den die Magd aus der Küche jagt.
Die Buhlerin seufzte tief, sie hätte in diesem Augenblick die ganze Menschheit mißhandeln mögen, wenn sie sie unter den Händen gehabt hätte; das Feuer, das ihr in den Eingeweiden brannte, war ihr zu Kopf gestiegen, die ganze Luft um sie herum knisterte von Funken. Das war der erste Priester, der ihr das zu bieten wagte. Der Kardinal aber lächelte von neuem, er hoffte, aus ihrer großen Wut Münze zu schlagen.
War das nicht ein geriebener Gesell? Wahrlich, er trug nicht umsonst einen roten Hut.
»Ah, guter Gevatter«, sagte er zu dem Bischof, »ich freue mich Eurer Gesellschaft und schmeichle mir, daß es mir gelungen ist, den ruppigen Küster zu vertreiben, der wahrhaftig unsrer schönen Frau nicht würdig war; auch Ihr müßt mir das danken, meine leckere, weiße Maus, Ihr hättet durch seine Berührung eines Euch unwürdigen und gar schimpflichen Todes sterben müssen.«
»Wie? Wieso?«
»Er ist der Schreiber des Herrn Erzbischofs von Bordeaux... Der gute Greis aber ist heute morgen von der schwarzen Pest...«
Bei diesen Worten sperrte der Bischof den Mund auf, wie wenn er einen Schweizer Käse hätte verschlucken wollen.
»Teufel, woher wißt Ihr das?« fragte er.
»Woher?« antwortete der Kardinal, indem er die Hand des guten Deutschen ergriff, »ich habe ihm vorhin die letzte Ölung gebracht. In diesem Augenblick befindet er sich mit vollen Segeln auf der Reise nach dem Paradies.«
Bei dieser Gelegenheit zeigte der Bischof von Chur, wie die Dicken leicht sein können, weil die Dickbäuche durch die Gnade Gottes und zur Ausgleichung ihrer schweren Last allem Anschein nach eine Art Luftballon in sich tragen. Und so sah man den Bischof zurückschnellen wie eine Sprungfeder, ganz mit Schweiß überdeckt und schon hüstelnd wie ein Ochse, der in seinem Häcksel eine Daune gefunden hat. Blaß wie der Tod taumelte er nach der Treppe, ohne auch nur von der Herrin des Hauses Urlaub zu nehmen; der Kardinal aber, als die Tür hinter dem Bischof geschlossen war, der bereits auf die Straße hinauswankte, brach in ein schallendes Lachen aus.
»Nun, meine Kleine«, höhnte er, »bin ich nicht würdig, Papst zu werden? Oder, was mir lieber ist, für heute nacht dein Geliebter?«
Die schöne Imperia aber machte eine bedenkliche Miene. Der Kardinal näherte sich ihr, um ihr Zärtlichkeiten zu erweisen, sie mit den Armen zu umschlingen und sie verliebt zu knutschen, ganz nach der Art dieser rotmänteligen Kardinäle, die ungestümer sind als andre Menschenkinder, die Soldaten nicht ausgenommen, weil sie ganz und gar müßiggängerisch leben und die Quintessenz ihres Spiritus nicht mit geistiger Anstrengung verderben.
Die Schöne aber wich ihm jäh aus.
»Du willst meinen Tod!« schrie sie, »du Ungeheuer von Rotmantel, für Euch ist Euer Vergnügen die Hauptsache, elender Kuppler, was liegt Euch an meiner Haut; wenn du mich tötest, wirst du mich nachher heilig sprechen, gelt? Was, Ihr habt das pestilenzialische Gift im Gedärm und wagt es, mich anzurühren? Pack dich zum Teufel, gedankenloser Pfaff ... Rühr mich nicht mehr an«, schrie sie, da er sich ihr von neuem nähern wollte, »oder Ich werde dich mit dem Dolch da kitzeln!«
Bei diesen Worten zog das liebe Wesen aus seiner Gretchentasche ein hübsches kleines Stilett, mit dem sie, wenn Not am Mann war, wunderbar umzugehen wußte.
»Aber mein Liebchen, mein kleines Paradiesgärtchen«, sagte er lächelnd, »siehst du denn nicht die List? Mußte ich nicht diesen Ochsen von Chur in die Flucht jagen?«
»Gut denn«, sagte sie, »wenn Ihr mich liebt, so wird es sich jetzt zeigen . .. Ich will, daß Ihr für heute abzieht. .. Wenn Ihr von der Krankheit gebissen seid, Euch liegt nichts an meinem Tod; ich kenne Euch genugsam, um zu wissen, daß Ihr alles drangeben würdet, um in der Stunde Eures Todes einen letzten Augenblick der Lust zu erhaschen. Ihr würdet dafür die Welt in einer zweiten Sündflut ersäufen. Oh! Ihr selber habt Euch dessen gerühmt im Rausch. Ich aber, ich liebe nichts als mich, meine Schätze und meine Gesundheit... Geht, und wenn Euch die neueste Pestilenz nicht im Gedärme sitzt, besucht mich morgen ... Heut Hass’ ich dich, mein guter Kardinal«, fügte sie lachend hinzu.
»Imperia«, rief der Kardinal und warf sich ihr zu Füßen, »meine heilige Imperia, geh doch, du willst mich zum Narren haben.«
»Nein«, sagte sie, »ich mag einen Narren nicht zum Narren haben.«
»Was! Ekelhafte Hure. Ich werde dich exkommunizieren... Morgen ...«
»Sonst fällt Euch nichts mehr ein in Eurem Kardinalsverstand?«
»Imperia, Satansweib, verteufeltes.. . was sag’ ich nur .. . mein süßes Liebchen, meine Kleine, mein Lustgärtlein .. .«
»Ihr werdet respektwidrig.. . Kniet Euch doch nicht hin wie vor dem Allerheiligsten, schämt Euch.«
»Willst du, daß ich dir Absolution gebe in articulo mortis. . .? Willst du mein ganzes Vermögen, oder besser noch, willst du einen Splitter des heiligen Kreuzes.. .? Willst du?«
»Keine himmlischen und keine irdischen Reichtümer können heute abend mein Herz bezahlen. Ich wäre die letzte der Sünderinnen, unwürdig den Leib unsres Heilands, des Herrn Jesus Christus, zu empfangen, wenn ich nicht meine Launen hätte.«
»Ich werde dir das Haus anzünden . .. Du bis eine Hexe, du hast einen teuflischen Zauber gegen mich gebraucht... Ich lasse dich auf dem Scheiterhaufen verbrennen . .. Höre mich, mein Schatz, meine süße kleine Maus, ich verspreche dir den schönsten Platz im Himmel . .. was sagst du dazu? Du willst nicht. . .? Zum Teufel also ... Auf den Scheiterhaufen mit der Hexe . . .«
»Wenn ich Euch aber vorher umbringen lasse, Herr Kardinal?«
Der Kardinal schäumte vor Wut.
»Ihr werdet ja rasend«, sagte sie. »Geht doch endlich. Ihr macht Euch krank, wenn Ihr’s nicht schon seid.«
»Du sollst mir den Streich bezahlen, wenn ich Papst werde.«
»Die Tiara wird Euch nicht von dem Gehorsam entbinden, den Ihr mir schuldig seid.«
»Sagt, was muß ich tun, um Euch diesen Abend zu gefallen?«
»Euch zum Henker scheren.«
Sie hüpfte vor ihm im Zimmer herum wie eine Bachstelze, streckte und dehnte sich wie eine Schlange und ließ den Kardinal fluchen und toben, dem nichts übrigblieb, als endlich das Feld zu räumen.
Als sich die schöne Imperia allein sah - im Kamin brannte ein schönes Feuer, die Tafel war noch wohl versehen, es fehlte nichts als das junge Pfäfflein -, da übermannte sie der Zorn.
»Bei dem Dreigehörn des Teufels«, rief sie aus, indem sie in ihrer Wut ihre goldenen Ketten zerriß, »wenn der Kleine schuld ist an diesem Auftritt mit dem Kardinal und mich der Gefahr einer Vergiftung ausgesetzt hat, ohne daß ich meine Absichten mit ihm erreiche und ganz zu meiner Zufriedenheit, so will ich ihn lebendig schinden sehen vor meinen Augen, ehe ich sterbe.«
»O Gott!« rief sie aus, und diesmal flössen ihr echte Tränen über die Wangen. »Was für eine unglückliche Kreatur bin ich, das bißchen Genugtuung, das ich von Zeit zu Zeit erlebe, ist mit einem solchen Hundeleben - und dem Verlust der ewigen Seligkeit obendrein - wahrhaftig zu teuer bezahlt.«
Nachdem sie sich unter Verrenkungen und Konvulsionen wie eine angeschossene Turteltaube so weit ausgetobt hatte, daß sie nicht mehr konnte, sah sie plötzlich das gerötete Gesicht des kleinen Priesters, der sich unverdrossen heimlich versteckt gehalten, in ihrem venezianischen Spiegel auftauchen . ..
»Ah!« rief sie, »du bist der vollkommenste Pfaffe, das hübscheste kleine Pfäfflein, so pfiffig pfäfflich und so pfäfflich pfiffig, wie es gewiß Feinen zweiten gibt in der verpfefferten und verpfäffelten Stadt von Kostnitz ... Aber komm, mein herziger Ritter, mein geliebter Sohn, mein Kleiner, mein Dicker, mein Baum der Glückseligkeit, mein wonniger Gärtner, komm, daß ich deine Augen trinke, ich möchte dich fressen, ich möchte dich umbringen vor Liebe; o mein Blumenbekränzter, mein Frühlingsgott! Mein süßer Glockenschwengel! Mein Gott in alle Ewigkeit, komm, komm! Du bist nur ein armes Pfäfflein, ich will einen König aus dir machen, einen Kaiser, einen Papst, nein, ich will dich glücklicher machen als alle zusammen. Was willst du noch, vernichte alles hier mit Feuer und Schwert, wenn es dir beliebt, ich bin dein Eigentum. Ich will dir’s zeigen, du sollst Kardinal sein, und wenn ich all mein Herzblut hergeben müßte, um dein Barett damit zu färben.«
Und mit zitternder Hand, so überglücklich war sie, füllte sie mit griechischem Wein einen goldenen Becher, den der dicke Bischof von Chur hergebracht hatte, und reichte ihn dem Freund; auf ihren Knien reichte sie ihm den Trank, sie, deren Pantoffel die Fürsten der Erde küßten, mit mehr Devotion küßten, als den Pantoffel des Papstes.
Er aber betrachtete sie mit einem stummen Blick voll Glück und Inbrunst, daß sie erzitterte vor seliger Genugtuung:
»Du hast recht, Kleiner, was sollst du noch lange reden ... komm!«
DIE LÄSSLICHE SÜNDE
Wie der gute Ritter Bruyn zu seiner Frau kam
Der edle Herr Bruyn, derselbe, der das Schloß Ravenstein-Weiberfreyt, oder wie sie es auf welsch nennen, Roche-Corbon-lez-Vouvray, an der Loire ausgebaut hat, war in seiner Jugend ein wilder Gesell und Tunichtgut. Er ging noch halb in den Knabenschuhen, da war schon keine Jungfernschaft mehr vor ihm sicher, und überall machte er einen Spektakel, als wenn er das Haus zum Fenster hinauswerfen wolle. Als er dann, noch ganz jung, seinen Vater, den Freiherrn von Ravenstein, zu begraben das Vergnügen hatte, wurde er vollends ein richtiger kleiner Teufelsbraten. Er war nun sein eigener Herr und konnte erst recht das Haus mitsamt allen Truhen und Kisten, und was sie enthielten, zum Fenster hinauswerfen.
Wirklich lebte er in Saus und Braus alle Tage, vertat sein Geld mit Saufen, Spielen und Huren und kümmerte sich den Teufel um Gesetz und Sitte, daß er sich bald aus der Gesellschaft der ehrsamen Menschen exkommuniziert sah und nur noch die Wucherer, Halszuzieher, Beutelschneider und andere Schnapphähne zu seinem Umgang hatte. Aber selbst die Herren Hypothekenjäger und Geldverleiher wurden stachelig wie eine Kastanienschale, als er kein andres Pfand mehr einzusetzen wußte als die genannte Herrschaft Ravenstein, in Anbetracht nämlich, daß diese Rupes Corbonis, als ein königliches Lehen, keinerlei Sicherheit und Bürgschaft zu bieten vermochte. Da war Bruyn im besten Zug, ein gefürchteter Raufbold zu werden, der wegen nichts mit den Leuten Händel anfing und kein größeres Vergnügen kannte, als Rippen einzustoßen und Schulterblätter und Schlüsselbeine entzweizuschlagen.
Dieses Treiben sah der Abt von Marienmünster oder Marmoustiers, sein Nachbar, ein Mann, der nicht gern ein Blatt vor den Mund nahm. Das sei ja alles sehr schön, sagte er zu dem Ritter, und wenn er so fortfahre, werde er sicher noch ein Ausbund aller ritterlichen Tugenden werden; aber noch fehle seinem schädelspalterischen Tun die Krone, nämlich: daß er zur Ehre Gottes hinziehe in das Heilige Land und sein Schwert an den Knochen der sarazenischen Mohammedaner und mohammedanischen Sarazenen, die jetzt das Heilige Land vollscheißen, schartig mache und dann zurückkehre, reich an Ablässen und Indulgenzen, entweder zurück in sein geliebtes Touran, den Garten Frankreichs, oder ins himmlische Paradies, den Garten Gottes, von wo alle christlichen Barone herkommen.
Diese weisheitsvollen Worte des Prälaten leuchteten dem Ritter ein, und ausgerüstet vom Kloster und gesegnet vom Abt, ging er zu Schiff und fuhr über Meer, zur nicht geringen Freude seiner Nachbarn. Er belagerte nun zahlreiche Städte in Asien und in Afrika, hieb auf die Ungläubigen ein, ohne Pardon zu geben, machte ein wahres Gemetzel unter Sarazenen, Griechen, Engländern und ändern, ohne viel danach zu fragen, ob es Freunde wären oder Feinde, denn er war als echter Mann wenig neugierig und befragte die Leute nach solchen Lappalien erst, nachdem er sie umgebracht hatte.
In diesem Beruf, dem lieben Gott, dem König und ihm selber sehr angenehm, gewann Bruyn einen großen Ruhm als ritterlicher Christ und christlicher Ritter und hatte viel Spaß in den heidnischen Ländern, wo er es trieb wie daheim und lieber einer Hure einen Taler als einem Bettler einen roten Heller schenkte, obwohl er mehr arme Teufel antraf, die einem Cherub gleichsahen, als er Weiber unter die Hände bekam, die auch nur von weitem den Huris des Mohammed geglichen hätten; aber er war ein guter Touraner, dem seine Suppe schmeckte aus jedem Teller.
Als er aber dann die Türkn satt hatte bis an den Hals und sein Durst nach Reliquien und ändern Gnadenspenden des Heiligen Landes hinlänglich gestillt war, kehrte er zur großen Verwunderung seiner Nachbarn aus dem Kreuzzug zurück, über und über beladen mit Gold und Edelgestein, im Gegensatz zu so vielen ändern, die reich auszogen und - auch über und über bedeckt, nämlich mit dem Grind des Aussatzes, zu ihren lieben Ehegesponsen heimkamen.
Sein Ruhm drang bis zu den Ohren des guten Königs Philipp, der ihn zum Grafen ernannte und dem ganzen Touraner Land als Seneschalk vorsetzte. Da wurde Bruyn von allem Volke geliebt und mit hohen Ehren umgeben, besonders da er es mit seinen Heldentaten nicht genug sein ließ, sondern auch den Karmelitern zu den Kalköfen in der Gemeinde Trebern eine schöne Kirche baute zur Sühne für die Sünden seiner Jugend.
Er wurde ganz und gar der Liebling Gottes und der Kirche. Aus einem Raufbold und Schnapphahn, der er ehedem war, wurde er ein kluger und gesetzter Mann, dem allmählich die Haare ausgingen und der darum die lustigste Sünde der lästigsten Tugend nur noch wenig vorzog. Sein Gemüt sänftigte sich immer mehr, und er geriet nur noch in Zorn, wenn jemand Gott lästerte vor seinen Ohren, was er nicht ertragen konnte, weil er selber schon für alle ändern in seiner Jugend gelästert hatte. Er überfiel und belagerte auch die Leute nicht mehr; denn da er Seneschalk war, gaben sie ihm alles freiwillig; auch sah er in Wahrheit alle seine Wünsche erfüllt, und da wird ein Mensch, wenn er nicht ganz ein Teufel ist, vom Scheitel bis zur Sohle voller Faulheit und Behagen.
Bruyn bewohnte ein altes Schloß an den Ufern der Loire, in deren Wasser es sich spiegelte. Dieses Gemäuer war von außen voller Löcher und Scharten, wie ein spanisches Wams, im Innern aber, in den Sälen und Kemenaten, mit königlichen Tapeten bekleidet und erfüllt mit Gerätschaften und tausenderlei Pomp sarazenischer Herkunft, daß die guten Leute von Tours davor Maul und Augen aufsperrten und sogar der Erzbischof und der hohe Klerus von Sankt Martin, denen der Graf ein seidenes Banner mit goldenen Fransen verehrte, die fremde Pracht und Herrlichkeit nicht genug bewundern konnten. Zu dem Schloß gehörte eine große Menge von Landgütern und Stadthäusern mit reichen Einkünften, mit Mühlen, Fischwassern und Wäldern, also daß seine Herrschaft eine der reichsten war im Land, die unserem Herrn dem König zu seinem Heerbann wohl an die tausend Mann zu stellen vermochte.
Wenn ihm jetzt sein Amtmann, der nicht wenige in seinem Leben hatte henken lassen, manchmal einen armen Bauer vorführte, der über irgendeinem kleinen Frevel betroffen worden, da lächelte der bejahrte Schloßherr oft gar gnädig:
»Laß ihn laufen, mein lieber Hanfwürger«, sagte er, »ich habe in früheren Jahren so viele aus Versehen umgebracht, mag er dafür das Leben haben.«
Doch nicht immer lief es so gut ab. Noch genug Bauern mußten an seinen Galgen oder an den Eichen seiner Wälder baumeln, >denn Gerechtigkeit muß sein<, pflegte er zu sagen, >und wenn es auch nur wäre, um eine alte Sitte nicht in Abgang kommen zu lassen.«
Im ganzen hielten sich seine Hintersassen ruhig und still wie die Nonnen in der Mette und waren ihm in Klugheit ergeben, denn er beschützte sie vor jeder Art von schlimmem Gesindel, vor den Vogelfreien und Vagabundierern, vor Beutelschneidern und Buschkleppern, die er unnachsichtig verfolgte, da er aus eigner Erfahrung wußte, welch eine Landplage dieses Raubzeug sein kann. Er betrieb seine Obliegenheiten in der Furcht Gottes und mit großem Eifer, war bei allem mit ganzer Seele dabei, beim Gottesdienst wie beim Trinken, machte aber bei Streitigkeiten, wie in allem, gern kurzen Prozeß, versüßte harte Urteile mit lustigen Scherzen, und wenn er einem hart weh getan hatte durch seinen Richterspruch, lud er sich bei ihm zu Gast und schmauste und zechte mit ihm, um ihn zu trösten. Er ließ sogar die Gehenkten in geweihter Erde begraben, denn er pflegte zu sagen: >Die gehören dem lieben Gott und sind schon genug bestraft, daß sie nicht mehr leben dürfen.< Über die Juden fiel er immer nur dann her, wenn er wußte, daß sie sich mit Wucherzinsen, dem Saft der Nation, vollgesaugt hatten, wie die Blutegel mit rotem Menschensaft; die übrige Zeit ließ er sie gewähren und pflegte sie seine lieben Bienen zu nennen, die ihm die Waben mit goldenem Honig füllen. Wenn er sie aber beraubte, geschah es immer nur zum Nutzen der Kirche, des Königs und des Landes, wie allenfalls zu seinem eignen Gewinn und Vorteil.
Seine Leutseligkeit gewann ihm immer mehr die Liebe von groß und klein. Oft, wenn er in vergnügter Stimmung vom Gericht nach Hause ritt und dem alten Abt von Marienmünster begegnete:
>Ihr habt, scheint es<, sagte dieser, >dem Galgen wieder reiche Dotationen vermacht, daß Ihr so lustig und zufrieden ausseht.<
Und wenn er von seinem Schloß Weiberfreyt nach der Stadt Tours hineinritt durch die Gassen der Vorstadt von Sankt Symphorion, da sagten die kleinen Gassendirnen unter sich: >Es muß heut Gerichtstag sein, da kommt der Gevatter Bruyn<; und ohne Furcht sahen sie ihm nach, wie er auf seinem weißen Zelter, den er von der Levante mitgebracht, gemütlich dahinritt. Auf der Flußbrücke unterbrachen die Knaben ihr Klickerspiel und riefen >Guten Tag, Herr Seneschalk.<
Und er antwortete: >Spielt weiter, meine Kinder, spielt weiter, um so besser werden euch nachher die Prügel schmecken.«
>Au weh, Herr Seneschalk riefen die Buben und lachten.
So schaltete Bruyn als gnädiger Herr und säuberte derart das Land von Spitzbuben und Diebesgesindel, daß man im Winter nach der großen Überschwemmung nur noch zweiundzwanzig Gehenkte zählte, abgesehen von einem Juden, der verbrannt wurde, weil er in der Gemeinde Neuenbürg eine Hostie gestohlen oder, wie andre sagen, gekauft hatte, da er ein sehr reicher Mann war.
Nun geschah es im darauffolgenden Jahr, ungefähr um Sankt Johann den Täufer oder Sankt Johann den Grasmäher, wie die Bauern hierzulande sagen, da kam eines Tages eine Truppe seltsames Volk in der Stadt an, Ägypter oder Böhmaken sagten die einen, Zigeuner oder Mausefallenhändler wurden sie von ändern genannt, kurz, ein Haufen fremden Raubgesindels, das im Münster von Sankt Martin nicht nur eine Anzahl heiliger Gegenstände entwendete, sondern auch an Stelle eines Bildnisses unsrer lieben Frau, um in schnöder Weise unsern heiligen Glauben zu verspotten, ein hübsches Heidenkind, eine Art weiblichen Seiltänzer und Scheuerpurzler, fasernackt zurückließ, ein freches Ding und nicht älter an Jahren wie ein alter Hund. Über diese unerhörte Schandtat war männiglich aufs äußerste ergrimmt, und die Leute des Königs wie die der Kirche waren darüber einig, daß die Mohrin für die ändern bezahlen solle, also daß man festsetzte, das nackte Tierlein lebendig zu braten, zu welchem Zweck und Ende man auf dem viereckigen Platz von Sankt Martins Münster nahe bei dem Brunnen, wo der Gemüsemarkt abgehalten wurde, einen mächtigen Holzstoß auftürmte.
Bei dieser Gelegenheit nun zeigte Bruyn, der Seneschalk, daß er weiterdachte als alle ändern, indem er dartat, was man für einen großen Gefallen Gott erweisen könne, wenn man die schwarze afrikanische Seele für die wahre Religion gewönne. »Wenn aber der Teufel, der diesen weiblichen Körper bewohnt«, so schloß er seine Rede, »etwa den Hartnäckigen spielen sollte, wäre der Holzstoß immer noch da, um ihm Gelegenheit zu geben, seinen dummen Eigensinn zu bereuen.« Das fand der Erzbischof weise gedacht und mit dem kanonischen Recht, den Geboten der christlichen Liebe und den Lehren des Evangeliums vollständig in Übereinstimmung.
Die Damen der Stadt jedoch und andre Leute von Autorität und Ansehen erhoben lauten Widerspruch dagegen, daß man sie um eine so schöne Zeremonie betrügen wolle (als die des Verbrennens nämlich). Denn die Mohrin weinte in ihrem Kerkerloch und stieß jammernde Schreie aus wie ein gebundenes Zicklein; da war also nicht zu zweifeln, daß sie das Wasser dem Feuer vorziehen und sich mit Vergnügen bekehren werde, um ihr Leben zu retten und ihre Tage zu verlängern wie die eines Raben, wenn es möglich wäre. Darauf aber erwiderte der Seneschalk, daß die Bekehrung der Heidin zur heiligen christlichen Religion ja noch eine viel lustigere Zeremonie sei und daß er sich anheischig mache, der Stadt Tours ein wahrhaft königliches Fest zu geben; er selber wolle als Taufpate zu Gevatter stehen und seine Mitgevatterin solle eine Jungfrau sein, um Gott eine besondere Freude zu machen, weil er doch selber ein Hagestolz oder Junggesell sei.
So nennt man bei uns zulande die Männer, die nicht verheiratet sind oder doch dafür gelten, um sie von den Ehemännern und Witwern zu unterscheiden; aber die Weiblein würden sie auch ohne Gattungsbenennung unter den Ehekrüppeln leicht herausfinden.
Das schöne Mohrenkind schwankte nicht lange zwischen den Flammen des Scheiterhaufens und dem Wasser der Taufe. Diese Wahl war für sie keine Qual, sie wollte tausendmal lieber eine lebendige Christin als eine verbrannte Heidin sein. Aber statt einen Augenblick am Leibe gebraten zu werden, fiel ihr nun das Los, daß eine Flamme durch lange, lange Jahre sie langsam verzehrte, denn um ihrer Bekehrung sicher zu sein, steckte man sie in das Frauenkloster der Vorstadt Vogelsang, wo sie eine Heilige werden sollte. Die genannte Zeremonie ihrer Bekehrung aber vollzog sich im Palaste des Erzbischofs, und es wurde bei der Gelegenheit zur Ehre unsres Herrn und Heilands mehrere Tage bankettiert und getanzt, woran sich alle schönen Damen und hohen Herren des ganzen Touraner Landes beteiligten, eines Landes, wo man mehr tanzt und turniert, bankettiert und Feste feiert und lustige Saufgelage hält als in der ganzen übrigen Welt zusammen.
Der gute alte Seneschalk hatte zur Mitgevatterin die Tochter des Herrn von Ridel-Alzay oder Alzeyt-Fidel ausgewählt, der zur Eroberung des Heiligen Landes ausgezogen und bei der Belagerung von Acre in die Hände eines Sarazenen gefallen war, welcher, da der fränkische Ritter danach aussah, ein königliches Lösegeld für ihn forderte.
Um die Summe zusammenzubringen, hatte die Dame von Alzay den Wechslern und Halszuziehern ihr ganzes Lehen verpfändet und wartete nun, arm wie eine Kirchenmaus, in einer elenden Stadtwohnung auf die Ankunft ihres Herrn und Gemahls. Obwohl sie keinen Stuhl besaß, um sich darauf zu setzen, war sie stolz wie die Königin von Saba und tapfer wie eine Bulldogge, die das Eigentum ihres Herrn verteidigt. Der Seneschalk, der ihre Bedrängnis kannte, erwählte ihre Tochter für die genannte Taufhandlung, um der Mutter eine Unterstützung zukommen zu lassen, die sie nicht ausschlagen durfte. Er besaß eine schwere goldene Kette, den Ehrenpreis für die Eroberung von Zypern, und er beschloß bei sich, sie seiner schönen Mitgevatterin um den Hals zu hängen. Er hängte aber an die Kette noch alle seine Landgüter und ersparten Schätze, seine Reitpferde, seine weißen Haare, mit einem Wort alles, sobald er die schöne Blancheflor von Fidel-Alzeyt zwischen den Damen von Tours eine Gavotte hatte tanzen sehen. Trotz der Ägypterin, die in ihrem Leben für das letztemal tanzte und in Volten und Sprüngen, Biegungen und Beugungen, in Beinspreizen und Zehenwirbeln sich selber übertraf, trug doch Blancheflor nach dem Urteil aller den Preis über sie davon, denn sie tanzte mit wahrhaft jungfräulicher Anmut.
Der alte Bruyn stand bezaubert bei dem Anblick des tanzenden Jungfräuleins, dessen Fersen Angst zu haben schienen vor der Berührung mit dem Fußboden, und das so unschuldig tollte mit seinen siebzehn Jahren und Sprünge machte wie eine junge Zikade am Sankt-Johannis-Morgen. Ein heftiger Wunsch entbrannte da in dem Greis, eine apoplektische Begierde, eine solche, die stark ist aus Schwachheit und die ihn durchglühte von der Fußsohle bis zum Nacken hinauf; denn sein Haupt sah so winterlich verwüstet aus, daß die Liebe davor haltmachte. Zum erstenmal fiel es dem Seneschalk ein, daß seinem Schloß die Hausfrau fehlte, und die schartige Burg kam ihm auf einmal so traurig und öde vor wie nie in seinem Leben.