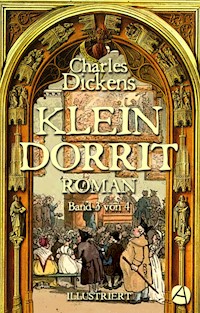
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Klein-Dorrit-Reihe
- Sprache: Deutsch
In London lebt William Dorrit, der als Schuldner inhaftiert ist, seit über zwanzig Jahren im Schuldnergefängnis Marshalsea. Er hat drei Kinder: Edward (bekannt als Tip), Fanny und Amy. Die jüngste Tochter, Amy, wurde im Gefängnis geboren und wird liebevoll Klein-Dorrit genannt. Ihre Mutter starb, als Amy acht Jahre alt war. Tip wurde vor kurzem wegen seiner eigenen Spielschulden inhaftiert, und die ehrgeizige Fanny lebt außerhalb des Gefängnisses bei Williams älterem Bruder Frederick. Sie arbeitet als Tänzerin in der Musikhalle, in der Frederick Klarinette spielt, und hat die Aufmerksamkeit des wohlhabenden, aber faden Edmund Sparkler auf sich gezogen. Die kleine Dorrit, die ihrem Vater treu ergeben ist, unterstützt die beiden durch ihre Näharbeiten und kann frei im Gefängnis ein- und ausgehen. Zur Ehre ihres Vaters, dem es peinlich ist, seine finanzielle Lage anzuerkennen, vermeidet Klein-Dorrit es, ihre Arbeit außerhalb des Gefängnisses oder seine Unfähigkeit, es zu verlassen, zu erwähnen. Mr. Dorrit übernimmt die Rolle des Vaters des Marshalsea und wird von den Bewohnern mit großem Respekt behandelt, als hätte er es sich ausgesucht, dort zu leben. Dies ist der dritte von vier illustrierten Bänden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
CHARLES DICKENS
KLEIN DORRIT
ROMAN
IN VIER BÄNDEN
BAND DREI
KLEIN DORRIT wurde zuerst im englischen Original als Fortsetzungsroman veröffentlicht von Bradbury & Evans, London 1855-57.
Diese Ausgabe in vier Bänden wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2022
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
Band Drei
ISBN 978-3-96130-533-9
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
***
Charles Dickens
KLEIN DORRIT
BAND EINS | BAND ZWEI | BAND DREI | BAND VIER
Klicke auf die Cover oder die Textlinks!
GESAMTAUSGABE
***
BUCHTIPPS
Entdecke unsere historischen Romanreihen.
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
DIE GEHEIMNISSE VON PARIS. BAND 1
MIT FEUER UND SCHWERT. BAND 1
QUO VADIS? BAND 1
BLEAK HOUSE. BAND 1
Klicke auf die Cover oder die Textlinks oben!
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
* *
*
Inhaltsverzeichnis
KLEIN DORRIT. Band Drei
Impressum
DRITTER BAND
Erstes Kapitel.
Reisegenossen.
Zweites Kapitel.
Mrs. General.
Drittes Kapitel.
Auf dem Wege.
Viertes Kapitel.
Ein Brief von Klein-Dorrit.
Fünftes Kapitel.
Es ist nicht richtig irgendwo.
Sechstes Kapitel.
Etwas richtig irgendwo.
Siebentes Kapitel.
Meist Prunes und Prism.
Achtes Kapitel.
Die Witwe Mrs. Gowan wird daran erinnert, daß es nicht geht.
Neuntes Kapitel.
Erscheinen und Verschwinden.
Zehntes Kapitel.
Die Träume der Mrs. Flintwinch mehren sich.
Elftes Kapitel.
Ein Brief von Klein-Dorrit.
Zwölftes Kapitel
In welchem eine große patriotische Konferenz gehalten wird.
Dreizehntes Kapitel.
Der Fortschritt einer Epidemie.
Vierzehntes Kapitel.
Rats erholen.
Fünfzehntes Kapitel.
Keine gegründete Ursache und kein Hindernis, warum diese beiden Personen nicht getraut werden sollen.
Sechzehntes Kapitel.
Vorwärts.
Siebzehntes Kapitel.
Vermißt.
Eine kleine Bitte
Charles Dickens im apebook Verlag
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
Dritter Band
Erstes Kapitel.
Reisegenossen.
Im Herbste des Jahres krochen Dunkelheit und Nacht zu den höchsten Gipfeln der Alpen empor.
Es war die Zeit der Weinlese in den Tälern auf der Schweizer Seite des St. Bernhardpasses und an den Ufern des Genfer Sees. Die Luft war von dem Duft der eingeernteten Trauben geschwängert. Körbe, Bütten und Kübel mit Trauben standen in den dunklen Dorftorwegen, verstellten die steilen und engen Dorfgassen und wurden den ganzen Tag auf Wegen und Straßen hin und her getragen. Trauben, von den Füßen zertreten und zerquetscht, lagen überall umher. Die junge Bäuerin, die sich schwerbeladen nach Hause schleppte, beruhigte ihr schreiendes Kind mit Trauben. Der Idiot, der seinen dicken Kropf unter der Traufe der hölzernen Hütte an dem Wege zum Wasserfall sonnte, saß gierig Trauben kauend da. Der Atem der Kühe und Ziegen duftete angenehm von dem Laub und den Kämmen der Trauben. Die versammelten Gäste in jedem kleinen Wirtshause sprachen, während sie aßen und tranken, von Trauben. Schade, daß aus dem großen Überfluß nicht etwas Reife auf den dünnen, harten, steinigen Wein überging, der im ganzen aus diesen Trauben gemacht wurde!
Die Luft war den ganzen schönen Tag über warm und durchsichtig gewesen. Glänzende metallene Kirchturmspitzen und Kirchendächer, die man da und dort in der Ferne sah, hatten die weite Gegend durchblitzt: und die schneeigen Berggipfel waren so klar gewesen, daß nicht daran gewöhnte Augen mit dem Blick über das dazwischenliegende Land hinwegeilten und ihre rauhe Höhe als etwas Fabelhaftes gering achtend, gewöhnlich glaubten, sie seien in wenigen Stunden zu erreichen. Bergkuppen von großer Berühmtheit sah man von den Tälern, wo bisweilen monatelang keine Spur von ihrer Existenz sichtbar war, seit dem Morgen klar und nahe an dem blauen Himmel stehen. Und selbst jetzt, wo es unten dunkel wurde, hoben sie sich – gleichsam feierlich zurückschreitend wie Geister, die entschwinden wollen – doch noch deutlich in ihrer Einsamkeit über dem Nebel und dem Schatten bleich und kalt vom Himmel ab.
Von diesen Einöden und vom Paß des großen St. Bernhard aus gesehen stieg die Nacht an den Bergen flutartig empor. Als sie endlich die Mauern des Klosters auf dem großen St. Bernhard erreicht hatte, erschien dieser wetterharte Bau wie eine zweite Arche, die auf den Schattenwogen schwamm.
Die Dunkelheit, die einige Fremde überholte, hatte die rauhen Klostermauern erreicht, als diese Reisenden noch den Berg hinanklommen. Wie die Hitze des glühenden Tages, die sie haltzumachen und an den Strömen geschmolzenen Schnees und Eises zu trinken eingeladen hatte, nun in die durchdringende Kälte der frostigen verdünnten Nachtluft auf großer Höhe übergegangen war, so war die frische Schönheit der Reise in tieferliegenden Gegenden jetzt der Dürre und Öde gewichen. Ein schroffer, holperiger Pfad, auf dem die Maultiere, eines hinter dem andern, von Block zu Block kletterten und sich wanden, als wenn sie die verbröckelte Treppe einer riesigen Ruine hinaufstiegen, war jetzt ihr Weg. Kein Baum war zu sehen, keine Pflanze zu erblicken, nur ein armes, braunes, elendes Moos, das in den Ritzen der Felsen erstarrt war. Geschwärzte Skelettarme von Holz zeigten am Wege hinauf nach dem Kloster, als wenn die Gespenster früherer Reisenden, die im Schnee begraben worden waren, an dem Schauplatz ihres Unglücks umgingen. Eiszapfenbehangene Höhlen und Hütten, als Zufluchtsorte für plötzliche Stürme gebaut, glichen ebenso vielen flüsternden Stimmen, die die Gefahren dieses Ortes den Reisenden ins Ohr raunten. Nimmerruhende Wirbel und Labyrinthe von Nebel wanderten, von einem Klagewind gescheucht, umher; und Schnee, die ringsum drohende Gefahr des Berges, gegen die man alle Sicherheitsmaßregeln getroffen, trieb heftig in die Tiefe.
Die Reihe der von ihrem Tagewerk müden Maulesel wand sich langsam an dem steilen Abhang in die Höhe: der vorderste wurde von einem Führer zu Fuß geleitet, der einen breitkrempigen Hut und eine runde Jacke hatte, auf der Schulter ein bis zwei Alpenstöcke trug und mit einem andern Führer plauderte. Die Schar der Reiter führte kein Gespräch. Die scharfe Kälte, die Anstrengung der Reise und ein neues Gefühl von gehemmtem Atem, zum Teil, als stiegen sie gerade aus sehr klarem, gekräuseltem Wasser, zum Teil, als wenn sie schluchzten, ließ sie schweigen.
Endlich glänzte ein Licht auf der Höhe der Felsentreppe durch Schnee und Nebel. Die Führer trieben die Maultiere an; diese hoben die gesenkten Köpfe, die Jungen der Reisenden waren gelöst, und unter einem plötzlich entstandenen Wirrwarr von Ausgleiten, Klettern, Klingeln, Klirren und Schwatzen kamen alle bei dem Tor des Klosters an.
Andre Maultiere waren nicht lange zuvor angekommen, einige mit reisenden Landleuten, andere mit Waren, und hatten den Schnee vor der Tür in einen Pfuhl von Schmutz getreten. Reitsättel und Zügel, Packsättel und Glockenriemen, Maultiere und Menschen, Laternen, Fackeln, Säcke, Mundvorräte, Fässer, Käselaibe, Tönnchen mit Honig und Butter, Strohbündel und Pakete mancherlei Art lagen in diesem aufgetauten Sumpfe und auf den Stufen durcheinander. Hier oben in den Wolken sah man alles durch Wolken, und alles schien sich in Wolken aufzulösen. Der Atem der Leute war Wolke, der Atem der Maultiere war Wolke, die Lichter waren von Wolke umgeben, die dicht nebenan Sprechenden waren vor Wolken nicht zu sehen, obgleich ihre Stimmen und alle andern Klänge überraschend klar waren. Von der wolkigen Reihe von Maultieren, die rasch innerhalb der Mauer Kreise bildeten, biß oder schlug gewöhnlich das eine das andre, und dann war der ganze Nebel zerstreut. Die Männer drangen dazwischen, Geschrei von Menschen und Tieren scholl aus dem Knäuel, und niemand, der dabeistand, konnte unterscheiden, was geschehen war. Mitten in diesem Treiben strömte der Klosterstall, der den untern Stock des Gebäudes bildete und in den man durch die Grundstocktür trat, außerhalb der all dieses Durcheinander sich umhertrieb, seinen Beitrag an Wolke aus, als wenn das ganze rauhe Gebäude mit nichts sonst gefüllt wäre und zusammenstürzen würde, sobald es sich geleert, so daß dann der Schnee auf die kahlen Berggipfel fiele.
Während all dieser Lärm und diese Unruhe unter den lebenden Reisenden herrschte, waren still versammelt in einem vergitterten, ein halbes Dutzend Schritte entfernten Hause, das von der gleichen Wolke umhüllt war und in das die gleichen Schneeflocken trieben, die toten Reisenden, die man auf dem Berge gefunden. Die vor vielen Wintern vom Sturm überraschte Mutter, die noch immer mit dem Säugling an der Brust in der Ecke stand; der Mann, der erfroren, während er aus Hunger oder Furcht den Arm zum Munde erhob, und ihn noch immer nach vielen Jahren an seine trockenen Lippen drückte. Eine schreckliche, auf seltsame Weise zusammengekommene Gesellschaft! Ein furchtbares Schicksal für eine Mutter, vorhergesehen zu haben: »Umgeben von so manchen und solchen Gefährten, die ich niemals gesehen und nie sehen werde, werden ich und mein Kind unzertrennlich auf dem großen St. Bernhard zusammen wohnen, Generationen überdauern, die uns zu sehen kommen und nie unsere Namen oder ein Wort von unserer Lebensgeschichte, außer dem Ende, erfahren werden.«
Die lebenden Reisenden dachten in jenem Augenblick wenig oder gar nicht an die toten. Sie dachten weit mehr daran, vor dem Klostertor abzusteigen und sich an dem Klosterfeuer zu wärmen. Aus dem Gewirr sich loswindend, das bereits weniger lärmend wurde, da man die Masse der Maultiere in dem Stall unterzubringen begann, eilten sie, schauernd vor Kälte, die Treppe hinauf in das Haus. Dort herrschte ein Geruch, der durch den Boden von den angebundenen Tieren herausdrang, ähnlich dem Geruch einer Menagerie von wilden Tieren. Drinnen befanden sich starke gewölbte Gänge, hohe steinerne Pfeiler und dicke Mauern mit kleinen verfallenen Fenstern – Bollwerke gegen die Bergstürme, als wenn es menschliche Feinde gewesen wären. Ferner düstere gewölbte Schlafzimmer, schrecklich kalt, aber reinlich und gastlich für Fremde eingerichtet. Endlich ein gemeinsames Konversationszimmer, in dem die Gäste saßen und aßen, wo auch bereits ein Tisch aufgestellt war und ein helles Feuer rot und hoch im Kamin flackerte.
In diesem Zimmer setzten sich die Reisenden, nachdem ihnen von zwei jungen Mönchen die für die Nacht bestimmten Quartiere angewiesen waren, um den Kamin. Es waren drei Gesellschaften: die erste, als die zahlreichste und bedeutendste, war die langsamste und hatte sich von einer und der andern auf dem Wege herauf überholen lassen. Sie bestand aus einer älteren Dame, zwei grauen Herren, zwei jungen Damen und ihrem Bruder. Diese hatten (vier Führer ungerechnet) einen Kurier, zwei Diener und zwei Kammermädchen bei sich: diese große lästige Gesellschaft wurde anderwärts unter einem Dache untergebracht. Diejenige Gesellschaft, die sie überholte und nun hinterdrein kam, bestand nur aus drei Gliedern: einer Dame und zwei Herren. Die dritte Gesellschaft, die von dem Tal auf der italienischen Seite des Passes heraufkam und zuerst da war, bestand aus vier Gliedern: einem vollblütigen, hungrigen und schweigsamen deutschen Hofmeister mit einer Brille, der sich auf einer Tour mit drei jungen Männern, seinen Zöglingen, befand, lauter vollblütigen, hungrigen und schweigsamen Menschen mit Brillen.
Diese drei Gruppen saßen rings um das Feuer, sich trocken ansehend und auf das Nachtessen wartend. Nur einer unter ihnen, einer von den Herren, die zu der Gesellschaft von den dreien gehörten, machte einen Ansatz zu einer Unterhaltung. Indem er seine Angelschnur nach dem Häuptling des bedeutenden Stammes auswarf, während er sich an seine eigenen Reisegenossen wandte, bemerkte er in einem Ton, der die ganze Gesellschaft einschloß, wenn sie eingeschlossen sein wollte, daß es ein langer Tag gewesen und daß er die Damen bedauere. Daß er fürchte, eine von den jungen Damen sei nicht stark genug und nicht hinlänglich ans Reisen gewöhnt und sei vor zwei bis drei Stunden außerordentlich ermüdet gewesen. Er habe von seinem Standort im Nachtrab aus bemerkt, daß sie ganz erschöpft auf ihrem Maultier gesessen. Er habe später zwei- oder dreimal sich die Ehre gegeben, einen von den Führern zu fragen, der nach hinten gekommen sei, wie es der jungen Dame gehe. Er sei entzückt zu erfahren, daß sie sich erholt und daß es nur ein vorübergehendes Unbehagen gewesen wäre. Er glaube (diesmal faßte er den Häuptling ins Auge und wandte sich an ihn), es werde ihm erlaubt sein, seine Hoffnung auszusprechen, daß sie sich nun ganz wohl befinde und nicht bereue, die Reise gemacht zu haben.
»Meine Tochter, – ich bin Ihnen sehr verbunden, Sir«, versetzte der Häuptling, – »ist vollkommen wiederhergestellt und fand großes Interesse an der Gesellschaft.«
»Vielleicht zum erstenmal in den Bergen?« sagte der einschmeichelnde Reisende.
»Zum – ha – zum erstenmal in den Bergen«, sagte der Häuptling. »Aber Sie sind damit vertraut, mein Herr?« fuhr der einschmeichelnde Reisende fort.
»Ich bin – hm – ziemlich vertraut damit. Nicht aus den letzten Jahren. Nicht aus den letzten Jahren«, versetzte der Häuptling, mit der Hand winkend.
Der einschmeichelnde Reisende antwortete auf das Winken der Hand mit einer Verbeugung des Kopfes und wandte sich von dem Häuptling zu der zweiten jungen Dame, die er bis jetzt noch nicht angeredet hatte, außer, daß er sie zu den Damen zählte, die er so innig bedauerte.
Er sprach die Hoffnung aus, daß die Anstrengungen des Tages sie nicht zu sehr mitgenommen hätten.
»Mitgenommen haben sie mich allerdings«, versetzte die junge Dame, »aber sie haben mich nicht ermüdet.«
Der einschmeichelnde Reisende machte ihr sein Kompliment über die richtige Unterscheidung. Das habe er sagen wollen. Jede Dame müsse sich freilich über dieses sprichwörtlich unfügsame und beschwerliche Tier, den Maulesel, beschweren.
»Wir mußten natürlich«, sagte die junge Dame, die ziemlich zurückhaltend und stolz war, »die Wagen und den Fourgon in Martigny zurücklassen. Und die Unmöglichkeit, etwas, was man braucht, an diesen unzugänglichen Ort herauszubringen, und die Notwendigkeit, allen Komfort zurückzulassen, ist nicht sehr angenehm.«
»Ein wüster Ort, allerdings«, sagte der einschmeichelnde Reisende.
Die ältliche Dame, die ein Muster von pünktlichem Anzug war und die in ihrer Art vollkommen genannt werden konnte, wenn man sie als ein Stück Maschine betrachtete, warf hier mit sanfter leiser Stimme eine Bemerkung ein.
»Aber wie andere unbequeme Orte«, bemerkte sie, »muß man ihn sehen. Als ein Ort, von dem viel die Rede, muß er mal besucht werden.«
»Oh! ich habe durchaus nichts dagegen, daß man ihn sieht, ich versichere Sie, Mrs. General«, versetzte die andere nachlässig.
»Sie, Madame«, sagte der einschmeichelnde Reisende, »haben diesen Ort schon früher besucht?«
»Ja«, versetzte Mrs. General. »Ich war früher schon hier. Ich möchte Ihnen raten, meine Liebe«, sagte sie zu der genannten jungen Dame, »Ihr Gesicht vor der Hitze des Feuers zu schützen, nachdem es der Bergluft und dem Schnee ausgesetzt gewesen. Auch Ihnen, meine Liebe«, fügte sie, an die andere junge Dame gewandt, hinzu, die sogleich tat, wie ihr anempfohlen worden, während die erstere einfach sagte: »Ich danke Ihnen, Mrs. General; ich fühle mich ganz behaglich so und ziehe es vor, zu bleiben, wie ich bin.«
Der Bruder, der vom Stuhl aufgestanden war, um das Piano zu öffnen, das in dem Zimmer stand, und hineingepfiffen hatte, schlenderte jetzt, das Monokel im Auge, wieder zu dem Feuer zurück. Er war im vollsten und vollständigsten Reiseanzug. Die Welt schien kaum groß genug, um ihm eine seiner Equipierung entsprechende Reisegelegenheit zu bieten.
»Diese Burschen brauchen ungeheuer lange zu ihrem Nachtessen«, sagte er schleppend. »Ich bin begierig, was sie uns geben werden! Hat jemand ein Vorstellung davon?«
»Keine gebratenen Menschen, glaube ich«, antwortete die Stimme des zweiten Herrn von der Gesellschaft der drei.
»Ich vermute nicht. Was meinen Sie?« fragte er.
»Daß, da Sie nicht bei dem allgemeinen Souper aufgesetzt werden sollen, Sie uns vielleicht die Gefälligkeit erweisen werden, sich nicht an dem allgemeinen Feuer zu rösten«, versetzte der andere.
Der junge Herr, der in einer bequemen Stellung am Kamin stand, das Monokel auf die Gesellschaft gerichtet, den Rücken nach dem Feuer zu und die Rockflügel unter den Armen, als ob er zum Hühnergeschlecht gehörte und an den Spieß gesteckt wäre, um zu braten, verlor bei dieser Antwort die Fassung; er schien im Begriffe, eine Erklärung zu fordern, als man entdeckte – indem alle Augen auf den Sprechenden gerichtet waren –, daß die Dame, die bei ihm war, ein junges und hübsches Geschöpf, nichts von dem gehört hatte, was vorgegangen, da sie ohnmächtig den Kopf auf die Schulter hatte sinken lassen.
»Ich glaube«, sagte der Herr in gedämpften Tone, »es wäre das beste, ich brächte sie sogleich nach ihrem Zimmer. Wollen Sie jemanden rufen, daß man Licht bringt?« fügte er, an seinen Begleiter gewandt, hinzu; »man muß uns den Weg zeigen. Ich glaube nicht, daß ich mich in diesem seltsamen Labyrinth zurechtfinden werde.«
»Bitte, lassen Sie mich mein Mädchen rufen«, sagte die größere von den jungen Damen.
»Bitte, lassen Sie mich dies Wasser an ihre Lippen bringen«, sagte die kleinere, die bis jetzt noch nicht gesprochen hatte.
Da jeder tat, was er vorschlug, so war kein Mangel an Beistand. Und als gar die beiden Mädchen eintraten (begleitet vom Kurier, damit niemand ihnen den Mund verstopfe, wenn er sie unterwegs in einer fremden Sprache anredete), war sogar die Aussicht auf zuviel Beistand. Als der Herr dies sah, sagte er einige Worte zu der kleinern und jüngern von den beiden Damen, legte den Arm seiner Frau um seine Schulter, hob sie in die Höhe und trug sie hinweg.
Sein Freund, der mit den andern Fremden nun allein war, ging langsam in dem Zimmer auf und ab, ohne wieder zu dem Feuer zu kommen: er zupfte nachdenklich an seinem schwarzen Schnurrbart, als ob er sich für die letzte Erwiderung verantwortlich fühlte. Während der Gegenstand derselben in einer Ecke Schmähungen ausstieß, wandte sich der Häuptling stolz an diesen Herrn.
»Ihr Freund, mein Herr«, sagte er, »ist – ha – etwas ungeduldig, und in seiner Ungeduld weiß er vielleicht nicht genau, was er andern schuldig ist – aber wir wollen darüber hinwegsehen, wir wollen darüber hinwegsehen. Ihr Freund ist etwas ungeduldig, mein Herr.«
»Es mag wohl sein, mein Herr«, versetzte der andere. »Da ich jedoch die Ehre gehabt, die Bekanntschaft dieses Herrn im Hotel zu Genf zu machen, wo wir und zahlreiche gute Gesellschaft vor einiger Zeit uns trafen, und da ich die Ehre gehabt, bei verschiedenen späteren Ausflügen mich seiner Gesellschaft und Unterhaltung zu erfreuen, so kann ich nichts hören – nicht einmal von einem Mann Ihres Äußern und Ihrer Stellung, was diesem Gentleman nachteilig wäre.«
»Sie sind durchaus in keiner Gefahr, mein Herr, irgend etwas Derartiges von mir zu hören. Wenn ich die Bemerkung machte, daß Ihr Freund Ungeduld an den Tag gelegt, so sage ich damit nichts Nachteiliges. Ich mache diese Bemerkung nur, weil nicht zu bezweifeln ist, daß mein Sohn, der durch Geburt und – ha – durch Erziehung – hm – Gentleman ist, sich bereitwillig jedem artig ausgesprochenen Wunsche bezüglich des Feuers gefügt, das für alle Glieder dieser Gesellschaft gleich zugänglich ist. Was ich grundsätzlich richtig finde, denn – ha – alle sind –hm – in solchen Fällen gleichberechtigt.«
»Gut!« lautete die Antwort. »Und damit genug! Ich bin Ihres Sohnes ergebener Diener. Ich bitte Ihren Sohn, die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung zu empfangen. Und nun, mein Herr, gestehe ich, gestehe ich offen, daß mein Freund bisweilen von sarkastischem Temperament ist.«
»Die Dame ist Ihres Freundes Frau, mein Herr?«
»Die Lady ist meines Freundes Frau, mein Herr.«
»Sie ist sehr schön.«
»Sie ist unvergleichlich schön. Sie befinden sich im ersten Jahre ihrer Verbindung. Sie sind zum Teil noch auf einer Hochzeits-, zum Teil auf einer Kunstreise.«
»Ihr Freund ist ein Künstler?«
Der Herr antwortete, indem er die Finger seiner rechten Hand küßte und den Kuß armhoch zum Himmel emporwarf, was soviel heißen sollte, wie: ich weihe ihn den himmlischen Mächten als einen unsterblichen Künstler.
»Er ist jedoch ein Mann aus vornehmer Familie«, fügte er hinzu. »Er hat die besten Beziehungen. Er ist mehr als ein Künstler. Er stammt aus sehr vornehmem Hause. Er mag seine Verwandtschaft wirklich stolz, ungeduldig, sarkastisch (ich erlaube mir beide Ausdrücke) zurückgestoßen haben, aber er besitzt sie einmal. Funken, die während unserer Unterhaltung fielen, haben mich darüber belehrt.«
»Nun! Ich hoffe«, sagte der stolze Herr, mit einer Miene, als wollte er die Sache endlich abtun, »daß die Unpäßlichkeit der Dame nur vorübergehend sein werde.«
»Das hoffe ich auch, mein Herr.« »Bloße Ermüdung, glaube ich.«
»Nicht Ermüdung allein, mein Herr, denn ihr Maultier strauchelte heute, und sie fiel aus dem Sattel. Sie fiel leicht und stand ohne Unterstützung wieder auf den Füßen; dann ritt sie lachend voraus: aber sie klagte gegen Abend über eine leichte Quetschung in der Seite. Sie sprach mehr als einmal davon, als wir hinter Ihnen den Berg hinauf ritten.«
Der Häuptling des großen Gefolges, der gnädig, aber nicht vertraulich war, schien nun der Ansicht zu sein, daß er sich mehr als genug herablassend bewiesen. Er sagte nichts mehr, und es trat für eine Viertelstunde Stille ein bis zum Abendessen.
Mit dem Abendessen kam einer von den jungen Mönchen (es schien hier keine alten Mönche zu geben) und setzte sich oben an die Tafel. Das Mahl war ganz ähnlich wie das Abendessen in einem gewöhnlichen Schweizer Hotel, und guter roter Wein, in einer heitereren Luft gewachsen, fehlte nicht. Der reisende Künstler kam ruhig zurück und nahm seinen Platz am Tisch ein, als die übrigen sich setzten: er schien nicht entfernt mehr an sein letztes Scharmützel mit dem Fremden in dem vollkommenen Reiseanzug zu denken.
»Bitte«, fragte er den Wirt über seine Suppe hinüber, »hat Ihr Kloster jetzt viele von seinen berühmten Hunden?«
»Monsieur, drei.«
»Ich sah drei im Gange unten. Ohne Zweifel die fraglichen drei.«
Der Wirt, ein schlanker, helläugiger, ernster, junger Mann von feinen Manieren, dessen Kleidung in einer schwarzen Kutte mit Streifen von weißem Tuch darüber, wie Tragbänder, bestand und der der klösterlichen Eigenart der Bernhardiner Mönche nicht mehr glich als wie der klösterlichen Zucht der Hunde von St. Bernhard, antwortete, ohne Zweifel würden es die drei fraglichen sein.
»Und ich glaube«, sagte der reisende Künstler, »ich habe einen derselben früher schon gesehen.«
Es sei möglich. Es sei ein wohlbekannter Hund. Monsieur könne ihn leicht im Tale oder sonstwo an dem See gesehen haben, wenn er (der Hund) mit einem vom Orden hinabgegangen, um Unterstützung für das Kloster zu sammeln.
»Was regelmäßig zu einer bestimmten Zeit im Jahr geschieht, nicht wahr?«
Monsieur habe recht.
»Und nie ohne den Hund. Der Hund ist sehr wichtig.«
Monsieur habe wieder recht. Der Hund sei sehr wichtig. Die Leute interessieren sich sehr für den Hund als einen von den überall bekannten Hunden, wie Mademoiselle begreifen werde.
Mademoiselle war etwas langsam im Begreifen, als ob sie noch nicht recht an das Französische gewöhnt wäre. Mrs. General begriff es jedoch statt ihrer.
»Fragen Sie ihn, ob er viele Menschen gerettet hat?« sagte der junge Mann, der seine Fassung verloren hatte, in seinem heimischen Englisch.
Der Wirt bedurfte keiner Übersetzung der Frage. Er antwortete rasch französisch: »Nein. Dieser niemanden.«
»Warum nicht?« fragte derselbe Herr.
»Entschuldigen Sie«, antwortete der Wirt gelassen, »geben Sie ihm die Gelegenheit, und er wird es sicher tun. Zum Beispiel, ich bin fest überzeugt«, fügte er, indem er das Kalbfleisch aufschnitt, um es herumreichen zu lassen, ruhig nach dem jungen Mann hinüberlächelnd, der aus der Fassung gekommen, hinzu: »daß, wenn Sie, Monsieur, ihm die Gelegenheit geben sollten, er mit größtem Eifer sich beeilen würde, seine Pflicht zu tun.«
Der reisende Künstler lachte. Der einschmeichelnde Reisende (der die lebhafte Besorgnis an den Tag legte, er möchte nicht seinen vollen Anteil an dem Abendessen erhalten) wischte sich einige Tropfen Wein mit einem Stück Brot von dem Schnurrbart und mischte sich in das Gespräch.
»Es wird etwas spät, mein Vater«, sagte er, »für Vergnügungsreisende, nicht wahr?«
»Ja, es ist spät. Noch zwei bis drei Wochen, und wir liegen im Winterschnee begraben.«
»Dann«, sagte der einschmeichelnde Reisende, »gilt's den ausscharrenden Hunden und den begrabenen Kindern, nach den Bildern.«
»Entschuldigen Sie«, sagte der Wirt, der die Anspielung nicht ganz verstand, »wie ist das gemeint mit den ausscharrenden Hunden und begrabenen Kindern, nach den Bildern?«
Der reisende Künstler fiel wieder ins Wort, ehe eine Antwort gegeben werden konnte.
»Wissen Sie nicht«, fragte er seinen Reisegenossen kalt über den Tisch hinüber, »daß nur Schmuggler im Winter dieses Weges kommen oder irgendein Geschäft auf diesem Wege haben können?«
»Herr, mein Gott! Nein, davon habe ich nie gehört.«
»Dem ist aber so. Und da sie die Vorzeichen des Wetters ziemlich gut wissen, so machen sie den Hunden nicht viel zu schaffen – die infolgedessen auch ziemlich ausgestorben sind – obwohl diese Herberge bequem für sie gelegen ist. Ihre jungen Familien, sagte man mir, lassen sie gewöhnlich zu Hause. Aber es ist ein großer Gedanke!« rief der reisende Künstler, unerwartet in einen enthusiastischen Ton ausbrechend. »Es ist eine erhabene Idee. Es ist die schönste Idee von der Welt und preßt uns Tränen aus, beim Himmel!« Nachdem er geendigt, aß er mit großer Ruhe an seinem Kalbfleisch fort.
Es lag genug höhnenden Widerspruchs in diesen Worten, um einen Mißton hervorzurufen, obgleich die Art, wie sie hervorgebracht wurden, sehr fein und die Person, die sie vorbrachte, sehr viel Manier hatte, und obgleich der herabsetzende Teil derselben so geschickt eingekleidet war, daß es für ein an die englische Sprache nicht vollkommen gewöhntes Ohr sehr schwer war, es zu verstehen oder selbst, wenn man es verstanden, sich beleidigt zu fühlen, so einfach und leidenschaftslos war der Ton. Nachdem er mit seinem Kalbfleisch mitten in der allgemeinen Stille zu Ende war, richtete der Sprecher wieder das Wort an seinen Freund.
»Sehen Sie«, sagte er in seinem früheren Ton, »sehen Sie diesen Herrn, unsern Wirt, an, der noch nicht mal in dem besten Mannesalter steht und auf so anmutige Weise und mit so seiner Lebensart und Bescheidenheit uns die Honneurs macht! Manieren für eine Krone geeignet! Essen Sie mit dem Lord-Mayor von London (wenn Sie eine Einladung bekommen können) und bemerken Sie den Kontrast. Dieser liebe Junge, mit dem feinstgeschnittenen Gesicht, das ich jemals sah, einem Gesicht von vollendeter Zeichnung verläßt ein tätiges Leben und kommt hier herauf, ich weiß nicht, wie viele Fuß über dem Spiegel des Sees, in keiner andern Absicht (ausgenommen, hoffe ich, um sich in einem trefflichen Refektorium zu ergötzen), als um ein Hotel für müßige arme Teufel, wie Sie und ich, zu halten und die Rechnung unsrem Gutdünken zu überlassen! Wie, ist das nicht ein schönes Opfer? Was brauchen wir mehr, um uns rühren zu lassen? Weil nicht acht bis neun Monate lang von den zwölfen gerettete Leute von interessantem Äußern sich am Halse der klügsten Tiere, die hölzerne Flaschen tragen, festhalten, sollen wir deshalb den Ort tadeln? Nein! Segen über diesen Ort. Es ist ein großer Ort, ein herrlicher Ort!«
Die Brust des grauen Gentleman, der der Häuptling der bedeutenden Gesellschaft war, schwoll, als wollte er dagegen protestieren, daß man ihn unter die armen Teufel zähle. Kaum hatte der reisende Künstler zu sprechen aufgehört, als er selbst mit großer Würde das Wort ergriff, als läge es ihm ob, an den meisten Orten das erste Wort zu führen, und er hätte diese Pflicht eine kurze Weile versäumt.
Er teilte mit großer Gewichtigkeit ihrem Wirt seine Ansicht mit, daß sein Leben im Winter hier ein höchst trauriges sein müsse.
Der Wirt gestand dem Monsieur zu, daß es etwas einförmig sei. Die Luft sei lange Zeit schwer zu atmen. Die Kälte sei sehr streng. Man müsse jung und kräftig sein, um es auszuhalten. Sei man dies jedoch und habe man den Segen des Himmels ...
Ja, das sei sehr gut. »Aber die Gefangenschaft?« fragte der graue Herr.
Es gebe viele Tage, selbst bei schlechtem Wetter, wo es möglich sei, auszugehen. Es sei dann ihre Gewohnheit, einen kleinen Weg zu bahnen und sich dort Bewegung zu machen.
»Aber der Raum«, machte der graue Herr geltend. »So klein! So – ha – sehr beschränkt.«
Monsieur möge sich erinnern, daß man die Zufluchtorte besuchen und auch dorthin Wege bahnen müsse.
Monsieur machte dagegen geltend, daß der Raum –ha – hm – so schmal sei. Mehr als das. Es sei immer derselbe, immer derselbe. Mit einem ausweichenden Lächeln hob und senkte der Wirt sanft seine Schultern. Das sei wahr, bemerkte er, aber es möge ihm zu sagen gestattet sein, daß beinahe alle Dinge ihre verschiedenen Gesichtspunkte hätten. Monsieur und er sehen dies sein armes Leben nicht vom gleichen Gesichtspunkt an. Monsieur sei nicht an Gefangenschaft gewöhnt.
»Ich – ha – ja, sehr wahr«, sagte der graue Gentleman. Er schien einen tüchtigen Stoß von der Kraft dieses Beweises zu bekommen.
Monsieur, als ein reisender Engländer, umgeben von allen Mitteln, angenehm zu reisen, ohne Zweifel im Besitz von Vermögen, Wagen, Dienerschaft –
»Ja wohl, ja wohl. Ganz richtig –« sagte der Gentleman.
Monsieur könne sich nicht leicht in die Lage einer Person setzen, die nicht die Macht habe, zu wählen, ich will heute dahin gehen und morgen dorthin: ich will diese Grenzen überschreiten, die Fesseln, die mich binden, erweitern. Monsieur könnte sich vielleicht nicht vorstellen, wie der Geist sich in solchen Dingen der gebieterischen Notwendigkeit fügt.
»Es ist wahr«, sagte Monsieur. »Wir wollen – ha – die Sache nicht weiter verfolgen. Sie sind – hm – sehr genau, ich zweifle nicht daran. Wir wollen nicht weiter davon reden.«
Als das Essen vorüber war, zog er während des Sprechens seinen Stuhl weg und bewegte sich nach seinem früheren Platz bei dem Feuer. Da es am größten Teil des Tisches sehr kalt war, nahmen die andern Gäste gleichfalls ihre früheren Sitze bei dem Feuer ein, denn sie hatten die Absicht, sich vor Schlafengehen tüchtig zu wärmen. Als sie sich vom Tische erhoben, verbeugte sich der Wirt vor allen Anwesenden, wünschte ihnen gute Nacht und ging von dannen. Zuvor hatte ihn jedoch der einschmeichelnde Reisende gefragt, ob sie etwas Wein heiß gemacht bekommen könnten; und da er »ja« geantwortet und das Getränk kurz darauf hereingesandt, setzte sich dieser Reisende in die Mitte der Gruppe und war in der vollen Hitze des Feuers bald damit beschäftigt, es den übrigen zu servieren.
Um diese Zeit schlüpfte die jüngere von den beiden jungen Damen, die stumm und aufmerksam in ihrer dunklen Ecke (das Kaminfeuer war das Hauptlicht in dem finstern Zimmer, die Lampe brannte rauchig und düster) auf das gehorcht, was von der abwesenden Dame gesprochen wurde, zur Tür hinaus. Sie wußte nicht, welchen Weg sie gehen sollte, als sie leise dieselbe geschlossen hatte; nach einigem Hin- und Hergehen in den hallenden Gängen und den zahlreichen Wegen kam sie an ein Zimmer in einer Ecke des Hauptgangs, wo die Diener beim Abendessen saßen. Diese gaben ihr eine Lampe und zeigten ihr den Weg nach dem Zimmer der Dame.
Es lag über der großen Treppe im obern Stock. Da und dort waren die kahlen weißen Wände durch ein eisernes Gitter unterbrochen, und sie glaubte, als sie vorüberging, der Ort sei eine Art Gefängnis. Die rundbogige Tür des Zimmers oder der Zelle der Dame war nicht ganz geschlossen. Nachdem sie zwei- bis dreimal daran geklopft hatte, ohne eine Antwort zu erhalten, drückte sie sie langsam auf und sah hinein.
Die Dame lag mit geschlossenen Augen außen auf dem Bett, durch wollene Decken und Umschlagtücher, mit denen sie bei ihrem Erwachen aus der Ohnmacht zugedeckt worden, vor der Kälte geschützt. Ein düstres Licht in der tiefen Fensternische verbreitete wenig Helle in dem gewölbten Zimmer. Die Fremde trat schüchtern an das Bett und sagte leise flüsternd: »Befinden Sie sich besser?«
Die Dame lag im Schlummer, und das Geflüster war zu schwach, um sie aufzuwecken. Ihr Besuch, der noch immer ganz stille stand, sah sie aufmerksam an.
»Sie ist sehr hübsch«, sagte sie bei sich. »Ich sah noch nie ein so schönes Gesicht. O, wie anders sehe ich aus!«
Es war ein seltsamer Ausspruch, aber er hatte seine verborgene Bedeutung, denn ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Ich weiß, ich hatte recht. Ich weiß, er sprach von ihr, an jenem Abend. Ich konnte sehr leicht über alles andre im Irrtum sein. Aber darüber nicht, nicht darüber!«
Mit sanfter und zarter Hand strich sie eine verirrte Locke von dem Haar der Schlafenden zurück und berührte dann die Hand, die außerhalb der Decke lag.
»Ich sehe sie gern an«, atmete sie leicht vor sich hin. »Ich sehe gerne, was ihn so sehr angezogen hat.«
Sie hatte ihre Hand noch nicht losgelassen, als die Schlafende ihre Augen öffnete und zurückfuhr.
»Bitte, beunruhigen Sie sich nicht. Ich bin nur eine von den Reisenden unten. Ich kam, um Sie zu fragen, ob Sie sich besser befänden und ob ich etwas für Sie tun könnte.«
»Ich danke: Sie waren bereits so freundlich, Ihr Kammermädchen zu meiner Unterstützung zu senden.«
»Nein, nicht ich, das war meine Schwester. Befinden Sie sich besser?«
»Viel besser. Es ist nur eine leichte Quetschung; man hat nach ihr gesehen und nun geht es beinahe ganz gut. Es machte mich nur einen Augenblick schwindlig und ohnmächtig. Es hatte mir zuvor schon weh getan. Aber zuletzt überwältigte es mich plötzlich.«
»Darf ich bei Ihnen bleiben, bis jemand kommt? Ist es Ihnen angenehm?«
»Es würde mir sehr lieb sein, denn es ist hier sehr einsam; aber ich fürchte, Sie werden die Kälte zu sehr fühlen.«
Ich kümmere mich nicht um die Kälte. Ich bin nicht zart, wenn ich auch danach aussehe.« Sie rückte augenblicklich einen von den rohen Stühlen an das Bett und setzte sich. Die andere nahm ebenso rasch einen Teil eines Reisemantels vom Bett und legte ihn auf sie, so daß ihr Arm, indem sie ihn um sie hielt, auf ihrer Schulter ruhte.
»Sie haben so ganz das Aussehen einer freundlichen Pflegerin«, sagte die Dame, sie anlächelnd, »daß es mir ist, als wenn sie aus meiner Heimat zu mir kämen.«
»Das freut mich sehr.«
»Ich träumte gerade von der Heimat, als ich aufwachte. Von meiner alten Heimat, meine ich, ehe ich verheiratet war.«
»Und ehe Sie so weit davon entfernt waren.«
»Ich war schon weiter entfernt von ihr, aber damals war der beste Teil derselben bei mir, und ich vermißte nichts. Ich fühlte mich so verlassen, als ich einschlief, und, die Heimat vermissend, wanderten meine Gedanken zu ihr zurück.«
Es lag ein traurig inniger und kummervoller Klang in ihrer Stimme, der ihren Gast einen Augenblick lang abhielt, sie anzusehen.
»Es ist ein seltsamer Zufall, der uns zuletzt unter dieser Decke zusammenführt, mit der Sie mich umhüllt haben«, sagte die Fremde nach einer Pause: »denn Sie müssen wissen, ich habe Sie schon lange gesucht.«
»Sie haben mich gesucht?«
»Ich glaube, ich habe ein kleines Billett bei mir, das ich Ihnen geben sollte, wenn ich Sie fände. Da ist es. Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist es an Sie adressiert. Nicht wahr?«
Die Dame nahm es, sagte ja und las es. Ihr Besuch beobachtete sie, während sie dies tat. Es war sehr kurz. Sie errötete etwas, als sie ihre Lippen an die Wangen ihres Besuches legte, und drückte ihre Hand.
»Die liebe junge Freundin, der er mich vorstellt, soll mir bisweilen ein Trost sein, sagt er. Sie ist wahrlich ein Trost für mich, im ersten Augenblick, da ich sie sehe.«
»Vielleicht kennen Sie«, sagte die Fremde zögernd, »vielleicht kennen Sie meine Geschichte nicht? Vielleicht hat er Ihnen nie meine Geschichte erzählt?«
»Nein.«
»O nein, warum sollte er auch! Ich habe selbst kaum ein Recht, es zu tun, da ich nicht dazu aufgefordert worden bin. Es ist nicht viel dabei, aber sie möchte Ihnen erklären, weshalb ich Sie bitte, nichts von dem Briefe hier zu sagen. Sie sahen vielleicht meine Familie bei mir? Einige Mitglieder derselben – ich sage das zu Ihnen – sind etwas stolz, etwas vorurteilsvoll.«
»Sie sollen ihn wieder haben«, sagte die andere, »dann ist mein Gatte sicher, daß er ihn nicht sieht. Er möchte ihn sonst durch irgendeinen Zufall finden oder davon sprechen. Wollen Sie ihn wieder in Ihren Busen stecken, um dessen gewiß zu sein?«
Sie tat es mit großer Vorsicht. Ihre kleine, zarte Hand hielt den Brief noch, als sie jemand im Gange draußen hörten.
»Ich versprach«, sagte die Fremde aufstehend, »daß ich ihm schreiben wolle, wenn ich sie gesehen hätte (ich mußte Sie sicher früher oder später sehen), um ihm zu sagen, ob Sie wohlauf und glücklich seien. Ich darf wohl sagen, daß Sie wohl und glücklich seien?« »Ja, ja, ja! Sagen Sie ihm, ich sei sehr wohlauf und sehr glücklich. Und ich danke ihm herzlich und werde ihn nie vergessen.«
»Ich werde Sie morgen früh sehen. Wir werden uns somit recht bald wiedersehen. Gute Nacht!«
»Gute Nacht. Ich danke Ihnen, danke Ihnen. Gute Nacht, meine Liebe.«
In größter Hast und Unruhe nahmen sie voneinander Abschied, und ebenso rasch war die Fremde aus der Tür. Sie hatte erwartet, dem Gatten der Dame zu begegnen: aber die im Gange befindliche Person war nicht er: es war der Reisende, der die Weintropfen mit einem Stück Brot vom Schnurrbart gewischt hatte. Als er die Schritte hinter sich hörte, drehte er sich um – denn er ging in der Dunkelheit.
Seine Höflichkeit, die ausnehmend groß war, wollte nicht dulden, daß sie sich selbst die Treppe hinableuchte und allein gehe. Er nahm ihre Lampe, hielt sie so, daß das beste Licht auf die steinerne Treppe fiel, und begleitete sie den ganzen Weg bis zu dem Speisezimmer. Sie hatte Mühe, auf dem Weg hinab zu verbergen, daß sie jeden Augenblick nahe daran war, zitternd zusammenzusinken; denn die Erscheinung dieses Reisenden war ihr besonders unangenehm. Sie hatte vor dem Essen in ihrer Ecke gesessen und sich vorgegaukelt, was er wohl in den Szenen und an den Orten ihrer Vergangenheit für eine Rolle gespielt, um ihr einen solchen Widerwillen einzuflößen, der ihn ihr nahezu furchtbar erscheinen ließ.
Er begleitete sie mit seiner lächelnden Höflichkeit hinab, führte sie in das Zimmer und nahm seinen Sitz am besten Platz des Kamins wieder ein. Dort saß er, während das Feuer, das bereits schwächer zu brennen begann, in dem dunklen Zimmer seinen Schein bald heller, bald matter auf ihn warf, die Beine nach der Wärme ausgestreckt, den heißen Wein bis auf den Grund leerend, während ein ungeheurer Schatten seine Bewegungen an Wand und Decke nachahmte.
Die müde Gesellschaft war aufgebrochen, und alle andern waren zu Bett gegangen, außer dem Vater der jungen Dame, der in seinem Stuhl am Fenster schlummerte. Der Reisende hatte sich die Mühe genommen, seine Taschenflasche mit Branntwein aus seinem entfernten, im zweiten Stock befindlichen Schlafzimmer zu holen. Er sagte es ihnen, als er den Inhalt in den Rest des Weines goß und ihn mit neuem Behagen trank.
»Darf ich Sie fragen, ob Sie auf dem Wege nach Italien sind?«
Der graue Herr war aufgestanden und rüstete sich zum Gehen. Er antwortete bejahend.
»Ich gleichfalls!« sagte der Reisende. »Ich darf wohl hoffen. Sie in schöneren Gegenden und unter freundlicheren Umständen wieder zu begrüßen als auf diesem traurigen Berge.«
Der Fremde verbeugte sich, ziemlich entfernt, und sagte, er sei ihm sehr verbunden.
»Wir armen Leute, Sir«, sagte der Reisende, den Schnurrbart mit der Hand trocknend, denn er hatte ihn in den Wein und Branntwein getaucht, »wir armen Leute reisen nicht wie Fürsten, aber die Galanterie und feinere Lebensart hat auch für uns ihren hohen Wert. Ihre Gesundheit, mein Herr!«
»Ich danke Ihnen, mein Herr.«
»Auf die Gesundheit Ihrer ausgezeichneten Familie, – der schönen Ladies, Ihrer Töchter!«
»Nein Herr, ich danke Ihnen abermals. Ich wünsche Ihnen gute Nacht. Meine Liebe, warten unsre – ha – Leute?«
»Sie sind ganz nahe zur Stelle, Vater.«
»Erlauben Sie!« sagte der Reisende, indem er aufstand und die Tür offen hielt, als der alte Herr, seinen Arm in den seiner Tochter steckend, durch das Zimmer darauf zuschritt. »Angenehme Ruhe! Auf das Vergnügen, Sie wiederzusehen! Auf morgen denn!«
Als er in der höflichsten Art und mit dem feinsten Lächeln seine Hand küßte, schmiegte sich die junge Dame fester an ihren Vater an und ging voller Angst, ihn zu berühren, an ihm vorüber.
»Hm!« sagte der einschmeichelnde Reisende, der sich gehen und seinen Ton sinken ließ, als er allein war. »Wenn sie sich alle zu Bett begeben, nun, so muß ich eben auch gehen. Sie haben ja eine verdammte Eile. Man sollte glauben, die Nacht wäre lang genug in dieser schauerlich kalten Stille und Einsamkeit, wenn man erst in zwei Stunden zu Bett ginge!«
Den Kopf zurücklehnend, während er das Glas austrank, fielen seine Blicke auf das Fremdenbuch, das, nebst Feder und Tinte, offen auf dem Piano lag, wie wenn die Namen während seiner Abwesenheit eingezeichnet worden wären. Er nahm es in die Hand und las die eingetragenen Namen:
William Dorrit, Esquire, Frederick Dorrit, Esquire, Edward Dorrit, Esquire, und Dienerschaft. Von Frankreich Miß Dorrit, nach Italien. Miß Fanny Dorrit, Mrs. General, Mr. und Mrs. Henry Gowan. Von Frankreich nach Italien.
Dazu fügte er mit einer kleinen, verwickelten Handschrift, in einen dünnen Schnörkel endigend, der einem um alle übrigen Namen geworfenen Lasso ähnlich sah:
Blandois. Paris. Von Frankreich nach Italien.
Dann begab er sich, während seine Nase über seinen Schnurrbart herabkam und sein Schnurrbart sich unter seiner Nase bäumte, nach der ihm angewiesenen Kammer.
Zweites Kapitel.
Mrs. General.
Es ist unerläßlich, die vollendete Dame vorzustellen, die bedeutend genug im Gefolge der Familie Dorrit war, um ihre eigne Linie im Fremdenbuch zu haben.
Mrs. General war die Tochter eines geistlichen Würdenträgers an einem Bischofssitz, wo sie den Ton angegeben, bis sie so nahe an fünfundvierzig war, wie es eine einzelne Dame sein kann. Ein steifer Kommissariatsbeamter von sechzig Jahren, bekannt als ein Mann, der auf strenge Zucht hielt, verliebte sich zu dieser Zeit in die Anstandsgefühle, die sie vierspännig durch die Bischofsstadt kutschierte, und hatte darum angehalten, neben ihr seinen Sitz auf dem Zeremonienwagen nehmen zu dürfen, an den dieses Gespann geschirrt war. Nachdem sein Heiratsantrag von der Dame angenommen worden, nahm der Beamte seinen Sitz hinter den Anstandsgefühlen mit großer Ehrbarkeit ein, und Mrs. General lenkte die Zügel, bis er starb. Im Verlauf ihrer gemeinsamen Reisen überfuhren sie verschiedene Leute, die den Anstandsgefühlen in den Weg kamen; aber immer großartig und mit äußerster Ruhe.
Nachdem der Kommissariatsbeamte mit allem dem Dienst entsprechenden Aufwande begraben worden (das ganze Gespann von Anstandsgefühlen war an seinen Leichenwagen geschirrt, und sie hatten alle Federn und schwarze Samtschabracken mit seinem Wappenschild in der Ecke), begann Mrs. General nachzuprüfen, welche Masse Staub und Asche bei den Bankiers deponiert sei. Es wurde ruchbar, daß der Kommissariatsbeamte in der Stille Mrs. General zuvorgekommen und sich einige Jahre vor der Hochzeit eine Leibrente gekauft, welchen Umstand er verschwiegen hatte, indem er zur Zeit seiner Bewerbung vorgab, sein Einkommen datiere von den Zinsen seines Vermögens. Mrs. General sah infolgedessen ihre Mittel so verringert, daß, wenn sie nicht mit ihrem Verstande sehr im reinen gewesen, sie sich hätte veranlaßt fühlen können, die Richtigkeit des Teiles der Leichenrede zu bezweifeln, der behauptete, der Kommissariatsbeamte könne nichts mit sich hinübernehmen.
In dieser Lage kam Mrs. General auf den Gedanken, sie wolle sich der »Geistesbildung« und gesellschaftlichen Erziehung einer jungen vornehmen Dame widmen. Oder auch die Anstandsgefühle an den Wagen einer reichen jungen Erbin oder einer Witwe schirren und zu gleicher Zeit Kutscher und Schaffner eines solchen Fuhrwerks durch die sozialen Irrgänge werden. Die Mitteilung, die Mrs. General ihren geistlichen und kommissariatlichen Bekanntschaften von dieser Idee machte, fand so warmen Beifall, daß, wenn die Verdienste der Dame nicht so außer allem Zweifel gestanden hätten, die Vermutung nahegelegen wäre, man wolle sie los werden. Zeugnisse, die Mrs. General als ein Wunder von Frömmigkeit, Gelehrsamkeit, Tugend und feiner Lebensart schilderten, wurden von einflußreichen Quartieren verschwenderisch beigesteuert, und ein ehrwürdiger Archidiakon vergoß sogar Tränen, wenn er an sein Zeugnis über die Vollkommenheiten (die ihm von Leuten, auf die er sich verlassen konnte, geschildert wurden) dachte, obgleich er nie in seinem ganzen Leben die Ehre und den sittlichen Genuß gehabt, seine Blicke auf Mrs. General ruhen zu lassen.
So gleichsam von Kirche und Staat zu ihrer Mission beordert, fühlte sich Mrs. General, die immer auf vornehmem Boden gewandelt, in der Lage, diesen zu behaupten, und begann damit, ein sehr stolzes Gesicht zur Schau zu tragen. Es trat eine Zwischenzeit von einiger Dauer ein, während der nicht auf Mrs. General geboten wurde. Endlich eröffnete ein gräflicher Witwer mit einer Tochter von vierzehn Jahren Unterhandlungen mit der Dame, und da es entweder im Charakter der angeborenen Würde oder der künstlichen Politik von Mrs. General lag (sicher jedoch eines von beiden), sich dabei zu benehmen, als wäre sie weit mehr die Gesuchte, denn die Suchende, verfolgte der Witwer Mrs. General, bis es ihm gelang, sie zu bewegen, seiner Tochter Geist und Sitten beizubringen.
Die Durchführung dieser Aufgabe beschäftigte Mrs. General ungefähr sieben Jahre. Währenddessen machte sie die Tour durch Europa und sah den größten Teil jenes umfangreichen Durcheinanders von Dingen, die wesentlich jeder Mensch von seiner Bildung mit den Augen andrer Leute und niemals mit den seinen sehen sollte. Als ihre Aufgabe endlich gelöst war, hatte sich nicht nur die junge Dame, sondern gleicherweise auch ihr Vater, der Witwer, zum Heiraten entschlossen. Der Witwer, der nun Mrs. General unbequem und kostspielig zu finden begann, wurde beinahe ebenso vernarrt in ihre Verdienste, als es der Archidiakonus gewesen, und verbreitete solche Lobeserhebungen ihres ausnehmenden Wertes in allen Quartieren, wo er glaubte, es könne sich eine Gelegenheit bieten, ihren Segen auf jemand andern zu übertragen, daß Mrs. General ein geschätzterer Name denn je war.
Der Phönix stand auf dieser erhabenen Stange zu vermieten, als Mr. Dorrit, der in jüngster Zeit in den Besitz seiner Erbschaft gekommen war, seinen Bankiers gegenüber erwähnte, er wünsche eine feingebildete, gesittete, mit der guten Gesellschaft bekannte und vertraute Dame zu finden, die geeignet wäre, zu gleicher Zeit die Erziehung seiner Töchter zu übernehmen und als Ehrendame oder Anstandswauwau zu dienen. Mr. Dorrits Bankiers, als die Bankiers des gräflichen Witwers, sagten augenblicklich: »Mrs. General.«
Dem Lichte folgend, das ihm so glücklich aufgegangen, und das einstimmige Urteil der ganzen Bekanntschaft von Mrs. General so erhaben findend, wie wir bereits erwähnt, nahm sich Mr. Dorrit die Mühe, sich nach der Grafschaft des gräflichen Witwers zu begeben und Mrs. General kennenzulernen, in der er eine Dame fand, die seine höchsten Erwartungen übertraf. »Entschuldigen Sie mich«, sagte Mr. Dorrit, »wenn ich Sie frage – ha – welche Belohn –«
»Nein,« versetzte Mrs. General, ihn unterbrechend, »das ist eine Sache, auf die ich lieber nicht eingehen möchte. Ich habe nie darüber mit meinen Freunden hier verhandelt, und ich kann die Delikatesse, mit der ich diese Sache stets betrachtet, Mr. Dorrit, nicht überwinden. Ich bin keine Gouvernante, wie Sie bemerkt haben werden –«
»O, gewiß nicht!« sagte Mr. Dorrit. »Bitte, Madame, glauben Sie nicht einen Augenblick, daß ich so etwas denke.« Er errötete wirklich, daß man ihn habe in solchem Verdacht haben können.
Mrs. General neigte feierlich den Kopf. »Ich kann deshalb nicht einen Preis auf Dienste setzen, die ich mit Vergnügen leiste, wenn ich sie freiwillig leisten kann, die ich jedoch als Ersatz unter keiner Bedingung zu leisten imstande wäre. Auch weiß ich nicht, wie und wo ich einen Fall finden sollte, der dem meinen ähnlich wäre. Er ist einzig in seiner Art.«
»Allerdings. Aber wie sollte man denn«, bemerkte Mr. Dorrit ganz natürlich, »die Sache anfangen?«
»Ich kann nichts dagegen einwenden,« sagte Mrs. General, »obgleich selbst das mir unangenehm ist, wenn Mr. Dorrit im Vertrauen meine Freunde fragt, wieviel sie vierteljährlich an meine Bankiers auszubezahlen gewohnt waren.«
Mr. Dorrit verbeugte sich zustimmend.
»Erlauben Sie mir, hinzuzufügen,« sagte Mrs. General, »daß ich mich nicht weiter auf dieses Kapitel einlassen werde. Ferner, daß ich keine zweite oder untergeordnete Stellung einnehmen kann. Wenn mir die Ehre zuteil würde, Mr. Dorrits Familie kennenzulernen – ich glaube, von zwei Töchtern war die Rede?«
»Zwei Töchter.«
»So könnte ich es nur unter der Bedingung vollkommener Gleichheit, als Gesellschafterin, Beschützerin, Mentor und Freundin annehmen.«
Mr. Dorrit kam es trotz des Bewußtseins seiner Würde vor, als ob es wirklich eine Freundlichkeit wäre, wenn sie es überhaupt unter irgendeiner Bedingung annähme. Er ließ dies beinahe in seinen Worten merken.
»Ich glaube,« wiederholte Mrs. General, »von zwei Töchtern war die Rede.«
»Zwei Töchter,« sagte Mr. Dorrit wieder.
»Es würde deshalb nötig sein,« sagte Mrs. General, »ein Drittel mehr zu der Summe hinzuzufügen (wie groß immer ihr Betrag auch sein mag), die meine Freunde hier bei meinen Bankiers niederzulegen gewohnt waren.«
Mr. Dorrit verlor keine Zeit, die delikate Frage dem gräflichen Witwer vorzulegen, und da er fand, daß dieser gewohnt war, jährlich dreihundert Pfund an die Bankiers von Mrs. General zu bezahlen, kam er, ohne seine Arithmetik besonders anzustrengen, zu dem Resultat, daß er vier bezahlen müsse. Da Mrs. General ein Artikel von jener glänzenden Außenseite war, der einen glauben macht, daß sie jeden Preises wert sei, so machte er ihr den förmlichen Antrag, ihm zu gestatten, sie als ein Glied seiner Familie zu betrachten. Mrs. General bewilligte das stolze Privilegium und gehörte von nun an zur Familie.
Persönlich war Mrs. General, mit Einschluß ihrer Toiletten, die eine bedeutende Rolle dabei spielten, von würdiger, imposanter Erscheinung: groß, rauschend und sehr umfangreich; beständig aufrecht hinter ihren Anstandsgefühlen. Man hätte sie nach den Höhen der Alpen und den Tiefen von Herkulanum mitnehmen können, und nahm sie auch mit, ohne daß eine Falte ihres Kleides aus der Ordnung gekommen oder eine Stecknadel verrückt worden wäre. Wenn ihr Gesicht und ihr Haar ein ziemlich mehliges Aussehen hatten, als wenn dies vom Aufenthalt in einer außerordentlich eleganten Mühle käme, so war dies eher darum der Fall, weil sie überhaupt eine kreidige Natur, als weil sie ihre Gesichtsfarbe mit Veilchenpulver aufbesserte oder grau geworden war. Wenn ihre Augen keinen Ausdruck besaßen, so war dies wohl deshalb der Fall, weil sie nichts auszudrücken hatten. Wenn sie wenig Runzeln besaß, so war es, weil ihr Geist nie seinen Namen oder eine Inschrift auf ihr Gesicht gezeichnet. Eine kalte, wachsartige, ausgelöschte Person, die niemals gut geleuchtet hatte.
Mrs. General hatte keine Meinungen. Ihre Art, einen Geist zu bilden, war die, daß sie ihn hütete, sich Meinungen zu bilden. Sie hatte eine kleine Anzahl kreisförmiger geistiger Rinnen oder Schienen, auf denen sie kleine Züge von andrer Leute Meinungen führte, die sich niemals überholten und nie irgendwohin kamen. Selbst ihr Anstandsgefühl konnte nicht bestreiten, daß es Unanständigkeit in der Welt gebe; aber Mrs. Generals Art, sich davon loszumachen, war, dergleichen aus dem Gesichtskreis zu rücken und glauben zu lassen, daß das gar nicht existiere. Dies war eine zweite Art, wie sie den Geist bildete – alle schwierigen Dinge in Schränke zu kramen, diese zuzuschließen und zu behaupten, sie existierten nicht. Es war die leichteste Art und ohne Vergleich die anständigste.
Mrs. General konnte nichts Angreifendes hören. Unglücksfälle, Jammer und Mißhandlungen durften nie vor ihr erwähnt werden. Leidenschaft schlief gewöhnlich in Mrs. Generals Gegenwart ein und Blut ging in Milch und Wasser über. Das wenige zu firnissen und zu beschönigen, was in der Welt übrigblieb, wenn man alle diese Abzüge gemacht, war Mrs. Generals Aufgabe. In diesem ihrem Bildungsprozeß tauchte sie den kleinsten Pinsel in den größten Topf und firnißte die Oberfläche aller Dinge, die in Betracht kamen. Je mehr Risse eine Sache hatte, desto mehr firnißte sie.
Es war Firnis in Mrs. Generals Stimme, Firnis in Mrs. Generals Berührung, eine Firnisatmosphäre um Mrs. Generals Gestalt. Mrs. Generals Träume waren sicher gefirnißt – wenn sie welche hatte –, als sie in den Armen des guten hl. Bernhard schlief, während der federige Schnee auf seinen Hausgiebel fiel.
Drittes Kapitel.
Auf dem Wege.
Die helle Morgensonne blendete die Augen, der Schnee hatte aufgehört, die Nebel waren verschwunden, die Bergluft war so klar und leicht, daß das neue Gefühl des Atmens wie das Eintreten in ein neues Dasein erschien. Um die Täuschung zu mehren, schien selbst der feste Boden verschwunden und der Berg eine leuchtende Wüste ungeheurer weißer Haufen und Massen, eine schwimmende Wolkenregion zwischen dem blauen Himmel oben und der Erde tief unten.





























