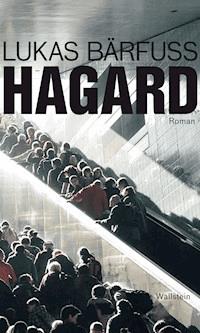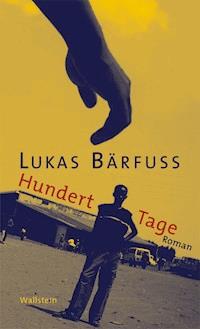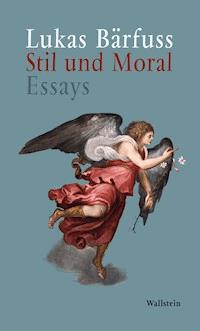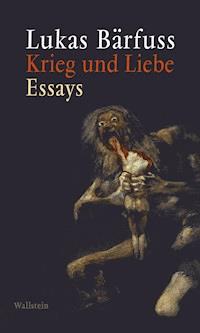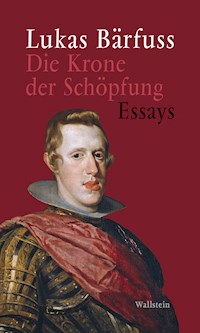Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lukas Bärfuss hat einen gedanklich weit ausgreifenden Roman geschrieben, der über die Frage, warum jemand willentlich den Tod gesucht hat, zu einer anderen vordringt: Welche Gründe gibt es, sich für das Leben zu entscheiden? Ein ganz gewöhnlicher Mensch, sein ganz gewöhnliches Leben und sein ganz gewöhnliches Ende. Aber nichts an dieser Geschichte in Lukas Bärfuss` neuem Roman will uns gewöhnlich scheinen. Denn das erzählte Ende ist ein Suizid, und der ihn verübt hat, ist sein Bruder. Auch wenn die Statistik sagt, dass für die Menschen zwischen zwanzig und vierzig Jahren Suizid die zweithäufigste Todesursache überhaupt ist, hilft das niemandem in seinem individuellen Schicksal. Die Fragen, die sich unweigerlich stellen, finden nicht zu Antworten, die denen, die zurückbleiben, wirklich Trost spenden. Bärfuss spürt dem Schicksal des Bruders nach, über das er zunächst wenig weiß. Und er begegnet einem großen Schweigen. Das Thema scheint von einem großen Tabu umstellt. Und von einem Geheimnis. Warum nannten seine Freunde ihn Koala? Wie kam er zu diesem Namen? Und hat vielleicht der Name gar das Schicksal des Bruders mitbestimmt; wird ein Mensch seinem Namen ähnlich? Die Geschichte der Tierart in Australien, die heute vor der Ausrottung steht, gerät in den Blick des Autors, und so ist das Buch auch eine Natur-Geschichte über den Umgang des Menschen mit dem anderen Menschen, mit dem Tier, mit Gewalt überhaupt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lukas Bärfuss
KOALA
Roman
Für T.
Man hatte mich in meine Heimatstadt geladen, damit ich einen Vortrag über einen deutschen Dichter halte, der zweihundert Jahre früher, an einem Tag im November, am Wannsee in Berlin eine Mulde gesucht und danach seiner Freundin Henriette Vogel ins Herz und schließlich sich selbst eine Kugel in den Rachen geschossen hatte. Im Rathaus, einem mächtigen Bau aus dem sechzehnten Jahrhundert, am zentralen Platz gelegen, sollte ich im großen Saal einige Gedanken zu diesem Mann und seinem Werk äußern, und da diese Stadt klein ist und die Gasthäuser früh schließen, es nach dem Vortrag also zu spät sein würde, um noch eine ordentliche Mahlzeit zu finden, setzte man sich schon gegen sechs Uhr abends in ein Lokal am Ufer des Flusses, der jene Stadt in zwei Armen durchschneidet.
Neben den Leuten, die diesen Anlass organisiert hatten, traf eine halbe Stunde später, nachdem das Essen bereits bestellt war, mein Bruder ein und setzte sich zu uns. Ich hatte ihn vor ein paar Wochen angerufen und über meinen Besuch in der alten Heimat informiert, obwohl ich sicher war, dass ihn der Inhalt meines Vortrags, das dunkle, teilweise schwerverständliche Werk eines deutschen Dichters vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts, wenig interessieren würde. Wir hatten selten Gelegenheit, uns zu sehen; mein Bruder bewegte sich kaum aus jener Stadt heraus, die ich dreiundzwanzig Jahre früher nicht ganz freiwillig verlassen und seither gemieden hatte. Wir führten verschiedene Leben, außer der Mutter und einigen nicht ausschließlich angenehmen Kindheits- und Jugenderinnerungen teilten wir wenig, und gewöhnlich reichten uns zwei Stunden, um der still empfundenen Verpflichtung, sich als Brüder nicht ganz aus den Augen zu verlieren, Genüge zu tun.
Ich sehe das Bild, wie er an jenem Tag Ende Mai das asiatisch angehauchte Lokal mit vornehmlich jungen Gästen betrat und sich vor dem Hintergrund einer Fensterfront, die den Blick auf ein paar Weiden, den Fluss und die erste Häuserzeile freigab, nach uns umsah, ein schlanker Mann jenseits der vierzig, gepflegt, freundlich, zurückhaltend, ein Junggeselle, wie auf den ersten Blick zu erkennen war. Er setzte sich neben mich, verzichtete auf das Essen und bestellte ein Bier. Am Gespräch über die Literatur und die Struktur der hypotaktischen Satzkonstruktionen, für die jener Dichter und Selbstmörder berühmt ist, beteiligte sich mein Bruder nicht. Er nippte schweigend an seinem Glas. Mir fiel ein, wie er diese Situation vorausgesehen hatte, als er am Telefon meinte, er habe keine Lust, sich in einer Gruppe meiner Verehrer zu finden, er verabscheue nichts so sehr wie Speichellecker. Meine Antwort, es werde sich bestimmt Gelegenheit zu einem Gespräch ergeben, wurde Lügen gestraft, und ich fühlte mich von Minute zu Minute unbehaglicher. Da man in diesem Lokal auf langen Bänken saß, berührten sich unsere Körper, etwas, das ihm zusätzlich unangenehm zu sein schien. Er rutschte auf der Bank hin und her, suchte nach Distanz, und ich fühlte, dass ihn nur die Höflichkeit daran hinderte, sich zu verabschieden, und obwohl auch mir, wie gesagt, die Situation keine Freude machte, war ich diese Stimmung gewohnt, das Schweigen erstaunte mich nicht, sein Schmollen war mir nur allzu vertraut.
Dann und wann wechselten wir ein paar Sätze, wenn der Kellner die Getränke oder das Essen brachte und eine Pause entstand. Ich erfuhr, dass es ihm nicht gutging, es Probleme mit einer Frau gab, die er vor einigen Jahren kennengelernt hatte und mit deren Liebe es nun, so befürchtete er, zu Ende ging. Die Situation erlaubte nicht, Einzelheiten zu erörtern, wir hätten dies aber wohl auch nicht getan, wenn wir alleine und ungestört gewesen wären. Wenn es eine Vertrautheit zwischen uns gab, dann beschränkte sie sich auf ein komplizenhaftes Schweigen, ein Reden in Andeutungen, das niemals auf den Grund der Dinge stieß.
Kurz vor acht Uhr wurde die Rechnung beglichen, man stand auf, um in das Rathaus hinüberzuwechseln, er aber, der in der Notschlafstelle erwartet wurde, zum Nachtdienst, wo er den Bettlern und Drogensüchtigen, die sonst kein Obdach hatten, Decken und Betten zuwies, verabschiedete sich und stieg auf sein himmelblaues Fahrrad, ein eigentümliches Gefährt, das einem Motorrad nachempfunden war, mit hohem Lenker, tiefem Sattel und breiten Reifen. Es passte weder zu seinem Alter noch zu seiner Person, eine Tatsache, die ihm bewusst war und aus der er eine diebische Freude bezog. So entfernte er sich in die Dämmerung, entschwand zwischen den Spaziergängern, die sich am linden Frühlingsabend erfreuten.
Der Vortrag fand statt, ich ließ das Bild eines Mannes auferstehen, dem, wie er formuliert hatte, auf Erden nicht zu helfen war, ein ehemaliger Soldat, der irrlichternd durch Europa gereist und für einige Monate auch in dieser Stadt gestrandet war, auf einer Insel in der Aare, am Rande eines Bürgerkrieges, um sich in eine einfache, bescheidene Existenz als Bauer zu schicken, eine Halluzination, der er wohl nur deshalb gefolgt war, um daran zu scheitern. Ob es die Anrufung dieser Existenz war, der Gewalt, die er gesehen und verursacht hatte, als Kindersoldat bei der Belagerung von Mainz etwa, ein unbeschreibliches Gemetzel, wie alle versichern, die dabei gewesen sind, alle, mit Ausnahme jenes Dichters, der an jene Kanonade nur die süßesten Erinnerungen aufbrachte, nicht an die siebentausend Leichen dachte, die verstreut um die Stadt lagen, sondern an die ersten Aufwallungen des Gefühls, was immer er damit gemeint haben könnte, ob es an meinem Unbehagen lag, einen Doppelselbstmord zu feiern oder, besser gesagt, einen Mord und einen Selbstmord, oder einfach an jenem blauen Frühlingsabend, der mich aufkratzte, kann ich nicht sagen. Sicher ist nur, dass ich es nach dem Ende des Vortrags eilig hatte, in das nächste Gasthaus zu kommen. Zwei alte Freunde aus meiner Schulzeit begleiteten mich. Die Wirtschaft lag nur einige Schritte vom Rathaus entfernt, auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes, und ich weiß nicht, ob eine Bedeutung darin zu finden ist, dass sie den Namen ›Zu Metzgern‹ trug und an ihrer Fassade ein goldener Löwe angebracht war, ein Löwe, der ein mächtiges Schlachterbeil präsentierte, jedenfalls stürzte ich unverzüglich zwei, drei Gläser Bier hinunter, jeweils begleitet von einem klaren Schnaps. Die Gasthäuser, wie erwähnt, schließen in jener Stadt zeitig, und so wechselten wir nach der Polizeistunde bereits etwas angetrunken ein paar Häuser weiter, in ein schummriges Lokal, das über eine schmale Treppe zu erreichen war und wo wir die einzigen Gäste waren, mit Ausnahme von zwei attraktiven Damen, Königinnen der Nacht, die an der Bar saßen. Eine davon war eine asiatische Schönheit namens Daisy, mit der ich in den folgenden Stunden die Bekanntschaft machte, mit jedem Glas mehr erheitert über ihre lückenhaften Sprachkenntnisse, die Anlass zu reizenden Missverständnissen wurden. Sie fand es aufregend, einen Schriftsteller zu unterhalten, und ich war erstaunt, wie aufmerksam sie meinen Ausführungen folgte, ein aufrichtiges Interesse für meine nicht leicht verständlichen Interpretationen gewisser dunkler Stellen im Werk jenes Dichters aufbrachte. Als erster Mensch schien sie ein Verständnis für jenes ungeheuerliche Komma aufzubringen, das in einer seiner Erzählungen einen ganz gewöhnlichen Satz während einer Versöhnungsszene zwischen Vater und Tochter in die Beschreibung der masturbierenden Mutter verwandelt, die diesem Moment von den beiden unbemerkt beiwohnt. Jedenfalls klebte Daisy an meinen Lippen und amüsierte sich über mein Interesse für onanierende Mütter, und als ich um vier Uhr morgens in der menschenleeren Gasse stand, trauerte ich weniger dem in ein paar Stunden verprassten Vortragshonorar nach, sondern vielmehr jener Daisy, die sich, als die letzte Runde angekündigt wurde, rasch in den Feierabend verabschiedet und mich mit meinen literarischen Erörterungen und der offenen Rechnung zurückgelassen hatte.
Da meine Verbindungen zu dieser Stadt nur noch lose waren, hatte man ein Zimmer gebucht, in einem Hotel in der Nähe des Bahnhofs, wohin ich nun geschwankt sein muss. Vielleicht karrte mich auch ein Taxi die paar hundert Meter, ich kann es nicht sagen. Bloß an den Nachtportier erinnere ich mich, oder vielmehr an meine Scham, als er den Meldezettel auf die Theke legte und ich es beim besten Willen nicht zustande brachte, den Stift richtig in die Hand zu nehmen, geschweige denn meine Unterschrift auf das Papier zu setzen. Der Mann hatte bald ein Einsehen und meinte, ich könne dies am nächsten Morgen nachholen, wenn ich ausgeschlafen sei, und so werde ich mich auf das Zimmer begeben und auf das Bett geschmissen haben. Dort fand ich mich ein paar Stunden später angezogen und mit den Schuhen an den Füßen wieder; die Sonne, die zu hell auf meinen Kopf schien, und ein Blick auf die Uhr mahnten mich zur Eile. Nach einer kalten Dusche und einem weichen Ei im Frühstücksraum eilte ich zurück aufs Zimmer und übergab mich in das Klosett. Danach stürzte ich hinaus in die Gasse, ich kann mich nicht erinnern, aus welchem Grund, ob ich etwas suchte, eine Schmerztablette vielleicht, oder ob ich meinen Kreislauf in Gang bringen wollte, jedenfalls irrte ich eine Weile benommen durch die Lauben, bestrebt, den Menschen auszuweichen, bevor ich mich auf die Terrasse des Hotels setzte und versuchte, die Strömung des Flusses und den Straßenlärm zu ignorieren und mich auf eine Journalistin des lokalen Radiosenders zu konzentrieren, die Fragen zum vergangenen Abend stellte, wissen wollte, wie ich mich an diesem sonnigen Morgen in meiner alten Heimatstadt fühle. An meine Antworten erinnere ich mich nicht, aber ich war erleichtert, als die halbe Stunde vorbei war und ich mich auf den Weg zum Bahnhof machen konnte. Ich wünschte nur, niemanden zu treffen und keinem Menschen zu begegnen, und als ich mich endlich in einem Abteil niederließ und sich der Zug in Bewegung setzte, sagte ich mir, dass alles schlimmer hätte enden können und das Wiedersehen mit meiner alten Heimat glimpflich verlaufen sei. Meinen Bruder aber habe ich nie wieder gesehen.
Das letzte Lebenszeichen meines Bruders erreichte mich im November darauf. An einem Sonntag schickte ich eine Kurznachricht, in der ich ihm zum Geburtstag gratulierte. Ich saß am See, der Tag war warm, Martinisommer, über dem Wasser kreisten die Möwen, Ausflügler promenierten, und da ich nicht sicher war, ob ich mich an das richtige Datum erinnert und er nicht schon am Vortag gefeiert hatte, formulierte ich meinen Glückwunsch vorsichtig, eher als Frage. Minuten später traf seine Antwort ein, ja, schrieb er in seiner Mundart, heute seien es genau fünfundvierzig Jahre und er freue sich aufrichtig, dass ich daran gedacht habe. In diesem Dank erkannte ich einen kleinlichen, aber nicht unberechtigten Vorwurf, denn obwohl ich es billig, um nicht zu sagen schäbig fand, ihm auf diese Weise zu gratulieren und nicht etwa mit einem kartengeschriebenen Gruß, war es doch das Äußerste an Aufmerksamkeit, das ich seit langer Zeit für ihn aufgebracht hatte. Geburtstage waren verstrichen ohne Nachricht, und ich nahm mir vor, öfter an meinen Bruder zu denken und ihn zu einem größeren Teil meines Lebens werden zu lassen, mehr noch, ich weitete diesen Vorsatz auf andere Menschen aus, um die ich mich wenig gekümmert hatte. Danach muss ich mich erhoben und einer Tätigkeit zugewandt haben, die mir damals unaufschiebbar schien, an die ich heute jedoch nicht die leiseste Erinnerung besitze. Meine Aufforderung, an diesem Tag nichts aus- und es gehörig knallen zu lassen, ließ er unbeantwortet.
Was ich nicht wissen konnte: Sechs Tage zuvor, an einem Montagnachmittag, an dem ich, wie mein Kalender mir später verriet, mit den Kindern einen Wildpark besuchte, hatte sich mein Bruder an einen Tisch gesetzt und mit schwarzem Kugelschreiber zuerst seinen Namen, das Datum seiner Geburt und jenes bestimmten Tages, dazu die Uhrzeit auf einen Bogen Papier gesetzt. Und während wir im weitläufigen Gehege nach dem Wolfsrudel suchten, das sich im Unterholz versteckte, formulierte mein Bruder seinen letzten Willen. Die Verteilung seines Besitzes nahm anderthalb Seiten und fünfzig Minuten in Anspruch, bevor er kurz nach fünfzehn Uhr abschließend bestimmte, dass man von einer Organspende absehen und seine Asche im See verstreuen solle.
Sechs Wochen später, kurz vor Weihnachten, rief mich eine unbekannte Frau an und überbrachte die Nachricht seines Todes. Die Frau erwies sich als seine Vorgesetzte, die ihn zum Dienst in der Notschlafstelle erwartet und nach einigen vergeblichen Anrufen schließlich einen Freund meines Bruders und danach die Polizei informiert hatte. Ihre Stimme war sanft, vorsichtig, als sie mir mitteilte, dass man ihn Stunden zuvor in der Badewanne seiner Wohnung gefunden habe. Sie gab mir die Nummer eines Mannes, den ich von früher flüchtig kannte und der die Leiche gemeinsam mit einem Freund entdeckt hatte. Nach einigen Worten des Beileids, für die ich mich bedankte, hängte sie auf, und ich hatte keine Ahnung, was ich nun tun sollte.
Vielleicht eine, vielleicht zwei Stunden blieb ich in meinem Lehnstuhl sitzen und weinte, erstaunt über die Automatik, mit der mein Körper geschüttelt wurde, nur weil ich Worte, eine unerfreuliche Nachricht vernommen hatte. Man hatte mir nichts getan, alles war wie fünf Minuten zuvor. Das Radio spielte dieselbe Musik, die Tasse stand da, wo ich sie vor dem Gespräch hingestellt hatte, der Kaffee war noch warm, selbst der Nachbar rauchte auf dem Balkon an derselben Zigarette.
Irgendwann wählte ich die Nummer des Mannes, der meinen Bruder gefunden hatte. Er bestätigte den Bericht der Vorgesetzten. Ich erinnere mich, dass zu Beginn dieses Gespräches eine Beklemmung entstand, weil der Freund sich verpflichtet fühlte, mir als Bruder des Verstorbenen zu kondolieren – und ich dasselbe ihm gegenüber als Freund empfand, der ihn besser gekannt hatte als ich. Vielleicht lag es an dieser ungeklärten Situation, wer nun wem das Beileid auszusprechen hatte, dass ich mich schuldig fühlte und versprach, noch am selben Tag in unsere Heimatstadt zu reisen. Was ich dort wollte und wozu man mich benötigen könnte, war mir nicht klar, aber ebenso wenig wusste ich, was ich sonst hätte tun sollen, und ich vermutete, dass dies den ganzen Tag so bleiben würde.
So machte ich mich auf, nahm am Bahnhof wieder den Zug, den ich erst ein halbes Jahr vorher bestiegen hatte, und wie damals war der Anlass ein Selbstmord. Als ich ankam, hatte die Dämmerung eingesetzt, und nach einem Fußmarsch von zehn Minuten, der mich in die Gegenden auf der Rückseite des Bahnhofs und durch erstaunlich schmale Straßen und verblüffend lebendige Kindheitserinnerungen führte, kam mir auf der Straße ein Mann entgegen, in dem ich den Freund meines Bruders erkannte. Nach einer stillen, aber herzlichen Begrüßung führte er mich in sein Haus jenseits der Geleise, die tiefer in die Berge führten, dem Hochgebirge entgegen, das sich dunkel am Horizont erhob.
Sein Haus war ein einstöckiges Gebäude, das wir durch den Garten betraten. An einem Tisch saß ein Mann, den ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Er war jünger als der Hausbesitzer, und es erwies sich, dass sie gemeinsam die Wohnung des Toten betreten hatten und den Schrecken teilten, der von der frischen Leiche eines Freundes ausgeht. Aber es schien, als habe dieser Schrecken mit verschiedenen Griffeln in ihre Gesichter geschrieben und bei jenem, der am Tische saß, harte, wütende Zeichen hinterlassen, beim anderen aber, dem Hausbesitzer, weiche und erstaunte.
Noch vor wenigen Tagen, so erzählten sie mir, hatten sie mit meinem Bruder an jenem Tisch gesessen und die Würfel geworfen, einen Abend, wie sie übereinstimmten, in gelöster, wenn auch nicht ausgelassener Stimmung verbracht. Die leichte Bedrückung, die sie an meinem Bruder bemerkten, beunruhigte weder den einen noch den anderen, nicht nach den Zeiten, die mein Bruder durchgemacht hatte, nicht nach dem, was sie über seine Launen wussten.
Jeder von ihnen, so stimmten sie überein, habe an jenem Abend Partien gewonnen und verloren, das Glück und das Pech seien gerecht auf die drei Spieler gefallen, ein Omen habe sich nicht gezeigt. Man müsse wohl, darin waren sich die Männer einig, gewisse Worte heute als Andeutungen verstehen. Ja, er werde sich verabschiedet haben, im Geheimen, er für sich alleine, ohne sich zu offenbaren.
Nach diesen Worten fielen beide in ein Schweigen, als kehrten sie zu jenem Moment zurück, der ihnen vor drei Tagen als ein Abschied zur Nacht erschienen, tatsächlich eine Trennung für immer gewesen war.
Später, nachdem der Geist das von Kerzen spärlich beleuchtete Zimmer wieder verlassen und die beiden Freunde sich gefasst hatten, bestanden sie darauf, dass jedes Erstaunen über seine Tat unangebracht sei, er seinen Entschluss bei vollem Bewusstsein getroffen habe. Die Entschlossenheit, mit der mein Bruder ans Werk gegangen sei, entspreche ganz und gar seiner Persönlichkeit, die Tat widerspiegle seinen Charakter, und man müsse ihm für die Umsicht Respekt zollen. So habe er die Wohnungstür entgegen seinen Gepflogenheiten nicht abgeschlossen, damit beim Betreten der Wohnung keinerlei Gewalt nötig sein würde und unnötiger Sachschaden vermieden werden konnte. Und er hatte seinen spärlichen Besitz geordnet, die Leihgegenstände mit Haftnotizen versehen, darauf die Namen der Eigentümer.
Er habe es gewollt, meinte der Jüngere, er könne dies bezeugen, denn mehr als einmal habe man bei einem Bier, halb im Spaß, halb im Ernst die beste Methode für einen sauberen Abgang erörtert, und sie seien sich einig gewesen, dass kein besserer, schmerzloserer Weg zu finden sei als eben jener, den er nun gewählt habe. Bei dieser Gelegenheit nannte er meinen Bruder bei dessen anderem Namen, den ich seit vielen Jahren nicht mehr gehört hatte, den man ihm als Kind bei den Pfadfindern gegeben hatte und der unter Eingeweihten als geheimer Ruf, als Totem zirkulierte, der Name eines Beutelsäugers, eines Tieres vom anderen Ende der Welt.
Danach setzte wieder ein Schweigen ein, jedoch ein anderes, eines, das nicht von einem Geist rührte, kein außergewöhnliches, kein Schweigen der Aufmerksamkeit, eines, das zu dieser Gegend gehörte und das mir nur zu vertraut war.
Wenn einer in jene Stadt kommt, die er dreiundzwanzig Jahre zuvor verlassen hat, an einem Wintersonntag, im ersten Schneegestöber, von einem Vorortbahnhof aus, mit einem Koffer in der Hand, einem Koffer aus brauner Pappe, den er Jahre zuvor von einer alten Dame überreicht bekommen hat, einer Dame, die in einem weitläufigen Haus lebte, alleine, als Witwe oder als ledige Frau, man vermag es nicht mit Sicherheit zu sagen, ein Haus, nebenbei gesagt, in dessen Stall der junge Mann morgens und abends fünf verlorene Rinder zu versorgen hatte, Rinder, die ihn jeweils mit einem Husten begrüßten, wenn also dieser Mann nun mehr oder weniger unfreiwillig in seine Heimatstadt zurückkehrt, dann wird er als erste Maßnahme seiner kurzzeitigen Eingliederung in diese Gesellschaft den Wortschatz reduzieren, die Sätze verklumpen lassen. Er wird alles vermeiden, was geschmeidig, anmutig oder gebildet erscheinen könnte. Kaum aus dem Zug gestiegen, spricht er nur in Brocken, bestellt am Kiosk die Zigaretten mit zwei, drei dumpfen Worten und wird selbst unter Bekannten seiner Seele keine Satzgirlanden verleihen. Viele Worte, so hat er als Kind gelernt, verliert allein der Hausierer, einer, der etwas verkaufen will, um das niemand gebeten und für das keiner Verwendung hat. In dieser Gegend geht man stumm durchs Leben, höchstens die Mädchen dürfen schwatzen, bis auch sie früher oder später erwachsen werden und sich in das Schweigen zu finden haben. Und falls der Besucher Fragen hat, die ihn umtreiben und von deren Antworten er sich eine Beruhigung der Seelenlage verspricht, dann wird er sie für sich behalten müssen, denn in dieser Gegend gelten Fragen nie als Ausdruck der Beteiligung, sondern als unangebrachte Neugier. In jeder Frage steht eine Anklage.
Und deshalb schwieg ich in jenem Haus an jenem Abend und hörte einfach zu, weil ich den Freunden, die sich so schuldig fühlen mussten wie ich, nicht mit übertriebener Neugier zu nahe treten wollte, und auch weil ich wusste, dass sich Wissen, zumal jenes über den Selbstmord, hier anders verbreitete als über das gesprochene Wort. Das Wesentliche lag im Ungesagten, in den Blicken, in den Gesten, den unausgesprochenen Gedanken, die als Gekräusel auf einer Stirn sichtbar wurden, als Lippen, die sich verkneifen.
Später am Abend wechselten wir in die Wohnung der Stiefmutter meines Bruders, ein paar Straßen weiter. Sein Vater lag ohne Bewusstsein im Krankenhaus, die Folge eines Hirnschlags, den er ein paar Wochen zuvor erlitten hatte. Wir kamen überein, mit der Trauerfeier zu warten, bis der Vater so weit genesen war, um die Nachricht vom Selbstmord seines Sohnes entgegennehmen zu können. Danach setzten wir die Todesanzeige auf, die erste Gelegenheit, bei der ich mich nützlich machen konnte. Ich erinnere mich an einen kurzen Streit über die Frage, in welcher Sprache die Anzeige verfasst werden sollte, in der Mundart oder der Hochsprache. Mehr gab es an jenem Abend nicht zu besprechen. Ich kehrte nach Hause zurück, in mein Leben, jedenfalls versuchte ich es.
Seine Habseligkeiten waren rasch verteilt. Die Uhr, Marke Tissot, das blaue Fahrrad, das man abgeschlossen am Bahnhof fand, die beiden Backgammon-Koffer, der braune, der ihm mehr bedeutet hatte als der schwarze, die Schachtel mit den Präzisionswürfeln aus Monte Carlo, die Pink Floyd-CDs und jene von Chris Rea, der Esstisch und die Stühle, die Comicsammlung, die an mich ging, das Bett, die rote und die schwarze Lederjacke, das graue Schraubenschlüssel-Set, das Mobiltelefon, die paar Franken, die auf seinem Konto lagen – alles wurde über die Stadt und das Land verstreut, jeder, der ihm nahe gewesen war, erhielt seinen Anteil, so wie mein Bruder es in seinem Testament bestimmt hatte. Nichts blieb zusammen. Die Dinge, so schien es mir, die sich im Leben an die Person binden, um die man sich bemüht, damit sie nicht verlorengehen, mit denen wir uns umgeben und an denen uns die anderen erkennen, lösen sich nach dem Tod von den Menschen, es ist, als würde ein Stern erlöschen. Die Planeten, die er an sich gebunden hat, lösen sich aus der Verbindung, sie entfernen sich von ihrem Zentralgestirn, und ihre Materie wird gleichmäßig im Universum verteilt.
Bis in den Sommer suchte ich nach einer Frage auf die Antwort, die er uns allen gegeben hatte. Ein Juli, die Hälfte des Augusts, Streifzüge durch die Hochebene, über die Moore, besetzt von unbekannten Blüten, silbrig, fädig, kleine Wimpel, unerreichbar im Hochmoor. Mit den Kindern und Freunden verbrachte ich die warmen Monate in unserem Haus in den Bergen, matte Tage auf der Terrasse, unter uns der Garten, wo die Malven und die Kresse wucherten. Es war nicht Trauer, die mich jede Minute begleitete und mich in ein ewiges, ermüdendes Karussell der Gedanken zwang, jedenfalls nicht das, was ich mir unter Trauer vorgestellt hatte. Ich fühlte keinen Verlust, er fehlte mir nicht, jedenfalls nicht mehr als damals, als er noch am Leben war.
Wir sammelten Heidelbeeren, die Kinder füllten ihre Gefäße und lachten darüber, wie geschickt der Hund mit seiner Schnauze die Früchte von den Zweigen löste. Mich verfolgten Bilder, die jemand anders gesehen und mir in den letzten Monaten zugetragen hatte. So sah ich immer wieder die rote Lederjacke, mit der er sich in die Wanne gelegt haben soll, ich versuchte mir einen Reim auf die Bemerkung des Freundes zu machen, an der Farbe des Gesichts habe er gleich erkannt, dass sie zu spät gekommen waren. Ich fragte mich, welche es gewesen sein könnte, und weil ich keine gültige Antwort fand, nahm in meiner Vorstellung das Gesicht meines toten Bruders mit jedem Mal eine andere Farbe an, das Spektrum des Regenbogens von Violett bis Gelb.