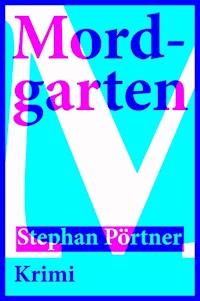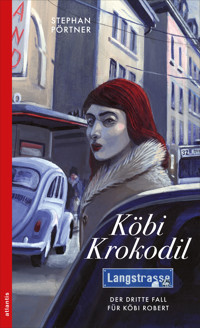9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Aisatore
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Köbi Krimis
- Sprache: Deutsch
In seinem vierten Fall trifft Köbi auf der Plaza Quintana in Santiago de Compostela ein Gespenst. Das Gespenst von Mark Haussmann, dem ehemaligen Zürcher Hanfkönig. Gemeinsam kehren sie nach Zürich zurück, um Marks Tochter zu treffen, die nichts von ihrem legendären Vater weiss. Kaum in Zürich wird Mark umgebracht und Köbi hat einen neuen Fall am Hals, der in tief ins Hanfgeschäft und in die Zeit der Zürcher Jugendunruhen in den 1980er-Jahren zieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Stephan Pörtner
Köbi Santiago
Alle Rechte vorbehalten
Originalausgabe bilgerverlag Zürich, 2007
2. Auflage
© 2015 Edition Aisatore
ISBN 978-3-906247-04-5
Covergestaltung: Christian Theiler
www.stpoertner.ch
They might be drinkers, Robin, but they are also human beings
Batman
Der Inhalt dieses Romans ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Inhalt
Gespenster
Mark Haussmann
Dinah Stettler
Diego Roberto
Connections
Reisefieber
Räubergeschichten
Sihlfeld
Morgengrauen
Nora Stettler
James
Edy
Dronenhalle
Weinstube
Beat Weber
Biergarten
Kündigung
Pedro
Tanja
Wohnungsübergabe
Albert Kunz
Frank Senn
Aufklärung
Johannes Grossenbacher
Jean-Claude Detruche
Robert Gordon
Luca Wasmeier
Rapport
Shopping
Nancy Manara
Armani und Pitbull
Martin Manara
Lowlife
Gespenster
Als ich das Gespenst zum ersten Mal sah, zuckte ich zusammen. Das Gespenst ging über die Quintana de los muertos hinter der Kathedrale von Santiago de Compostela. Wie passend. Der Platz der Toten. Wo sonst sollte ich dem Geist Mark Haussmanns begegnen, dem ehemaligen Zürcher Hanfkönig, der vor Jahren gewaltsam ums Leben gekommen war. Überfallen im Gewerbegebiet von Dietlikon. Inmitten von zwanzigtausend potenten Graspflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien. Die alle noch da waren, als die Polizei kam. Die Bewässerungsanlage war aufgedreht. Das Wasser drang in den unteren Stock, ein Lager für Sanitärbedarf. Der Besitzer alarmierte die Polizei, weil oben niemand aufmachte. Die Polizei hatte damit gerechnet, Graspflanzen zu finden. Wasserschäden in Gewerbeliegenschaften sind typisch für die Branche. Die Pflanzen brauchen eine Menge Wasser und die ausgeklügelten Systeme machen häufig Probleme. Diesmal aber fanden sie nicht nur die erwarteten Pflanzen, sondern auch einen übel zugerichteten Pflanzer. Er lebte noch und die Polizei vermutete, dass er es war, der das Wasser aufgedreht hatte, in der Hoffnung, gefunden zu werden. Allerdings vergebens. Mark starb ein paar Tage später.
Hieß es zumindest, an diesem denkwürdigen Tag im Mai 2000 auf dem Friedhof Sihlfeld. Der Strom der Trauergäste riss nicht ab. Alle hatten Mark Haussmann gekannt. Partyvolk, Künstler und Geschäftsleute ebenso wie junge Hip-Hopper, alte Hippies und ehemalige Punks. Die Könige des Nachtlebens standen neben den autonomen Familienvätern, Wohlgenährte neben Aufgeschwemmten und Abgehalfterten. Reichtum, Wohlstand und Elend fanden sich einträchtig auf dem Gottesacker im Sihlfeld ein. Ein Stelldichein von schwarzen Kampfhosen und Springerstiefeln, Helly-Hansen-Jacken, Wanderschuhen, Versace-Anzügen und Gucci-Tretern. Ich hatte so eine Beerdigung noch nie gesehen. Ein inoffizielles Staatsbegräbnis, dem niemand ferngeblieben war. In der Abdankungshalle wurden Reden gehalten. Mark der Visionär, Mark der Freund, Mark der Rebell. Draußen stand man herum, rauchte, blickte zu Boden, grüßte verhalten und plauderte mit gedämpfter Stimme. Ich sah Leute, von denen ich geglaubt hatte, sie lägen längst selbst auf dem Friedhof. Leute, die ich kaum mehr erkannte. Die einen waren rund geworden und hatten die Haare verloren. Die anderen waren sehr dünn und hatten schlechte Zähne.
Mark war nicht alt geworden. Einundvierzig Jahre. Zu jung zum Sterben. Als sich der Menschenstrom zur Grabstätte bewegte, um die Urne zu versenken, setzte ich mich mit drei alten Jungs ab. Mit dem einen hatte ich schon mehr Biere getrunken als Worte gewechselt. Wir grüßten uns, wann immer wir uns auf der Straße sahen. Wir hatten mal auf dem Bau zusammengearbeitet, und er trug noch dieselben Kleider wie damals. Blaue Arbeitshosen und ein kariertes Flanellhemd. Er war ein wenig grau geworden im Gesicht, ansonsten schien die Zeit spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein. Das Reden hatte er noch immer nicht gelernt.
Der andere hatte Bass bei einer Hardcore-Band gespielt, deren Ruhm bis in den japanischen Untergrund vorgedrungen war. Nach Jahren des Tourens war er nach Zürich zurückgekehrt und betrieb jetzt ein Kellerstudio, in dem der hoffnungsvolle Nachwuchs seine Demos aufnahm.
Der Dritte war ein paar Jahre jünger als ich. Ich hatte ihn als Kellner in der Roten Fabrik kennengelernt. Später betrieb er eine illegale Bar, unterdessen war er Mitbesitzer von zwei gut gehenden Szeneclubs. Wir gingen in eine kleine Kneipe und tranken Bier aus großen Gläsern. Sie spendeten uns den Trost, den wir brauchten. Wir tranken noch eins und noch eins: auf Mark, der nie viel getrunken hatte, auf uns, die immer zu viel tranken. Es war schon lange wieder hell, als ich endlich nach Hause wankte.
Diesen Mark Haussmann, den wir damals beerdigt hatten, sah ich also unten den Platz der Toten überqueren, kurz zu mir aufschauen und in den Gassen der Altstadt verschwinden. Es musste sich um ein Gespenst handeln. Um eine vage Illusion, eine Erinnerung an vergangene Zeiten, die mich gestreift hatte und mir sinnlose Bilder projizierte. Ich saß auf der großen Steintreppe, dort wo man sich in dieser Stadt hinsetzt, wenn man auf etwas wartet. Oder anderen beim Warten zuschaut. Ich schaute zu. Dachte ich. Der süddeutschen Tramperin etwa, die Rotwein aus einer Flasche trank und ihrer Begleiterin mit schneidender Stimme Belangloses über ihr Studium in Berlin erzählte. Den geduckten Pennern, die das Billigbier aus dem Hause Heineken tranken, das hier Aguila Amstel hieß, aber genauso schmeckte wie das Amstel überall sonst auf der Welt. Dem dicken, blonden Amerikaner, der seine dicke, rothaarige Frau fotografierte, die sich vor der Puerta Santa aufbaute, der Tür, die nur in heiligen Jahren geöffnet wird. Etwas gefiel dem Mann an der Komposition aus gotischer Baukunst, nackten, weißen Unterschenkeln, beigen Shorts, geblümter Bluse und hellgrüner Mütze noch nicht, wie er mit Handzeichen zu verstehen gab. Daneben stand ein sehniger Pilger, der am Ende seiner Reise angekommen war und verloren aussah. All ihnen schaute ich zu und wie sollte ich wissen, ob es Menschen oder Gespenster waren? Ich musste lächeln.
Etwa zehn Minuten später legte sich eine Hand auf meine Schulter.
»Köbi Robert, schön, dich zu sehen.«
Mark Haussmanns unverwechselbare Stimme. Ein Quäntchen gequetscht. Ein nie ganz abgelegtes Wiler Näseln im Zürichdeutsch.
»Mark«, sagte ich, ohne das Gespenst anzusehen. Gespenster lösen sich auf, wenn man sie beim Namen nennt. Hieß es. Das Gespenst verschwand nicht. Es setzte sich neben mich auf die steinernen Stufen. Diese trennten den unteren Teil, die Quintana de los muertos vom oberen Teil, der Quintana de los vivos, dem Platz der Lebenden. Von dort war das Gespenst gekommen, was mir zu denken gab. Mein Lächeln gefror.
Mark Haussmann. Ich drehte mich zu ihm um, erkannte die grünen Augen und die feine, gerade Nase. Die ehemals hellblonden Haare waren schlohweiß geworden und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der unter einem braunen Schlapphut hervorschaute. Mark hatte sich einen dezent gestutzten Bart wachsen lassen. Er trug Jeans, ein weißes Hemd, ein violettes Seidenfoulard und eine braune Lederjacke. Gepflegt sah er aus. Ich schaute auf seine Hand, als er sie von meiner Schulter nahm. Die Tätowierung fehlte. Mark, so erinnerte ich mich, hatte zu Lebzeiten einen fünfzackigen Stern in der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger gehabt. Offenbar hatten Gespenster keine Tätowierungen. Vielleicht wurden sie ihnen vom Astralleib gelasert.
»Du bist tot!«, sagte ich, um klarzustellen, dass ich mich nicht an der Nase herumführen ließ.
Ein trockenes Lachen. »Nicht wirklich. Wie du siehst, lebe ich noch. Trotzdem hast du natürlich recht. Offiziell bin ich tot.«
»Eben«, sagte ich. Für eine Weile saßen wir schweigend auf der Treppe, zwischen den Lebenden und Toten.
»Was machst du hier in Santiago? Bist du auf Pilgerreise?«, versuchte ich es unverfänglich.
»Gewissermaßen. Ich bin seit zwei Tagen in der Stadt und jetzt treffe ich dich.«
»Das ist aber ein Zufall!«
»Es gibt keinen Zufall, Köbi.« Mark legte mir seine ehemals tätowierte Hand auf den Unterarm. »Wir mussten uns treffen, du und ich.« Er schaute mir in die Augen.
Ich lächelte nicht mehr und wandte den Blick ab.
»Du musst mir helfen, Köbi«, sagte Mark. Ich schüttelte den Kopf, denn wenn einem einer mit »helfen« und »müssen« kommt, sollte man grundsätzlich Nein sagen. Erstens muss man nicht und zweitens hilft es nichts. Es bringt nur Ärger. Leider hatte ich schon immer ein Problem mit dem Neinsagen. Das war mein Verhängnis, gute Vorsätze halfen da wenig.
»Nimm noch eins!« »Nur für ein paar Tage!« »Ich zahl sogar Zinsen!« »Das wird der Hammer!« »Eine todsichere Sache!«
Nein! Nein! Nein!, redete ich mir auch jetzt wieder ein, vielen Dank und nichts für ungut! Auf Wiedersehen! So einfach ist das. Menschen, die Nein sagen, kommen weiter im Leben und sind beliebt. Wer nicht Nein sagt, läuft Gefahr, seine Bekannten an offene Schulden, gescheiterte Projekte und leere Versprechen zu erinnern. Das verursacht Missmut und ein schlechtes Gewissen. Beides schlägt leicht in Abneigung um.
Weil ich nicht Nein sagen konnte, sagte ich gar nichts.
»Karin ist gestorben, Köbi«, riss mich Mark aus meinen
Gedanken.
»Aha«, machte ich. Es war mir egal, ich kannte keine Karin.
»Karin ist die Mutter meiner Tochter«, erklärte Mark unaufgefordert. »Meine Tochter weiß nichts von mir. Aber sie braucht mich jetzt. Ich spüre es. Das arme Mädchen. Sie ist gerade erst zwanzig Jahre alt. Ich kann doch nicht einfach bei ihr hereinplatzen und sagen: »Hallo, ich bin dein Vater. Seit du auf der Welt bist, hast du nie etwas von mir gehört. Ich bin offiziell tot, aber jetzt bin ich hier, wir werden es schön haben zusammen.«
»Warum denn nicht?«, fragte ich, weil ich wusste, dass bei dieser Vorgehensweise keine Unterstützung meinerseits notwendig wäre.
Mark schüttelte traurig den Kopf. »Sie hat gerade erst ihre Mutter verloren und wird schon genug durcheinander sein. Ich möchte, dass sie einen Vater hat, der ihr in dieser schweren Zeit beisteht. Der für sie da ist. Ich will ihr alles geben, was ich bisher versäumt habe. Das wird nicht einfach werden, aber ich muss es tun. Ich brauche jemanden, der mit ihr Kontakt aufnimmt, der sie auf die große Neuigkeit vorbereitet. Jemand, der mich kennt, der bestätigen kann, dass ich der bin, der ich zu sein behaupte. Es gibt ja nichts Offizielles mehr über mich. Dazu brauche ich deine Hilfe, Köbi.«
»Warum gerade ich?«, versuchte ich mich herauszuwinden. Aber ich kannte die Antwort. Ich war Mark etwas schuldig.
Mark Haussmann
Er hatte mich einmal gerettet. Ewig her, aber trotzdem. Ich war noch keine siebzehn. Ich wollte mich engagieren. Auf die Straße gehen für das autonome Jugendzentrum, das AJZ. Ich war zu weit hinten in der Demo.
Wenn so eine Panik losgeht, Tränengasnebel dir die Sicht und den Atem rauben, aber von allen Seiten gedrückt und gestoßen wird, wenn von links Gummigeschosse geflogen kommen, rechts eine Mauer ist und rund um dich Geschrei, dann weißt du gar nicht, wie du vorwärtskommst, aber irgendwie kommst du weiter und irgendwie siehst du einen Durchgang zwischen zwei Häusern und stürzt hinein. Stehen bleiben. Durchatmen. Feuer in der Lunge. An die Wand gelehnt in diesem Innenhof, vornübergebeugt, die Augen brennen, du kannst sie nicht aufmachen. Stimmen, Schritte. Schwarze Stiefel. Blaue Kampfoveralls. Runde Strohschilder. Weiße Helme mit einem großen schwarzen P darauf.
»Da sind sie!« Ein Knall. Eine Tränengaspetarde kommt geflogen. Eine volle Ladung ins Gesicht. Taumeln, umdrehen, die Gummigeschosse prasseln auf den Rücken. Panik, weil du weißt, was mit denen passiert, die sie in einem Hinterhof stellen. Knüppel, Knochenbrüche, Knast.
Eine Hand reißt mich fort, eine halbe Zitrone wird mir ins Gesicht gedrückt, unter die Augen, noch im Rennen durch den Nebel. Das tut gut. Ich schaue kurz auf.
Sehe ein Paar Augen hinter einer Schwimmbrille, ein vermummtes Gesicht. Eine Wasserflasche wird mir gereicht. Das juckende Gesicht abspritzen, noch immer rennend. Die Gestalt springt auf einen Container, zieht mich hoch, weiter auf ein Vordach, in den nächsten Hinterhof, auf der anderen Seite raus und die Straße hinunter. Wir sind hinter der Linie.
Ich stehe auf dem Trottoir, in der Luft noch immer der beißende Geruch von Tränengas, aber mir kommt es wie frische Bergluft vor. Wir finden einen Brunnen. Mein Retter nimmt das Tuch vom Gesicht und klopft mir auf die Schulter.
»Alles okay, Junge?«
»Du hast mir das Leben gerettet.«
Er lacht. »Übertreib nicht, wir passen doch aufeinander auf. Wir gehören alle zusammen. Ich bin der Mark.«
»Ich bin der Köbi. Merci, Mark, das war wirklich knapp.« Ein Stück weiter vorn graben ein paar Leute Steine aus einer Baustelle. Wir gehen zu ihnen. Das Halstuch nass machen und vors Gesicht binden, Zitrone unter die Augen und so viele Steine in die Taschen wie nur möglich.
Wir kennen einander nicht. Wir gehen zusammen die Straße hinunter, wortlos, schauen um die Ecke. Da sind sie. Ein Sixpack und seine Besatzung. Sechs Blaue, die danebenstehen.
Wir rennen. »Ah-jot-zett« der Schlachtruf. Die Steine fliegen. Jetzt sind sie es, die Angst haben. Sie schießen Tränengas. Aber wir sind immun. Wir haben keine Angst mehr. Wir greifen an. Wir rücken vor. Wir kommen gefährlich nahe. Die Blauen verschanzen sich hinter ihren Wagen, schützen sich mit ihren runden Strohschildern. Versuchen ihre Gummischrotgewehre in Position zu bringen. Wir halten drauf. Die Scheiben bersten. Da kommt mit quietschenden Reifen ein grauer Mannschaftswagen um die Ecke. Sechzehn Mann. Flinten im Anschlag. Wir lassen alles, was wir noch haben, auf sie prasseln. Dann rennen wir die Straße hinauf. Sie schießen uns hinterher, aber die Gummigeschosse tun nicht weh. Wir rennen weiter, bringen uns in Sicherheit. Das Grüppchen zerfällt. Ich setze mich aufs Trottoir. Mark neben mich. Er reicht mir eine Zigarette. Parisienne carrée. Wir rauchen. Wir lachen. Nichts ist mehr, wie es war. Etwas hat sich verschoben. Eine Lektion gelernt. Einen Glauben verloren. Einen neuen gefunden. Ein Tag, an dem sich das Leben verändert.
Von dem Tag an war Mark so etwas wie ein Freund. Seinen Freunden hilft man. Auch wenn sie tot sind.
Dinah Stettler
»Du kennst die Mutter meiner Tochter, Köbi«, riss mich Mark aus meinen Gedanken. »Sie nannte sich früher Dinah.«
Er legte mir wieder seine Hand auf den Unterarm. Ich fragte mich, wo er diese blöd väterliche Geste herhatte. Hoffentlich hatte er sie nicht extra für seine Tochter einstudiert.
»Wieso Dinah, ich denke, sie hieß Karin?«
Mark nahm die Hand von meinem Unterarm und schaute mir in die Augen. Noch so eine blöde Angewohnheit.
»Ja, richtig hieß sie Karin Stettler, aber damals nannte sie sich eben Dinah. Sie muss dir doch aufgefallen sein, Köbi, im AJZ oder in der Roten Fabrik. Sie war eine auffallend schöne Frau.« Mir ging ein Licht auf. Natürlich. Die schöne Dinah. Ich sah sie deutlich vor mir. Groß, blaue Augen, kurze, rot gefärbte Haare. Hochnäsig, immer gut gestylt, enge schwarze Lederhosen, zerrissene T-Shirts, Miniröcke über grünen Netzstrümpfen. Wehe, einer schaute zu lange hin, dann ging sie auf ihn los: »Sexist, Macker, Scheißtyp«. Darum hatte ich meist nur aus dem Augenwinkel auf ihren Arsch geschielt. Das war ungefährlich, solange sie sich nicht umdrehte. Und nach mir hat sie sich garantiert nie umgedreht. Mit jungen Punks gab die sich nicht ab. Jetzt fiel mir alles wieder ein: Sie war zwei oder drei Jahre älter gewesen als ich und unerreichbar. Immer mit den coolen Obermackern zusammen. Den Wortführern und den ganz Harten. Eine von der Politfraktion. Dem Vorläufer dessen, was später Autonome und schließlich Schwarzer Block genannt wurde.
Die ganzen kommunistischen Splittergruppen, die hauptsächlich aus Studenten bestanden, die darauf warteten, revolutionäre Kader zu werden, hatten die Jugendbewegung schlicht verschlafen. Während dieses Gemisch aus Punks, Freaks, Kiffern, Künstlern, Gassenrowdys und unbescholtenen Teenagern explodierte, theoretisierten sie in ihren abgeschlossenen Zirkeln über das revolutionäre Dispositiv im Subproletariat des Trikonts. Niemand hörte ihnen zu. Die Bewegung brauchte keine Führer und Kader. »Lieber Chaot als rot«, spotteten die Leute von der Bewegung und erhoben den Schimpfnamen, den ihnen die Boulevardpresse angehängt hatte, zum Ehrentitel. Die Marxisten machten erst lange Gesichter und wurden später eben bürgerliche Kader.
Ein paar versuchten zwar, Teile der Bewegung zu rekrutieren, was aber erst gelang, als diese in Trümmern lag. Erste Risse machten sich bald bemerkbar. Unter den Bewegten gab es jene, die sich freuten, innert kurzer Zeit dem Staat das AJZ abgetrotzt zu haben. Gelernt zu haben, dass man etwas verändern kann, wenn man zusammensteht. Dass die Welt nur so funktioniert, wie man uns weismachen will, wenn alle daran glauben. Dass es auch anders geht. Man forderte die Sachen »subito, oder susch tätschts!« Und weil man diese Drohung wahr machen, die schöne, friedliche Stadt Wochenende für Wochenende in ein Schlachtfeld verwandeln konnte, bekam man, was man wollte. Diesen Schwung wollten nun die Politos nutzen, um die Gesellschaft weiter zu verändern.
»In El Salvador werden die Leute abgeschlachtet und ihr hängt hier rum und trinkt Bier«, monierten sie. Nach jeder Vollversammlung, VV genannt, machten sie Krawall oder zogen vors Bezirksgebäude, das praktischerweise dem Volkshaus, wo die VVs stattfanden, genau gegenüberlag. »Use mit de Gfangene!« skandierten sie, warfen Farbbeutel und schossen Knaller aus Signalstiften.
Die Politos erwiesen sich als vollkommen humorlos und nervig. Nach und nach hatten jene, die anders dachten, genug davon, sich ständig anöden zu lassen, und zogen sich zurück. Es war die erste Spaltung der Bewegung. Die Politischen gegen die Unpolitischen. Und Dinah war definitiv eine Politische gewesen.
Dass sie mit Mark liiert gewesen war, hatte ich gar nicht mitbekommen. Ich rechnete nach. Die Tochter musste Mitte der Achtzigerjahre zur Welt gekommen sein. Das AJZ war 1983abgerissen worden. Also nach der AJZ-Zeit. An diese Phase hatte ich nur verschwommene Erinnerungen.
Das lag im Wesentlichen daran, dass im Herbst 1984 die Dronenhalle ihre Tore geöffnet hatte. Sie wurde zum Dreh- und Angelpunkt meiner Existenz. Donnerstag war Dronenhalle. Das hieß durchtrinken bis Freitag oder Samstag. Woche für Woche. War Mark auch dort gewesen? Oder Dinah? Ich erinnerte mich nicht. Es waren viele Leute dort gewesen.
Wir hatten Durst. Wir hatten den Krieg letztlich verloren und nur die eine oder andere Straßenschlacht gewonnen. Die andere Seite hatte schnell gelernt, aufgerüstet, taktiert und auch nachgegeben. Die Luft war raus. Davon erholt man sich nicht so schnell. Natürlich fanden viele einen Weg. Man muss sich halt anpassen. Mit der Zeit gehen. Kompromisse eingehen. Wenn man halbwegs schlau ist. Wir waren nicht schlau. Wir waren realitätsinkompatibel. Erst zwanzig und schon Veteranen einer gescheiterten Revolte. Man hatte die Wahl, sich einzureihen, was in unseren Augen eine Niederlage war, oder sich zu verweigern, was, wie wir damals schon wussten, lächerlich war. Schöne Aussichten, die sich trefflich mit Bier trüben ließen. Ab drei Uhr früh war man unter sich: die maßlosen Trinker, die unermüdlichen Tänzer, die militant Paarungswilligen. Die Leute, die einen Job hatten oder seriös studierten, konnten da nicht mithalten. Zürich war damals noch keine Partystadt. Ganz im Gegenteil.
Darum war Arbeitslosigkeit ein Lebensstil, kein soziales Elend. Das Arbeitsamt befand sich hinter dem Bahnhof Selnau. Dienstag und Freitag musste man sich melden. Dienstags nur eine Karte durch ein Fenster halten, auf die es tatsächlich noch einen Stempel gab. Freitags ging's im Büro vorbei, wo man seine Formulare abgab, darunter der Nachweis von Bewerbungsbemühungen bei irgendwelchen imaginären Firmen. Niemand kontrollierte die Bewerbungen. Auf dem Arbeitsamt erwartete man von keiner Firma, dass sie Leute wie uns anstellte.
»Dinah, stimmt, ich erinnere mich«, sagte ich endlich.
»Siehst du, Köbi. Du bist der Mann, den ich brauche.«
»Blödsinn.« Ich schüttelte den Kopf.
»Es ist doch kein Zufall, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, Köbi«, sagte Mark. »Ich lebe im Süden von Spanien, außerhalb von Granada. Ich bin erst seit zwei Tagen in der Stadt und schon habe ich dich gefunden.«
»Gefunden? Wusstest du etwa, dass ich hier bin?«, fragte ich leicht beunruhigt.
»Nein, Köbi. Ich sage doch, es ist alles vorbestimmt. Ich wusste einfach, dass bei der Kathedrale ein Freund auf mich wartet.«
Es war Mark nicht gut bekommen, umgebracht worden zu sein. Ich hatte ihn als bodenständigen, rationalen Menschen in Erinnerung. Ich wollte aufstehen und gehen.
»Wie bist du überhaupt nach Spanien gekommen? Was hast du die letzten Jahre getrieben?«, fragte ich stattdessen.
»Das erzähle ich dir alles unterwegs, Köbi. Wir fahren zusammen nach Zürich.« Mark strahlte mich an, als sei das das Beste, was mir passieren konnte.
»Hör zu, Mark, du bist in der Schweiz offiziell tot und ich hatte dort eine Menge Ärger. Vielleicht werde ich sogar von der Polizei gesucht.«
»Mach dir keine Sorgen, Köbi. Ich werde mich um alles kümmern. Gib mir einen Tag Zeit, und ich werde die nötigen Abklärungen treffen. Am besten, wir verabreden uns für morgen Nachmittag um vier Uhr wieder hier oben.« Er deutete auf das Café, das sich hinter uns an der Quintana de los vivos befand.
Diego Roberto
Ich war also eingeholt worden. Mark Haussmann war eines der Gespenster meiner Vergangenheit. Vor ihnen war ich ans Ende der Welt geflohen. Und vor der Polizei. Und vor mir selber. Man kann nicht vor sich selber fliehen. Hieß es. Stimmt nicht. Seit ich weg war von Zürich, kam ich blendend mit mir aus. Ich war zwar nicht mehr am Ende der Welt, in Finisterre oder Fisterre, wie die Einheimischen sagen, so wie ich es ursprünglich geplant hatte, sondern in Santiago de Compostela. Hier lagerten die Gebeine des Apostels Jakobus. Nach achthundertjähriger Irrfahrt über die Weltmeere waren sie in einem steinernen Sarg an die Küste geschwemmt worden. Hieß es. Es hieß auch, nicht der Apostel sei im Steinschiff übers Meer gefahren, sondern die Heilige Jungfrau, die ihn besuchen kam und ihn landeinwärts schickte, wo er sich dann ein paar hundert Jahre in seinem Steinsarg im Wald ausruhte, ehe man auf seinen Gebeinen eine Kathedrale errichtete.
Ich bevorzugte die erste Version. Es war der ideale Ort zu stranden, wenn man schwer an sich trug und trotzdem obenauf schwamm. Der heilige Jakobus war immerhin mein Namenspatron. Er war viel herumgekommen und hatte viel herumgelegen. Genau wie ich.
Ich wohnte außerhalb der Stadtmauern. In einem kleinen möblierten Haus, das ich gemietet hatte. Trotz unmittelbarer Stadtnähe lebte ich auf dem Land. Ein Bach plätscherte neben dem Haus vorbei. Die Nachbarn fuhren mit dem Traktor herum und trugen blaue Überkleider. Auf dem ungeteerten Zufahrtssträßlein tummelten sich Hühner und provozierten die angebundenen Hofhunde, die mit wütendem Gebell reagierten. Alte, schwarz gekleidete Frauen trieben Lämmer und Schafe vorbei, Kühe weideten beim Bach. Hier kannte man mich als Diego Roberto. Mein Name auf Spanisch. Das war natürlich kein allzu raffinierter Deckname, aber ich hatte mich daran gewöhnt. Mir gefiel Diego unterdessen besser als Köbi. Mark war seit langer Zeit der Erste, der mich bei meinem alten Namen nannte.
Ich lebte gern hier. Die Nachbarn grüßten mich freundlich, ich kaufte ihnen Eier und Milch ab, sie passten auf mein Haus auf, wenn ich wieder einmal für ein paar Tage wegfuhr.
Die ersten Monate hatte ich zurückgezogen für mich gelebt. Ich wollte einfach eine Weile untertauchen. Bis Gras über die Sache gewachsen war. In Zürich gab es einen Privatdetektiv namens Sauter, dem ich eins auf die Rübe gegeben hatte, ehe ich ihn in einen Keller sperrte. Zuvor hatte er gedroht, mir einen Brandanschlag und einen Mord in die Schuhe zu schieben. Ich wusste nicht, ob er es getan hatte. Ich hätte eigentlich längst herausfinden müssen, ob ich zu Hause polizeilich gesucht wurde oder ob ich gefahrlos einreisen konnte. Aber bis dato hatte ich es trotz guter Vorsätze nicht geschafft, mich darum zu kümmern.
Ich lernte ein paar Leute kennen. Einer von ihnen, Raoul, hatte mir das Haus vermittelt, in dem ich nun wohnte. Es gehörte einem Onkel von ihm, der im Immobiliengeschäft tätig war. Raoul verwaltete ein paar seiner Liegenschaften. Wir mochten uns auf Anhieb. Raoul stellte mich seinen Freunden vor, nahm mich zu den unzähligen Abendessen, Ausflügen und Zerstreuungen seines Umfelds mit. So konnte ich bald nicht mehr durch die Stadt gehen, ohne irgendjemanden zu treffen, den ich von irgendwoher kannte. Ich kam mir fast vor wie zu Hause. Nur ohne den ganzen Ballast. Ohne den Köbi, den ich nach und nach wie eine alte Haut abstreifte.
Ich war zufrieden und führte ein beschauliches Leben. Morgens ging ich zum Spanischunterricht bei Raouls Schwester Maribel. Sie war Lehrerin, hatte aber keinen festen Job und konnte das Geld gut gebrauchen. Ich lernte etwas und hatte einen Vorwand, Zeit mit ihr zu verbringen. Sie gefiel mir, die Schwester von Raoul, und offenbar mochte sie mich auch ganz gut, denn wir blieben immer häufiger nach dem Unterricht hängen, diskutierten stundenlang über alle möglichen Themen und vergaßen die Zeit. Inzwischen hatten wir uns auch schon in Bars und bei anderen Leuten zu Hause getroffen, aber noch wagte keiner von uns den ersten Schritt. Meist lud ich sie mittags zum Essen ein, danach verabschiedeten wir uns und ich hielt zu Hause eine Siesta. Nachmittags fuhr ich mit dem Rennvelo eine Runde, oder ging in ein leicht heruntergekommenes, modrig riechendes Fitnesscenter. Ich war wieder richtig gut in Form. Anschließend setzte ich mich, wann immer es das Wetter zuließ, auf die Treppe an der Plaza Quintana und freute mich an meinem Dasein.
Die Abende verbrachte ich lesend zu Hause, oder ich machte eine kleine Tour durch die Cafés und Bars der Stadt.
So übte ich mich in Konversation, vertiefte meine Bekanntschaften und traf, wenn ich Glück hatte, Maribel.
Ich trank keinen Alkohol mehr. Seit meiner Flucht erschien mir die Welt ganz erträglich. Äußerlich, zumindest. Die Hügel, der Regen, das Grün. Warum also immer betrunken sein? Das gibt einen schiefen Blick und einen schlechten Schlaf. Unausgeschlafen sein ist etwas Schreckliches. Die Welt verwandelt sich in ein quietschendes, rumpelndes Tram voll nasser Gestalten in stinkenden Mänteln, die einem ins Gesicht husten, auf die Füße trampeln und sich dann noch beschweren.
Ich war nach und nach dabei, mich hier festzusetzen. Bereit, eine längere Zeit zu bleiben, vielleicht für immer. Das Häuschen, in dem ich wohnte, war ziemlich feucht und schlecht geheizt, darum wandte ich mich an Raoul, ob er nicht eine komfortablere Bleibe für mich wüsste.
»Woran denkst du?«, fragte er. »Willst du etwas mieten oder kaufen?«
»Na ja, ich würde schon gern etwas kaufen«, sagte ich, obwohl ich mir das gar nie so genau überlegt hatte. Raoul wusste von einer kleinen Pension, die zum Verkauf stand. Ein schönes, altes Haus, auf einer leichten Anhöhe, mit großem Garten und Blick über die Stadt. In den oberen Stockwerken gab es kleine Zimmer mit Gemeinschaftsküchen, die von Studenten gemietet wurden. Der Besitzer war zu alt und wollte in sein Häuschen am Meer ziehen. Das Haus müsste ein wenig renoviert werden, aber grundsätzlich war es ein gutes Geschäft. Man brauchte nicht viel zu arbeiten, hatte ein Einkommen und ein Dach über dem Kopf.
Der Gedanke gefiel mir. Er gefiel mir sogar sehr gut. Allerdings müsste ich dazu in die Schweiz fahren und das Geld holen, das mir mein letzter Fall eingetragen hatte. Es lag in einem Bankfach in der Zürcher Vorortsgemeinde Kloten. Den Schlüssel zum Bankschließfach trug ich immer auf mir. Ich spielte mit Raoul verschiedene Optionen durch. Er bot an, das Haus für mich zu kaufen, falls ich nicht in den Papieren auftauchen wollte.
Ich hätte es natürlich lieber selber gekauft. Dazu musste ich aber endlich wissen, ob etwas gegen mich vorlag. Irgendwann ließe es sich nicht mehr aufschieben.
Ich hatte aber keine Lust, beim Grenzübertritt verhaftet zu werden, und trauerte der alten Heimat nicht nach. Zürich ist eine Stadt, die Fernweh macht. Eine schöne Stadt, in die man nach den Ferien gern zurückkehrt. Aber Heimweh? Der Limmat- und der Helvetiaplatz sind nicht eben geeignet, im Menschen Sehnsucht zu entfachen.
Es gab das Durchlauferhitzer-Zürich, das junge, unsichere Einfamilienhausgören ansog, sie durch Szenebars und Lehranstalten pumpte, sie mit Ein- und Ausbildung versorgte, mit modischen und politischen Insignien behängte, um sie dann als strebsame Berufsleute und hingebungsvolle Eltern wieder in die Agglomeration zu spülen. Daneben das Zürich der Alteingesessenen, in dem es eher wie in einem Dorf zuging.
Ich hatte beides hinter mir gelassen, sogar äußerlich. Ich ging jeden Monat zum Frisör, trug weite Anzüge und weiße Hemden. Ich war ein mittelalterlicher Unsichtbarer geworden, dem man mit Höflichkeit begegnete und sofort vergaß.
Mein Krokodil hatte sich auch selbstständig gemacht. Eines Morgens war es zum Bach gegangen und davongeschwommen. Ich habe es nie wiedergesehen und auch nichts darüber gelesen, dass es je gefunden worden war. Vermutlich hatte es Artgenossen gewittert und sich ihnen angeschlossen.
Ich ging bei Raoul vorbei und erzählte ihm, dass ich einen alten Freund getroffen hatte, mit dem ich vielleicht nach Zürich fahren würde.
»Das ist gut, der Besitzer will bald einmal wissen, ob du die Pension kaufen willst.«
»Sag ihm, ich kaufe sie.«
Connections
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, kam mir sofort Mark in den Sinn. Wahrscheinlich hatte ich von ihm geträumt. Zuversichtlich lächelnd schüttelte ich mir den Schlaf aus dem Schädel. Heute würde ich erfahren, ob ich Gespenster gesehen hatte.
Um Viertel nach vier betrat ich die Kneipe. Mark saß an einem Tischchen und winkte gelassen. Er hatte wohl keine Sekunde an meinem Kommen gezweifelt. Mark bestellte einen Amontillado und ich ein alkoholfreies Bier. Der Kellner nahm die Bestellung auf, ohne mit der Wimper zu zucken.
Das war früher anders gewesen. Früher hatte es in Spanien kein alkoholfreies Bier gegeben. Wer nach diesem Getränk verlangte, wurde mit ungläubigen Blicken, verworfenen Händen oder höhnischem Gelächter bedacht. Unterdessen war es in jeder Bar zu haben. Ein Zeichen der Zivilisation.
»Gute Nachrichten, Köbi«, Mark legte mir wieder die Hand auf den Arm. »Du wirst in der Schweiz nicht polizeilich gesucht.«
»Wer sagt das?«
Mark lachte. »Ich habe noch immer ein paar gute Connections in Zürich.«
» Connections, so, so«, ich schüttelte den Kopf, »etwa bei der Polizei?«
Mark ignorierte die Frage »Hast du einen Wagen, Köbi?«
Ich nickte. Der graue 73er Mercedes 280 SE stand in der Garage. Sie war fast genauso groß wie mein Häuschen. Er stand fast immer in der Garage, weil ich mit meinen Schweizer Nummernschildern keine unnötige Aufmerksamkeit erregen wollte. Schade eigentlich, es war ein schönes Gefährt, ideal für lange, gemächliche Reisen.