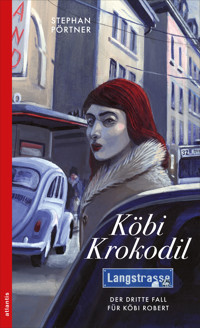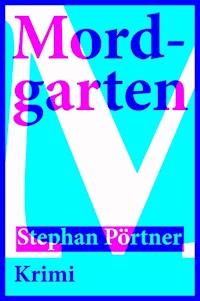
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Aisatore
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Edgar Zingg ist eigentlich Hauswart. Unkonventionell und mit Leidenschaft geht er seiner Berufung nach und schaut in der Genossenschaftssiedlung Moorgarten nach dem Rechten. Doch eines Morgens ist die Idylle bedroht. Ein Toter liegt im Hof, und fortan hat Edi alle Hände voll zu tun, den Ruf der Siedlung und der Agglomerationsgemeinde zu retten und herauszufinden, wer den Mann erschlagen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Stephan Pörtner
Mordgarten
Herausgegeben von
Wohnbaugenossenschaften Schweiz,
dem Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger
Alle Rechte vorbehalten
erschienen im ApplausVerlag Zürich, 2013
2. Auflage
© 2015 Edition Aisatore
ISBN 978-3-906247-03-8
Covergestaltung: Christian Theiler
www.stpoertner.ch
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Epilog
Wieso ein «Genossenschaftskrimi»?
Prolog
Auf so etwas ist ja niemand vorbereitet. Wer hält es schon für möglich, irgendwann in einen Mordfall verwickelt zu werden? Ich sicher nicht. Trotzdem ist mir genau das passiert. Mein Name ist Edgar Zingg. Ich bin der Abwart der Genossenschaftssiedlung «Im Moorgarten». Wenn ich Abwart sage, dann stellen Sie sich wahrscheinlich einen Typen im blauen Übergwändli vor, der eine braune Manchesterdächlikappe oder einen schwarzen Lederhut trägt, Stumpen raucht und den ganzen Tag hässig ist. Habe ich recht? Denn so stellen sich doch die Leute in der Schweiz einen Abwart vor. Und so stellen die Kabarettisten in der Schweiz den Abwart auch dar. Seit Jahrzehnten. Ganz so, als sei die Zeit in den 1970er Jahren stehen geblieben. Wenn einer als Abwart verkleidet auf die Bühne kommt, dann weiß das Publikum gleich: Jetzt wird es lustig, jetzt kommt ein leicht beschränkter Oberspießer, über den man lachen kann. Denn dieser Typ sieht nicht nur bireweich aus, er ist natürlich total kleinlich, engstirnig und regt sich über alles auf. Da lacht das Publikum, und jeder freut sich, weil man sich einbildet, selbst nicht so spießig zu sein.
In Wirklichkeit ist dieses Klischee das Einzige, worüber ich mich als Abwart aufrege. Ich entspreche ihm nämlich überhaupt nicht. Tut mir leid. Nur das mit der Dächlikappe stimmt. So eine trage ich ständig, wenn auch selten eine aus Manchesterstoff. Ich habe etwa fünfundzwanzig verschiedene Modelle im Schrank. Solche Mützen haben einfach Stil. Die trug ich schon, bevor ich Abwart wurde, und das ist mehr als dreiundzwanzig Jahre her. Davor habe ich studiert. Ich habe sogar einen Abschluss. Ich bin Historiker, lic. phil I. Abwart bin ich aus purem Zufall geworden, und hässig bin ich ganz selten, aber an jenem kühlen Morgen im Frühsommer, an dem diese schlimme Geschichte ihren Anfang nahm, war ich nah dran, es zu werden. Denn als ich von meiner Wohnung in der Nummer 20 über den Hof ging, um in mein Magazin zu gehen, das sich an der Stirnseite des Hofs befindet, sah ich, dass bei dem Festtisch vor der Nummer 28 eine zerbrochene Flasche lag. Da hört bei mir der Spaß auf. Scherben im Hof, vor allem am Morgen, wenn die Kinder in die Schule und in den Chindsgi aufbrechen, das geht gar nicht. Deshalb machte ich von der zerbrochenen Weinflasche mit meinem Handy ein Foto. Damit ich einen Beweis hatte, um dem Schuldigen später ins Gewissen reden zu können. Es gibt klare Grenzen. Wir in unserer Siedlung sind tolerant. Es wohnen die verschiedensten Leute zusammen, da kommt man nicht weit, wenn man allen alles verbieten will. Aber es gibt immer wieder Leute, die meinen, wo nicht alles verboten ist, da sei alles erlaubt. Und in der letzten Zeit hatte es hin und wieder mal Vorfälle gegeben. Und so hatte ich mir vorgenommen, mit ein paar Leuten wieder einmal ein ernstes Wort zu reden.
Ich machte also das Foto und wollte ins Magazin hinübergehen, um Handschuhe, Kübel und Besen zu holen, als ich sah, dass da einer neben dem Tisch auf dem Bauch lag. Ich hatte ihn vorher nicht bemerkt, weil er zwischen Hauswand und der Festbank lag, und nun freute ich mich, den Schuldigen gefunden zu haben.
«Heda, aufstehen, Gopfertami», rief ich und trat zu ihm. Er machte keinen Wank. Ich stieß ihn mit dem Fuß an.
«Hallo, aufstehen, das ist hier kein Campingplatz und keine Notschlafstelle.» Keine Reaktion. Ich beugte mich zu ihm hinunter. Am Hinterkopf war das schüttere graue Haar braun verklebt. Blut wahrscheinlich, dachte ich und berührte vorsichtig seinen Arm. Der Körper fühlte sich steif und kalt an. Kein Wunder. Der Mann war tot.
1. Kapitel
Ich beugte mich über den Toten, um dessen Gesicht, das zum Haus gewendet auf dem hellbraunen, gestampften Mulchboden lag, besser sehen zu können. Ich kannte den Mann. Es war Rolf Holliger. Einer von denen, die manchmal blöd taten. Er wohnte nicht in der Siedlung, sondern im Moorgarten 55, einem heruntergekommenen Appartementhaus, das etwa zweihundert Meter weit entfernt von uns lag.
Es gibt ja diese Momente im Leben, in denen man sofort weiß, jetzt ist alles anders. Wenn das Telefon klingelt, die Mutter dran ist und ihre Stimme so komisch tönt, dass sie gar nicht aussprechen muss, dass dem Vater was zugestoßen ist. Oder wenn die Freundin, mit der man seit vier Jahren zusammen ist und den Rest des Lebens zusammenbleiben will, sagt: «Du, wir müssen reden.»
So ein Moment war das, als ich Rolf Holliger unter dem Tisch liegen sah, neben zwei Bierdosen. Mir war klar, das hier war kein Unfall, sondern der Anfang einer üblen Geschichte.
Doch ich wischte die Vorahnung vorerst weg, denn mit Bangen und Zaudern, da kommt man nicht weiter, das hilft meist grad gar nichts, das hatte ich gelernt im Leben. Und nun musste ich erst einmal handeln. Die Dinge ins Laufen bringen. Ich rief die Polizei an. Sie versprachen sofort zu kommen.
Dann ging ich in mein Magazin hinüber, eine umfunktionierte Garage, in der ich eine kleine Werkstatt eingerichtet hatte und alles aufbewahrte, was ich für meine Arbeit brauchte. Ich fand eine Blache, kehrte auf den Hof zurück und legte sie über den Tisch, damit man die Leiche nicht sehen konnte. Dann legte ich den Pfosten um, der größeren Fahrzeugen die Durchfahrt auf dem Weg, der zwischen den Garagen verlief, versperrte, damit die Polizisten bis zum Tatort vorfahren konnten, und stellte mich schließlich neben die zerbrochene Flasche, um zu verhindern, dass jemand in die Scherben trat. Ich war kaum dort, da kamen die ersten Kinder aus den Häusern.
«Salü Edi», sagte Toni, der im gleichen Haus wohnte wie ich. «Was stehst du hier herum? Hast du nichts zu tun?»
Die Kinder in der Siedlung gingen alleine in die Schule, sie wurden nicht gefahren.
«Ich warte auf jemanden, Toni», sagte ich. Toni war Tamile und hatte eigentlich einen anderen Vornamen, er hieß Thondamaan. Aber weil das nur seine Eltern, Geschwister und Verwandten richtig aussprechen konnten, hatte sich irgendwann Toni als Rufname durchgesetzt. Auch ich nannte ihn so, obwohl ich mir jeweils Mühe gab, mir die Namen der Leute nicht nur zu merken, sondern sie auch richtig auszusprechen. Das ist eine Frage des Respekts, finde ich. Und ist es nicht so, dass man, wenn man die Leute mit einem verballhornten Namen anspricht oder den Vor- mit dem Nachnamen verwechselt, das Gespräch schon versiebt hat, bevor man überhaupt zu reden begonnen hat. Das habe ich in meiner Hauswartskarriere oft erfahren. Wenn man hingegen der einzige Schweizer ist, der es im Gegensatz zu den Arbeitskollegen und Nachbarn fertigbringt, den Namen einer Person richtig auszusprechen, können sich viele Türen öffnen. Nicht nur Wohnungstüren.
Bei den Kindern aber war das etwas anderes, weil die ihre Namen sowieso abkürzten. Toni war neun Jahre alt und ging in die dritte Klasse. Er war etwas zu dick, verfügte über eine scharfe Beobachtungsgabe und hielt sich mit seinen Ansichten und Erkenntnissen nicht zurück. Er war ein vorlauter, mitunter frecher Junge, aber halt auch charmant und sehr witzig. Drei weitere Kinder kamen aus den Häusern, und als Sina, Anastasia und Noah uns sahen, kamen sie zu uns herüber, um zu sehen, was los war.
«Edi wartet auf jemanden», informierte Toni, und alle vier schauten mich erwartungsvoll an. Ich hatte mich so aufgestellt, dass sie die zerbrochene Flasche nicht sehen konnten, aber mir fiel spontan keine einleuchtende Erklärung dafür ein, warum ich ausgerechnet hier herumstand und auf wen ich wartete. Immerhin hatte ich gerade einen Toten gesehen. Ich hoffte, die Kinder würden von allein verschwinden.
«Hast du endlich eine Frau gefunden? Kommt sie dich besuchen?», fragte Toni.
Anastasia lachte. Es war ein helles, fröhliches Kinderlachen, das ein wenig höhnisch klang. Wie Kinder halt lachen, wenn jemand etwas völlig Undenkbares sagt.
Anastasia war zehn. Ihr Vater kam aus Nigeria, ihre Mutter aus Unteriberg. Ihre Eltern hatten sich bei einem Besuch im Kloster Einsiedeln kennengelernt und ein Jahr später geheiratet.
Anastasia war spindeldürr und für ihr Alter sehr groß. Sie konnte das Rad schlagen, auf Händen gehen, die Brücke und allerlei andere gymnastische Verrenkungen vollführen, bei denen meine alten Knochen schon vom Zuschauen knirschten. Bei einigen ihrer akrobatischen Übungen hatte ich gar den Verdacht, dass sie gegen die Gesetze der Physik verstießen.
Die Kinder wandten sich von mir ab, als der Streifenwagen auf den Hof gefahren kam.
«Edi, hast du einen Blödsinn gemacht», fragte Asta und schaute mich an, als ob es für mich am besten wäre, es gleich zuzugeben.
«Der Edi muss in den Knast», stellte Noah trocken fest. Er war erst sieben, zurzeit der einzige Erstklässler in der Siedlung und ebenso vorlaut wie Toni. Seine Eltern stammten beide aus dem Kanton und waren hierhergezogen, als der zwei Jahre ältere Bruder von Noah zur Welt kam.
«Müsst ihr nicht in die Schule?», fragte ich ungeduldig. «Es läutet in fünf Minuten. Ihr müsst euch beeilen.»
Sina zückte ihr iPhone. «In acht», sagte sie. Sina war zwölf und ging in die sechste Klasse. Ihr Vater stammte aus Ostdeutschland, ihre Mutter aus Meilen.
«Eben, ihr schaut besser, dass ihr vorwärtskommt.»
Die vier sahen mich an und setzten sich langsam und widerwillig in Bewegung.
«Klappe halten, dann passiert dir nichts», sagte der kleine Noah zum Abschied.
«Wir kommen dich besuchen im Knast», versicherte Toni.
Ich seufzte. «Ich muss nicht in den Knast. Ich erzähl euch später, warum die Polizei da ist. Macht jetzt endlich, dass ihr in die Schule kommt.»
«De Edi muss id Chiste, de Edi chunt is Loch», sangen sie, während sie langsam davontrotteten, und auch die Kinder, die sich ihnen anschlossen, sangen mit, ohne die genauen Umstände zu erfragen.
Beim Polizeiauto blieben die Kinder noch einmal stehen und bewunderten es eingehend. So etwas sahen sie nicht alle Tage.
Früher hatte unser Quartier keinen guten Ruf. Rund um die Genossenschaft herum waren in den Sechzigerjahren Mietkasernen hochgezogen worden. In den oft schlecht gebauten Häusern wohnten die Arbeiter und Gastarbeiter der umliegenden Industriebetriebe, die sich während der Nachkriegszeit und der Hochkonjunktur in der Gemeinde etabliert hatten. Als diese nach und nach schlossen, ging es mit dem Quartier bergab. Unsere Agglomerationsgemeinde bekam einen schlechten Ruf, und der Moorgarten, wie nicht nur die Siedlung, sondern das ganze Viertel hieß, galt als besonders schlimm. Darunter hatte natürlich auch unser Ansehen gelitten. Ein Mädchen wie Sina hätte damals nicht hier gewohnt. Undenkbar, dass ein Ehepaar wie die Keller-Kochs mit ihren Kindern in unsere Siedlung gezogen wären. Der Vater, Dieter Koch, arbeitete in der Stadt, an der Uni. Was genau, hatte ich nie kapiert. Die Mutter, Helene Keller-Koch, hatte Politologie studiert und eine Zeit lang für eine namhafte Werbeagentur gearbeitet. Jetzt kümmerte sie sich um die beiden Kinder und einen Haufen anderer Dinge. Sie trug eine große Brille, die so aussah wie früher die Kassengestelle, aber sie war von Tom Ford, und nur das Gestell hatte schon fast tausend Franken gekostet, wie ich einem zufällig mitgehörten Gespräch entnommen hatte.
Unterdessen waren die alten Blockwohnungen abgerissen oder saniert worden, und unsere Vorortsgemeinde, einst als Agglo gemieden, war regelrecht am Boomen. Und der Hauptgrund war der, dass die Wohnungen in der Stadt nahezu unbezahlbar geworden waren. Dabei hatten die Vorteile schon immer auf der Hand gelegen: Es war nicht weit in die Stadt, es gab gute ÖV-Verbindungen und man wohnte im Grünen. Auch der Wald war nicht weit.
Die Wohnbaugenossenschaft hatte die Zeichen der Zeit früh erkannt. Vor acht Jahren war die Siedlung saniert worden. Große Balkone waren angebaut worden und jede Wohnung hatte ein richtiges Bad erhalten. Vorher hatte es in den Wohnungen nur Duschen gehabt. Ein paar der älteren Mieter waren nach der Sanierung nicht zurückgekehrt, dafür waren junge Familien eingezogen.
«Salü Edi», begrüßte mich Winterhalder. «Was ist passiert?» Wir kannten uns gut. Winterhalder war seit fünfundzwanzig Jahren Gemeindepolizist und unterdessen Postenchef. Winterhalder hatte lange Zeit keine Sympathien für die Leute aus unserem Quartier gehabt. Genauso wenig wie für mich.
In meinen ersten Jahren als Abwart musste ich die Polizei immer wieder mal wegen eines aufgebrochenen Kellers, eines geklauten Mofas oder kleinerer Sachbeschädigungen aufbieten. Winterhalder war damals ziemlich unmotiviert und gab mir zu verstehen, dass man mit diesen Dingen rechnen müsse, wenn man hierher ziehe. Meinen Einwand, dass die Genossenschaft und viele der Mieter schon da gewesen waren, bevor die Probleme losgingen, ignorierte er geflissentlich. Ihm war das Hans was Heiri.
Winterhalder missfielen damals nicht nur mein Äußeres und mein Lebensstil, er hegte auch ziemliche Ressentiments gegenüber allen, die nicht aus der Schweiz stammten. «Wenn man das Pack ins Land lässt, muss man sich nachher nicht wundern», war seine Meinung, die er auch ungefragt kundtat. Ich sah das anders, und so hatten wir lange ein eher gespanntes Verhältnis. Doch mit der Zeit gewöhnte man sich aneinander, und als es vor ein paar Jahren vor allem Leute aus der Genossenschaft gewesen waren, die sich für die Erhaltung des Polizeipostens eingesetzt hatten, den die Gemeinde aus Spargründen hatte aufheben wollen, war Winterhalder gerührt und änderte seine Meinung. Vorträge über die schädlichen Multikulti-Fantastereien der Linken und Netten hielt er schon länger nicht mehr, sondern lobte uns sogar hin und wieder, weil es bei uns weniger Probleme gab als anderswo. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass seine Tochter einen Mann aus Mazedonien geheiratet hatte. Auf alle Fälle war er der Siedlung gegenüber nun wohlgesinnt, und wir kamen gut miteinander aus.
«Hoi Edi», auch Sandra Brunner nickte mir kurz zu. Sie war die stellvertretende Postenchefin oder so etwas. Bei den Rängen der Polizei blickte ich ehrlich gesagt nie ganz durch. Auf alle Fälle war sie Winterhalders rechte Hand, und einer von beiden war meist auf dem Posten, denn die Schließung des Gemeindepolizeipostens hatte zwar verhindert werden können, aber der Dienst war trotzdem reduziert worden. Der Posten war nur unter der Woche geöffnet, am Wochenende gab es lediglich einen Pikettdienst, oder die Kantonspolizei kam.
Sandra Brunner war Ende dreißig, ihre dunkelbraunen Haare hatte sie zu einem Rossschwanz zusammengebunden. Ihre braunen Augen schauten streng, sehr streng sogar. Sie wusste sich Respekt zu verschaffen. Nicht nur mit Worten, wenn es sein musste, konnte sie auch zulangen. Sie trainierte regelmäßig Krav Maga und beherrschte Schlag- und Tritttechniken, die jeden umhauten, der nicht selbst Kampfsport betrieb.
Das wusste ich so genau, weil ich auf sie stand. Wir hatten uns vor etwa vier Jahren einmal an einem Motörhead-Konzert getroffen. Im Gegensatz zu ihr war ich nicht wirklich ein Metal-Fan. Ich hatte mich in jungen Jahren mit Punkmusik sozialisiert, ohne je echter Punk gewesen zu sein, aber Motörhead schauen gehen, das war etwas, das auch mich begeisterte. Früher hatte ich zu solchen Anlässen immer meine engsten Jeans angezogen, weil ich das Gefühl so sehr mochte, wenn sie flatterten und gleichzeitig eng anlagen. An jenem Abend trug ich keine engen Jeans, und es flatterte auch nichts, weil es da bereits diese Regel gab, dass es an Konzerten nicht mehr allzu laut sein durfte. Wer heutzutage einen Ohrenschaden will, muss sich einen Laubbläser kaufen.
Ich stand ziemlich weit hinten, was an meinem Alter lag, denn von der verschwitzten Menge vorne an der Bühne, die sich gegenseitig die schweißnassen Mähnen ins Gesicht klatschten und mit Bier überschütteten, hielt ich mich inzwischen fern. Entsprechend erschrocken und empört fuhr ich herum, als mir jemand hart den Ellbogen in die Rippen rammte, so dass ich mein halbes Bier verschüttete. Aber statt eines Rüpels stand eine Frau vor mir, die mir zwar bekannt vorkam, die ich aber nicht einordnen konnte. Braune Augen, braune Locken, Lederjacke, enges T-Shirt, noch engere Jeans. Erst als sie streng zu schauen begann, weil ich sie nicht erkannte, fiel der Zwanziger: Sandra Brunner. Wow.
«Was machst du denn hier ?», fragten wir beide gleichzeitig und lachten synchron. «Ich muss sagen, das hätte ich dir nicht zugetraut.
Ich hätte jetzt eher gedacht, du hörst Liedermacher und Mundartrock», grinste Sandra.
«Wie man sich täuschen kann. Ich dachte, Polizisten hören alle volkstümliche Schlager oder House-Musik.»
«Wäh», schrie sie und stieß mich freundschaftlich mit der Faust gegen die Brust. Von der Wucht stolperte ich rückwärts und wäre wohl hingefallen, doch sie hielt mich am Arm fest, worauf ich auch noch den Rest meines Bieres verschüttete.
«Was ist, willst du auch eins? Meins jedenfalls ist leer», fragte ich. Wir gingen zusammen an den Bierstand, und als ich nach fünf Minuten immer noch nicht weiter vorgedrungen war, sagte sie: «Lass mich!» Ich drückte ihr das Geld in die Hand und wenig später stand sie mit zwei großen Bechern wieder vor mir. Wir stießen an.
«Komm, wir gehen nach vorne», sagte sie und zog mich hinter sich her. Widerstand war zwecklos. Zum Glück hielt sie nicht erst am Bühnenrand an. Wir fanden ein Plätzchen im vorderen Drittel und bald schüttelte sie ihre Mähne, und ich nickte mit dem Kopf, so lang und so schnell, dass mir nachher noch tagelang der Nacken weh tat.
Nachdem das Konzert zu Ende war, standen wir erschöpft und irgendwie selig beduselt rum.
«Gehen wir noch eins trinken?», fragte ich.
«Was heißt hier eins?», grinste sie. «Ich muss mich nur noch von Rob und Joe verabschieden, komm.» Sie zog mich hinter sich her, bis sie einen großen Typen mit langen roten Haaren entdeckte, dem sie zuwinkte. Neben ihm stand ein etwas kleinerer, ziemlich fester Mann mit kurzen braunen Haaren und in einem alten Coroner-T-Shirt. Die drei redeten kurz, ich stand ein wenig abseits.
«Tschou Sändi, tusch nid z wuid», sagte der lange Rothaarige. Sie grinste und küsste die beiden zum Abschied auf die Wangen. Wir verließen das Konzertlokal. «Sändi?», fragte ich.
Sie winkte ab. «Das waren mein älterer und mein jüngerer Bruder. Zwei von vieren. Sie sind die Einzigen, die mir Sändi sagen. Sie dürfen das. Du nicht.»
Sie hakte sich bei mir unter. Sie war warm und leicht verschwitzt, und als wir ins Freie kamen, wo es windig und kühl war, drückte sie sich fester an mich. Sie kannte eine Beiz in der Stadt, wir mussten ein Stück gehen. Als wir angekommen waren, bestellten wir zwei Große und kamen ins Reden.
«Hast du einen Freund?», fragte ich nach dem dritten Bier.
«Würde ich dann allein an ein Motörhead-Konzert gehen?», gab sie zur Antwort. «Nein, ich bin Single, schon seit längerem.»
Sie rollte die Augen. «In meinem Job ist es recht schwierig, eine Beziehung zu haben, vor allem als Frau. Es ist halt eine eigene Welt, die Polizei, da haben viele Vorurteile dagegen. Außerdem ist nicht allen wohl mit einer Frau, die ihnen körperlich überlegen ist und mit Waffen umgehen kann. Viele meiner Kolleginnen haben Affären mit älteren, verheirateten Polizisten.»
«Willst du damit sagen, dass du etwas mit Winterhalter hast?»
Sie trat mich gegen das Schienbein, und es tat höllisch weh, weil sie Motorradstiefel trug. Sie merkte, dass sie zu heftig gewesen war, und nahm meine Hand.
«Sorry, aber das war saufrech. Nein, mein Problem ist natürlich auch, dass ich wählerisch bin. Mir gefallen meist die böseren Jungs, und die wollen erst recht keine Polizistin. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du eine Freundin?»
Ich schüttelte den Kopf. «Nein, ich bin auch schon seit längerem Single. In meinem Beruf ist es ebenfalls nicht einfach. Eine der sichersten Methoden, Frauen zu vertreiben, ist, auf die Frage: ‹Und, was machst du?› zu antworten: ‹Ich bin Abwart.›»
Sie lachte. Sie hatte ihre Hand nicht weggenommen. Ich auch nicht. Wir landeten bei ihr. Sie wohnte in der Nachbargemeinde, die größer und anonymer war, in einer ziemlich lieblosen, modernen Überbauung. Der nächste Tag war ein Sonntag. Wir pendelten zwischen ihrer Küche, wo wir uns mit Eiern, Speck, Toast und allerlei Snacks stärkten, und ihrem Bett.
Weil sie am Montag früh rausmusste, schmiss sie mich nach einer Tiefkühlpizza am Sonntagabend raus.
«Das hat gutgetan», sagte sie. «Ich melde mich.»
Ich verstand, dass das hieß, ich solle ihr nicht auf die Pelle rücken und mir keine Illusionen machen. Ich hielt mich daran, und sie rief tatsächlich hin und wieder an. Wir gingen an Konzerte. Wir tranken Bier. Wir gingen manchmal zu ihr und schliefen miteinander. Bei mir trafen wir uns nie. Logisch, man kannte sie hier. Mich hingegen kannte niemand, und man beachtete mich auch nicht, wenn ich den anonymen Block betrat und in ihrer Zweieinhalbzimmerwohnung verschwand, die bis auf eine ziemlich potente Stereoanlage und eine Budweiser-Neonreklame im Wohnzimmer keinen persönlichen Stil erkennen ließ. Die Möbel kamen allesamt aus Schweden.
Leider wurde nichts aus Sandra und mir. An mir lag es nicht, ich hatte mir was Dauerhaftes gewünscht und mit ihr vorstellen können, aber ich war nicht ihr Typ, sie mochte mich. Mehr war nicht. Ich war ein guter Kumpel. Ein friend with benefit, mit dem sie manchmal das Bett teilte. Eineinhalb Jahre waren mittlerweile seit ihrem letzten Anruf vergangen. Dass ich es zwischendurch mal bei ihr versucht hatte, war keine gute Idee gewesen.
«Drüben beim Festtisch liegt ein Toter», sagte ich, nachdem ich Sandra ein wenig zu lange angeschaut hatte. Sie hatte abgenommen, ihr Gesicht, wirkte dadurch kantiger und härter. «Es ist Rolf Holliger.»
«Bist du sicher, dass er nicht nur besoffen ist», fragte Winterhalder. Ich trat zum Tisch und nahm die Blache weg.
«Nein», sagte ich, «der ist tot.»
«Oha», sagte Winterhalder.
Sandra kniete sich neben den Tisch und betrachtete den Toten aufmerksam.
«Er hat eine Kopfwunde. Da müssen wir die Kripo holen.» Sie stand auf. «Ist dir sonst noch etwas aufgefallen?»
«Da vorne liegt eine zerbrochene Weinflasche.»
«Du hast hoffentlich nichts angefasst?»
«Nein», sagte ich. «Ich hab nur den Tisch abgedeckt, damit die Kinder nichts sehen, ich wollte ihnen das ersparen.»
Sie nickte. In ihrem Blick lag eine winzige Spur Anerkennung. Vereinzelt schauten Leute aus den Fenstern. Sandra ging zum Streifenwagen und setzte den Funkspruch ab und zündete sich eine Zigarette an. Seit ich sie kannte, hatte sie mehrmals versucht, damit aufzuhören. Aus der Nummer 16 kamen ein paar Vorschulkinder. Der Kindergarten war nur wenige Hundert Meter weit entfernt, und sogar die Kleinen gingen diesen Weg selber. Bevor sie etwas sehen konnten, führte ich sie vom Hof.
Danach warteten wir auf die Kripo, Winterhalder stand in der Nähe des Toten, und ich ging ein paar Meter und gesellte mich schließlich zu Sandra. «Alles klar?», fragte ich.
Sie blies Rauch aus und sah mich an.
«Alles klar», sagte sie. Es klang nicht überzeugend.
Eine halbe Stunde später fuhr ein Beamter in Zivil auf den Hof, stieg aus seinem Wagen, schaute sich grußlos um, und nur wenige Augenblicke später folgten die Fotografen und die Spurensicherung, die mit einem rot-weißen Plastikband einen Teil des Hofes absperrte. Der Leichenwagen traf ein. Der Fahrer manövrierte den fensterlosen Kleinbus um die geparkten Autos und brachte sich in Position. Ein Töff röhrte auf den Hof. Auch das noch, dachte ich.
«Das ist Stahl von der Kripo», sagte Winterhalder.
Der Mann bockte seine Harley auf. Er stieg ab und zog den Helm aus, was rein optisch keinen großen Unterschied machte, denn darunter kam ein runder und kahlrasierter Schädel zum Vorschein. Mir kamen die russischen Matrjoschka-Puppen in den Sinn, jene Figuren, in deren Inneren sich weitere, kleinere Figuren verbergen. Wobei weder der Kopf klein war, noch der Mann. Er war groß und breit, trug Jeans, Motorradstiefel, eine braune Lederjacke und um den Hals ein rotes Glarnertüchli, das er auszog, während er auf uns zukam. Er nickte Sandra kurz zu, die eine weitere Zigarette zu Boden warf und austrat. Während Stahl zu uns herüberkam, studierte ich aufmerksam sein Gesicht. Er hatte grüne Augen und trug einen dieser seltsamen, winzigen dreieckigen Kinnbärtchen. Das sah bescheuert aus, fand ich, aber es gab bestimmt eine Menge Frauen, die das attraktiv fanden. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, trat er vor Winterhalder und drückte ihm die Hand.
«Watts öp?», fragte er lässig. «Was ist passiert ?»
Winterhalter erklärte ihm, dass beim Tisch drüben ein Toter lag und dass ich ihn gefunden hatte.
Stahl drehte sich langsam zu mir um. Er sah mich an, als hätte ich etwas angestellt, das er mir für einmal knapp durchgehen lassen wollte. Mit einem überlegenen Lächeln streckte er mir die Hand hin. Ich nahm sie, und er hatte, wie erwartet, einen viel zu festen Händedruck. Er war sicher gut zehn Jahre jünger als ich und wahrscheinlich doppelt so stark, aber ich hielt ganz passabel dagegen. Immerhin arbeitete ich oft mit den Händen und versuchte fit zu bleiben. Jeden Samstag ging ich zehn Kilometer rennen. Fast jeden Samstag. Gut, diesen Winter über hatte ich es vernachlässigt, und der Frühling war verregnet gewesen, aber am nächsten Samstag würde es bestimmt wieder so weit sein.
«Dan Stahl, Kriminalpolizei», stellte er sich vor, noch immer meine Hand quetschend. Er sprach den Vornamen Englisch aus: Dän. «Ich leite die Ermittlungen.»
«Edi Zingg, freut mich», antwortete ich.
«Braucht es uns noch?», fragte Winterhalder.
«Nein, von mir aus nicht», sagte Stahl. Winterhalder nickte mir zu, und ich wollte Sandra ein Zeichen geben, ihr kurz zum Abschied winken, aber Stahl stand direkt vor mir. «Kommen Sie, Herr Zingg, lassen wir die Leute ihre Arbeit machen. Wir sprechen dort drüben weiter.»
Auf dem Hof hatten sich unterdessen immer mehr Leute eingefunden. Frauen, Männer und Kinder. Sie schauten teils interessiert, teils erschrocken. Ich war froh, dass man von der Absperrung aus, an der auch ich mit Stahl mittlerweile stand, die Leiche nicht sehen konnte. Sie war zuvor von allen Seiten fotografiert und mit einer Nummer versehen worden. Die Leiche hatte die Nummer 1 bekommen, andere Nummerntäfelchen standen bei der zerbrochenen Weinflasche, den Bierdosen, die unter dem Tisch lagen, und an Stellen, an denen zumindest für mich nichts Auffälliges zu sehen war.
«Sie haben den Toten gefunden?», fragte Stahl.