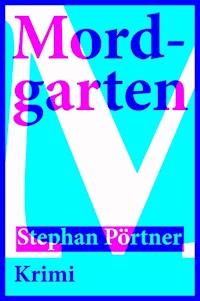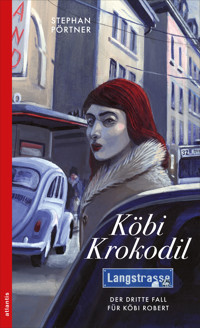Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Camping erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Statt spießiger Kleinbürgeridylle ist das »Vanlife« auch in der jüngeren Generation angekommen: Ausgebuchte Plätze, in der Hauptsaison sogar Wartelisten. Für die Dauercamper sind Touristen unerwünschte Eindringlinge in ihr Paradies. Heinrich »Henry« Kummer ist nicht ganz freiwillig auf dem Campingplatz gelandet. Mit 60 hat er seine Frühpensionierung beantragt - »So einen Bauchschuss lässt einen nachdenken«. Polizist war er, 32 Jahren lang. Aber keiner, der Verbrecher jagt, nicht einmal einer, der den Verkehr regelt. Als sich ihm die Gelegenheit geboten hat, ließ er sich in den Hausdienst versetzen. Und ist hängen geblieben. 25 Jahre hat er am Empfang des Kripo-Gebäudes in der Zürcher Kasernenstrasse verbracht. War für den Hausdienst zuständig, eine Art Abwart oder Portier. Und doch wurde ausgerechnet er bei einem Einsatz lebensgefährlich verletzt. Aber auch das war keine Heldentat: Er war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Kummers neues Leben auf vier Rädern beginnt weniger erholsam als gedacht: Dauercamperin Rosa wird tot in ihrem Wohnwagen gefunden: durchgeschnittene Kehle, ein einziger, sauberer Schnitt. Kummer wäre nicht sein halbes Leben Polizist gewesen, wenn er den Ermittlungen tatenlos vom Campingstuhl aus zusehen würde ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephan Pörtner
Der Campingplatzkiller
Der erste Fall für Henry Kummer
Kriminalroman
atlantis
Erstens
Verschlafen schlurfte Henry Kummer den Kiesweg entlang, es war früher Donnerstagmorgen, und alles war still. Wer ging, ging gemächlich, noch war man unter sich. Die ersten Wochenendgäste und Ausflügler würden am Freitagnachmittag eintreffen. Gutes Wetter war angesagt. Seit zwei Wochen war der Campingplatz wieder geöffnet. Die Coronakrise hatte dem Saisonstart, wie allem anderen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Den ganzen, ungewöhnlich schönen Frühling hindurch waren die Campingplätze geschlossen gewesen, sogar als die Beizen und Hotels wieder aufmachen durften, blieben sie zu, was unter den Campern für Gemurre sorgte.
Camping war beliebter denn je. Hatte Margrit Rainer über das Zelten im Sihltal noch ein Spottlied gesungen, war die ehemals als biedere Kleinbürgeridylle verlachte Tourismusform hip geworden. Gut aussehende, glückliche und von keinen finanziellen oder sonstigen Sorgen geplagte Paare und Familien zeigten auf YouTube und Instagram, wie schön das Leben im Camper sein konnte. Der seit Jahren anhaltende Boom ließ die Zahl der Wohnmobile, -wagen und Campingbusse stetig steigen. In diesem Frühling, als während des Lockdowns alle zu Hause eingesperrt waren und sich nach Abwechslung und Reisen sehnten, waren die Verkäufe regelrecht explodiert. Es war abzusehen, dass es in diesem Jahr keine Ferien im Ausland geben würde. Man blieb im eigenen Land, und Camping war eine Möglichkeit, dabei in den eigenen vier Wänden zu bleiben, auch wenn es nur dünne Fiberglas-, Blech- und Zeltwände waren. An dem Wochenende, an dem die Campingplätze wieder öffnen durften, hatte es allerdings geregnet.
Auch Kummers Pläne waren durchkreuzt worden. Sein neues Leben war stecken geblieben. Seit Anfang des Jahres war er Rentner, die Frühpensionierung hatte er selbst beantragt. Finanziell ein grober Unfug, trotzdem war ihm der Entscheid leichtgefallen. So ein Bauchschuss regt zum Nachdenken an, über das Leben, wie lange es noch dauert und was man damit anfangen will. Er war sechzig Jahre alt. Jeden Tag konnte Schluss sein. Ein Fehltritt, eine Diagnose, ein Virus. Wäre er damals nicht schnell genug ins Spital gebracht worden, hätte dort schon der coronabedingte Krisenmodus geherrscht, die Kugel ein wichtiges Organ getroffen oder das Rückenmark verletzt, wäre er tot oder schwer behindert. Er hatte Glück gehabt, aber das Glück, Kummer wusste es, sollte man nicht herausfordern. Aufhören, so lange man vorn liegt. Auch wenn er nicht vorne, sondern in einem Spitalbett gelegen hatte, als er diesen Entschluss fasste. Der Bauchschuss hatte ihm gezeigt, wie entscheidend Gesundheit war. Abhandenkommen würde sie ihm so oder so: langsam, stetig, unaufhaltsam oder schnell und vollständig. »Dem Weisen ist es einerlei, ob er früh oder spät stirbt«, hatte neben den kunstvoll gemalten chinesischen Schriftzeichen auf der Karte gestanden, die ihm der Kollege Bärtschi gemalt hatte. Acht Jahre lang hatten sie das Büro geteilt, aber Kummer wusste nicht, dass Bärtschi sich mit chinesischer Kalligraphie befasste. Er wusste auch sonst nicht allzu viel über ihn. Sie waren beide große Schweiger, darum kamen sie gut miteinander aus. Mehr aber auch nicht.
Den Zeitpunkt seines Todes konnte er nur bedingt beeinflussen, aber er konnte beeinflussen, wie er die Zeit bis dahin verbringen würde. Noch fünf Jahre lang Dienst tun oder selbstbestimmt leben. Polizist war er gewesen. Aber keiner, der Verbrecher jagt, nicht einmal einer, der den Verkehr regelt. Zweiunddreißig Jahre lang war er bei der Kantonspolizei gewesen, die letzten fünfundzwanzig davon im Kommandobereich 2 in der Abteilung Logistik. Zu seinen Aufgaben hatte unter anderem der Dienst am Empfang des Kripo-Gebäudes an der Kasernenstrasse gehört. Das war natürlich nicht die Laufbahn, die er sich vorgestellt hatte. Er war zur Polizei gegangen, um Verbrecher zu jagen, der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, schwierige Fälle zu lösen. Zumindest hatte er sich das eingeredet. Eigentlich war er bei der Polizei gelandet, weil er nicht wusste, was er sonst machen sollte. Sein Plan: Nach spätestens zehn Jahren, noch bevor er vierzig war, bei der Kriminalpolizei angestellt zu sein oder den Job zu wechseln. Er hatte sowohl die Karriere wie auch den Absprung verpasst. Es war diese Mentalität, diese fehlende Entschlossenheit, die ihn daran gehindert hatte, beispielsweise in die Abteilung Leib und Leben vorzustoßen. Das war die Elite der Polizei, doch er war im Mittelbau gelandet, nach ein paar Jahren auf einem Posten in der Agglomeration war die Stelle im Hausdienst frei geworden, und er hatte sich darum beworben, weil er wieder in Zürich arbeiten wollte. Auch wenn er am Stadtrand, in Affoltern an der Wehntalerstrasse, aufgewachsen war, so war er doch ein Städter und vermisste seine Heimat. Er blieb hängen, schob eine ruhige Kugel, hatte ein sicheres Einkommen. Abgesehen von den unregelmäßigen Arbeitszeiten eine solide Existenz. Leider nur beruflich, seine Ehe war gescheitert, was er nicht einmal auf den Stress bei der Arbeit schieben konnte.
Bei dem Einsatz, bei dem es passiert war, hatte er nichts verloren gehabt. Es war keine Schießerei mit Bankräubern oder Terroristen, bei der er eine Geisel gerettet oder sonst eine Heldentat vollbracht hätte. Die Kugel durchschlug die Tür eines gutbürgerlichen Einfamilienhauses, abgefeuert aus einer ordentlich registrierten, großkalibrigen Waffe. Schwer zu handhaben und zur Selbstverteidigung denkbar ungeeignet. Als Symbol von Macht und Potenz hingegen unschlagbar.
Er war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, im Auto seiner Kollegin Strittmatter nämlich. Sie hatten beide frei und waren unterwegs in ein Brockenhaus, wo sie einen Schrank abholen wollten, den sie gekauft hatte. Strittmatter hatte ihn gefragt, ob er Traggurte besäße; der Hausdienst war auch für den Umzug von Büromobiliar verantwortlich, und er bot an, ihr zu helfen, das Ding in die Wohnung hinaufzutragen. Kummer half Kollegen öfter beim Umzug, davon hatte wohl auch Strittmatter Wind bekommen.
Sie waren ganz in der Nähe des Gebrauchtwarenladens, als sie, die bei der Kripo arbeitete und direkt von der Arbeit kam, den Funkspruch mithörte. Typische Berufskrankheit, den Funk auch in der Freizeit eingeschaltet zu lassen. Da sie in unmittelbarer Nähe waren, fuhren sie hin.
»Lass mich machen«, sagte Kummer, als er aus dem Wagen stieg. Männer, die ihre Frauen und Kinder terrorisierten, hatten tendenziell Mühe, sich von einer Frau etwas sagen zu lassen, so seine Überlegung.
»Ich bin gleich hinter dir.« Strittmatter war ebenfalls ausgestiegen.
Mit seinen knapp zwei Metern Körpergröße, seiner Masse, von der ihm seither ein Stück abhandengekommen war, wirkte er deeskalierend, wie das im modernen Polizeijargon hieß.
Beeindruckend, aber nicht bedrohlich. Papa Bär ist da, alles wird gut. Hinter der Tür tobte ein Mann, schrie, er solle verschwinden. Kummer blieb ruhig, bat ihn, die Tür zu öffnen. Der Mann schoss ohne Vorwarnung. Da nützte seine deeskalierende Erscheinung natürlich nichts, wenn der Agitator sie gar nicht sehen konnte. Die Kugel fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Im ersten Moment begriff Kummer nicht. Er roch das Blut, bevor er es zwischen den Fingern der linken Hand spürte, die er auf den Bauch hielt. Wollte etwas sagen, doch die Stimme versagte ihm. Das Blut floss, die Tür blieb verschlossen, er sank auf die Knie. Strittmatter stützte ihn, dann rief sie über Funk nach einer Ambulanz und Verstärkung. Kummer lag schon im Rettungswagen, als sich der Schütze widerstandslos festnehmen ließ.
Ein Mann Anfang vierzig, Position im mittleren Management. Nach außen hin ein unauffälliger, anständiger Bürger. Zu Hause ein Tyrann, der Frau und Kinder seinen Launen mit Gewalt unterwarf, in dem modernen, gesichtslosen Einfamilienhäuschen mit dem gepflegten Rasen und der Doppelgarage. Kaum war der Mann in Haft, meldeten sich die Nachbarn bei der Polizei. Sie sprachen in die Mikrophone der Lokalradios und Onlineportale: Schlimm sei es gewesen, vor allem die Kinder hätten einem leidgetan, hätten manchmal stundenlang in der sengenden Sonne oder im strömenden Regen gestanden, ohne sich zu bewegen, vom Vater durch das Fenster beobachtet. Manchmal hätten sie geschrien oder seien voller Striemen gewesen, das habe man schon gesehen, beim Schulsport zum Beispiel.
Bei der Gemeinde gemeldet hatte es aber nur eine Bürgerin. Die einen fanden, das sei Privatsache. Es ginge sie nichts an, was zu Hause passierte, und wenn es überhandnähme, würde der Staat schon eingreifen. Wo war er denn überhaupt, der Staat, der doch immer da ist, wenn es darum geht, Steuern einzutreiben? Und diese Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB oder wie die hieß, machte die Sache doch nur noch schlimmer. Also!
Die andern wollten nicht Polizist spielen und den Nachbarn denunzieren. Das wäre doch bünzlig. Lieber eine halb totgeschlagene Frau und misshandelte Kinder, als sich wie ein Blockwart vorkommen. Außerdem hat sie ihn ja geheiratet, nicht wahr, und in der Schweiz kann man sich scheiden lassen. Wir sind hier nicht in Saudi-Arabien. Eben!
Männer waren bereit, jeden Gehorsam zu leisten, jede Erniedrigung hinzunehmen, zu kriechen und schlucken, solange sie in den eigenen vier Wänden unbeschränkt herrschen durften. Männer am unteren Ende der sozialen Hackordnung waren deshalb etwas anfälliger, aber es gab sie in allen Schichten. Diesen Umstand machten sich Despoten, repressive politische und religiöse Systeme zunutze. Ein Mann, der zu Hause König ist, ist ein guter Untertan, ein frommer Gläubiger, ein effizienter Abteilungsleiter. Ein schlechter Mensch.
Kummer sah den Schützen erst beim Prozess, bei dem akribisch geschildert wurde, wie der Täter seine Familie terrorisiert hatte, jahrelang. Die Verhaftung gab der Frau Gelegenheit sich zu befreien, mit ihren Kindern zu fliehen. Eine Befreiung, die direkt in die Armut führte. Sie stammte aus Polen, ihre Ausbildung wurde in der Schweiz nicht anerkannt. Kummer hoffte, dass sie nicht zu ihrem Mann zurückgekehrt war, als der aus dem Gefängnis kam. Abzüglich der Untersuchungshaft musste er nach dem Prozess noch drei Monate einsitzen, der Rest der Strafe wurde auf Bewährung ausgesetzt, er war ein Ersttäter mit gutem Leumund. Bestimmt hatte er schon wieder Arbeit. Es sei denn, die Coronakrise habe ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Kummer kümmerte das nicht mehr. Er war wieder gesund, aber nicht mehr der Alte. Im Krankenhaus hatte er achtzehn Kilo abgenommen. Sein Magen war wieder zusammengeflickt worden, nach den Operationen musste er ihn schonen, seither hielt er sich zurück mit fettigem Essen und Alkohol. Auch Kaffee war nicht gut für den Magen, aber darauf mochte er nicht verzichten. Abgesehen davon hatte er seine Ernährung umgestellt. Nicht ganz freiwillig.
Den Winter hatte er in Südfrankreich verbracht und war nach seiner Rückkehr, kurz vor dem Lockdown, zu seiner Tochter gezogen. Sie hatte ihn auf den Geschmack gebracht. Sie brachte ihm bei, frisches Gemüse und Früchte zu schätzen. Er war eher der Imbissbuden- und Fertigmenütyp gewesen. Wie alles war es eine Frage der Gewohnheit.
Zweitens
Auf dem Boden vor dem Eingang des Camping-Bistros waren mit gelbem Klebeband Streifen angebracht, auf einem Tischchen neben der Tür stand ein Pumpspender mit Desinfektionsmittel. Kummer, der die Hände in den Sanitäranlagen gewaschen hatte, trat ein und holte die vorbestellten Gipfeli ab. Dreimal Butter, zweimal Laugen.
»Einen Kaffee dazu?«, fragte der Betreiber, ein kleiner Mann unbestimmbaren Alters, der ein Gesicht machte und sich bewegte, als habe er einen Reißnagel im Schuh. Kummer kam Dr. John’s I Walk on Gilded Splinters in den Sinn, während er »Nein, danke« sagte.
Der Mann brummte etwas, worin der Name »Heinz« vorkam. Kummer bezahlte bargeldlos mit Karte, wünschte einen schönen Tag und bekam keine Antwort.
»Guten Morgen!« Heinz war damit beschäftigt, die Frontplane seines Vorzelts aufzurollen, damit die zaghaften Sonnenstrahlen den weißen Plastiktisch erreichen konnten.
»Salü Kummer.« Rosa saß bereits auf ihrem gewohnten Platz in einem der vier weißen Plastikstühle. »Ich würde dich gerne küssen, aber man darf ja nicht.« Den Spruch brachte sie jeden Morgen. Kummer war es recht, dass man nicht durfte, und er bezweifelte, dass sie würde, wenn sie dürfte. Diese Küsserei auf die Wangen hätte man seiner Ansicht nach gerne den Franzosen überlassen können. Vielleicht machte das Virus diesem vor etwa dreißig Jahren eingeschleppten Brauch endlich den Garaus. Die Schweizer gaben sich gern traditionsbewusst, liebten ihre Bräuche und machten doch jeden irgendwo auf der Welt praktizierten Firlefanz begeistert mit. Vom Autokonvoi über Jubelgeschrei oder eben Bussi hier Bussi da, alles, was Lebensfreude und Offenheit zum Ausdruck bringen sollte, setzte sich durch. Das Leben wollte ausgekostet sein, und alle sollten sehen, wie einem das gelang. Nicht dass noch der Eindruck entstand, man blase Trübsal. Kummer trauerte dem beengenden Mief keinesfalls nach, der in seiner Kindheit und Jugend, in den sechziger und siebziger Jahren in der Schweiz geherrscht hatte. Er war ein Rebell gewesen, was damals noch Konsequenzen hatte. Die Mehrheit war brav. Das heutige Rebellentum war gratis, ungefährlich und mittelklasselimousinenwerbungskompatibel.
»Morge mitenand.« Er setzte sich auf einen der Stühle, der knirschend nachgab, und legte die Backwaren, ohne sie zu berühren, in den bereitstehenden Plastikkorb.
»Expresso?«, fragte Heinz unter Betonung des x und verschwand, ohne eine Antwort abzuwarten, in seinem Wohnwagen.
»Na?«, machte Rosa.
»Momoll«, antwortete Kummer, »und selber?«
Sie seufzte und winkte ab. »Die Sonne scheint, es wird warm, also will ich nicht klagen.«
»Rächt häsch.«
»Das Wetter wird gut. Dieses Wochenende ist restlos ausverkauft, sogar die Warteliste ist voll, sagt der Miroslav.«
Miroslav war der Chef auf dem Platz. Er hatte ein gutes Herz. Leben auf dem Campingplatz lag im dunkelsten Bereich der rechtlichen Grauzone. Die Gemeinde versuchte immer wieder, neue Vorschriften zu erlassen, die es unterbanden. Miroslav ignorierte sie, so gut es ging. Selbst während der Krise hatte er die sechs Menschen, die ganzjährig auf dem Campingplatz wohnten, nicht ausquartiert, einen der Waschräume offen gelassen, das Warmwasser nicht abgestellt, ohne zu fragen, ob das den Vorschriften entspräche. Wo hätten die Leute auch hinsollen?
Heinz brachte Kummer ein Tässchen mit dem Logo einer italienischen Kaffeemarke. Hatte er irgendwann mal irgendwo mitgehen lassen, vielleicht, weil man ihn schlecht bedient, vielleicht, weil es ihm gefallen hatte, vielleicht einfach so. Heinz trank Milchkaffee, Rosa Cappuccino. Alles zubereitet mit einer Kaffeemaschine, die in Heinz’ Wohnwagen stand. Er hatte sie aus dem Sperrmüll gefischt und wieder hergerichtet.
»Die Leute bestellen solche Maschinen im Internet, und wenn sie kaputtgehen, kaufen sie eine neue, weil ihnen das Einschicken zu mühsam ist. Statt bis zur Post tragen sie das Zeug bis zur nächsten Straßenecke, hängen einen Zettel dran, auf dem Gratis oder Zum Mitnehmen steht.« Er grinste. »Das meiste ist tatsächlich Schrott. Es ist billiger, die Komponenten zu verkleben als zu verschrauben. Und selbst wenn du die Maschine aufkriegst, findest du keine Ersatzteile. Aber es gibt Ausnahmen.«
Kummer kannte Heinz seit letzten Dienstag. Am Samstag war er auf den Platz gekommen, am 6. Juni, dem Tag, an dem die Campingplätze wieder öffnen durften. Am Montagmorgen hatte im Bistro einen Espresso getrunken. In seinem Camper hatte er eine Bialetti Moka, aber der Aufwand, damit einen Kaffee zu kochen, war ihm zu groß gewesen.
»Ist er gut, der Kaffee?«, hatte Heinz im Vorbeigehen gefragt.
»Nein«, gab Kummer zu. Der Espresso hatte den sauren, metallischen Geschmack, der entstand, wenn die Maschine nicht regelmäßig gereinigt wurde.
»Billig ist er auch nicht«, bemerkte Heinz.
»Das stimmt.« Vier Franken, etwa genauso viel wie in Zürich, wo allerdings sechs Franken keine Seltenheit waren. Nach oben offen waren die Preise in den hippen Stadtvierteln, wo sogar Filterkaffee getrunken wurde. Kummer musste eigentlich sparen. Seine Rente war knapp. In Frankreich war das Leben billiger gewesen. Nach der Sommersaison, wenn die Pandemie vorbei war, wollte er wieder in den Süden und diesmal weiter bis nach Spanien fahren. Bis dann würde er in der Schweiz bleiben, auch seiner Tochter Mona zuliebe, die sich sonst Sorgen machte. Die Rollen hatten sich seit dem Bauchschuss vertauscht. »Was, wenn du irgendwo in Südfrankreich ins Spital kommst und ich nicht ausreisen kann?«, hatte sie gefragt.
Heinz war listig grinsend weitergegangen. Am nächsten Morgen fing er Kummer noch vor dem Bistro ab und führte ihn in den hinteren, der Straße abgewandten Teil des Campingplatzes. Dorthin, wo die Dauercamper standen. Ein Hund bellte.
»Sei still, Tara!« Eine mittelgroße Mischlingshündin rannte auf Kummer zu, bellte noch ein paar Mal, schnupperte, als er sich nicht beeindrucken ließ, an seinen Beinen und wedelte mit dem Schwanz.
»Hock ane!« Kummer setzte sich an den Plastiktisch unter dem Vorzelt. Die Hündin legte ihm den Kopf auf den Oberschenkel.
Heinz servierte ihm einen Espresso. Er schmeckte gut, besser als jener im Bistro. Um das festzustellen, brauchte man kein Aficionado zu sein. Im Aufenthaltsraum des Hausdienstes hatte irgendwann eine Kapselmaschine gestanden, und er trank sich durch die verschiedenen Farben, ohne große Unterschiede festzustellen. Espresso schade dem Magen am wenigsten, hatte er irgendwo gelesen und es gerne geglaubt.
»Besser?«, fragte Heinz.
»Viel besser.«
»Hör zu. Von nun an frühstückst du bei mir. Du bringst die Gipfeli, ich spendiere den Kaffee, ist das ein Deal?«
»Klingt gut.«
»Dann bringst du morgen für mich und Rosa je ein Laugen- und ein Buttergipfeli.«
Jedes Gipfeli kostete im Bistro einen Franken vierzig. Der Kaffee wurde für Kummer also nicht billiger, aber er sagte nichts. Er vermutete, dass er auch noch einen zweiten Espresso bekommen würde. Auf den er wegen des Magens verzichten sollte.
»Machst du hier Ferien?«, fragte Heinz.
»Nein, ich bin pensioniert.«
»Du siehst nicht aus wie ein Pensionierter.«
»Wie sehen Pensionierte denn aus?«
»Beige Bermudashorts mit Seitentaschen, dazu Sportsocken in Turnschuhen oder Sandalen, T-Shirt mit Aufdruck oder kurzärmliges kariertes Hemd. Baseballkappe bedruckt mit einem Markenlogo oder einer Touristendestination.«
Kummer lachte. »Du schaust genau hin.«
Heinz trug abgeschnittene, verwaschene Jeans, ein schwarzes T-Shirt unter einer Lederweste. Kummer erkannte den AC/DC-Schriftzug. Heinz reckte stolz die Brust.
»Das ist im Fall ein Originalshirt von der Black-Ice-Tour. Für das Konzert und das T-Shirt hab ich fast ein Jahr lang gespart. 2009 im Stade de Suisse, eines der letzten Konzerte mit Malcolm Young an der Gitarre.« Heinz zuckte mit den Schultern. »Ich habe AC/DC vor über vierzig Jahren im Volkshaus in Zürich gesehen, mit Bon Scott, sie spielten im Vorprogramm von Black Sabbath. Ich muss zugeben, dass ich AC/DC damals auch nicht gekannt habe, aber seit dem Abend bin ich Fan, also lang vor ihrem ersten Hit mit TNT. In der Zeit habe ich in einem Spunten in Zürich gearbeitet. Was habe ich mir da anhören müssen: ›Eysidisi gang uf d’Schissi, AC/DC gang ufs WC.‹«
»Auf was sparst du jetzt, da du keine Gipfeli mehr kaufen musst?«, fragte Kummer. Seit er im Camper wohnte und ihm seine Tochter auf dem Tablet ein Spotify-Konto eingerichtet hatte, hörte er auch andere Musik als die auf den kümmerlichen Überresten seiner einst umfangreichen CD-Sammlung, die er noch im Camper hatte und die Country, Rockabilly, Rock ’n’ Roll und seine Vorläuferformen wie Jump Blues umfassten.
Metal hatte ihm nie etwas gesagt, und er bezweifelte, dass er jetzt noch auf den Geschmack kommen würde. Mit der zukünftigen Lieblingsmusik wurde man in jungen Jahren infiziert. Gerade beim Metal war ein hoher Testosterongehalt im Körper ein Türöffner.
Heinz zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, ob ich AC/DC ohne Malcolm noch mal sehen will, er war für mich mit Abstand der beste Rhythmusgitarrist aller Zeiten. Die Abschiedstour von Black Sabbath habe ich verpasst, Motörhead gibts nicht mehr, die Zeit meiner Helden ist vorbei.«
»Jedenfalls siehst du auch nicht aus wie der typische Rentner«, sagte Kummer, der Jeans und ein rotes, groß kariertes Hemd mit heraufgerollten Ärmeln trug.
»Da hast du recht, es gibt auch noch die Variante mit den kurzen weißen Hosen mit Bügelfalte und dem Polo-Shirt. Die Leute, die einen pastellfarbenen Pulli um die Schultern legen, wenn es kühl wird. Seit ein paar Jahren tragen die alle diese Schweizer Turnschuhe, die von zweihundert Stutz an aufwärts kosten, weil der Roger Federer alle Jahre mal in die Gummimischung spuckt. Das sind die, die mit dem Edelcamper ankommen, der so lang ist wie ein Postauto und so viel kostet wie ein Einfamilienhaus im Thurgau. Die tauchen hier allerdings selten auf.« Heinz winkte ab. »Was warst du vor der Pensionierung?«
»Polizist.«
»Oha!« Heinz verzog das Gesicht.
»Du magst keine Polizisten?«
»Nun gut, auch da gibt es solche und solche.«
»Wie meinst du das?«
»Es gibt solche, die bei Dienstschluss mit der Uniform auch den Polizisten ablegen.«
»Ich war für den Hausdienst tätig, eine Art Pförtner oder Portier.«
Heinz zuckte mit den Schultern. »Nur damit du es weißt: Ich stand zeit meines Lebens auf der anderen Seite des Gesetzes. Ich bin dreiundsechzig Jahre alt. Fast die Hälfte davon habe ich im Knast, im Heim oder im Entzug verbracht.«
Kummer hatte Heinz älter geschätzt. »Aber jetzt bist du hier. Du bist frei und bleibst es.«
»Ich hoffe es.«
»Ich bin der Henry.«
»Ist das dein richtiger Name?«
»Nein, Heinrich, Heinrich Kummer. Seit ich fünfzehn bin, nennt man mich Henry.«
»Heinz, schon immer und für immer.«
Sie schlugen ein.
»Ein Schmier. Das muss ich erst mal verdauen.« Heinz ging in den Wagen und kam mit einer Glasflasche ohne Etikett zurück, leerte noch im Stehen ein wenig davon in seinen Kaffee und hielt sie über Kummers halb ausgetrunkene Espressotasse.
»Chrüter. Aus der Innerschweiz.«
»Danke, dafür ist es noch zu früh.«
Als Kummer am nächsten Tag mit den bestellten Gipfeli bei Heinz vorbeigegangen war, hatte er Rosa kennengelernt. Sein früherer Beruf wurde nie mehr erwähnt.
»Die Rosa und ich sind so«, sagte Heinz am dritten Morgen, an dem Kummer bei ihnen Kaffee trank, und legte den Mittelfinger über den Zeigefinger seiner rechten Hand. »Aber nicht so, wie du jetzt denkst. Im Winter, wenn es kalt ist, schlafen wir im gleichen Bett, mehr nicht.«
»Musst du alles ausplaudern? Glaubst du, das interessiert den Henry?« Rosa schüttelte den Kopf. Sie war größer als Heinz, Ende fünfzig, dezent geschminkt, ihre weißen Haare hatte sie zu einem Zopf geflochten. Sie trug weiße Leinenhosen und ein hellgrünes T-Shirt mit Rüschen.
Kummer lächelte. Nein, es interessierte ihn nicht besonders. Er musste an seine eigene Situation denken, die genau umgekehrt war. Irma ließ ihn ab und zu in ihr Bett, aber mit ihm zusammenleben wollte sie nicht. Sie arbeitete noch. Solange er auch gearbeitet hatte, war es gegangen, aber kaum war er pensioniert, ging er ihr auf die Nerven. Dabei war das mit dem Camper ihre Idee gewesen. Nicht darin zu wohnen, sondern damit Urlaube und Ausflüge zu machen. Sie mieteten für zwei Wochen einen VW-Bus und fuhren damit in die Westschweiz. Irma war nicht begeistert, man hocke zu eng aufeinander, fand sie, nachdem es in Estavayer-le-Lac drei Tage lang geregnet hatte. Kummer hingegen gefiel es, auch wenn sie recht hatte. Für zwei Personen war der Camper zu klein.
Weil sie im Gesundheitswesen arbeitete, war sie vorsichtig mit Kontakten. Ein paar Mal hatte er vor ihrem Balkon gestanden, und sie hatten sich unterhalten wie einst Romeo und Julia. Ab und zu chatteten sie auf WhatsApp miteinander oder schickten sich Sprachnachrichten. Kummer mochte Sprachnachrichten, dabei konnte man sagen, was man zu sagen hatte, ohne dass ein endloses Gespräch daraus wurde. Auch wenn es nur ein, zwei Sätze waren, bei denen ihm nicht in den Sinn gekommen wäre anzurufen. So plauderten sie zeitverschoben miteinander.
»Ich habe mit den Männern genug Ärger gehabt. Damit bin ich fertig«, unterbrach Rosa seine Gedanken.
»Rosa hätte Grund sich zu beklagen, aber sie beklagt sich nie!«, bemerkte Heinz.
Sich trotz widriger Umstände nicht zu beklagen, galt in der Schweiz als hohe Tugend. Obwohl, wenn sich niemand beklagte, änderte sich an den Umständen nie etwas, dachte Kummer.
»Ich kann schon selber reden, Heinz. Willst du meine Geschichte hören, Henry?«
»Gern.« Mehr als das, was die beiden im Bett miteinander anstellten, interessierte ihn, wie sie dazu kamen, auf dem Campingplatz zu wohnen.
»Also gut, hier die Kurzversion: Ich bin ein Gastarbeiterkind, geboren in Italien, in der Nähe von Padua. Mein Vater war Saisonnier, ich habe ihn nur im Winter gesehen, bis meine Mutter und ich in die Schweiz durften. Da war ich schon neun Jahre alt. Ich konnte kein Wort Deutsch und schon gar kein Wort Berndeutsch. Darauf wurde aber keine Rücksicht genommen, Sprachförderung oder so was gab es damals nicht, man wurde ins kalte Wasser geworfen, und dann hieß es: Schwimm oder geh unter! Die Lehrpersonen halfen einem lieber beim Untergehen. Was aus dir wird, geht uns nichts an, niemand hat euch hierhergebeten, also wartet auch niemand auf dich. In Italien war ich immer gut in der Schule, hier blieb ich im ersten Jahr sitzen, habe schließlich die Real gemacht und Verkäuferin gelernt.« Rosa tunkte – das hatte Kummer schon ewig nicht mehr gesehen – ihr Gipfeli in den Kaffee. Diese Geste war der Beweis der vollständigen Assimilation. Wobei heute kaum mehr jemand sein French Almond Croissant in den Chocolate Cream Frapuccino tunkte.
Kummer erinnerte sich daran, wie im letzten Schuljahr der Berufsberater in die Klasse gekommen war und die verschiedenen Berufe vorgestellt hatte. Jeder Beruf ein quadratisches Kärtchen aus Karton. Vorne ein Foto und die Bezeichnung: Bäcker, Maurer, Technischer Zeichner, Kaufmännischer Angestellter, hinten die Anforderungen: handwerkliches Geschick, kräftige Statur, gutes Auffassungsvermögen, Freude am Umgang mit Zahlen. So wurde den Fünfzehnjährigen vermittelt, wie ihre Zukunft aussehen würde, welchen Platz in der Gesellschaft sie einnehmen konnten. Damals ging man davon aus, dass der gewählte Beruf ein Leben lang ausgeübt wurde. Knapp fünfzig Jahre lang, von der Lehre bis zur Pensionierung. Den Fleißigen und Aufgeweckten winkte der berufliche und soziale Aufstieg. Handwerker konnten es zum Eigenheim, mitunter sogar zur Villa bringen, wenn sie sich selbstständig machten und über Geschäftssinn verfügten. Angestellte konnten sich die Karriereleiter hocharbeiten, Sprosse um Sprosse, in einem Großbetrieb oder in der Verwaltung. Die restlichen Leute würden in ihrer Schicht verharren, aber sich im Vergleich zu ihren Eltern trotzdem materiell verbessern. Die Zeit, die für ein Auto, eine Waschmaschine oder einen Fernseher gearbeitet werden musste, sank kontinuierlich. Es sei wichtig, so der Berufsberater, dass ein jeder wisse, wo er hingehöre. Der Kärtchenstapel für die Mädchen war deutlich kleiner gewesen, Verkäuferin kam weit unten. Der Beruf war für sie nicht so wichtig, sie würden sowieso heiraten, Hausfrau und Mutter werden. Zwar gab es schon Leute, die einen anderen Weg suchten, die aus dem starren Gesellschaftskorsett ausbrechen wollten, aber die waren dünn gesät in Zürich Affoltern, wo Kummer aufgewachsen war. Er wusste damals nicht, was er werden wollte. Er wusste nur, was er nicht werden wollte: eines der Kärtchen. Auf eine Art war ihm das gelungen. Polizist, weil kein Lehrberuf, war nicht dabei gewesen. Ein Polizist war kein Kärtchen, wie er später merkte, sondern eine Schablone.
Als er dem Lehrer sagte, er wolle aufs Gymnasium, lachte der ihn aus. Zürich Affoltern war ein Arbeiter- und Kleinbürgerquartier. Aufs Gymnasium gingen die Kinder vom Zürichberg und der Goldküste. Kummer meldete sich selber zur Prüfung an und bestand. Im Gymi gab es nur wenige, die aus einfachen Verhältnissen stammten, Arbeiter- und Ausländerkinder, deren Eltern nicht studiert hatten. Kummer schaffte die Matura, aber nach dem ersten Semester Geschichte schmiss er den Bettel hin und beendete seine akademische Laufbahn. Er arbeitete auf dem Bau, bis er sich aus einer Laune heraus bei der Polizeischule anmeldete und genommen wurde. Als einfacher Polizist mit Matura, als Studierter, der nicht oben in der Hierarchie einstieg, war er damals ein Exot. An beiden Orten fehl am Platz.
Rosa fuhr mit ihrer Erzählung fort. »Ich habe eine Lehre als Parfüm-Verkäuferin beim Loeb in Bern gemacht, das galt damals etwas. Ich habe früh geheiratet, einen Kunden, der immer mit seiner Mutter vorbeikam. Wir eröffneten zusammen eine Boutique, es lief gut, irgendwann hatten wir vier Filialen und drei Kinder. Sie waren elf, vierzehn und sechzehn, als ich ihn im Warenlager entdeckte. Er hatte sich erhängt, wir waren pleite, weil er unser ganzes Geld verspielt hatte, das Finanzielle war sein Ressort. Wir waren eine Einzelfirma, ich als Geschäftsführerin eingetragen, und so blieben die ganzen Schulden an mir hängen. Der Umzug vom Einfamilienhaus in die Blockwohnung ist den Kindern nicht leichtgefallen. Vor allem, weil wir im selben Ort geblieben sind. Sie wurden ausgelacht und gepiesackt. Nichts sehen die Leute lieber, als wenn jemandem, der aus denselben Verhältnissen stammt, die Flügel gestutzt werden. ›Haben gemeint, die sind etwas Besseres, das haben sie jetzt davon.‹ Wir mussten die Gegend verlassen, die Älteste ist bei der Gelegenheit gleich ausgezogen. Ich habe zwanzig Jahre lang gearbeitet und abbezahlt. Weil mein Mann während der ganzen Jahre keine Beiträge für mich entrichtet hat, bekomme ich die Minimalrente, und die reicht nicht weit. Wenigstens müssen meine Eltern das nicht mehr erleben. Sie haben hart gearbeitet, damit ich es besser habe, sie waren so stolz, dass ich in meinem eigenen Haus mit Garten wohne. Jetzt lebe ich im Wohnwagen. Come una zingara, würde meine Mutter sagen, Gott hab sie selig!« Rosa bekreuzigte sich. »Mir macht es nichts aus, ich brauche nicht viel und lebe lieber auf dem Campingplatz als in einem anonymen Mietshaus. Hier kennt man sich, schaut man aufeinander und lernt sogar die reichen Nachbarn kennen.« Rosa lachte, und Kummer begriff nicht gleich, dass sie ihn damit meinte.
»Du bist noch mobil, du kannst hinfahren, wo du willst. Wir sitzen fest. Du hast noch Pläne, wir stehen auf dem Abstellgleis.«
Kummer dachte an seine Pension, die gerade so reichte. An seine Pensionskasse, die er zum Teil in den Camper gesteckt, zum Teil seiner Tochter Mona geliehen hatte. Sie hatte sich selbstständig gemacht mit einem Café. Vier Monate vor der Coronakrise. Es war nicht sicher, ob ihr Geschäft überleben oder ob sie wie Rosa viel Zeit, Geld und Zuversicht verlieren würde.
Drittens
Es war Freitagmorgen, und es roch nach Sonne. Nach Sonne und nach etwas anderem, das Kummer erst nicht einordnen konnte, dann aber erkannte: Blut. Er schaute auf sein Kopfkissen, ob er in der Nacht Nasenbluten gehabt hatte, untersuchte das Bett und seinen Körper. Nichts. Er hatte sich getäuscht. Kummer war kein Sonnenanbeter, keiner jener Menschen, die über ein paar Sonnenstrahlen regelmäßig aus dem Häuschen gerieten, als hinge ihr Lebensglück davon ab, obwohl es Studien gab, die belegten, dass Menschen in Südkalifornien nicht glücklicher waren als jene in Finnland. Auf dem Campingplatz bedeutete Regen allerdings erschwerte Bedingungen, und so war er zufrieden, dass sich der Sommer doch noch gezeigt hatte. Er legte die Bettdecke zusammen und verstaute sie in der Kiste unter dem Bett. Er brauchte einen Kaffee und überlegte sich, selber einen zu brauen, weil er nicht wusste, ob er Heinz schon gewachsen war. Es gab Tage, da redete der am Morgen, redete und redete und redete, während Kummer und Rosa sich ansahen und stumm die Köpfe schüttelten. Er mochte den Heinz, mochte solche Typen, die immer knapp an der Wahrheit und am Abgrund vorbeischrammten, die Fäden spinnen konnten, die zu entwirren unmöglich war, die sich im Kreis drehten, sich um Kopf und Kragen redeten und dabei immer wieder Sätze von erstaunlicher Klarheit und Tiefe formulierten. Die über Intelligenz und Witz verfügten, aber Nerven kosteten, und das nicht nur, weil sie zu viel redeten.
»Tamisiech«, brummte Kummer unentschlossen vor sich hin und machte sich auf den Weg in den Waschraum. Es war kurz nach sieben, eine Frau kam ihm entgegen, in Bermudashorts und Turnschuhen, sie trug einen kleinen Rucksack und eine blaue Baseballkappe.
»Grüezi«, entwand er sich einen Gruß, das gehörte sich so auf dem Campingplatz.
»Morge«, erwiderte sie, ohne aufzuschauen. Ihre Stimme klang zuversichtlich. Mit der Ruhe würde es bald vorbei sein. Ab Mittag trudelten die Leute ein, die Reservationen waren gemacht, die Saison startete so richtig. Das letzte Wochenende hatte einen Vorgeschmack darauf gegeben. Während es am Freitag noch geregnet hatte, war es am Samstag schön gewesen, ehe es am Sonntag wieder regnete. Erwachsene, Kinder, Jugendliche, alle auf engem Raum, die einen schrien und lachten, die anderen hörten Musik über ihre Bluetooth-Speaker und ignorierten die ab dreiundzwanzig Uhr geltende Nachtruhe. Bis in den frühen Morgen röhrte oder kreischte jemand, bellte ein Hund, wummerte ein Bass, verlor jemand die Nerven und schrie nach Ruhe. Kummer konnte es egal sein, wenn er in der Nacht nicht schlafen konnte, blieb er am Morgen einfach länger liegen. Ganz bestimmt würde er die Zeit, die ihm noch blieb, nicht damit verplempern, sich aufzuregen und andere zurechtzuweisen. Wenn es ihm irgendwo nicht gefiel, konnte er ja weiterziehen. Theoretisch zumindest, zurzeit war fast alles ausgebucht, aber trotzdem. Wenn es ihm zu laut wurde, stopfte er sich Ohropax in die Ohren, das war ein wohlfeiles Gegenmittel.
In einer Kabine im Waschraum schaufelte er sich kaltes Wasser ins Gesicht und schaute in den Spiegel. Eigentlich hätte er sich rasieren müssen. Oder sollte er sich einen Bart wachsen lassen? Praktisch wäre es. Mit seinen Jeans und karierten Hemden und der Brille, die er zum Lesen brauchte, sähe er dann aus wie ein Hipster oder wie die hießen, nur dass er nicht tätowiert war. Das konnte sich ja ändern. Früher wurde das bei der Polizei nicht gern gesehen, inzwischen hatten die jungen Kollegen teils großflächige Motive. Kummer hatte selten genau genug hingeschaut, um herauszufinden, was sie darstellten. Einige tätowierten sich die Namen ihrer Kinder auf die Arme, so vergaßen sie nicht, wie die hießen. Vielleicht könnte er sich die Wappen aller Dörfer tätowieren lassen, in denen er übernachtete, wie die Leute früher Stocknadeln am Wanderstab anbrachten.
Zurück im Camper zog er seine Jeans an, das Hemd, das er seit drei Tagen trug und das er nach dem Frühstück in die Sonne hängen würde. Dazu die hässlichen, aber praktischen blauen Crocs-Kopien. Sie ließen sich rasch an- und ausziehen, die Füße blieben auch bei Regen trocken. Dergestalt angekleidet holte er die Gipfeli.
»Wo ist Rosa?«, fragte Kummer, als er sich zu Heinz an den Plastiktisch setzte.
»Keine Ahnung. Sie macht nicht auf. Vielleicht ist sie früh aufgestanden, weil sie irgendwohin musste.«
»Wo soll sie so früh hinmüssen?«