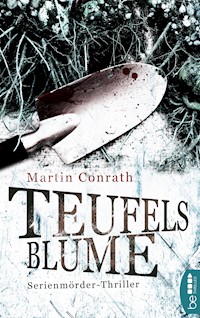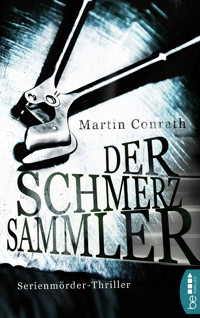9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Ruhrpott-Krimis
- Sprache: Deutsch
Ein Mord im alten Bergwerk – der packende Auftakt zur neuen Krimireihe im Ruhrpott Knochenfunde in der Zeche Ludwig. Als der Notruf bei Hauptkommissarin Elin Akay eingeht, weiß sie sofort, worum es geht: Das Wandernde Dutzend wurde gefunden. Zwölf Bergmänner, die vor 34 Jahren im Füllort der Zeche verschüttet wurden. Doch es sind nicht zwölf Skelette, die die Einsatzkräfte bergen – es sind dreizehn. Das dreizehnte Opfer starb durch einen Kopfschuss. Die Patrone ist noch in seinem Schädel, den der Bergmann Werner Flemming findet. Flemming gehört zu den damals Geretteten, durch den Fund ist er retraumatisiert und spricht nicht. Elin Akay zieht die forensische Psychiaterin Jana Fäller als Beraterin hinzu. Weil sie die Beste ihres Fachs ist. Und weil ihr verstorbener Vater damals bei dem Grubenunglück dabei war. Sie kennt die Bergmänner, ihr vertrauen sie. Elin Akay und Jana Fäller ermitteln gemeinsam unter den Kumpeln. Sie stoßen auf Geheimnisse, die viel zu lange unter dem schweren Gestein der Zeche verborgen lagen. Als öffentlich wird, wer das dreizehnte Opfer ist, droht das Lügengerüst einzubrechen. Einer der Bergleute hat damals zur Waffe gegriffen. Und um die Wahrheit zu schützen, wird er es wieder tun …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Martin Conrath
Kohle, Stahl und Mord: Das 13. Opfer
Elin Akay und Jana Fäller ermitteln
Kriminalroman
Über dieses Buch
Tief unten im Berg wartet die Wahrheit
Knochenfunde in Zeche Ludwig. Als der Notruf eingeht, weiß Kommissarin Elin Akay sofort, worum es geht: Das wandernde Dutzend. Zwölf Bergmänner, die vor 34 Jahren im Bergwerk verschüttet wurden. Doch es sind nicht zwölf Skelette, die die Einsatzkräfte bergen – es sind dreizehn.
Das dreizehnte Opfer starb durch einen Kopfschuss. Die Patrone ist noch in seinem Schädel, den Bergmann Werner Flemming findet. Flemming gehört zu den damals Geretteten, er könnte Entscheidendes wissen, doch er ist retraumatisiert, erinnert sich nicht. Elin Akay zieht die forensische Psychiaterin Jana Fäller hinzu. Weil sie die Beste ihres Fachs ist. Und weil auch ihr Vater bei dem Grubenunglück dabei war. Sie kennt die Bergmänner, ihr vertrauen sie.
Elin Akay und Jana Fäller ermitteln gemeinsam unter den Kumpeln. Sie stoßen auf Geheimnisse, die zu lange unter dem schweren Gestein des Berges verborgen lagen. Einer der Bergleute hat damals zur Waffe gegriffen. Und um die Wahrheit zu schützen, wird er es wieder tun …
Vita
Martin Conrath ist in Neunkirchen geboren. Nach der Schule machte er zunächst eine Ausbildung zum Schlagzeuger und tourte über 20 Jahre mit Bands und Ensembles durch Deutschland, bevor er sich dem Journalismus zuwandte und für verschiedene Zeitungen tätig war. Nebenbei arbeitete er als freier Schriftsteller und Personalvermittler und lehrte Journalismus, Stilistik und Kommunikation. Heute schreibt er Krimis und historische Romane und lebt in Düsseldorf.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Kai-Patric Fricke/lost-places.com; Shutterstock
ISBN 978-3-644-02028-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Die Vergangenheit ist wie ein Teppich. Man kann auf ihm schreiten oder auf ihm ausrutschen.»
John Steinbeck
Tag 1, Freitag
Essen, Schacht Ludwig V, Gegenwart
Seit dem Unglück vor vierunddreißig Jahren war Werner nie das Gefühl losgeworden, in eine Unterwelt voller Gefahren und Unwägbarkeiten abzutauchen, wenn er in einen der Schächte hinabfuhr, wenn das Tageslicht versickerte, wenn er aufgesogen wurde von der nie endenden schwarzen Nacht unter Tage.
Mit langen Schritten betrat er die Weißkaue, wo Tausende Kleiderkörbe unter der Decke schwebten, bis auf wenige Dutzend waren sie leer. Jedes Mal, wenn er die leeren Körbe sah, musste er die Trauer herunterschlucken, die ihn seit dem Sterben des Kohlebergbaus begleitete.
Auf Ludwig V wurde schon lange keine Kohle mehr gefördert, es ging nur noch darum, das Grundwasser zu kontrollieren. Dafür mussten riesige Pumpen täglich Millionen Liter Wasser absaugen. Aber damit hatte er heute nichts zu tun. Üblicherweise wartete er die kleinen Pumpen, doch sein Job in den nächsten Wochen war es, die Strecken, in denen das neue Besucherbergwerk entstehen sollte, mit ausreichend Strom für die Bauarbeiten zu versorgen. Kabel waren zu legen, mithilfe einer Bolzenschusspistole wurden Befestigungen in den Beton getrieben, die Elektrik musste geprüft werden.
Die großen Pumpen, mehr als zweihundert, die jedes Jahr 700 Millionen Badewannen Wasser an die Oberfläche und von dort in die Zuflüsse der Emscher und des Rheins brachten, waren in den Stollen des ganzen Ruhrgebiets verteilt und wurden ferngesteuert. Durch den Bergbau hatten sich Landschaft und Städte flächendeckend abgesenkt, weit unter den Grundwasserspiegel. Die Essener Innenstadt um dreißig Meter. Fielen die Pumpen aus, war es nur eine Frage der Zeit, bis große Teile des Ruhrgebiets durch das nach oben drängende Grundwasser geflutet wurden. Wie lange das dauern würde, wusste niemand so genau, nur dass es passieren würde. Deswegen mussten die Pumpen, die großen wie die kleinen, bis in alle Ewigkeit laufen.
Für Werner bedeutete das einen sicheren Arbeitsplatz, für die Allgemeinheit Kosten in Millionenhöhe jedes Jahr, nur ein Bruchteil der Ewigkeitskosten, die der stillgelegte Bergbau verursachte. Viele ärgerten sich darüber, aber ohne die Kohle wäre Deutschland noch heute ein Bauernstaat, da war sich Werner sicher.
Er zog sich nackt aus, achtete darauf, dass sein Hörgerät sicher verwahrt war, wechselte in die Schwarzkaue, wo ebenso viele Körbe schwebten wie in der Weißkaue und ebenso viele leer waren. Er ließ den Korb mit seinen Arbeitskleidern herunter, zog sich an, setzte den Helm auf, prüfte den CO2-Selbstretter und die Kopflampe, vergewisserte sich, dass er genug Wasser und Verpflegung für zehn Stunden eingesteckt hatte und sein Werkzeug vollständig war. Obwohl er dieses Ritual seit fünfundvierzig Jahren fast täglich vollzog, ging er jeden Punkt sorgfältig durch. Der Berg verzieh keine Fehler.
Er trottete zur Schachtschale. Dort wartete Kevin, sein neuer Kollege, der heute zum ersten Mal antrat. Werner war skeptisch. So ein Neuling machte meist Probleme, aber er hatte keine Wahl, er musste ihn mitnehmen. Gestern hatten sie sich kurz getroffen und einander vorgestellt. Kevin war 34 Jahre alt, dünn wie ein Hering, studierter Elektrotechniker. Er sollte die elektrische Anlage prüfen und einen neuen Stromversorgungsplan aufstellen für den ganzen Schnickschnack, den sie in das Besucherbergwerk einbauen würden. Werner hielt das Projekt für groben Unfug, aber was die Großen entschieden, mussten die Kleinen ausbaden. So war das schon immer gewesen, und so würde es immer sein. Immerhin konnte Kevin jedes einzelne Teil der elektrischen Anlage auswendig aufzählen, das musste man ihm lassen. Aber er machte keinen Hehl daraus, dass er die Bergleute nicht begriff, die einer harten, auszehrenden Arbeit unter Tage nachtrauerten, wo sie doch über Tage ein besseres Leben gehabt hätten.
Werner hatte es nie besser gehabt als mit seinen Kumpeln, denen er jeden Tag sein Leben anvertraut hatte, mit denen er im Stadion gestanden und seinem Verein, Rot-Weiss Essen, zugejubelt hatte, egal wo sie gerade in der Tabelle standen. Im Moment kämpften sie für den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Werner verpasste kein Spiel und feuerte seine Jungs an, so laut er konnte.
Er reichte Kevin die Hand. «Alles klar?»
«Geht so.»
«Schlecht geschlafen?»
«Blöd geträumt.»
«Die erste Seilfahrt?»
Kevin nickte.
«Wird schon», sagte Werner und betrat den Metallkäfig, der sie in die Unterwelt bringen sollte.
Sie würden zusammen einfahren, also wollte Werner ihn behandeln wie einen Kumpel. Mit Respekt. Kevin seufzte und folgte ihm. Der Fahrsteiger erwartete sie am Korb, schob die Gittertüren hinter ihnen zu, sie rasselten und quietschten.
Heute war das Gefühl namenloser Bedrohung besonders stark. Seit Tagen quälte Werner eine Vorahnung, dass etwas Furchtbares passieren würde. Aber was sollte schon passieren? Die Strebe, Strecken und Schächte waren tot, zurückgeführt, das hieß, alles von Wert war nach oben geschafft und ins Ausland verkauft worden, der Rest hatte seine letzte Fahrt zum Schrotthändler längst angetreten. Nur hier und da hingen Kabel herum, vor allem am Füllort, wo in luftiger Höhe noch Hubwinden und Flaschenzüge montiert waren und die Zugketten für den manuellen Betrieb bis auf den Boden reichten. Hier sollte das neue Besucherzentrum bald Tausenden den Bergbau näherbringen. Doch das würde noch ein oder zwei Jahre dauern oder noch länger, denn Werner war sich sicher, dass der Berg sich dagegen wehren würde.
Was für eine Schnapsidee, so was auf der siebten Sohle hinzuklotzen. Zwar gab es kein Methan mehr, das explodieren konnte, oder Kohlenstaub, der, vermischt mit Luft, die Sprengkraft von Nitroglyzerin erreichte, wenn auch nur der kleinste Funke entstand. Aber siebte Sohle, tausend Meter unter der Erde? Was für ein irrwitziger Aufwand an Transport, Sicherheit und Kontrollen für ein bisschen Nervenkitzel. Mit Bergbau hatte das nichts mehr zu tun. Das war Disneyland unter Tage.
Der Steiger wünschte Glück auf, es war nett gemeint, aber dennoch: Was für ein Hohn! Fahrsteiger, Schichtführer, sechs Mann an den Kontrollen der Motoren – alles für zwei Mann in einem Korb, in dem früher einhundertzwanzig eingefahren waren. Die Glocke erklang fünf Mal, wenigstens das war, wie es immer gewesen war.
Die Motoren liefen an, viele Tausend PS stark, der Korb sackte in die Tiefe, raste nach unten, vierzig Kilometer pro Stunde, es rasselte und ruckelte, dröhnte, zu laut, um sich zu unterhalten, zumal Werner ohne sein Hörgerät für das rechte Ohr, das seit zwanzig Jahren fast taub war, sowieso nur die Hälfte verstand.
Er warf Kevin einen Blick zu. Der hielt sich tapfer, dennoch sehnte er das Ende der Seilfahrt herbei, das sah Werner ihm an: Der Blick seines Kollegen flackerte, seine Haltung war steif.
Mit einem Ruck kam der Korb nach neunzig Sekunden zum Stehen. Kevin zuckte zusammen, entspannte sich, dann sah er Werner entschuldigend an, der ihm aufmunternd zulächelte. Werner hatte seine erste Seilfahrt nicht vergessen, bei der er sich fast in die Hose gemacht hatte. Sechzehn war er da gewesen.
Er schob die Gittertüren auf. Vor ihm, auf Sohle sieben, öffnete sich der größte Füllort der Gegend. Eine Kathedrale aus Beton und Stahl, mitten im Berg, fast einen Kilometer unter der Erde. Ein Ort, der ihm noch immer Ehrfurcht einflößte. Er bewunderte die Ingenieure, die ein solches Bauwerk unter Tage zustande brachten. Sein Einfamilienhäuschen mit zweieinhalb Geschossen hätte bequem hineingepasst.
Die Höhe war nötig, schließlich mussten drei meterhohe Körbe übereinanderpassen, aus denen bei jeder Schicht mehr als dreihundert Bergleute zu ihren Arbeitsplätzen strömten. Geströmt waren. Werner hatte noch immer die Bilder vor Augen, wie sich die Menschenschlange der Malocher in die Strecken ergossen hatte, konnte sich gut erinnern, wie sicher er sich gefühlt hatte inmitten seiner Kumpel. Bis zu dem Tag, den er am liebsten vergessen würde.
Er trat in den Füllort, von wo aus damals Millionen von Tonnen Kohle nach oben geschafft worden waren. Er wusste nicht genau, wie viele davon er abgebaut hatte, aber es mussten Hunderttausende gewesen sein. Jahrelang hatte er einen Walzenschrämlader bedient, der mit seinen Zähnen, so lang und spitz wie die eines T. Rex, die Kohle aus dem Berg fräste, und das in einem Tempo, bei dem kein Mensch mithalten konnte. Je nach Mächtigkeit der Flöze waren 400 Tonnen und mehr pro Tag kein Problem. Starke hydraulische Schilde hatten den Streb, in dem die Kohle lag, gestützt und waren wie Tausendfüßler langsam durch das Flöz gewandert, immer der Schrämwalze voraus und dem schwarzen Gold hinterher.
Kevin schaute sich um. «Beeindruckend. Ich habe viel darüber gelesen, wie so ein Füllort aussieht, aber darin zu stehen, das ist eine ganz andere Sache. Es ist irgendwie», er suchte nach dem richtigen Wort, «erhaben.»
Das war eine gute Beschreibung für das Gefühl, das auch Werner immer wieder packte. Kevin wurde ihm sympathischer. Der Kerl schien in Ordnung. Vielleicht hatte er Lust, nach der Schicht mit ihm ein Bierchen zu zischen.
Werner nickte und zeigte auf die Verbauungen. «Dahinter liegt genug Kohle, um Deutschland ein halbes Jahrhundert mit Strom und Wärme zu versorgen.»
«Wäre da nicht der Klimawandel.»
«Ja, schon klar, jeder, der bis drei zählen kann, weiß das.»
«Schön wär’s.» Kevin zuckte die Schultern. «Aber das ist nicht unser Problem. Das müssen die da oben lösen.» Er zeigte in Richtung der grauen Betondecke mit den runden Stahlstreben und den Flaschenzügen.
«So sieht es aus. Lass uns loslegen. Zuerst prüfen wir die Leitungen durch.»
Neben dem Schacht hing ein Kasten, in dem man leicht einen Erwachsenen hätte unterbringen können. Er war vollgestopft mit Starkstromsicherungen, denn die Motoren der Bänder und die Hydraulik liefen nur mit Drehstrom, 32 Ampere aufwärts. Gute Voraussetzungen für Kevins Verteilungsplan. Sie würden nicht sehr viel ändern müssen, schätzte Werner, nur ein paar Hundert Meter Kabel neu ziehen, hier und da Verteiler einbauen und verdrahten. Keine große Sache. Zwei oder drei Wochen höchstens. Dann konnten die Ingenieure, Architekten und die Bauleitung anrücken.
Werner öffnete den Kasten, Kevin leuchtete mit einer Stablampe hinein. Alle Sicherungen waren drin, kein Kabel hatte sich gelöst, es roch nicht durchgeschmort nach verbranntem Kunststoff.
«Wunderbar», sagte Kevin.
Werner stellte sich auf eine entspannte Schicht ein. Das Gefühl der Bedrohung ließ nach, fast fühlte er sich wohl hier unten. Mit Kevin hatte er einen guten Mann an der Seite, er konnte ihm das eine oder andere über den Berg beibringen, niemand machte Druck, sie hatten Zeit zum Plaudern. Werner hatte schon immer darauf geachtet, die Leute kennenzulernen, mit denen er arbeitete. Er musste wissen, mit wem er es zu tun hatte, musste ihre Stärken und Schwächen ausloten, damit er im entscheidenden Augenblick richtig reagieren konnte.
«Hast du eine Freundin?», fragte er und vermutete, dass dem so war.
Kevin nickte. «Wir wollen bald heiraten. Sie ist die Richtige.»
Das freute Werner. Es war immer schön zu sehen, wie junge Menschen sich verliebten, gemeinsam ihr Leben bestreiten wollten und das mit einem Versprechen bekräftigten. Und es gab ja auch viele Ehen, die lange hielten, bis dass der Tod sie schied. So wie seine.
Ohne Vorwarnung gab der Berg ein Grollen von sich. Wie ein Wachhund, der kurz davor stand zuzubeißen. Der Boden unter Werners Füßen zitterte leicht. Sein Verstand sagte ihm, dass es nur eins der unzähligen kleinen Beben war, von denen das Ruhrgebiet ständig erschüttert wurde, und es keinerlei Grund zur Besorgnis gab. Die Verbauungen hielten einer Erschütterung bis 7,0 auf der Mercalliskala stand. Eine Stärke, bei der oberirdisch bereits Häuser einstürzten, wenn sie nicht erdbebensicher gebaut waren. Sein Puls jedoch schlug schneller, die Kehle wurde eng. Bilder schossen durch seinen Kopf. Er hörte Schreie, spürte Hitze, die gar nicht da war, sie kam aus seiner Erinnerung. Seine Narben am Rücken, die waren da, die gaben keine Ruhe, Schmerz strömte durch seinen Körper.
«Werner!»
Er fuhr herum. Kevin schaute ihn entgeistert an.
«Alles klar?»
Werner schüttelte den Kopf, die Bilder rissen ab, nur die Narben schmerzten noch ein wenig. Aber er war wieder auf Sohle sieben, Schacht Ludwig V. Der Berg hatte sich beruhigt. Werner atmete tief durch.
«Alles klar, war nur in Gedanken.»
Dass er fast kopflos davongerannt wäre, so wie damals, das würde er Kevin nicht erzählen. Es war schon schlimm genug, dass ihn die Erinnerungen nicht losließen. Es waren immer Fetzen, Geräusche und Gerüche, einzelne Bilder. Kumpel, die mit vor Panik verzerrten Gesichtern vorbeihasteten, verbranntes Fleisch, Schreien und Jammern, Fluchen und Beten. Seit vierunddreißig Jahren schleppte er diese Last mit sich herum, manchmal spürte er nichts, manchmal, so wie heute, schien es ihm, als wäre das Unglück erst gestern geschehen. Die Explosion damals hatte ihn von den Füßen geholt, die Hitze seinen Rücken versengt. Er hatte mit dem Leben abgeschlossen, um die Vergebung seiner Sünden gebeten. Er war nicht ohnmächtig gewesen, doch von dem Moment der Explosion bis zu dem Moment, als ihn die Grubenwehr aus dem Schacht geholt hatte, war sein Gedächtnis wie geschreddert, alles wirkte wie in einem Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gab. Seine Erinnerungen setzten sich vor allem aus den Erzählungen der Kollegen zusammen. Nur der Schmerz der Verbrennung der Haut auf seinem Rücken, der war immer real gewesen, war es bis heute.
Werner holte tief Luft, wandte sich dem Kasten zu. Kevin hatte bereits das Messgerät ausgepackt und die ersten Anschlüsse auf Last und richtige Drehrichtung geprüft. Es waren 165 Klemmen, alle fein säuberlich durchnummeriert. Neunundneunzig waren jeweils mit Phase 1 bis Phase 3 für die stromführenden Leitungen beschriftet, für jedes Gerät gab es ein eigenes Schildchen, mit dem man es identifizieren konnte.
Bei der achtzehnten wurde Kevin fündig. Keine Last. Er schaute im Verdrahtungsplan nach. «Wir müssen gut einen Kilometer in die Strecke rein. Da sitzt eine 12-Kilowatt-Pumpe. Die sollten wir uns anschauen, bevor wir weitermachen.»
Werner nickte. «Da hatten wir schon mal Probleme. Sind die neuen kleinen Mistdinger. Die taugen nichts. Fallen ständig aus.»
«Wer billig kauft, zahlt zehnfach», stellte Kevin fest und klappte seinen Werkzeugkoffer zu. «Soweit ich weiß, sind schon andere bestellt worden, und den Lieferanten erwartet eine Klage.»
«Immerhin.» Werner streckte sich und klatschte in die Hände.
Im selben Augenblick wankte der Boden unter seinen Füßen, das Licht verlosch. Um ihn herum donnerte der Berg. Das war kein kleines Beben. Da war etwas anderes im Gange, etwas Großes. Absolute Dunkelheit hüllte ihn ein. Es gelang ihm nicht, die Kopflampe einzuschalten, so sehr tanzte der Boden, er musste mit aller Macht gegen den Reflex ankämpfen loszurennen, gleichzeitig hatte er das Gefühl, dass sein Brustkorb platzen müsste, so schnell schlug sein Puls. Es war wie damals. Er konnte nichts tun. War hilflos. Nun würde es doch passieren. Der Berg hatte ihn damals nicht erwischt, aber heute würde er ihn zerquetschen, er hatte nur ein paar Jahre gewartet – was waren schon vierunddreißig Jahre für einen Berg, der Millionen Jahre alt war? Ein Wimpernschlag.
Brocken prasselten auf seinen Helm, sein Herz raste immer schneller, jederzeit konnte sich ein Stahlträger oder ein Teil des Betonverbaus lösen und ihn zermalmen wie eine Kakerlake. Das Blut rauschte in seinem Kopf, der Puls hämmerte in seinen Ohren.
Dann schwieg der Berg. Das Beben hatte nur wenige Sekunden gedauert, doch Werner kam es vor, als wären es Minuten gewesen. Er atmete tief ein und aus, spürte den Schweiß, der seine Haut von oben bis unten bedeckte. Die Panik zog sich zurück, doch Angst und Wachsamkeit blieben. Jederzeit konnte der Boden unter seinen Füßen erneut erwachen.
Er schaltete seine Helmlampe ein. Kevin lag auf dem Boden, hatte sich wie ein Fötus zusammengekrümmt. Ein Beben unter Tage hatte schon stärkere Männer in ein Häuflein Elend verwandelt. Und ein so starkes hatte selbst Werner noch nicht erlebt. Er zitterte noch immer am ganzen Leib und konnte kaum fassen, dass er noch lebte. Gerade wollte er seinem Kollegen aufhelfen, da hielt er inne, lauschte, ließ den Kegel der Lampe über die Verbauung huschen. Er hörte ein Rauschen, das lauter zu werden schien. Waren die Pumpen ausgefallen? Experten prophezeiten schon lange, dass ein Stromausfall die Pumpen auf längere Zeit lahmlegen würde, das Wasser würde steigen, die Strebe und Schächte füllen und an die Oberfläche drängen. Langsam, aber sicher. Vorher würde das Grubenwasser, angefüllt mit giftigen Stoffen, die Gebirgsschichten erreichen, aus denen das Trinkwasser gewonnen wurde, und es zu einer tödlichen Brühe machen.
Werner schüttelte den Kopf. Diese Gedanken machten ihm Angst. Zu viel Angst. Er musste bei klarem Verstand bleiben, wenn er eine Chance haben wollte zu überleben.
Kevin rappelte sich hoch, fummelte an seiner Lampe herum, sie leuchtete auf, er stotterte etwas vor sich hin, das Werner nicht verstehen konnte. Mit einer Handbewegung brachte er ihn zum Schweigen.
Er griff nach seinem CO2-Warner, doch der blieb stumm. Er schnüffelte in die Luft, obwohl er wusste, dass er Methan nicht riechen konnte, ein Reflex aus alten Zeiten. Kohlenstaub, den es ja gar nicht mehr gab, den hatte er riechen und schmecken können, wenn er aufgewirbelt wurde und sich mit Luft vermischte. Aber das war lange her. Das Einzige, das er jetzt schmeckte, war die Magensäure, die ihm den Hals hinaufstieg.
Er hörte etwas, lauschte in die Strecke wie ein Reh, das den Wolf zu wittern versucht. Da war es. Ein Rauschen, wie von einem fernen Wasserfall. Es kam aus der Strecke. Wie konnte das sein? Fielen die Pumpen aus, stieg das Wasser, ja, aber es war kein plötzlich anschwellender Wildbach, der alles mit sich riss, sondern ein langsam und dennoch unaufhaltsam steigender Pegel, wie die Flut, die das Watt überspült. Es konnte Wochen dauern, sogar Monate, bis das erste Wasser an die Oberfläche trat. Nein, das hier war etwas anderes.
Der Boden begann zu vibrieren. Irgendwo im Berg über ihnen musste durch das heftige Beben eine Wassersperre gebrochen sein, ein Damm, der die Flut zurückhielt. Die Wassermassen, die sich dann in die Strecken und Schächte ergossen, würden alles mit sich reißen, was sich ihnen in den Weg stellte.
«Wir müssen in den Korb, sofort», brüllte Werner.
Über Tage war der Strom sicherlich nicht ausgefallen, in 90 Sekunden wären sie in Sicherheit, die tausend Meter über ihnen wartete. Er packte Kevin am Kragen, wollte ihn mit sich ziehen, doch der starrte auf den dunklen Schlund des Schachtes.
Kevin riss sich los. «Nicht dahin! Es kommt von oben, nicht aus der Strecke. Im Korb sind wir verloren. Wir müssen in die Kuppel!»
Werner kniff die Augen zusammen. Das Licht seiner Kopflampe reichte gerade bis in den Schacht. An den Wänden lief bereits Wasser in Kaskaden herunter. Kevin hatte recht.
Er hatte sich geirrt, weil er ohne Hörgerät die Richtung, aus der die Geräusche kamen, verdrehte. Der Weg nach oben war abgeschnitten. Im Korb würden sie wie die Ratten ersaufen. Der nächste Fluchtweg war ein Wetterschacht in drei Kilometer Entfernung. Keine Chance zu entkommen. Werner hatte recht behalten. Seine Vorahnung. Sie war eingetreten. Was der Berg vor vierunddreißig Jahren begonnen hatte, würde er heute zu Ende bringen. Der Berg gab nicht auf. Und wenn er ihn schon nicht selbst erledigen konnte, sandte er eben das Wasser.
Plötzlich packte Kevin ihn am Arm und zeigte nach oben. «Der Flaschenzug! Los. Einhaken, den Fuß auf den Schäkel. Die Zugketten bringen uns nach oben. Egal welche. Sie sind miteinander verbunden.»
Werner verstand. Warum war er nicht darauf gekommen? Weil er schon mit seinem Leben abgeschlossen hatte. Aufgegeben hatte. Verdammte Scheiße!
Er riss sich am Riemen, schwor, ab jetzt zu kämpfen. Der Gedanke gab ihm Kraft, er setzte einen Fuß auf den Metallhaken, an dem früher Stahlträger, Balken oder Tröge in die Höhe gezogen worden waren. Er wollte eine Zugkette packen, doch die war zu weit weg. Kevin riss eine Zugkette an sich, sprang auf einen anderen Schäkel und begann zu ziehen. Werner spürte, wie er sich langsam nach oben bewegte. Er hatte Kevin mächtig unterschätzt. Er mochte kein Bergmann sein, ein Kumpel war er ab jetzt auf jeden Fall. Werner klammerte sich fest, die Kette schwang hin und her. Das Rauschen schwoll weiter an, wurde ohrenbetäubend. Kaum hatten sie eineinhalb Meter Höhe erreicht, donnerte die Flut aus dem Schacht in den Füllort. Angsterfüllt sah Werner auf die tosende Wassermasse. Im Kegel seiner Kopflampe schien sie ein lebendiges Wesen.
Kevin stöhnte vor Anstrengung, zog und zog, das Wasser stieg Werner bis zur Hüfte, es war eiskalt, zerrte an ihm, griff nach ihm, drohte ihn mit sich zu reißen. Die Todesangst verlieh ihm die Kraft, sich festzuhalten. Lange würde er nicht durchhalten.
Doch so plötzlich, wie es gekommen war, ließ das Wasser von ihm ab und sank.
Werner kam es vor, als hätte jemand einen Eimer in ein Becken gekippt, es war vollgelaufen, bevor das Wasser durch den Abfluss verschwand. Der bestand hier unten aus zahllosen Strecken und Schächten, niemand wusste genau, wie viele es gab. Es mussten mehr als 60000 sein.
Wadentief blieb die Brühe im Füllort stehen. Kevin stöhnte auf, ließ die Kette los, sie sausten nach unten, platschten ins Wasser, Werner strauchelte, machte sich lang, suchte nach Halt. Was für ein Glück im Unglück, dass der Strom ausgefallen war, sonst wäre er gegrillt worden. Aber er lebte noch. Obwohl der Berg ihm den Garaus hätte machen können.
Was hatte er mit ihm vor? Wollte er ihn noch mehr quälen? Mit ihm spielen wie die Katze mit der Maus? Werner fühlte sich den Naturgewalten ausgeliefert wie noch nie. Natur war gnadenlos.
Er setzte sich auf, saß da wie ein Kind im Sandkasten nach einem Gewitterregen und schüttelte ständig den Kopf. Tonnen von Geröll und Schlamm waren mit dem Wasser in den Füllort geschwemmt worden. Vielleicht war es am besten, nichts mehr zu fühlen, nichts mehr zu denken, nichts zu erinnern.
Nein. Er hatte geschworen, nicht aufzugeben. Was auch immer ihn erwartete, er würde sich dem stellen. Er würde hier wieder rauskommen.
Er tastete nach festem Grund, spürte etwas glattes Rundes, packte es, hielt es sich vor das Gesicht. Aus leeren Augenhöhlen starrte ihn ein Totenschädel an.
Essen-Ruhr-TV, Gegenwart
Jana stand pünktlich auf die Minute in der Lobby des Fernsehsenders «Essen-Ruhr-TV». Sie atmete tief durch, noch immer saß ihr der Schreck in den Gliedern. Nur einen Moment vorher auf der Straße hatte sie geglaubt, jemanden erkannt zu haben. Jemanden, der sie hasste: Gerd Melzer, der sie für den Tod seines Bruders verantwortlich machte. Sie hatte ihn nur von hinten gesehen und sich eingestehen müssen, dass es viele Männer gab, deren Rückansicht der von Gerd Melzer ähnelte. Groß gewachsen, schlank, kurze Haare, den Nacken sorgfältig ausrasiert, Jeans, ein leichter Blouson. Sie kannte ihn nicht gut genug, als dass sie ihn am Gang oder der Körperhaltung hätte erkennen können. Ein- oder zweimal hatte sie ihn gesehen, und immer nur kurz. Sie holte noch mal tief Luft.
Keine Frage, sie war mit dem Kapitel Melzer noch nicht fertig, wenn ihr Unterbewusstsein so sensibel auf eine Ähnlichkeit reagierte, wenn eine Silhouette, die entfernt an Gerd Melzer erinnerte, sie so triggerte. Ganz unberechtigt war ihre Angst nicht, denn er galt als gewaltbereit. Bei der nächsten Supervision würde sie den Fall Melzer erneut besprechen.
Sie versuchte, sich auf das Jetzt zu konzentrieren, betrat die Lobby, trat an den Empfangstresen, lächelte den jungen Mann an, der gerade telefonierte. Er nahm sofort Blickkontakt auf, Jana bemerkte goldene Einsprengsel in seinen braunen Augen.
«Einen Moment bitte», sagte er zu der Person am anderen Ende und hielt eine Hand über die Sprechmuschel.
«Frau Dr. Fäller, schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich sage sofort oben Bescheid. Die Regisseurin wird Sie in einer Minute abholen.» Er tippte auf seiner Telefonanlage herum, dann hörte sie ihn sagen: «Frau Dr. Fäller ist da, Angie. Bis gleich.» Er lächelte. «Sie kommt sofort.»
Jana nickte, machte ein paar Schritte vom Tresen weg, er nahm sein Gespräch wieder auf.
Als sie die Anfrage erhalten hatte, war sie zuerst skeptisch gewesen, doch dann hatte sie eingewilligt, sich in der Sendung «Die Experten» den Fragen der Moderatorin und des Publikums zum Thema forensische Psychiatrie zu stellen. Viele Menschen hatten eine vollkommen falsche Vorstellung von dem Beruf, den Jana voller Leidenschaft ausübte. Wenn sie durch ihren Auftritt bei einigen Zuschauern etwas mehr Interesse für die forensische Psychiatrie wecken konnte, dann hatte sich der Aufwand gelohnt.
Eine Frau um die vierzig kam mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Rundes Gesicht, Lachfalten, Kurzhaarschnitt, schwarze Caprihosen, die gebräunte Unterschenkel zeigten, rote Ballerinas. Jana hätte es nicht gewundert, wenn «Angie» in einem Verein für Rock ’n’ Roll das Tanzbein schwang. Die Statur hätte auf jeden Fall gepasst, schlank, aber nicht dürr, sie wirkte wie eine Leichtathletin.
«Frau Dr. Fäller. Wie schön! Ich darf Sie im Namen von Essen-Ruhr-TV herzlich begrüßen.»
«Das ist sehr freundlich, danke.»
Sie schüttelten sich die Hände.
«Ich bin Angelika Dressler, ich übernehme die Regie heute Abend. Bitte nennen Sie mich Angie.»
Sie führte Jana in die Maske, ein junger Mann sortierte einige Produkte auf dem Schminktisch. Angie setzte sich neben sie.
Wieder blitzte Melzers Bild vor ihrem inneren Auge auf. Er hatte damals keine offenen Drohungen ausgestoßen, dennoch war ihr zugetragen worden, dass er sie am liebsten in der Ruhr ertränkt hätte. Und er ist gewaltbereit, echote es in ihrem Kopf. Sie wusste, wie schmal der Grat zwischen Fantasie und Tat war.
«Wundern Sie sich nicht, dass ich etwas großzügiger nachschminke.» Der Visagist riss sie aus ihren Gedanken. «Handelsübliche Schminke ist nicht gefeit gegen solche Temperaturen. Selbst unsere Klimaanlage kommt im Moment an ihre Grenzen.»
Jana nickte und schloss die Augen, während der Pinsel über ihr Gesicht wanderte. Die Hitzewelle lag seit Tagen über dem Ruhrgebiet, Temperaturen um die fünfunddreißig Grad, kein Wölkchen am Himmel. Für sie war das kein Problem. Wenn es heiß wurde, blühte sie auf. Nur mit der UV-Strahlung hatte sie Schwierigkeiten. Ungeschützt zog sie sich in kürzester Zeit einen Sonnenbrand zu.
«Lassen Sie uns noch mal den Ablauf durchgehen», sagte Angie. «Amira Saleh macht die Anmoderation, dann bittet sie die Expertin auf die Bühne, das sind heute Abend Sie. Amira stellt Fragen zu Ihrer Person und zum Thema. Die haben wir im Vorfeld ja bereits abgeklärt. Dann kommt das Publikum zum Zug. Die Fragen werden vorher abgegeben, damit wir sie filtern können. Dann Abmoderation. Das war’s schon. Haben Sie noch Fragen?»
Jana schüttelte vorsichtig den Kopf, der Visagist brummte kurz, dann trat er zurück. «Fertig, sie kann unter die Lampen.»
Jana schälte sich aus dem Friseurstuhl, dankte dem jungen Mann, Angie ging vor, sie folgte ihr durch den Flur.
Vor Amira Salehs Büro verabschiedete Angie sich. «Ich muss in die Regie, damit auch alles reibungslos klappt.»
Bevor Jana etwas sagen konnte, war sie verschwunden, stattdessen kam die Moderatorin mit einem breiten Lächeln auf sie zu und schüttelte ihr die Hand.
«Frau Dr. Fäller. Ich bin wirklich begeistert, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.»
«Ich danke Ihnen für die Einladung», sagte Jana. «Ich freue mich sehr, es ist mein erster Fernsehauftritt. Eine gute Gelegenheit, meine Arbeit einem größeren Publikum vorzustellen.»
«Wir sind nur ein kleiner Sender, aber wir erreichen jeden Haushalt in NRW. Und wir streamen unsere Sendungen live im Internet. Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles.»
Jana folgte ihr durch noch mehr Flure, sie inspizierten Büros, drei kleinere Aufzeichnungsstudios, Garderoben, Aufenthaltsräume für das Personal, einen Lagerraum für Equipment, das vor allem für Reportagen gedacht war.
Schließlich erreichten sie das Livestudio. Jana hatte sich einen kleinen heißen Raum vorgestellt, in dem zwei Kameras standen, doch das Studio sah eher aus wie ein Theatersaal. Die Bühne maß gut und gerne fünfzig Quadratmeter. In der Mitte war ein Podest aufgebaut, gut einen halben Meter hoch, darauf thronten zwei Ohrensessel, dahinter erstreckte sich eine Projektionswand. Vier fahrbare Kameras, die Jana aus dem Fernsehen von Talkshows kannte, umzingelten die Bühne. Irgendwer musste hier mächtig Geld reinstecken, denn Jana bezweifelte, dass die Werbeeinnahmen eine solche Technik finanzieren konnten, die gut und gerne zwei Millionen gekostet hatte. Drei Frauen und ein Mann waren bereits mit den Hightechgeräten beschäftigt und nahmen von Jana und Amira Saleh keine Notiz.
Vor der Bühne erstreckte sich über die gesamte Breite eine Art Theatergraben, nur nicht so tief, dass ein Orchester darin hätte verschwinden können, sondern hüfthoch. Dahinter erhob sich die Zuschauertribüne, die etwa siebzig Personen Platz bot.
Ein Techniker klemmte ihr mit routinierten Handgriffen das Mikrofon an, die Studiouhr mahnte, dass es Zeit wurde, in die Startposition zu gehen.
Jana nickte Amira Saleh zu und ging von der Bühne, wo sie ein älterer Mann mit Vollbart und Bauch erwartete: der Inspizient, der wie beim Theater dafür sorgte, dass jeder zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
Er verzog keine Miene, deutete nur auf ein weißes Kreuz aus Klebeband auf dem Boden. «Dort stehen bleiben, bis ich Sie reinschicke.»
Jana bezog ihre Position. Von hier hatte sie einen guten Überblick.
«Meute kann rein», sagte der Inspizient in das Mikrofon seines Headsets.
Die ersten Zuschauer strömten ins Studio, sie tuschelten, suchten ihre Plätze, Einweiser kontrollierten die Tickets und wiesen die richtigen Sitze zu. Langsam füllten sich die Ränge. Noch fünf Minuten bis zur Sendung. Jana warf einen Blick auf die Bühne. Sie fühlte ein wenig Lampenfieber. Genug, damit sie voll konzentriert war, aber nicht so viel, dass es sie blockieren würde. Sie lächelte in sich hinein. Sie musste zugeben, dass es ihr gefiel, im Mittelpunkt zu stehen. Sie wandte sich wieder der Tribüne zu, ließ ihren Blick über die Gesichter schweifen, alte und junge Menschen, die sich freudig umsahen und unterhielten. Dann erstarrte sie.
Das konnte nicht wahr sein. Also hatte sie ihn doch erkannt. Gerd Melzer.
Polizeipräsidium Essen, KK 11, Gegenwart
Der Deal mit ihrem Chef war klar gewesen: Elin machte Bereitschaftsdienst, zwölf Stunden von sechs bis sechs, dafür durfte sie, solange nichts dazwischenkam, die Livesendung mit Jana verfolgen. Sie machte es sich am Schreibtisch bequem, lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Dirk war nicht begeistert gewesen, dass sie schon wieder den Abend und die ganze Nacht nicht zu Hause war, aber er wäre nicht ihr Ehemann, hätte er nicht Verständnis gezeigt, ihr eine ruhige Schicht gewünscht und sie zum Abschied geküsst. Nicht so ein Küsschen auf die gespitzten Lippen, sondern voller Leidenschaft, so als wären sie frisch verliebt. Sie seufzte genüsslich, spürte Verlangen nach ihm, aber das musste warten.
Elin schaute Essen-Ruhr-TV regelmäßig, damit sie in der Region auf dem Laufenden blieb. Und weil ihr die Formate gefielen. Vor allem die Livesendung «Die Experten», zu der Jana eingeladen worden war. Damit war ihre Freundin ein echter Promi, zumindest lokal. Wer in dieser Sendung auftrat, den umwehte der Nimbus des Großen.
Jana war eine Koryphäe auf ihrem Gebiet, eine Senkrechtstarterin, der außer ihrer Mutter und ihr, Elin, im Leben nichts wichtiger war als ihr Beruf. Das war nicht immer so gewesen, es hatte mal eine dritte Person gegeben. Tim Harms. Wie es mit ihm stand, konnte Elin nur vermuten. Seit der Trennung war fast ein Jahr vergangen, Jana hatte seinen Namen ihr gegenüber noch ein- oder zweimal erwähnt und sich ansonsten über ihn ausgeschwiegen. Dennoch machte sich Elin Sorgen. Sie musste zugeben, dass sie von Tim anfangs ebenfalls begeistert gewesen war. Sie hätte geschworen, dass er Janas große Liebe ist. Doch sie hatte sich wohl geirrt.
Sie hatte den Stream schon vor einer halben Stunde eingerichtet, konnte es kaum erwarten, dass es losging. Der Bildschirm zeigte die Website des Senders mit dem Slogan «Immer ganz dicht dran – Essen-Ruhr-TV» und einer Uhr, die gerade von zehn Sekunden auf null zählte. Die Uhr löste sich in einem Sturm von Farben auf, aus denen sich das Bild des Studios zusammensetzte.
In der kleinen Küche nebenan klapperte es. «Ich komme gleich», rief Holger, der seit einem Jahr ihr neuer Partner war. Er war ins Team gekommen, fast zur selben Zeit, als sich Jana von Tim Harms getrennt hatte. Holger war eine echte Bereicherung, nachdem sein Vorgänger, ein Kommisskopf und Dickschädel, endlich in Rente gegangen war. Mit fast zwei Metern überragte Holger die meisten Kollegen, er war drahtig, und seine knapp fünfzig Jahre sah man ihm nicht an. Sein volles schwarzes Haar trug er schulterlang, seine Gesichtszüge waren weich, und wenn er grinste, hatte er etwas Lausbubenhaftes. Doch es war niemandem zu raten, ihn zu unterschätzen.
«Bin mal gespannt auf unseren Fernsehstar.»
Elin nickte. «Ich auch. Jana wird das gut machen.»
Bei ihrem ersten Treffen hatten sich Holger und Elin verdutzt angeschaut, denn sie hätten von den Gesichtszügen her Geschwister sein können. Elin hatte ebenfalls schwarze Haare, allerdings fielen sie bei ihr bis unter die Schulterblätter, wenn sie sie nicht zum Zopf hochgebunden hatte. Ihre Augen waren rund und ebenso schwarz wie ihr Haar. Dazu eine schmale Oberlippe und eine volle Unterlippe.
Wo blieb er denn? «Holger, du verpasst die Hälfte!»
Sie waren alleine im Büro, die anderen waren rausgefahren, ein Leichenfund am Rosenhügel. Elin hoffte, dass es die nächste Stunde ruhig bleiben würde, sodass sie wenigstens den größten Teil der Sendung würde anschauen können.
«Komme ja schon.» Holger stellte eine Schüssel mit Erdnussflips vor sie hin und öffnete zwei Flaschen Fassbrause. «Es hat ja noch gar nicht richtig angefangen.»
Sie griff dankbar zu. Als die Anfrage gekommen war und Jana zugesagt hatte, war sie fünfmal so nervös wie ihre Freundin gewesen, die sie nur in den Arm genommen und gesagt hatte: «Ich weiß, du bist die Ältere von uns, auch wenn es nur ein paar Wochen sind, und wie immer willst du mich beschützen. Das wird schon klappen, mach dir keine Sorgen.»
Sie hatten gelacht, und plötzlich war Elin Janas Auftritt nicht mehr ganz so einschüchternd erschienen. Dennoch hatte sie noch immer eine leise Ahnung, dass dieser Abend mit etwas Besonderem aufwarten würde.
Die Moderatorin Amira Saleh erschien, dann schwenkte die Kamera über das wild applaudierende Publikum, um sich schließlich wieder auf die Bühne zu richten.
«Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke schön. Wunderbar, dass Sie hier im Studio sind», sie blickte in die Kamera, «und ich begrüße auch alle Zuschauer vor den Fernsehgeräten und Bildschirmen herzlich. Ich bin Amira Saleh, und ich freue mich auf eine neue Ausgabe von ‹Die Experten›. Heute Abend mit einer ganz besonderen Frau, der Sie möglichst nicht als Gegenstand ihres Berufs begegnen möchten. Ich begrüße Dr. Jana Fäller, forensische Psychiaterin und Psychotherapeutin.»
Wieder donnerte der Applaus, doch nichts geschah. Amira Saleh blickte zur linken Seite, und für einen Sekundenbruchteil huschte ein sorgenvoller Ausdruck über ihr Gesicht, den auch Holger zu erkennen schien. Elin warf ihm einen Blick zu. Was war da los?
Doch bevor sie eine Befürchtung äußern konnte, trat Jana auf die Bühne, stieg auf das Podest, wandte sich dem Publikum zu und deutete eine Verbeugung an. Der Applaus schwoll an, Amira Saleh strahlte über das ganze Gesicht. Kein Wunder. Was für ein Auftritt.
Elin hatte Jana schon oft vor Gericht erlebt, wo sie als Gutachterin ebenfalls im Rampenlicht stand, ihre Gutachten gegen Staatsanwälte und Rechtsanwälte verteidigen und bohrende Fragen beantworten musste. Ihre Präsenz war jedes Mal beeindruckend. Aber der Gerichtssaal war keine Bühne, eine Verhandlung keine Volksbelustigung. Und es waren viel weniger Menschen da. Das hier war etwas ganz anderes.
Jana setzte sich, der Applaus verebbte.
Was immer sie hatte zögern lassen, auf die Bühne zu gehen, es hatte sie nicht davon abgehalten. Doch Elin war klar: Wenn Jana zögerte, dann aus gutem Grund.
«Frau Dr. Fäller.» Amira Saleh griff nach ihren Moderationskarten. «Eine Ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Begutachtung von Straftätern, insbesondere von Gewaltverbrechern, um ihre Schuldfähigkeit festzustellen und einzuschätzen, ob sie wieder straffällig werden. Ist das nicht eine schwierige Aufgabe? Versuchen nicht die meisten, Sie zu täuschen, um ihre Haut zu retten? Und welche Rolle spielt Ihre Einschätzung später?»
«Da reißen Sie ein weites Feld an, das viele Fragen der forensischen Psychiatrie berührt.» Jana sammelte sich einen Moment. «Meine Aufgabe ist es, zu verstehen, warum ein Täter ein Verbrechen begangen hat und ob seiner Tat eine psychische Erkrankung zugrunde liegt. Anhand meiner Erkenntnisse befinde ich ihn für schuldfähig oder eben für schuldunfähig. Dem geht aber ein langer Prozess von Gesprächen voraus, in dem ich mich der Frage aus verschiedenen Richtungen nähere. Dieses Vorgehen so zu durchblicken, dass eine Täuschung möglich wäre, ist für einen Täter sehr schwierig und folglich recht unwahrscheinlich.» Sie machte eine Pause. «Wenn es dann zur Verhandlung kommt, falle ich vor Gericht unter die Rubrik Zeugenbeweis. Das heißt erst mal, dass das Gericht mir glauben kann oder auch nicht, wenn ich meine Einschätzung vorbringe, denn in Deutschland gilt für die Vorsitzenden, also Richter und Richterinnen, die freie Beweiswürdigung. Da das Gericht mich aber in aller Regel beauftragt hat, wird es mein Gutachten als Beweis werten.»
Elin nickte. Ähnlich ging es ihr selbst. Auch sie sammelte Beweise, fügte sie zusammen, stellte den Täter, und der Staatsanwalt vertrat die Anklage vor Gericht. Elin hatte nicht zu urteilen, sondern nur die Fakten zusammenzutragen. In den meisten Fällen war das nicht besonders schwierig, denn die meisten Tötungsdelikte wurden von Menschen begangen, die zu ihrem Opfer eine Beziehung hatten. Die Aufklärungsquote ihrer Abteilung betrug 98,7 Prozent, ein großartiger Wert.
Amira Saleh warf einen kurzen Blick auf ihre Karten. «Sie haben Medizin studiert, approbiert, die Ausbildung zur Fachärztin für Psychiatrie gemacht und sich dann zur forensischen Psychiaterin qualifiziert – in Rekordzeit. Und Sie haben den Eid des Hippokrates geleistet, der besagt, dass es Ihre edelste Pflicht ist, Schaden von Ihren Patienten fernzuhalten, ja, sogar alles zu tun, um sie zu heilen. Wenn Sie aber jemanden in den Maßregelvollzug schicken, ist das doch das Gegenteil?»
Jana überlegte einen Moment.
«Als forensische Psychiaterin muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich im Auftrag des Gerichts handele, das wiederum ein gesellschaftliches Instrument ist. Hier geht es nicht nur um Wohl und Schaden des Angeklagten, sondern ebenso um Wohl und Schaden der Gesellschaft. Ich muss die Regeln der Strafprozessordnung einhalten, mich an die Gesetze halten, wie alle anderen auch. Dabei sehe ich mich als Werkzeug des Rechtsstaates, der wiederum dem Angeklagten gerecht werden will, indem er fragt: ‹Ist der Angeklagte schuldfähig oder nicht?› Da ich nicht die letzte Entscheidung darüber treffe, sondern das Gericht, hätte ich nur dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich mein Gutachten nicht nach bestem Wissen und Gewissen anfertigen würde.»
Elins Handy meldete sich mit den ersten Takten von «It’s all over now», dem Klingelton, den sie für die Zentrale eingestellt hatte. Der gemütliche Teil des Abends war vorbei. Wenn die Zentrale anrief, dann gab es Arbeit. Sie stellte auf laut, damit Holger mithören konnte.
«KHK Elin Akay, was gibt’s, Kollegen?»
Eine junge Frauenstimme antwortete. «Schacht Ludwig V, ein Bergmann hat auf Sohle sieben eine Leiche mit Kopfschuss gefunden. Rettungsmannschaften sind vor Ort, vorher hat es ein Beben und einen Wassereinbruch gegeben. Der Finder und sein Kumpel sind unverletzt. Spusi ist angefordert, psychologischer Dienst ebenfalls, Sonderrechte frei.»
Elin schluckte. Das waren klare Informationen, die sie nüchtern verarbeiten konnte, bis auf eine. Sohle sieben. Tausend Meter unter der Erde. In zweihundert Meter Höhe über eine Planke zu balancieren war kein Problem für sie, aber wenn es in einen Schacht ging oder eine Höhle oder irgendeinen engen Raum, dann wurde ihr mulmig. Aber Deal war Deal. Sie hatte Bereitschaft und musste übernehmen.
Sie räusperte sich. «Alles klar, sind unterwegs.»
Sie legte auf, Holger hielt ihren grauen Blazer in der Hand, den sie überzog, obwohl es eine tropische Nacht war. Die weiße Bluse hätte ausgereicht, es ging nur darum, die Dienstwaffe zu verdecken und einen professionellen Eindruck zu machen. Sie mochte es nicht, dass die Leute sie anstarrten, wenn sie an ihrer Hüfte sichtbar die Walter P99 trug, die nicht gerade zierlich war.
Sie schloss mit großem Bedauern den Stream, Jana antwortete gerade auf eine weitere Frage von Amira Saleh, es schien um etwas Heiteres zu gehen, denn beide lachten. Plötzlich, im letzten Moment, bevor das Fenster verschwand, erstarb Janas Lachen. Elin hielt inne. Was war los? Mist, sie musste abrücken, aber viel lieber hätte sie gewusst, was da passierte. Sobald sie Zeit hatte, würde sie Jana anrufen. Es konnte ja nichts Ernsthaftes sein, sagte sie sich, es gab keinen Grund, sich Sorgen zu machen.
Holger griff nach dem Autoschlüssel für ein unauffälliges Familienauto, allerdings mit einem deutlich stärkeren Motor unter der Haube, der den Wagen auf 240 Kilometer pro Stunde beschleunigen konnte. Sie ließ Holger fahren, er war eindeutig der bessere Fahrer, sein Hobby waren Rallyes. Sie schaltete das Blaulicht ein, die Sirene würden sie an Kreuzungen hinzunehmen oder wenn vor ihnen jemand das Blaulicht nicht bemerkte. Holger gab Gas, der Wagen schoss los, und obwohl ihr Partner mit fast 140 über die Alfred-Straße heizte, blieb sie vollkommen ruhig. Es waren nicht viele Autos unterwegs, und die Fahrer machten Platz. Sie brauchten knapp fünf Minuten bis zum Schacht V der Zeche Ludwig.
«Die bauen dort unten ein neues Besucherbergwerk», sagte Holger düster. «Mit allem Drum und Dran, eine Erlebniswelt Bergbau, sogar Maschinen sollen wieder in Betrieb gehen.» Er schüttelte den Kopf und bog auf den geräumigen Parkplatz ein, der mit einem guten Dutzend Einsatzfahrzeugen aller Art noch lange nicht zugestellt war. Krankenwagen, THW, Entstördienst der Stadtwerke, RAG-Transporter, Polizei und Feuerwehr. «Das Ganze erinnert mich an Jurassic Park. Das ist auch schiefgegangen. So ein Berg ist kein Freizeitpark.»
Da konnte Elin nur zustimmen. Die Kräfte, die im Berg wirksam wurden, waren gigantisch und letztendlich nicht beherrschbar. Es war die Kraft des ganzen Planeten, die die ungeheuren Massen des Gesteins in seine Mitte zog und immer versuchte, jeden Hohlraum zu schließen. Allein deshalb wollte sie nicht hinab in die Unterwelt der Kohle.
«Das sehe ich genauso», sagte sie, öffnete die Tür und stieg aus, Holger warf ihr den Schlüssel zu, sie verriegelte den Wagen.
Holger folgte ihr zur Absperrung, die Kollegen von der Streife hatten weiträumig Flatterband gespannt, rund um alle Tagesanlagen, Weißkaue und Schwarzkaue, Kantine, Förderturm und Maschinenhaus. Gut so, denn es war nur eine Frage der Zeit, bis es hier von Schaulustigen wimmeln würde. Sie zückten ihre Ausweise, ein Uniformierter winkte sie durch und zeigte auf einen großen Mann um die fünfzig in der Uniform des THW. Sein Dienstzeichen wies ihn als Zugführer aus, sein Namensschild als Peter Raczek. Elin reichte ihm die Hand.
«KHK Elin Akay, KK 11.» Sie zeigte auf Holger. «Mein Kollege KOK Sieburg. Wie ist der Stand?»
Raczek stellte sich vor, wischte sich mit dem Ärmel Schweiß von der Stirn. «Wassereinbruch auf Sohle sieben. Der Füllort ist komplett überspült worden, die zwei Bergmänner, die unten waren, haben sich mit einem Flaschenzug gerettet. Beide sind geborgen und in Sicherheit. Der eine ist ganz schön durch den Wind, der hat den Schädel aus dem Wasser gefischt.»
«Schädel?» Elin hatte mit einer Leiche gerechnet, die vor Kurzem umgekommen war, aber das klang, als habe der Tote schon lange dort unten gelegen.
«Ja, ein Schädel. Blitzblank. Der andere Bergmann ist ziemlich gut drauf, wie auf Drogen, schließlich hat er sich und den anderen gerettet. Und das bei seiner ersten Seilfahrt. Ein Frischling. Das erste Mal unter Tage.» Er sah zum Eingang hinüber. «Wir haben den Schacht mit den Spezialisten von der RAG schnell wieder in Betrieb gehabt, die Schäden halten sich in Grenzen. Sie können also einfahren und den Tatort besichtigen.»
Elins schwache Hoffnung, dass der Füllort nicht zugänglich sein könnte, löste sich in Luft auf. Vielleicht konnte Holger den Tatort ja alleine begutachten, und sie kümmerte sich um den ganzen anderen Kram. Nein, sie wusste selbst, dass sie mit da runtermusste. Elin seufzte. Zwar graute ihr vor der Fahrt in dem rasselnden Metallkasten und den Hunderttausenden Tonnen Gestein über ihrem Kopf, aber weggelaufen war sie noch nie. Das würde sich auch heute nicht ändern. Sie musste damit klarkommen, ganz einfach.
Sie setzte ein Lächeln auf. «Großartig, Herr Raczek. Ihr seid wirklich eine tolle Mannschaft!»
Er schmunzelte. «Fast schon eine Frauschaft. Wir haben vier Ladys im Zug, und die sind knallhart. Die beißen sich mit den Zähnen durch den Berg, wenn es sein muss.»
Elin hob anerkennend die Brauen. Das waren ja ganz neue Töne. «Dann richten Sie den Mädels aus, dass ich sie sehr bewundere.»
«Mach ich, Frau Kommissarin.» Er deutete mit dem Daumen hinter sich. «Da geht’s zum Aufzug. Wünsche angenehme Fahrt.» Und weg war er.
Holger sah ihm hinterher. «Korrekter Typ. Hätte ich nicht erwartet.»
Elin nickte zustimmend. Sie gab sich einen Ruck und ging auf das Fördergerüst zu. 70 Meter Höhe, Seilscheiben mit einem Durchmesser von siebeneinhalb Metern, Stahlseile, die lang und stark genug waren, Hunderte Menschen über 1200 Meter hinabzulassen und im Gegenzug Hunderte Tonnen Kohle ans Licht zu bringen. Nur Superlative. So groß wie die Angst, die sich in ihr breitmachte. Sie sah vor sich, wie die Konstruktion versagte, die Stahlträger einknickten, sie im Käfig in die Tiefe stürzte und zerschmettert wurde. Die Seile, die allein mehrere Tonnen wogen, würden sie zu Staub zermahlen, wenn sie kurz nach den Käfigen aufschlugen. Nichts würde von ihr übrig bleiben.
«Elin?» Holgers Stimme holte sie ins Leben zurück. «Geht es dir gut?»
Holger wusste einiges von ihr, aber nicht, dass sie unter Klaustrophobie litt. Niemand wusste das. Außer Jana.
«Ja, alles gut.»
Sie musste in den Käfig. Vorher galt es, die Bergmannskleidung anzulegen, was sich als schwierig erwies, denn selbst die kleinste Größe war für Elin deutlich zu groß. Sie sah aus wie in einem Comic. Mit einem düsteren Blick bedeutete sie Holger, bloß nicht zu lachen. Er biss sich auf die Lippe und blieb ernst, doch seine Augen verrieten ihn.
Der Fahrsteiger prüfte ihre Ausrüstung, achtete darauf, dass sie nichts bei sich trugen, das Funken erzeugen konnte. Dann gab er das Zeichen, fünf Glockentöne. Elin lehnte sich gegen das kalte Metall des riesigen Käfigs. Die Türen schlossen sich mit einem rasselnden Geräusch, das nur der Hölle entspringen konnte. Ich liebe dich, Dirk, dachte sie. Dann sackte der Boden unter ihren Füßen weg, ihr Magen hob sich, sie konnte nur schwer atmen, ihre Kehle schnürte sich zu. Ihre Hände schmerzten, so fest klammerte sie sich an eine Strebe des Käfigs. Dann, so plötzlich, wie er hochgestiegen war, sackte ihr Magen zurück in den Bauch, der Käfig stoppte mit einem Ruck, der sie fast von den Füßen holte. Das Gitter wurde aufgezogen, vier Männer der Grubenwehr, an ihrer Ausrüstung mit dem schweren Atemgerät zu erkennen, standen in einem gewaltigen Raum, der Elin an eine Kathedrale erinnerte. Der Füllort. Eine Frau in Bergmannskleidung wandte sich ihr zu. Sie verlor keine Zeit mit Formalitäten.
«Wären Sie so gut herauszukommen? Sie sind Elin Akay, nicht wahr? Und Holger Sieburg? Kripo, nicht wahr? Man hat Sie angekündigt. Ich wäre froh, wenn wir keine Zeit verlieren würden. Hier kann es jederzeit wieder beben. Der ganze Berg ist wackelig. Ein Pudding mit Löchern wie ein Schweizer Käse.» Sie lachte kehlig.
Elin fuhr erneut der Schreck in die Glieder. «Schweizer Käse?» Sie musste sich einen Moment sammeln. «Aber Peter Raczek, der Mann vom THW, hat doch gesagt, die Schäden halten sich in Grenzen …»
«Das ist korrekt. Aber das heißt nicht, dass hier alles vollkommen stabil ist.»
«Aber dann dürfte doch niemand hier unten sein?» Elin hörte ihre eigene Stimme krächzen.
«Geht nicht anders. Wir stabilisieren gerade die Strecke, aus der das Wasser eingebrochen ist. Und Sie müssen doch den Tatort inspizieren? Deshalb haben wir uns beeilt.» Sie kniff die Augen zusammen, musterte Elin. «Ach du je, ich verstehe. Ihre erste Seilfahrt. Sorry, es wird schon nichts passieren. Entspannen Sie sich.» Sie reichte ihr die Hand. «Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Sie sind nicht die Erste, der hier unten anders wird.» Sie schaute Holger an. «Ihr Kollege scheint ja keine Probleme zu haben.»
«Ich war schon öfter unter Tage», sagte Holger ernst. «Mein Vater war Bergmann. Obersteiger. Er wollte, dass ich in seine Fußstapfen trete. Für mich war das aber nichts.»
Elin schämte sich. Sie kam sich vor wie ein dummes Landei, dem die Bergmannskultur völlig fremd war. Entschlossen nahm sie die Hand der Bergfrau und trat in den Füllort. Sie atmete tief durch. Das half. Endlich war sie in der Lage, sich das Chaos zu ihren Füßen genauer anzusehen.
Der Füllort war mit grellen Scheinwerfern bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet und übersät mit Geröll, das zum Teil in knöcheltiefem Schlamm steckte. Mittendrin standen drei Personen in weißen Overalls. Eine von ihnen überragte die anderen. Elin hatte angenommen, die Spusi sei noch nicht vor Ort, anscheinend hatte sie sich getäuscht.
«Darf ich Ihren Namen erfahren?», fragte sie die Bergfrau.
«Ich bin Edith.»
«Vielen Dank, Edith.» Sie nickte ihr zu, stapfte zu den dreien in Weiß, einer drehte sich um. Elin hob erstaunt die Augenbrauen. Doch nicht die Spusi.
«Professor Lüderitz! Wie kommen Sie denn hierher?»
«Auf demselben furchtbaren Weg wie Sie, Frau Akay. Ich habe schon einiges mitgemacht, aber das war wirklich eine Höllenfahrt.»
Ein kleiner Trost, dass sie nicht die Einzige war, die auf eine Seilfahrt gut verzichten konnte. «Das meinte ich nicht, aber Sie haben natürlich recht. Wie kann man so etwas jeden Tag ertragen?» Sie reichte Lüderitz die Hand. «Wer hat Sie angefordert?»
Langsam wich ihre Übelkeit der Neugier. Wenn Professor Lüderitz als Erster an einem Tatort auftauchte, dann musste es etwas Spektakuläres geben. Er war einer der renommiertesten forensischen Anthropologen und hatte schon bei der Opferidentifizierung der Massaker im Balkankrieg und von 9/11 teilgenommen. Außerdem war er der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Uniklinik Essen. Jetzt war sein Gesicht bis auf die Augen von einer Maske verdeckt, doch an denen hatte Elin ihn erkannt. Sie waren stahlgrau, das linke mit schwarzen Einsprengseln, die ein Pentagramm ergaben.
«Der Bergdirektor hat mich alarmiert, als er gehört hat, dass ein Grubenunglück geschehen ist. Er hat wohl mit einer erheblichen Anzahl von Opfern gerechnet.»
«Aber es waren doch nur zwei Bergmänner vor Ort.»
«Richtig. Und eine ganze Reihe Skelette.» Er wies auf zwei Klapptische, die mitten in dem Trümmerfeld standen. Elin erkannte Kunststoffboxen, in denen Knochen lagen, und das Werkzeug eines Archäologen, Spatel, Pinsel, eine Reihe Hämmer, von Haushaltsgröße bis Steinmetz. Da war was im Gange.
Sie sah sich um. «Eine ganze Reihe? Es war die Rede von einem Schädel.»
«So sah es am Anfang aus. Der Bergmann hat einen Schädel gefunden, mit Einschussloch. Deshalb sind Sie hier. Das ist schon seltsam genug. Aber dann haben wir weitere Knochen gefunden, auch Schädel. Es werden immer mehr. Wir sind bei Nummer zwölf. Und deshalb bin ich hier. Dämmert Ihnen etwas?»
Elin spürte ein Ziehen im Magen. Konnte das wirklich sein?
Holger sprach das Unfassbare aus. «Das Wandernde Dutzend. Zeche Wilhelmshöhe. Das Grubenunglück vom 14.10.1988.» Er war leichenblass geworden. «Wir waren davon ausgegangen, dass die Kumpel zu Staub zerblasen worden sind durch die Schlagwetterexplosion.»
«Zu Staub? Wie kann das sein?», fragte Elin. Sie wusste, wie heftig ein Schlagwetter sein konnte, aber so?
Holger schwieg. Er schien wirklich betroffen, denn üblicherweise fehlten ihm nicht die Worte.
Lüderitz übernahm. «Die Detonation war so zerstörerisch, so stark, dass der Schacht, die Strebe und Stollen erst ein gutes Jahr später zugänglich gemacht werden konnten. Bis auf einen Streb. Der war einfach weg.» Er schüttelte den Kopf. «Mit ihm ein Dutzend Kumpel. Einfach verschwunden.»
«Und jetzt wieder aufgetaucht», sagte Elin. Sie erinnerte sich an ihren Heimat- und Sachkundeunterricht. Jedes Kind, das im Ruhrpott aufgewachsen war, kannte die Zeche Wilhelmshöhe, wusste von der verheerenden Grubengas- und Kohlestaubexplosion, den Geretteten und vor allem den seit mehr als dreißig Jahren vermissten Bergleuten, dem «Wandernden Dutzend im Berg», wie man sie bis heute nannte. Obwohl man keine Überreste gefunden hatte, wollten die Angehörigen und Freunde sie nicht aufgeben. Irgendwo mussten sie sein, irgendwo im Berg, davon waren sie immer überzeugt gewesen. Augenscheinlich zu Recht.
«Wir haben bereits einiges an Bekleidung gefunden, aber wir stehen ganz am Anfang», sagte Lüderitz. «Ich erwarte Verstärkung, Personal und Material. Wir bauen über Tage Zelte auf und schaffen alles nach oben.» Er wies auf den Schutt. «Das Wasser hat den gesamten Abraum in die Strecke gespült. Und die ist gut drei Kilometer lang. Das braucht seine Zeit.»
«Danke, Professor Lüderitz. Kann ich den Schädel mit dem Einschussloch sehen?»
Er winkte sie an den Tisch, hob einen Schädel hoch, schüttelte ihn. Es rasselte.
«Das Geschoss ist im Gewebe stecken geblieben und nicht wieder ausgetreten. Das Gewebe ist natürlich verschwunden. Schätze, Kleinkaliber. 0.22. Der Schuss ging ins Frontalhirn. Vermutlich tödlich, sicher kann ich das aber nicht mehr sagen.» Er schüttelte noch mal. «Klingt wie eine Sparbüchse. Gut, dass das Projektil nicht durch das Foramen magnum entwischt ist.» Er drehte den Schädel und zeigte auf das Loch an der Schädelbasis. «Hier tritt das Rückenmark in den Schädel ein.» Er legte einen Finger daneben. «Schätze, 34 Millimeter.»
Auf den Millimeter genau zu schätzen, so kannte Elin Professor Lüderitz. Ein hervorragender Wissenschaftler, aber sein kühler Blick auf die Welt verstellte ihm öfter das Gefühl für den Respekt vor den Toten. Es war sicherlich nicht seine Absicht, einen Scherz auf Kosten des Opfers zu machen. Er hatte schlicht beschrieben, wie das Geräusch des Geschosses in dem Schädel auf ihn wirkte, und Elin musste ihm recht geben. Ausgesprochen hätte sie es aber niemals.
Eine junge Frau in weißer Schutzkleidung trat an den Tisch. «Professor, verzeihen Sie die Störung, aber ich glaube, das könnte Sie interessieren.»
Lüderitz wandte sich um. «Ich hoffe, es ist etwas Wichtiges.»
«Das denke ich schon», sagte sie und hielt ihm einen weiteren Schädel hin. «Nummer 13.»
Essen-Ruhr-TV, Gegenwart
Jana blickte immer wieder zu Gerd Melzer. Seine Miene war wie zementiert, sie konnte nicht sagen, was in ihm vorging. Flüchtig sah sie zu den Männern und Frauen des Sicherheitsdienstes, die rechts und links der Bühne standen und aufmerksam alles im Blick behielten. Eine Waffe hätte Melzer nicht hereinschmuggeln können, jeder wurde am Eingang so gründlich untersucht wie am Flughafen.
Jana musste konzentriert bleiben, musste das Gefühl der Bedrohung ausblenden. Sie redete sich ein, dass Melzer aus demselben Grund hier war wie alle anderen. Aus Interesse. Es funktionierte, die Vorstellung verdrängte das Gefühl der Bedrohung, das gespeist war aus ihrem schlechten Gewissen und noch etwas, das sie nicht greifen konnte. Etwas, das tief in ihrem Unterbewusstsein steckte.
Amira Saleh machte ihre Sache wirklich gut. Sie fasste zusammen, hakte nach, wo Jana zu unkonkret war, und ergänzte immer wieder die Sicht der Medien auf ihren Beruf. Dadurch gab sie Jana die Möglichkeit, falsche Vorstellungen richtigzustellen, und machte es ihr leicht zu folgen, auch wenn sie nicht ganz bei der Sache war.
«85 Prozent der schweren Gewalttaten werden von Männern verübt», stellte Amira Saleh fest. «Und das liegt an einem Hormon, sagt man: dem Testosteron, über das Männer in Hülle und Fülle verfügen. Sie haben etwa zehnmal mehr Testosteron als Frauen. Wäre das nicht ein Ansatz zur Behandlung von Gewalttätern?»
Jana schüttelte den Kopf. «Ganz klares Nein. Die Annahme, dass Testosteron Aggression und Gewalttätigkeit auslöst, ist nicht haltbar, das ergeben Studien eindeutig. Diese Auffassung entstand durch falsche Logik. Ja, es sind meist Männer, die schwere Gewaltverbrechen begehen, und ja, Männer sind geprägt von diesem Hormon. Also ist das Hormon schuld, denkt man. Ich wäre froh, wenn es so einfach wäre. Doch wie so oft ist das Problem wesentlich vielschichtiger. Soziale Faktoren sind mitentscheidend, ebenso wie Prädispositionen, die genetisch bedingt sind, aber eben nicht zwangsläufig wirksam werden, also nicht unbedingt auch zu einer Persönlichkeit führen, die zu Gewaltverbrechen neigt.»
So ging es noch eine Weile hin und her, schließlich bedankte sich Amira Saleh und eröffnete die Fragerunde des Publikums. Sie zog eine Karte und wollte vorlesen.
In diesem Moment sprang Gerd Melzer auf. «Sie sind eine Mörderin! Sie haben meinen Bruder auf dem Gewissen! Warum werden nicht Sie angeklagt?»
Jana fuhr der Schreck in die Glieder, aber sie hatte sich sofort wieder im Griff. Es war nicht das erste Mal, dass sie mit einem spontanen Gefühlsausbruch konfrontiert wurde. Amira Saleh war blass geworden, sie starrte Melzer an.
Sofort hechteten zwei Sicherheitsleute auf die Tribüne, nahmen Melzer in die Mitte, griffen ihn an den Oberarmen und wollten ihn hinausführen. Melzer wehrte sich, versuchte, sich zu befreien, aber er hatte keine Chance, die Sicherheitsleute verstanden ihr Handwerk. Er gab auf. Auf dem Monitor konnte Jana sehen, dass die Kameras den Zwischenfall einfingen und die Regie die Bilder liveschaltete.
Sie zögerte nur einen Wimpernschlag. «Halt. Warten Sie. Ich werde antworten.»
Amira Saleh sah sie einen Moment erschrocken an, wurde dann wieder professionell. «Ich denke, das ist eine gute Idee. Es wird ein schwerer Vorwurf gegen Sie erhoben, also ist es Ihr gutes Recht, darauf zu antworten.»
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: