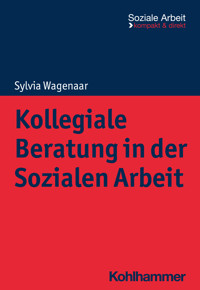
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Kollegiale Beratung spielt in der Sozialen Arbeit eine bedeutsame Rolle. Sie ermöglicht eine strukturierte Reflexion beruflich erlebter Situationen, die die Beteiligten als herausfordernd oder lange nachwirkend erleben. Dabei berücksichtigt sie die Zusammenhänge von Person, Rolle und Organisation. Das Buch stellt Kollegiale Beratung sozialwissenschaftlich fundiert und praxisorientiert vor. Es bereitet die Grundlagen systematisch auf und zeigt, wann und wie Kollegiale Beratung eingesetzt wird. Zudem beschäftigt sich das Buch mit dem Verhältnis zu den benachbarten Formaten Supervision und Coaching sowie der Frage, wie Kollegiale Beratung online funktioniert. Studierenden und Fachkräften wird auf diese Weise ermöglicht, die Chancen Kollegialer Beratung im Arbeitsalltag zu nutzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort der Reihenherausgeber*innen
Zu diesem Buch
1 Was ist Kollegiale Beratung?
1.1 Begriff der Kollegialen Beratung
1.2 Merkmale Kollegialer Beratung
2 Warum und wozu Kollegiale Beratung?
2.1 Allgemeine Ziele
2.2 Kollegiale Beratung als Instrument für Fallverstehen in der Sozialen Arbeit
2.3 Kollegiale Beratung in der Aus- und Weiterbildung
2.4 Kollegiale Beratung als Maßnahme der Personalentwicklung
3 Wie läuft Kollegiale Beratung ab?
4 Wie arbeitet Kollegiale Beratung?
4.1 Fallberatung und ihre zwei Funktionen als Zentrum Kollegialer Beratung
4.2 Wie subjektive Interpretations- und Deutungsmuster dem Verstehen zugänglich gemacht werden
4.3 Ablaufschema als Garant der beiden Funktionen von Fallarbeit
5 Worauf gründet sich Kollegiale Beratung?
5.1 Übertragung bereits vorhandener Therapie- und Beratungsansätze auf Kollegiale Beratung
5.2 Das Forschungsprogramm Subjektive Theorie
5.3 Lerntheorien
6 Wie steht Kollegiale Beratung zu den benachbarten Formaten Supervision und Coaching?
6.1 Kollegiale Beratung und Supervision
Welche Gemeinsamkeiten haben Supervision und Kollegiale Beratung?
Wie lassen sich diese Gemeinsamkeiten erklären?
Wo liegen die Unterschiede und wie stehen die beiden Formate zueinander?
6.2 Kollegiale Beratung und Coaching
Entwicklungsgeschichte des Coachings
Zuständigkeitsanspruch in Abgrenzung zur Supervision
Kollegiale Beratung und Coaching
7 Wie funktioniert Kollegiale Beratung online?
7.1 Kollegiale Beratung in digitalen Settings
7.2 Kollegiale Beratung als textbasierte asynchrone Form
Wie verändert die Asynchronität die Kollegiale Beratung?
Wie verändert die Schriftlichkeit die Kollegiale Beratung?
Literaturverzeichnis
Soziale Arbeit – kompakt & direkt
Herausgegeben von Rudolf Bieker und Heike Niemeyer
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/soziale-arbeit-kompakt-direkt
Die Autorin
Sylvia Wagenaar ist Beraterin in der Zentralen Studien- und Karriereberatung der Universität Oldenburg, freiberufliche Supervisorin (DGSv) und Organisationsberaterin. Von 2017 bis 2022 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Hannover, Forschung im Feld der Beratungswissenschaft, Lehrtätigkeit zu Seelsorge und Beratung. 2013 schloss sie ihren M.A. in Mehrdimensionaler Organisationsberatung an der Universität Kassel mit einer Masterthesis zu Intervision/Kollegialer Beratung ab.
Sylvia Wagenaar
Kollegiale Beratungin der Sozialen Arbeit
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2024
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-042182-0
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-042183-7epub:ISBN 978-3-17-042184-4
Vorwort der Reihenherausgeber*innen
Ergänzend zu klassischen Lehrbüchern geht es in der neuen Reihe »Soziale Arbeit – kompakt & direkt« um die vertiefende Bearbeitung spezieller Themen- und Fragestellungen aus der Sozialen Arbeit und ihren Bezugsdisziplinen, z. B. theoretische Konzepte, spezifische Methoden, Arbeitsfelder oder soziale Probleme. Kompakt und direkt heißt die neue Reihe, weil sie in der Präsentation der Inhalte auf das konzentriert ist, was Lernende über das ausgewählte Thema wissen und für Studienleistungen und Prüfungen zielgenau aufbereiten können sollten.
Zielgruppen der Reihe sind jedoch nicht nur Studierende im Bachelor- oder Masterstudium, sondern auch Berufseinsteiger*innen und Praktiker*innen, die autodidaktisch oder in Fortbildungen Anschluss an den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs halten wollen.
Der fokussierte Zuschnitt der Bände spiegelt sich in einem innovativen Buchformat, das Leser*innen Überschaubarkeit im Umfang und eine gut strukturierte Textpräsentation bietet. Zentrale Sachverhalte werden anhand von Praxisbeispielen und Abbildungen veranschaulicht. Didaktische Elemente wie Begriffserläuterungen, Textcontainer, Reminder, Essentials, kurze Zusammenfassungen, Piktogramme etc. erleichtern das Erfassen, Speichern und Wiederaufrufen der Inhalte.
Die Autor*innen der Bände sind durch ihre wissenschaftliche Expertise ausgewiesen, schreiberfahren und stehen in der Regel mit Studierenden und Praxisfeldern in engem Kontakt.
Rudolf Bieker und Heike Niemeyer, Köln
Zu diesem Buch
In der Sozialen Arbeit ist die Reflexion des beruflichen Handelns zentral. Es gilt ständig, Spannungsfelder wie das von Hilfe und Kontrolle auszubalancieren oder die Beziehungsdynamiken, die zwischen den am Fall beteiligten Systemen und Personen wirken, zu reflektieren. Um diese Qualität der Arbeit gewährleisten zu können, ist eine hoch professionelle Reflexion sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Handelns notwendig. Formate arbeitsbezogener Beratung in Form von Supervision und Kollegialer Beratung, die eine solche Reflexion gewährleisten, gehören daher in vielen Handlungsfeldern Sozialer Arbeit mittlerweile zum Qualitätsstandard. Kollegiale Beratung erfreut sich, seit ihrer Entstehung in den 1970er Jahren, einer wachsenden Aufmerksamkeit. Für die Soziale Arbeit gehört sie mittlerweile »zum verbreiteten Standardrepertoire der ›professionsbezogenen‹ Methoden« (Steffan 2013, 459). Auch in Wissenschaft und Forschung findet sie Beachtung, wie die gestiegene Anzahl an Forschungsarbeiten im Feld zeigt. Verglichen mit Supervision ist diese Aufmerksamkeit dennoch erschreckend gering. Eine Einführung in Kollegiale Beratung ist bisher vor allem durch sogenannte Praxisbücher möglich. Während es für Supervision und Coaching zahlreiche wissenschaftliche Lehrbücher gibt, lässt ein solches für die Kollegiale Beratung bis heute auf sich warten. Da eines der entscheidenden Merkmale Kollegialer Beratung die fehlende Leitung in Form einer*eines externen Expert*in darstellt und das Format dennoch (oder gerade deswegen) den Anspruch hat, Reflexion beruflichen Handelns für Professionelle zu gewährleisten, kann eine (sozial-)wissenschaftlich fundierte Einführung zur Qualitätssicherung in der Sozialen Arbeit beitragen.
Umso schöner, dass die Verleger*innen der Reihe »Soziale Arbeit – kompakt & direkt« diesem Thema mit diesem Buch einen eignen Platz widmen! Das Buch bietet Studierenden und Fachpersonen eine kompakte, aber wissenschaftlich fundierte Einführung zu den Fragen: Was ist Kollegiale Beratung? Warum und wozu Kollegiale Beratung? Wie läuft sie ab? Wie arbeitet sie? Worauf gründet sie sich? Diese Einführung soll zu Klarheit und Struktur beitragen, sodass der verwirrenden Vielfalt an Praxisbüchern und existierenden Ablaufschemata konstruktiver begegnet werden kann und die Qualität der Durchführung, vor allem bezogen auf den kritisch-reflexiven Charakter von Beratung, weiter erhöht wird. Das wird in diesem Werk unter anderem dadurch gewährleistet, dass dem Format konsequent eine fallverstehende Funktion zugewiesen wird. Das heißt, Kollegiale Beratung wird hier stets als Instrument gesehen, das ein tieferes Verständnis der Komplexität des jeweiligen Falles ermöglicht. Auch relevante Wissensbestände zur Abgrenzung zu anderen Formaten wie Supervision und Coaching werden kompakt dargestellt, sodass Ideen entstehen können, welches der Formate wann und in welcher Kombination eingesetzt werden kann. Da Beratung in der Sozialen Arbeit zunehmend auch in digitalen Settings durchgeführt wird, beleuchtet das letzte Kapitel die Frage, ob und wie Kollegiale Beratung online durchgeführt werden kann und wie sich Beratung in Präsenz in diesem speziellen Format von digitaler Beratung unterscheidet.
Sylvia Wagenaar, Aurich im März 2024
1 Was ist Kollegiale Beratung?
T Überblick
In diesem Kapitel erfahren Sie einführend, was unter dem Begriff Kollegiale Beratung zu verstehen ist. Anhand einer Definition werden wichtige Kernmerkmale Kollegialer Beratung näher beschrieben.
1.1 Begriff der Kollegialen Beratung
Im beruflichen Alltag kommt es immer wieder zu Situationen, in denen man sich fragt, wie man die berufliche Rolle in einer schwierigen oder komplexen Situation professionell ausfüllen kann. Das können zum einen Momente sein, in denen Professionelle mit dem Ergebnis des eigenen Agierens unzufrieden sind. Zum anderen kann es sich um Situationen handeln, in denen sie unsicher sind, wie ein der beruflichen Rolle angemessenes Handeln aussehen könnte. Für die Soziale Arbeit kommt noch hinzu, dass die Professionellen in ihrem Handeln die Aufgabe haben, die sich teilweise widersprechenden Erwartungen der Adressat*innen auf der einen, der eigenen Profession auf der anderen und der Gesellschaft/des Staates/der Organisation auf der dritten Seite in einer guten Balance zu halten (vgl. Staub-Bernasconi 2019, 83 ff.). Kolleg*innen aus der eigenen Einrichtung, demselben oder einem ähnlichen Arbeitsfeld bzw. mit derselben fachlichen Qualifikation zu nutzen, um solche Situationen gemeinsam zu reflektieren und sich gegenseitig qualifiziert zu beraten, ist der Grundgedanke der Kollegialen Beratung. Diese Reflexion und Beratung unter Kolleg*innen ist allerdings von einer Tür-und-Angel-Beratung (vgl. Hollstein-Brinkmann & Knab 2016) unter Kolleg*innen oder von einer dyadischen Beratung abzugrenzen.
Tür-und-Angel-Beratung
nennt man Beratungen, die in offenen, uneindeutigen Settings oder Übergangssituationen stattfinden. Bezogen auf Kollegiale Beratung sind damit Situationen gemeint, in denen sich z. B. eine Fachkraft in der Teeküche von einer anderen Fachkraft beraten lässt, ob ihre Ideen, wie sie mit einer schwierigen Familie weiter verfahren will, gut sind.
Dyadische Beratung
Das Wort Dyade steht in der Soziologie für eine intensive Zweierbeziehung. Dyadische Beratung meint also die Beratung zu zweit, in der eine Person von einer anderen beraten wird. Eine Einzelsupervision stellt z. B. ein dyadisches Setting dar.
In der deutschsprachigen Literatur finden sich für Kollegiale Beratung auf der einen Seite viele verschiedene, zum Teil synonym verwendete Begriffe wie kollegiale Supervision, kollegiale Praxisberatung, kollegiale Fallbesprechung oder Intervision (vgl. Lippmann 2013, 10 ff., Schlee 2008, 22), die für sehr ähnliche Konzepte stehen und bestimmte gemeinsame Merkmale aufweisen. Auf der anderen Seite wird der Begriff Kollegiale Beratung für Konzepte mit sehr unterschiedlichen Intentionen verwendet. Die begriffliche Vielfalt ist entstanden, weil aus der Praxis heraus verschiedene Modelle entwickelt wurden, ohne dass eine grundlegende, die verschiedenen Modelle verbindende Konzeption oder Systematik erarbeitet wurde (vgl. Tietze 2010, 24).
Tietzes Forschung zu Kollegialer Beratung leistete 2010 einen längst überfälligen Beitrag, um das Format eindeutig bestimmen und von anderen abgrenzen zu können. Er formuliert eine Definition, die im Wesentlichen mit der einschlägigen deutsch- und englischsprachigen Literatur zur Kollegialen Beratung übereinstimmt:
Definition
»Kollegiale Beratung beschreibt ein Format personenorientierter Beratung, bei dem im Gruppenmodus wechselseitig berufsbezogene Fälle der Teilnehmenden systematisch und ergebnisorientiert reflektiert werden« (Tietze 2010, 24).
1.2 Merkmale Kollegialer Beratung
Die Definition von Tietze entsteht auf der Grundlage von vier definitorischen Kernmerkmalen, die er für das Format der Kollegialen Beratung herausarbeitet.
Ein wesentliches Merkmal ist, dass die Teilnehmenden (1) berufsbezogene Fälle einbringen. Fälle stellen berufliche Ausnahmesituationen dar. Diese entstehen z. B., wenn in der Interaktion mit Adressat*innen, Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen oder Vorgesetzen das eigene Handeln zu deutlich anderen Ergebnissen führt bzw. das Gegenüber auf dieses Handeln deutlich anders reagiert, als die Fachkraft es erwartet hat. Sprich, wenn sich ihr nicht erschließt, wieso sich der Verlauf der Interaktion auf diese, für sie selbst unerwartete Weise entwickelt hat. Das führt häufig dazu, dass die Interaktion bei den Professionellen psychisch nachwirkt, z. B. in Form von kreisenden Gedanken um die erlebte Szene (vgl. Tietze 2010, 26, 67). Die erlebte Situation wird dann in die Beratung eingebracht und dort bearbeitet. Wie in der Supervision liegt der thematische Fokus auch hier auf der Rolle der ratsuchenden Person als Angehörige einer Organisation und ihrem beruflichen Agieren in dieser Rolle. Den Fokus der Beratung bildet eine anwesende einzelne Person mit einem konkreten Anliegen aus ihrem beruflichen Kontext. Es geht also nicht um Beratungen von Teams oder Organisationen und auch nicht um ein allgemeines Arbeitsthema oder ein außerorganisationales, privates Problem.
Praxisbeispiel
Frau XY leitet als Sozialpädagogin die Kindertagesstätte der Matthäuskirchengemeinde in Stadt B. Sie findet es wichtig, dass in einer kirchlichen Kita auch religionspädagogische Angebote durchgeführt werden. Sie bittet die Mitarbeitenden, sich für ihre Gruppen kleine religionspädagogische Projekte auszudenken. Immer wenn sie nachfragt, ob denn schon Ideen entwickelt wurden, bekommt sie von den Mitarbeitenden ausweichende Antworten. Sie wüssten nicht genau, wie sie das machen sollten, hätten keine Idee. Auch wenn Frau XY dann ein paar Anstöße für Ideen gibt und ein paar Wochen später wieder nachfragt, ist in Sachen Projektentwicklung weiterhin nichts passiert. Sie weiß nicht, was sie noch machen soll, damit die Mitarbeitenden endlich den Auftrag umsetzen und mit den Kindern religionspädagogisch arbeiten. Sie ist Mitglied einer Kollegialen Beratungsgruppe und bringt den Fall dort ein. Durch die Beratung wird deutlich, dass es bei den Mitarbeitenden womöglich nicht um Unlust oder Arbeitsverweigerung geht, wie sie vermutet hat, sondern dass Unsicherheit im Umgang mit dem Thema Glaube und Religion und mit den Fragen der Kinder eine Rolle spielen könnten. Frau XY hat nun einen völlig neuen Zugang zu dem Problem und entwickelt schnell Ideen, wie sie weiter vorgehen will.
Ein weiteres Merkmal stellt der (2) Gruppenmodus dar. Kollegiale Beratung findet also immer mit mindestens drei Teilnehmenden statt und grenzt sich damit zu dyadischen Beratungssettings ab. Die Gruppengröße variiert in der Literatur und weist eine Spannbreite von drei bis zwölf Teilnehmenden auf. Da es in der Kollegialen Beratung darum geht, möglichst vielfältige Perspektiven auf das eingebrachte Problem zu entwickeln, steigt die Produktivität mit der Anzahl der Teilnehmenden. Mit steigender Gruppengröße verringert sich aber gleichzeitig sowohl die Möglichkeit der Falleinbringung als auch der Beteiligung an der Gruppeninteraktion für jede*n Einzelne*n. Die Frage nach der Anzahl der Teilnehmenden ist demnach durchaus relevant, weil sie eine Wirkung auf den Beratungs- und Gruppenprozess entfaltet. Bei Überlegungen zur Zusammensetzung einer Gruppe gibt es noch viele weitere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Für die Kollegiale Beratung sind hier vor allem die beiden Dimensionen der Arbeitsfähigkeit in sozialer Hinsicht und der Attraktivität für die einzelnen Mitglieder relevant. Diese beiden Dimensionen können wechselseitig positiven Einfluss aufeinander nehmen. So ist die Sympathie und das Vertrauen gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern elementar, um sich im Rahmen der eigenen Falleinbringung für eine intensive Reflexion der eigenen Denk- und Handlungsmuster öffnen zu können. Die beiden Dimensionen können sich aber auch negativ beeinflussen. So ermöglicht die Heterogenität einer Gruppe vielfältige Perspektiven, kann aber für einzelne Mitglieder weniger attraktiv sein (vgl. ebd., 88 f.).
Praxistipp
Bei der Zusammensetzung der Teilnehmenden kommt es darauf an, möglichen Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit einer Gruppe vorzugreifen und gleichzeitig der Attraktivität einer Konstellation ein erhebliches Gewicht beizumessen. Die Gruppe sollte für die Arbeitsfähigkeit so heterogen zusammengesetzt sein, dass tatsächlich vielfältige Perspektiven entstehen. In einer Gruppe aus Kita-Leitungen könnte das z. B. gewährleistet werden, wenn die Leitungen unterschiedliche berufliche Qualifikationen mitbringen, die einen in der Stadt und die anderen auf dem Land arbeiten, die einen konservativ und die anderen liberal eingestellt sind. Gleichzeitig ist für die Attraktivität darauf zu achten, dass die Personen in ihrer Unterschiedlichkeit noch ein Interesse aneinander und an den Perspektiven der jeweils anderen haben können.
Das Einbringen berufsbezogener Fälle in eine Gruppe weist eine hohe Nähe zur Fallsupervision auf (▸ Kap. 3).
Mit dem nächsten Kernmerkmal, dem der (3) Wechselseitigkeit, entsteht allerdings eine eindeutige Abgrenzung zu dieser Form arbeitsbezogener Beratung. Jede*r Teilnehmende kann falleinbringend oder beratend sein. Die Mitglieder sind somit gleichrangig, auch wenn sie sich von ihrer Qualifikation, ihrer beruflichen Funktion oder ihrem Gehalt her unterscheiden (vgl. Fengler, Sauer & Stawicki 2000, 173). Eine ratsuchende ist gegenüber einer ratgebenden Person bedürftig, sodass zwischen beiden eine Asymmetrie entsteht. Diese wechselt bei dem Format der Kollegialen Beratung fallweise ab, im Gegensatz zur Supervision, die eine feste Rollenverteilungen vorsieht (vgl. Tietze 2010, 27). Damit wird die Möglichkeit gegeben, ein stärkeres und gleichberechtigtes Engagement im Beratungsprozess zu erleben.
»In der Peer-Supervision steht die funktionale Autorität jedes Einzelnen in jeder Sitzung neu auf dem Prüfstand. [...] Wer mit der Arbeit der Peer-Supervision nicht zufrieden ist, kann dies keiner anderen Person anlasten. Er hat die Möglichkeit, die Arbeitsintensität der Gruppe zu erhöhen, oder er kann sie verlassen« (Fengler, Sauer & Stawicki 2000, 174).
Dementsprechend gibt es auch keine Person, die ihre erbrachte Leistung in Rechnung stellen kann. Die Abwesenheit einer Expert*innenautorität kann helfen, Themen freier und offener anzusprechen. Die Leitungslosigkeit bringt aber auch Gefahren mit sich. Eine davon ist das Herausbilden einer informellen Leitung. Wenn ein einzelnes Gruppenmitglied Gespräche aktiv lenkt und kontrolliert, kann es damit mehr und mehr eine solche Rolle übernehmen. Für den Beratungsprozess der Kollegialen Beratung ist deshalb ein Schema entwickelt worden, das unterschiedliche Rollen vorsieht. Diese werden stets wechselnd besetzt. Die Rolle der Moderation hat z. B. die Aufgabe für das Einhalten der einzelnen Beratungsschritte zu sorgen und durch ihre moderierende Tätigkeit das Herausbilden einer informellen Leitung zu verhindern (vgl. Tietze 2010, 91 f.). Eine weitere Gefahr des Prinzips der Leitungslosigkeit stellt das Wegdriften vom Beratungsprozess dar, hin zu therapieähnlichem Arbeiten oder zu Alltagsgesprächen.
Exkurs: Abgrenzung von Beratung zu Therapie und Alltagsgesprächen
Beratung stellt eine Unterbrechung des Handlungs- und Entscheidungsflusses im Alltag dar. Sie dient der Entscheidungshilfe bei einem aktuellen oder sogar akuten Problem. Ziel von Beratung ist es, zu selbstbestimmter Lebenspraxis zu verhelfen.
In der Therapie geht es um die Heilung einer seelischen Erkrankung. Die Identität einer Person ist beschädigt und soll im therapeutischen Prozess wiederhergestellt werden. Während Beratung dialogisch stattfindet und mit der ratsuchenden Person gemeinsam Interpretationen erarbeitet werden, liegt die Deutungsmacht in der Therapie einseitig bei dem*der Therapeut*in.
Beratung in Alltagsgesprächen findet z. B. zwischen Freund*innen, Verwandten, Arbeitskolleg*innen oder Nachbar*innen statt. Der Zufall spielt eine große Rolle, z. B. in der Frage, wie zugehört oder nachgefragt wird, wie verbindlich oder intensiv die Beratung stattfindet. Beratung grenzt sich vom Alltagsrat ab, indem sie keine vorschnellen Ratschläge oder oberflächlichen Interpretationen liefert.
Deshalb ist (4) die feste Ablaufsystematik (▸ Kap. 3) als weiteres Kernmerkmal Kollegialer Beratung wichtig, da diese eine ergebnisorientierte Reflexion gewährleistet und den komplexen Beratungsprozess in übersichtliche Phasen gliedert.





























