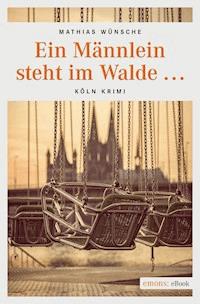Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Köln-Krimi
- Sprache: Deutsch
Als die fünfzehnjährige Schülerin Leonie spurlos verschwindet, macht sich die junge Lehrerin Marie auf die Suche nach dem Mädchen. Dabei wird sie nicht nur von den schmerzhaften Erinnerungen an ihre eigene Kindheit, sondern auch von einem Schatten verfolgt. Das unheimliche Phantom gibt vor, Marie zu beschützen. Und ist bereit, dafür zu töten ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Mathias Wünsche wurde 1957 in Köln geboren. Nach dem Studium der Sozialpädagogik arbeitet er heute seit über zwanzig Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe in Köln. Neben seiner Autorentätigkeit ist er erfolgreich als Musiker und Komponist unterwegs. Bei Emons ist bereits sein Kinderkrimi »Die Südstadtdetektive« erschienen. Mehr Informationen über den Autor unter www.mathiaswuensche.de.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Cirsten Gülker Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-447-4 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Cirsten
Prolog
»Du lässt mir keine Wahl. Ich habe dir ein mehr als großzügiges Angebot gemacht, aber du willst es ja nicht annehmen. So zwingst du mich, zu anderen Mitteln zu greifen. Schade, ich hätte es bevorzugt, wenn du mich freiwillig begleitest.«
Wie hypnotisiert starrt sie auf das Taschentuch in seiner Hand, das sich nun ihrem Gesicht nähert, dabei groß und größer wird, und sie vernimmt den Schrei, der über ihre Lippen kommt. Marie bemerkt den verunsicherten Ausdruck in seinen Augen, als sie sich aufbäumt, auf die Füße springt und ihm beinahe gleichzeitig einen Tritt zwischen die Beine verpasst. Sie hat all ihre Wut und ihre ganze Kraft in diesen Angriff gelegt und sieht nun, wie die Tränen über sein schmerzverzerrtes Gesicht rinnen.
Du musst weg von ihm!, drängt die innere Stimme, du musst dich von ihm befreien … endgültig! Marie läuft los. Der Revolver! Sie springt über die Blutlache. Du musst an den Revolver! Sie hält inne, dreht den Kopf, sieht ihn gekrümmt am Boden liegen und entscheidet sich für die Treppe. Gegen die Flucht aus dem Haus. Entschlossen läuft sie die ersten beiden Stufen empor, schaut über die Schulter, sieht, wie er sich mühsam aufrappelt.
Schwankend schaut er sich um, und ihr wird heiß, als er sie entdeckt. Sein getrübter Blick trifft sie und wirkt auf eine für sie unerklärbare Weise sehnsüchtig. Sie schüttelt den Kopf. Nein, sie will und darf sich jetzt nicht aufhalten lassen. Sie schnellt herum, rennt die Treppenstufen weiter hoch, entflieht seinem Blick. Doch schon hört sie seinen schleppenden Schritt auf dem unteren Treppenabsatz.
Mit Wucht stößt Marie die Tür auf, dabei verliert sie fast das Gleichgewicht, und stolpert in das Schlafzimmer ihrer Eltern. Keuchend wirbelt sie herum, bekommt die Tür zu fassen und wirft sie zu. Ihre Finger suchen im Halbdunkel den Schlüssel im Schloss. Das klackende Geräusch beim Umdrehen beruhigt sie.
Seine Fäuste hämmern gegen die massive Eichentür.
»Marie, verflucht, was soll das?« Beschwörend dringt seine Stimme zu ihr. »Mach auf! Was soll dieses alberne Spielchen? Das hältst du doch keine Stunde durch. Du bist ein seelisches Wrack. Marie – vergiss nicht, ich weiß alles über dich. Ich kenne dich, Marie!«
»Nein, das tust du nicht! Gar nichts weißt du über mich, rein gar nichts«, sagt sie leise, während sie die Patronen in die Trommel drückt.
1
Freitag, 7.12.
Wer die Wahl hat, hat die Qual! Er lacht. Es ist ein helles Lachen. Marie schüttelt unmerklich den Kopf. Nein, nicht jetzt!
Wer die Wahl hat, hat die Qual! Seine Stimme ist sanft. Nichts Bedrohliches liegt in ihr. Nein, ich will jetzt nicht! Schroff zieht sie die Ärmel ihres Pullovers bis über die Handrücken herunter. Sie ballt die Fäuste. Die Finger halten den Ärmelbund fest, und sie spürt, wie sich die Nägel in ihr Fleisch drücken.
»Da, sie tut es wieder!« Wie aus der Ferne dringt das Getuschel an ihr Ohr.
Oh, sie hört sie. Sie hört sie immer. Die Stimmen der Schüler und wie sie sich über sie lustig machen. Sie zwingt sich dazu, ihre Augen zu öffnen. Bläuliches Flimmern. Blinzelnd kämpfen ihre Lider gegen das Neonlicht an.
Wie sie da sitzen, hinter ihren Pulten, wie sie starren und dabei ihre Mundwinkel verziehen. Unverschämt grinsend. Egal.
Marie dreht den Kopf und blickt aus dem Fenster. Schwere, dunkle Wolken ziehen träge vorbei. Es wird Regen geben. Ohne ihren Blick abzuwenden, erhebt sie sich von ihrem Platz, geht auf das Fenster zu und öffnet es. Begierig zieht sie die feucht-kühle Luft in sich hinein. Der Winter ist nah, denkt sie. Die Blumen! Ich muss an die Blumen denken! Die roten und die gelben Rosen. Die bringen Farbe ins Haus.
Hinter ihrem Rücken vernimmt sie ihren Namen.
»Frau Fredehoff, ich verstehe die Aufgabe sechs nicht«, sagt die Stimme ungefragt zu ihr.
Sie dreht sich um, löst sich zwei Schritte vom Fenster, bleibt stehen, senkt den Kopf und schaut in das rotwangige Gesicht der Schülerin.
»Was ist das Problem, Leonie?«
»Hier steht:«, antwortet das Mädchen, »›Löse folgende Gleichung/Ungleichung für G N und gib die Lösungsmenge an‹.«
»Ja, und was ist daran nicht zu verstehen?«
»Ich … ich weiß nicht mehr, wie man das rechnet.«
Ach Leonie, schau mich doch nicht so an! Was erwartest du von mir?
»Da kann ich dir leider nicht helfen«, antwortet sie, »wir haben doch genau diesen Stoff in den letzten Wochen gründlich durchgenommen.«
Die Schulklingel ertönt. Die Schülerin weint.
»Komm Leonie, die Zeit ist um, und ich muss die Hefte einsammeln. Es tut mir leid, aber ich kann da keine Ausnahme machen.«
Johlend und schubsend strömen die Jugendlichen aus der Klasse. Nur das Mädchen mit den verheulten Augen nicht. Es sitzt nach wie vor auf seinem Stuhl. Still wartend. Marie denkt an den Einkauf, während sie die Hefte in ihre Tasche packt.
Morgen ist Samstag. Die Blumen, sie darf die Blumen nicht vergessen. Er liebte Blumen.
Er sagte immer: Die Blume ist ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Dann machte er jedes Mal eine kleine Pause und flüsterte ihnen zu: Ihr seid meine Blumen.
Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Rasch nimmt sie ihren Mantel und legt ihn sich über den Arm.
»Bitte, ich …« Oh Leonie, was willst du denn noch? Bereits an der Tür stehend, dreht sie sich zu ihr um und sieht sie fragend an.
»Ich … ich trau mich nicht nach Hause«, schluchzt die Schülerin. »Meine Eltern werden mich fragen, wie die Mathearbeit gelaufen ist. Was soll ich ihnen sagen? Wenn ich hängen bleibe, bringt mein Vater mich um«, ihre Stimme ist kaum zu verstehen.
Unschlüssig verharrt Marie an der Tür. Sie spürt einen Anflug von Zorn in sich aufsteigen. Ja, sie erinnert sich nur zu gut an Leonies Vater, neulich beim Elternsprechtag. Hat erlebt, wie aufbrausend er sein kann, weil er befürchtet, dass seine Tochter eine Fünf in Mathematik auf dem Zeugnis bekommen wird. Reflexartig hatte sie seine Hand abgewehrt, bevor diese Leonie treffen konnte.
»Mensch, Leonie, warum hast du dich denn nicht besser vorbereitet? Du wusstest doch, dass die Arbeit heute geschrieben wurde. Was soll ich anderes denken, als dass du eben nicht genügend gelernt hast?«
Leonie hebt den Kopf. Ihr verschwommener Blick saugt sich an Marie fest.
»Hab ich wohl!«, ruft sie trotzig, um im gleichen Moment ihre Lautstärke zu dämpfen, so als ob sie selbst darüber erschrocken sei.
»Hab ich wohl«, wiederholt sie leise, ohne aber die Augen von ihr zu nehmen. »Ich lerne und lerne, aber kapiere rein gar nichts. Ich bin wohl einfach zu blöd.«
Verflucht, ich muss los! Der Einkauf für das Wochenende, für sich und für Emma. Marie hatte ihr heute früh noch zugesichert, dass sie an das Futter für den alten Watson denken wird. Ja stimmt, beim letzten Mal hatte sie es vergessen. Aber nur weil es wieder so verdammt voll im Supermarkt war. Sie hasst dieses Gedränge. Und ja, wahrscheinlich auch, weil sie ihre Tabletten nicht genommen hatte. Oje, die Blumen! Sie kann unmöglich ohne Blumen nach Hause kommen. Widerstrebend geht sie ein paar Schritte auf das Mädchen zu.
Es gibt Arbeitsgemeinschaften, hört Marie sich sagen, warum sie sich nicht mit anderen zusammentue.
Leonie antwortet nicht. Sie schaut nur, mit einem Ausdruck, den sie nicht deuten kann.
»Vergessen Sie es!«, schleudert sie ihr schließlich entgegen und wendet sich abrupt ab.
Mit fahrigen Handbewegungen nimmt sie ihre Materialien vom Pult und verstaut sie in ihrem Rucksack.
»Warum sind Sie so?« Der Ton ihrer Stimme klingt im Raum nach. Und bleibt. Bleibt auch noch, nachdem die Schülerin die Klasse verlassen hat.
Was meint sie damit? Nachdenklich verlässt Marie ebenfalls den Klassenraum.
Wie bin ich denn? Wie soll ich denn sein? Was für eine Frage. Gestellt von einem fünfzehnjährigen Mädchen.
Das gleichmäßige Klacken ihrer Absätze auf dem Linoleumboden beruhigt sie. Alles ist wie gewohnt. Der Geruch, der typische Geruch. Schulgebäude haben schon immer so gerochen. Und die Beleuchtung, bläuliches Decken-Neonlicht. Neonlicht wirft keine Schatten.
Sie geht zügig den langen Flur entlang, vorbei an den geöffneten Türen. Die Räume dahinter verwaist. Stühle stehen auf Tischen. Es ist Freitag, der Unterricht ist zu Ende und die Kollegen schon auf dem Weg nach Hause.
Sie schiebt im Gehen den Ärmel ihres Pullovers hoch und schaut auf die Uhr. Gleich halb vier und schon wieder frische Schnitte auf dem Unterarm.
Oh, ich muss mich beeilen, das Mädchen hat mich viel zu viel Zeit gekostet. Der Blumenhändler hat nach vier keine Rosen mehr. Keine gelben, keine roten. »Rosen verkaufen sich wie geschnitten Brot«, sagt der Blumenhändler immer und lacht dann jedes Mal laut. Sie mag sein Lachen nicht. Es klingt schmutzig und anzüglich. Anzüglich sind auch seine Bemerkungen. Aber sie hat keine Wahl. Natürlich könnte sie die Rosen woanders kaufen, aber das Blumengeschäft liegt auf ihrem Nachhauseweg und zudem direkt gegenüber dem Supermarkt. Sie geht gerne dorthin, weil sie weiß, wo alles ist, und keine Zeit mit Suchen vergeuden muss. Und überhaupt: Sie lässt sich doch von einem Macho nicht von ihren Gewohnheiten abbringen.
Sie drückt die Glastür auf und tritt ins Freie. Der Regen hat bereits eingesetzt. Ohne zu zögern, läuft sie los, auf ihr Auto zu, das noch als einziges auf dem Parkplatz steht. Ein paar Jugendliche auf Motorrollern drehen trotz des Regens ihre Runden. Schnell holt sie die Wagenschlüssel aus der Manteltasche, öffnet die Tür, schmeißt Tasche und Mantel auf den Beifahrersitz und setzt sich hinter das Steuer. Sie lässt die Füße Kupplung und Bremse treten, startet den Motor, schaltet die Scheinwerfer an und den Scheibenwischer.
Ein Schatten! Marie dreht ihren Kopf zur Seite. Verdammt! Wo kommst du denn so plötzlich her?
Der Regen wird stärker und prasselt sein Stakkato auf das Wagenblech. Die langen Haare kleben Leonie im Gesicht. Sie steht einfach nur da. An der Fahrertür. Regungslos.
Was soll das Ganze? Sekunden vergehen. Schließlich lässt Marie die Scheibe herunterfahren. Augenblicklich fallen unzählige Regentropfen ins Innere und hinterlassen nasse Flecken auf ihrem Pullover.
Das Mädchen löst sich von der Stelle und tritt an die Wagentür.
»Hier, für Sie!«, sagt sie und wirft ihr ein zusammengefaltetes Stück Papier in den Schoß. Maries Hände fassen danach, es fühlt sich feucht an, sie will etwas sagen, doch das Mädchen hat sich bereits umgedreht und läuft davon.
Ich werde zu spät kommen.
Hastig stopft sie das Papier in die Innentasche ihres Mantels und lässt die Scheibe wieder hochfahren. Wenig später hat sie den Lehrerparkplatz am Volkhovener Weg verlassen, um sich in den aufkommenden Feierabendverkehr einzufädeln.
Was denkt sie sich nur? Steht da im Regen, wird patschnass und stiehlt mir meine Zeit.
Oh nein, jetzt hab ich auch noch den Bus vor mir. Die Haltestelle. Da ist sie ja! Leonie, was schaust du denn so?
Marie betätigt den Blinker und fährt links an dem stehenden Fahrzeug vorbei. Im Rückspiegel das Mädchen. Sie steht auf der Straße und sieht ihr nach. Was machst du nur? Leonie, du hältst doch den ganzen Verkehr auf. Warum steigst du nicht in den Bus? Marie wechselt die Spur und erhöht das Tempo. Das Mädchen ist aus dem Rückspiegel verschwunden.
***
Sie haben sich gestritten. Wieder mal. In letzter Zeit häufen sich die Streitereien. Seine Blicke verfolgen sie, er beobachtet, wie sie beinahe geistesabwesend in den Bus steigt. Pierre schüttelt den Kopf und schnippt die heruntergerauchte Zigarette in den Rinnstein.
Die ist ja völlig weggetreten, denkt er bitter. Der Regen prasselt auf seinen Helm mit dem schwarz-weißen Spinnenmuster, und er spürt, wie vereinzelte Tropfen durch das offene Visier auf seine Haut treffen.
»Das ist alles nur diese Schlampe schuld.«
Vom Linienbus geht ein dumpf grollendes Motorengeräusch aus, Pierre registriert, wie sich der linke Vorderreifen schwerfällig herausdreht. Unweigerlich setzt sich der Bus in Bewegung und schert aus der Haltebucht heraus.
Klar, er könnte ihr nachfahren. Könnte sie vor ihrem Haus abfangen und versuchen, mit ihr zu reden. Pierre dreht das Gas hoch, der Motor heult auf. Aber er weiß, dass er mit so einer Aktion alles nur noch schlimmer machen würde.
Sie kann überhaupt nicht auf seine Auftritte. Manchmal hasst er sie für ihr Getue. Nur weil sie in einem Einfamilienhaus in Pesch wohnt. Ja klar, in einer schickeren Gegend als er. Heißt ja nicht umsonst: In Esch, Pesch, Longerich, da wohnen die besseren Leute. Darum glaubt sie, ihn runtermachen zu dürfen. Und das nicht selten vor seinen Freunden.
Als Leonie vor einem Jahr zu ihm auf die Schule in Heimersdorf kam, hatte sie einen derben Absturz hinter sich, so hatte sie es auf jeden Fall erzählt. Sie sei vom Gymnasium geschmissen worden. Weshalb, hatte sie ihm bis heute nicht verraten. Ihre Eltern hielten es wohl für eine gute Idee, sie auf eine Hauptschule strafzuversetzen. Nur für ein Jahr, wie Leonie gern betont, danach würde sie auf eine Privatschule nach Bonn wechseln. Getue!
Er drückt sich mit den Füßen vom Asphalt ab und lässt das Moped vom Bürgersteig nach hinten auf die Straße rollen. Den herannahenden Pkw bemerkt er zu spät, haarscharf zieht der Wagen an ihm vorbei. Abrupt bleibt er wenige Meter weiter mit aufblinkendem Warnlicht am Straßenrand stehen. Die Fahrertür fliegt auf, und ein bulliger Mann mit Glatze stürmt auf Pierre zu, der schnell von seinem Sitz steigt und den Motorroller aufbockt.
»Los, nimm den Helm ab!«, befiehlt der Mann.
Pierre blickt in das Gesicht seines Gegenübers und schüttelt langsam den Kopf.
Die flache Hand sieht er zwar kommen, kann ihr jedoch nicht ausweichen. Sie trifft ihn seitlich am Kopf. Die enorme Wucht des Schlages überrascht ihn und wirft ihn zu Boden. Aus seinem Blickwinkel macht er Füße aus, die in schwarzen Springerstiefeln stecken. Scheiße, ein Fascho. Er krümmt sich zusammen, in angstvoller Erwartung, die Stahlkappen gleich in seinem Magen zu spüren. Doch die Tritte bleiben aus. Ungläubig öffnet er die Augen und sieht, wie sich die Stiefel entfernen.
»Arschloch!«, presst er halblaut hervor.
Etwas benommen rappelt er sich auf.
»Ich habe mir das Kennzeichen gemerkt«, hört er hinter sich eine brüchige Stimme. »K-RT und irgendwas mit fünf.«
Pierre dreht den Kopf, und sein Blick bleibt an der gebeugten Gestalt einer alten Frau hängen.
»Verpiss dich!«, zischt er. Ohne sich weiter um die verdutzte Alte zu kümmern, steigt er auf seinen Motorroller und fährt davon.
2
Marie fährt die A 61 in Bergheim ab, biegt von der Krefelder Straße in die Aachener Straße Richtung Ortszentrum.
Autofahren strengt sie an. Sie verstärkt den Druck. Fest umklammern ihre Hände das Lenkrad. Es liegt nicht am Regen oder an dem Unfall.
Nein, es sind die vielen Dinge, Menschen, Fahrzeuge, auf die sie achten muss. Unvorhersehbares kann passieren.
Mir ist noch nie etwas passiert. Nein, auch damals nicht! Egal, was der Therapeut sagt. Er redet immer nur von posttraumatisch. Bei ihm ist alles posttraumatisch.
Er ist ein blasser Mann mit rundlichem Gesicht, weichen Zügen und kleinem Kopf, zu dem dieser kräftige Körper nicht so recht passen will. Grotesk. Seine klobig wirkenden Hände, auf denen schwarze Haare sprießen, die wie Spinnenbeine aussehen, und diese mausgrauen Augen hinter der häufig fleckigen Brille findet sie abstoßend.
Ja, sie weiß, er meint es gut mit ihr. Aber er hat manchmal so einen mitleidigen Ausdruck in seinen Augen, in seinen winzigen mausgrauen Augen. Ach, was heißt manchmal … Sie hasst sein Mitleid. Doch der Wechsel zu einem anderen Therapeuten schreckt sie ab – das würde bedeuten, dass sie wieder so viel von sich erzählen müsste. Und wieder wäre es jemand, der in sie eindringen, sie verstehen und begreifen wollte. Dabei ging es ihr nur darum, dass jemand ihr die Tabletten verschreibt, die sie braucht, um ihren Tag zu meistern. Sie will doch bloß in Ruhe gelassen werden. Will arbeiten gehen und ihr Leben leben. Ihr Leben und nicht das der anderen. Und sie will auf gar keinen Fall mehr in die Klinik.
Schweißperlen bilden sich auf ihrer Stirn. Ihr ist heiß. Der Rollkragen ihres Pullovers schnürt ihr die Luft ab. Sie zieht daran, schiebt ihn runter, befreit den Hals.
Meine Tabletten, ich darf nicht vergessen, meine Tabletten zu nehmen. Der Regen schlägt unablässig hart gegen die Scheibe und lässt dem Wischer kaum eine Chance. Sie kneift die Augen zusammen und orientiert sich an den roten Rücklichtern der Autos, die vor ihr fahren. Eine Gestalt mitten auf dem viel befahrenen Knüchelsdamm. Wankend.
Bist du verrückt geworden? Bleib bloß stehen, du besoffener Idiot! Sie verschwendet keinen Blick, als sie an dem Betrunkenen vorbeifährt.
Gleich, gleich bin ich da.
Blinker setzen, Spur wechseln, erneutes Blinkersetzen. Langsam rollt sie an den parkenden Autos entlang auf der Suche nach einem Stellplatz. Sie hat Glück. Wenige Meter vor ihr steigt ein älterer Mann in seinen Wagen und überlässt ihr die Parkbucht »An der Stadtmauer«.
»Ah, da sind Sie ja!«, begrüßt sie der Blumenhändler und kommt mit ausgebreiteten Armen auf sie zu.
Gleich lacht er wieder.
»Rote und gelbe Rosen? So wie jeden Freitag?«
Marie nickt. Sie schaut ihn nicht an. Schaut an ihm vorbei. Der Blumenhändler lässt die Arme sinken und lacht.
»Sind schon eingepackt. Zehn von den roten und zehn von den gelben. Ist recht so, ja?«
Sie nickt, das Portemonnaie schon in der Hand.
»Rosen für die Rose«, sagt der Verkäufer lachend und überreicht ihr die Blumen. Unwillkürlich presst sie die Lippen aufeinander. Dieser Wicht, denkt sie, als sie vor ihrem Wagen steht.
Der Regen hat nachgelassen.
Sie öffnet die Beifahrertür und legt die Rosen behutsam auf den Sitz.
Wie sie wieder duften!
»Fahren Sie weg?«
Und wie schön sie sind!
»Entschuldigung! Fahren Sie weg?«
Was? Sie richtet sich auf, schaut über ihr Wagendach hinweg in das offene Beifahrerfenster eines Autos. Der Mann darin sieht sie ungeduldig an.
Sie schüttelt den Kopf. Missmutig verzieht er das Gesicht und braust davon. Einen Moment lang verharrt sie, bevor sie ihre Augen abwendet, die Wagentür ins Schloss drückt und das Fahrzeug verschließt.
In Gedanken überquert sie die Straße, achtet nicht auf den Verkehr. Bremsgeräusche. Das Quietschen verursacht Schmerzen in ihren Ohren. Marie hebt die Hand und geht weiter.
Verdammt, ich muss mich mehr zusammenreißen. Ja, es war ein harter Tag, aber trotzdem … und ich muss meine Tabletten nehmen. Ich muss …
3
Die harte Silhouette von Köln-Chorweiler ist aus der Ferne unübersehbar. Hierher verirren sich keine Köln-Touristen. Keine Sightseeing-Busse bewegen sich durch die Straßenschluchten. Warum auch? Die Osloer Straße ist weit weg vom Dom. Und hier, hier gibt es nichts, was es mit dem megaschicken Rheinauhafen auch nur ansatzweise aufnehmen könnte. Da wohnt der Poldi, im ersten Kranhaus ganz oben. Kostet locker ’ne Million. Der hat’s geschafft, der Poldi. Scheiße ja, er hat den FC im Stich gelassen, so sagen viele. Aber so war es nicht. Der Verein hat ihn hängen lassen, das ist die Wahrheit. Hat ihm übel mitgespielt.
Pierre glaubt, bereits im Eingang des Hochhauses riechen zu können, was seine Mutter heute zu Mittag gekocht hat. Was wohl daran liegt, dass es meistens das Gleiche gibt: Dosenravioli. Keine Beschwerde! Mom tut, was sie kann. Der Geruch sticht ihm in die Nase und vermischt sich mit den anderen bekannten Gerüchen, die unauslöschlich mit seinem Zuhause verbunden sind. Von irgendwoher schallt Schlagermusik durchs Treppenhaus. Das Haus ist ein monströser Beton-Stahl-Bau, mit schlauchartigen Verbindungsbalkonen zwischen den einzelnen Wohnungen, in einer ebenso monströsen Hochhaussiedlung. Er wartet nicht auf den Aufzug, sondern nimmt die dreimal zehn Stufen, die in den ersten Stock führen, mit großen Schritten.
»Pierre, bist du’s?«
Es versetzt ihm jedes Mal einen tiefen Stich, wenn dieser gewisse Tonfall in der Stimme seiner Mutter mitschwingt. Dieser Tonfall, der nach Angst und Besäufnis klingt.
»Ja, Mom«, antwortet er, während er die Haustür von innen abschließt.
Er lehnt sich mit dem Rücken gegen die Tür, nur für einen kurzen Moment, dann geht er auf sein Zimmer zu. Wieder hört er, wie sie seinen Namen ruft.
Zittrig fährt seine Hand durch die blauschwarz gefärbten Haare. Der Zwischenfall mit dem Skin steckt ihm immer noch in den Knochen. Klar, er hätte frühzeitig einen Abflug machen können. Der Arsch hätte ihn never ever gekascht, aber Abhauen ist einfach nicht sein Ding. Lieber mal ein paar in die Fresse kriegen, als sich für immer als feige Sau fühlen.
Dreck! Der Kopfschmerz und das mulmige Restgefühl im Magen sind ja noch harmlos. Ja, er weiß es, es hätte für ihn beschissener ausgehen können, und dann hätte er seiner Mutter wieder mal Sorgen bereitet.
»Ich komm sofort, Mom. Ich geh nur mal eben in mein Zimmer, Helm und Jacke wegbringen … ich komm sofort.«
Er findet seine Mutter auf dem Sofa liegend und mit geschlossenen Augen vor. Er hasst dieses vor Jahren einmal marineblaue, mittlerweile ausgeblichene Sofa mit den drei Brandlöchern an der rechten Lehne.
Das Sofa war am gleichen Tag geliefert worden, an dem sein Vater sich in der Badewanne die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Wie ein abgestochenes Schwein ist er verblutet, und er hatte ihn damals gefunden, sterbend. Da war er elf Jahre alt. Er kam gerade aus der Schule, als er im Flur dieses Stöhnen hörte. Pierre hatte nicht begriffen, was mit seinem Vater los war. Wollte es wohl auch nicht begreifen und stand einfach nur da. Wie lange dauert ein Moment? Das ist jetzt sechs Jahre her.
Seine Mutter war nicht zu Hause gewesen. Sie hat nie gesagt, wo sie an jenem heißen Augustnachmittag gewesen ist. Schon verrückt: Morgens wird das Scheißsofa geliefert, und ein paar Stunden später bringt sich der Alte um.
»Ich hab dir Ravioli gemacht«, sagt seine Mutter, ohne dabei die Augen zu öffnen, »auf dem Herd, müssten noch warm sein.« Sie hebt kraftlos den dürren Arm, um damit in Richtung Küche zu deuten. »Du kommst spät. Wo warst du? Du weißt doch, dass ich mir Sorgen mache, wenn du zu spät kommst.«
Pierre geht zu ihr, beugt sich herunter und küsst sie auf die Stirn. Zwischen Couchtisch und Sofa liegt die leere Schnapsflasche.
»Hey Mom, alles in Ordnung. Ich war in der Schule und hatte AG. Hat heute etwas länger gedauert. Es ist alles bestens. Du musst dir keinen Kopf um mich machen. Mir geht’s prächtig.« Seine Mutter macht sich immer so viele Gedanken seit der Sache mit dem Schulleiter.
»Du musst was essen, Junge.«
»Danke, Mom. Das mach ich.«
Er küsst sie ein weiteres Mal auf die Stirn und geht in die Küche.
Seine Mutter hat nicht die geringste Ahnung, dass er schon seit über einem halben Jahr nicht mehr zur Schule geht. Sie glaubt, er wäre nach dieser Aktion mit der Bombendrohung mit einem blauen Auge davongekommen. Die Polizei war da gewesen, mit einem Großaufgebot, und hatte ihn in Handschellen abgeführt. Seine Mutter war mal wieder völlig betrunken gewesen, sodass sie wenigstens von der Verhaftung kaum etwas mitbekommen hatte. Achtundvierzig Stunden später hatten sie ihn wieder aus der U-Haft entlassen. Und noch am selben Tag stand ein Sozialarbeiter des Jugendamtes vor der Tür. Aber der konnte ihm auch nicht helfen; konnte auch nicht verhindern, dass er von der Schule geschmissen wurde. Na ja, jetzt ist er siebzehn und ist raus aus der Jugendhilfe, is’ ja klar, die Stadt ist pleite. Sicher, er hätte seinen Sozialarbeiter aufsuchen können – das Angebot bestand: »Pierre, wenn du Hilfe brauchst oder auch nur mal quatschen willst, meld dich bei mir.«
»Klar, mach ich«, hatte er gesagt und war insgeheim froh darüber gewesen, den Sozifuzzi los zu sein. Die vom Jugendrichter aufgebrummten Sozialstunden in einem Altenheim hatte er an einem Stück heruntergerissen. Alles paletti jetzt.
Im Vorbeigehen schnappt er sich den Stieltopf vom Herd, geht zum Kühlschrank und holt die halb leere Flasche Cola heraus. Noch bevor er die Tür seines Zimmers mit dem Fuß aufdrücken kann, hört er sein Handy klingeln.
»Golem, was liegt an?«
4
Das grelle Licht lässt sie kurzzeitig blinzeln. Der Supermarkt ist hell erleuchtet, die Angebotsschilder unübersehbar. Sie greift in ihre Manteltasche, holt den Chip hervor, drückt ihn in den Schlitz und zieht den Einkaufswagen heraus. Sie schaut auf und glaubt für einen kurzen Moment, das verschwommene Gesicht eines Mannes wahrzunehmen, der sie von draußen durch die Glasfront des Supermarktes anstarrt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!