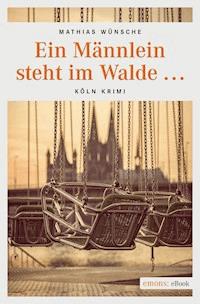
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Köln-Krimi
- Sprache: Deutsch
Nahe der Osterkirmes in Deutz wird eine Leiche gefunden, nur einen Tag später taucht eine weitere am Rheinufer in Rodenkirchen auf. Zwei männliche Opfer. Beide auf ähnliche Weise verstümmelt. Waren es Ritualmorde? Detektiv Lou Parker wird beauftragt, einen der beiden Morde aufzuklären. Die Ermittlungen führen ihn weit zurück in die Vergangenheit - und zu einem zutiefst verstörenden Geheimnis . ..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mathias Wünsche wurde 1957 in Köln geboren. Nach dem Studium der Sozialpädagogik arbeitet er heute seit über zwanzig Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe in Köln. Neben seiner Autorentätigkeit ist er erfolgreich als Musiker und Komponist unterwegs.www.mathiaswuensche.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/gb-photodesign.de Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Martina Dammrat, Köln eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-769-7 Köln Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Schwere See, die Wellen schlagen hoch.
Schwere See, wenn ich wieder in die Knie geh,
du bist mein Leuchtturm, wenn ich das Land nicht seh,
schenkst mir das Licht, das all die Dunkelheit durchbricht.
aus: »Leuchtturm«, M.
EINS
Köln, an einem Sonntagabend im Mai in den zwanziger Jahren Maifest auf den Poller Wiesen
Sie wehrt sich nicht mehr, hat einfach aufgehört, sich zu wehren. Einfach so, mit einem Mal. Sie liegt da, starr, in dem Wohnwagen auf den rauen Holzdielen, ihre Arme wie bei einer Kreuzigung ausgestreckt. Den langen grauen Rock hat er ihr bis zum Kinn nach oben geschoben und ihre Scham entblößt.
Sinnlos. Sinnlos, das verzweifelte Umsichschlagen, sinnlos das Kratzen, das Beißen, das Flehen. Alles erscheint ihr plötzlich völlig verrückt. So als habe sie den Faden, der sich durch ihr Leben zog, verloren. Sie spürt, sie gehört ab jetzt nicht mehr in diese Welt.
Der schwere Körper drängt sich stöhnend zwischen ihre Beine… sie dreht ihren Kopf zur Seite, will ihm nicht ins Gesicht, nicht in die Augen sehen.
Dabei hatte sie geglaubt, einer Krankenschwester könnte so etwas nicht passieren. Wie töricht! Als ob ihre Tracht, ihre weiße Schürze, ihr weißes Häubchen, sie vor dem hier beschützen könnte.
Warum nur? Warum musste sie nach der anstrengenden Arbeit im Spital noch unbedingt auf den Rummelplatz? Sie war doch müde gewesen. Das hatte sie doch auch der Oberschwester gesagt. Müde, weshalb sie heute auch so ungeschickt gewesen war. Hatte den Eimer mit dem schmutzigen Putzwasser umgestoßen. Warum war sie von Kalk nicht direkt nach Hause gegangen? Sie war doch schon auf der Rheinallee gewesen. Warum hatte sie innegehalten, sich umgedreht? Warum war sie schließlich heruntergelaufen, zu den Poller Wiesen? Ja, sie hatte Musik gehört und laute, fröhliche Stimmen. Aber ihre Mutter machte sich doch immer so große Sorgen, wenn sie herumtrödelte. Sie wusste das! Und warum hatte sie sich ansprechen lassen, von diesem Mann? Sie kannte ihn nicht.
»Na, schönes Fräulein, wie ist denn der werte Name?«, hatte er gefragt. Und sie hatte geantwortet: »Theresa.« Und er hatte gelacht und gesagt: »Na, Theresa, darf ich dich ein bisschen über den Platz führen?« Und sie hatte genickt und ließ es sich gefallen, dass er seinen starken Arm um ihre Schultern legte. Sie protestierte auch nicht, als er sie an sich drückte. Nein, sie fühlte sich auf eine ihr fremde Weise sicher und beschützt.
Ein wohliger Schauer durchfuhr sie. Dicht drängten sich die Menschen vor den Fahrgeschäften und vor den Buden. Aber er sorgte dafür, dass sie nicht angerempelt oder gar belästigt wurde. Er führte sie von einer Attraktion zur nächsten. An jeder blieben sie stehen, und Theresa bestaunte das Riesenrad, die Kettenflieger und die laut dahinratternde Raupe. Und sie schüttelte jedes Mal heftig den Kopf, wenn er sie fragte, ob sie denn nicht Lust habe, auf irgendwas mitzufahren. Sein lautes, belustigendes Lachen gefiel ihr.
Als sie, angezogen vom süßen Duft, vor dem Wagen der Konditorei »Cremann« standen, musste er ihren sehnsüchtigen Blick bemerkt haben. All die Leckereien, die Schokolade, die Honigkuchen und die Eiswaffeln. Wie lange hatte sie solches Naschzeug nicht mehr gekostet. Seitdem der Vater im Krieg geblieben war, musste Mutter mit dem wenigen Geld, das sie beide verdienten, streng haushalten. Da blieb kaum was übrig für etwas außer der Reihe.
Er zwinkerte ihr zu und kaufte ihr ein Tütchen gebrannte Mandeln. Ganz langsam hatte sie die Süßigkeit zerkaut, und es war ihr beinahe wie ein kleines Wunder vorgekommen, dass ausgerechnet ihr aus heiterem Himmel so viel Glück beschieden war. Ja, zu diesem Zeitpunkt war sie sich sicher, dass Gott es gut mit ihr meinte. Und als er sie nach einer Weile fragte, ob sie seinen Wohnwagen sehen wolle, hatte sie lachend zugestimmt.
Sie sah das große glänzende Messingschild, das über dem Fenster an der Holztür prangte, und las stumm den Namen der Schaustellerfamilie, der dort mit schwungvoller Schrift eingraviert war.
Warum? Warum war sie mit ihm gegangen? Warum hatte sie ihren Weg auf der Rheinallee nicht fortgesetzt? Wäre sie weitergegangen, nichts von alledem geschähe jetzt. Ein sechzehnjähriges Mädchen gehört um diese Zeit nach Hause.– Wenn es ein anständiges Mädchen ist.
Nein, du bist kein anständiges Mädchen. Du bringst Schande über die Familie. Der stechende Schmerz lässt sie aufschreien, heiße Tränen laufen ihr übers Gesicht, und er stößt tiefer in ihren Leib. Musik dringt an ihr Ohr. Die Drehorgel, ganz in der Nähe, spielt ein altes Kinderlied. Theresa liebt dieses Lied, kennt den Text, und sie summt leise zur Melodie:
»Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm.
Es hat vor lauter Purpur ein Mäntlein um.
Sagt, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein,
mit dem purpurroten…«
***
Neun Monate später
Das Kind. Es schreit. Mit dem Messer durchtrennt sie die Nabelschnur. Überall das Blut. Auf ihren Schenkeln, ihrem Bauch. Auch auf dem Laken und dem Plumeau. Und es fließt weiter aus ihr heraus. Theresa drückt noch mehr Leinentücher auf ihren Schoß, die sich sogleich rot färben. Das viele Blut. Noch immer hält sie das Messer in ihrer Hand.
Worauf wartet sie denn noch? Was hält sie ab? Sie sieht auf das blutverschmierte strampelnde Etwas neben sich.
Dann hebt sie den Kopf, ihr Blick bleibt für einen kurzen Moment am Fenster hängen. Eisblumen haben sich innen an den Butzenscheiben gebildet und trotzen den ersten Sonnenstrahlen des Tages. Über Nacht ist die letzte Kohle in dem schmalen Ofen verbrannt, und rasch hat sich die Kälte in dem Mansardenzimmer ausgebreitet. Zimmer und Bett teilt sie sich mit ihrer Mutter, die bereits im Morgengrauen aus dem Haus ist. Ihre Stelle als Waschfrau bei einer angesehenen Kölner Apothekerfamilie befindet sich unweit vom Dom, und für den Fußweg dorthin braucht sie von Poll aus fast eine Stunde.
Ihre Mutter hat seit der Sache im Mai nur noch das Nötigste mit Theresa gesprochen. Regungslos hatte sie dagesessen, an jenem Abend im Mai, während die Tochter weinend vor ihr auf die Knie gefallen war. Theresa hatte sich so gewünscht, die Hand der Mutter auf ihrem Kopf zu spüren. Hatte sich nach ihrer tröstenden, liebevollen Hand gesehnt. Doch Mutter hatte bloß auf diesem Stuhl gesessen. Ihr Gesicht wie versteinert, ihre Arme vor der Brust verschränkt. Sie hatte einfach nur dagesessen, ohne ein Wort zu sagen. Theresa war schließlich vor lauter Erschöpfung auf dem Fußboden eingeschlafen, und als sie mitten in der Nacht wach wurde, sah sie im Schein des Mondes ihre Mutter im Bett liegen. Theresa hatte sich nicht getraut nachzusehen, ob sie tatsächlich schlief, auch wagte sie es nicht, sich neben sie zu legen. So schlief sie da, wo sie war, wieder ein.
Am nächsten Morgen sagte ihre Mutter, dass sie, sollte in ihrem Leib jetzt etwas heranwachsen, sich für diesen Bastard nicht den Buckel krumm arbeiten werde. Das war das Letzte, was sie in dieser Sache zu Theresa gesagt hatte.
Das Schreien wird lauter und holt sie zurück. Theresa starrt auf das Messer in ihrer Hand. Dann auf das Kind. Ein Junge!, schießt es ihr durch den Kopf. Es ist ein Junge! Sie legt das Messer beiseite und flüstert: »Egal, in was für eine Welt du auch hineingeboren bist: Ich bin deine Mutter, und du bist mein Männlein.«
***
Sechzehn Jahre später
»Werde ich ihn heute sehen?« Seine Stimme, hell und hoch, lässt sie innehalten. Deutlich hört sie die Erregung heraus, die seine Frage färbt.
An der Tür stehend, dreht sich Theresa um, schaut ihm in die wasserblauen Augen. Dieser traurige Blick! Dieser Blick, angeboren, der viel mehr sagt, als es Worte jemals auszudrücken vermöchten, hatte nie aufgehört wehzutun.
Theresa streicht ihm sanft über die dunklen Locken. Wie ein Engel sieht er aus. Ein zarter kleiner Engel. Nein, er hat keine Ähnlichkeit mit seinem Vater. Hat nichts gemein mit ihm. Mit seinen langgliedrigen Händen bedeckt er sein Gesicht, so wie er es immer tut, wenn er sich schämt. Und er wiederholt seine Frage:
»Werde ich ihn heute sehen, Mutter?« Eine Stimme wie die eines Kindes.
»Vielleicht«, antwortet sie leise. »Aber wirst du es genauso machen können, wie wir es besprochen haben? Bist du schon dazu bereit?« Der Junge nimmt die Hände herunter und blickt sie von der Seite an.
»Ja, Mutter, das bin ich«, erwidert er. »Und ich werde alles genau so machen, wie du es mir gezeigt hast. Ich bin bereit!«
Unzählige Menschen bevölkern den Rheinpark. Das warme Maiwochenende sorgt dafür, dass die Kirmes gut besucht ist und dass es in den Kassen der Schausteller und Moppenbuden-Besitzer klingelt. Etwas abseits, auf einer kleinen Anhöhe, bleiben sie kurz stehen und blicken von dort auf das Treiben. Theresa spürt, wie die Hand ihres Sohnes in ihrer feucht wird. Sie weiß um seinen Blick und schüttelt stumm den Kopf. Sie ist seit damals nicht mehr auf einem Rummel gewesen. Natürlich hat sie die Bilder nie aus ihrer Seele verbannen können. Jede Einzelheit ist immer gegenwärtig. Doch was sie jetzt sieht, nimmt ihr die Luft.
Nein, es hat nicht an diesem Ort stattgefunden. Es sind nicht die Poller Wiesen. Aber es sind die gleichen Menschen wie damals. Menschen, die lachend vorübergehen, die scherzen, die sich vergnügen– während sie nur wenige Meter entfernt in einem Wagen auf dem Boden…
Sie hatte ihn gesucht und hatte ihn gefunden. Sie wohnten auf einem Bauernhof in der Nähe von Longerich: er und seine Eltern und seine Geschwister. Im achten Monat schwanger war sie gewesen. Es war ihr nicht leichtgefallen, dorthin zu gehen, doch wollte sie ihm sagen, dass er bald Vater werden würde. Sie hatten sie beschimpft, hatten sie eine Lügnerin, eine Hure gescholten und vom Hof gejagt. Sie alle: er und seine Eltern und seine Geschwister. Wie ein Stück Dreck hatte sie sich gefühlt. Aber darin hatte sie ja mittlerweile Erfahrung.
»Mutter, was ist mit dir?«
»Nichts, mein Junge.« Sie wischt sich durchs Gesicht und schenkt ihm ein schmales Lächeln. »Es ist alles gut, mein Männlein. Lass uns nach unten gehen, zu den Leuten.«
Sie führt ihn durch die Menge, hält ihn dabei fest an der Hand und ignoriert eine Gruppe von Männern, die angetrunken und grienend Obszönitäten hinter ihr herrufen.
Theresa reckt ihren Kopf in die Höhe, versucht sich zu orientieren, schaut sich um. Unübersehbar das Riesenrad. Da das Pferdekarussell. Und da der Kettenflieger. Ja, und da stehen sie, etwas abgelegen und doch schnell zu erreichen: die Wohnwagen der Schausteller. Sie nickt dem Jungen zu.
»Ich hab sie entdeckt, Männlein!«
Er blickt sie an, mit fiebrig glänzenden Pupillen.
»Gehen wir jetzt dorthin?«, fragt er, wobei seine Stimme vernehmbar zittert.
»Noch nicht! Wir warten auf die Dämmerung«, antwortet Theresa und weist mit dem Kopf zur Reibekuchenbude.
»Um die Wartezeit zu nutzen, solltest du etwas essen. Du musst dich stärken. Komm!«
»Madam«, hört sie ihn fragen, »was kostet ein Reibekuchen?«
ZWEI
Heute
Parker schlägt abrupt die Augen auf. Er liegt auf dem Rücken und braucht einen Moment, um zu sich zu kommen, sich zu orientieren. Braucht eine Weile, um zu verstehen, was ihn aus diesem unruhigen Schlaf gerissen hat.
Der Druck in seinem Schädel überlagert alle Synapsen und deren Signalübertragungen.
Oh Mann, geht’s ihm scheiße! Hatte er nicht mal irgendwo gelesen, dass im menschlichen Gehirn einhundert Billionen von diesen Synapsen ihrer Arbeit nachgingen? Verdammt, und wo sind die jetzt gerade? Die können doch nicht alle abgesoffen sein! Bruchstückhaft setzen sich seine Erinnerungen allmählich wieder in die richtige Reihenfolge. Und es beruhigt ihn ungemein, dass es sich bei diesem pelzigen, Übelkeit verursachenden Etwas in seinem Mund nicht um einen Fremdkörper handelt, sondern um seine Zunge.
Ah, da war doch was, gestern Abend, im Stavenhof. Sein Geburtstag! Und er hatte die Jungs ins »Anno Pief« zum Reinfeiern bestellt. Nix Großes, hatte er erklärt. War ja kein runder.
Wie alt ist er jetzt? Moment!
Ja! Seit ein paar Stunden sechsunddreißig. Genau, jetzt bin ich wieder da. Von wegen nix Großes! Die finden einfach kein Ende. Allen voran sein bester Freund und Exkollege Jo Degen. Wie spät war es, als der Wirt sie beide aus der Kneipe gekehrt hatte? Keine Ahnung. Parker schließt die Augen.
Jo hatte ein Taxi auf dem Eigelstein angehalten und Parker aufgefordert, mit einzusteigen. Er hatte abgewinkt. So ein Quatsch, hatte er seinem Freund zugerufen, die paar Meter zu meinem Bett gehe ich zu Fuß.
Da! Da ist es wieder! Dieses Kratzen an der Tür!
Das Geräusch, das ihn so brutal aus dem Schlaf gerissen hat. Und nun dafür sorgt, dass ihm die Nackenhaare zu Berge stehen.
Was ist das? War er nicht allein in der Wohnung? Hatte er in der vergangenen Nacht jemand mit nach Hause genommen? Er schüttelt den Kopf und verflucht sich im selben Augenblick dafür. Zu schnelles und ruckartiges Bewegen kommt noch nicht gut.
Aber nein, so voll kann er gar nicht gewesen sein, dass er so eine Aktion vergessen hätte. Nein, es gab keine Frau gestern Abend und keine in der Früh!
Er hat schließlich keinen Filmriss, sondern höchstens ein paar einstweilige Gedächtnislücken und einen – mit hoher empirischer Wahrscheinlichkeit– heranwachsenden Kater… Kater! Stimmt! Da war noch was. Da war… das Handy! Parker stöhnt auf.
Er weiß, wer dran ist, und weiß auch, dass er rangehen muss. Mit größter Anstrengung bäumt er seinen Oberkörper auf, um sich dann seitlich fallen zu lassen. Der Klingelton treibt ihn an. Ja doch! Parker schiebt den rechten Arm über die Bettkante, um mit der Hand nach dem am Boden liegenden Handy zu suchen. Seine Finger tasten fast panisch über das Parkett. Ohne Erfolg.
Das Scharren an der Tür wird lauter. Das blöde Handy scheinbar auch. Wieder stöhnt er auf. Nee, es hilft nix. Er wuchtet sich aus der Seitenlage und wechselt, die Explosionen unter seiner Schädeldecke ignorierend, in die Sitzposition. Sein Kopf fällt vornüber, sodass die Kinnspitze das Brustbein berührt. Aber der Einsatz hat sich gelohnt. Er hört es nicht nur, nein, nun sieht er es auch!
»Hallo, Mama«, beginnt er und räuspert sich sogleich. Mist, seine Stimme klingt genau so, wie er sich fühlt.
»Na endlich, mein Junge!«, antwortet sie. »Ich hab es schon auf dem Festnetz versucht… bist du krank?«
»Ähm, nein, Mama! Ich war gestern bloß ein bisschen feiern, mit…«
»Ich wollte dir zu deinem Geburtstag gratulieren…«
»Das ist ganz lieb von dir, ich bin…«
»Liegst du etwa noch im Bett?« Hört er da einen leichten Vorwurf in ihrer Stimme?
»Ja, ähm, also ich hab gestern gefeiert…«
Jetzt ist es seine Mutter, die sich räuspert.
»…mit Jo und den anderen…«
»Junge, es ist kurz nach zwölf«, unterbricht sie ihn, und Parker schließt die Augen.
»Sag jetzt bloß nicht, dass du Watson noch nicht gefüttert hast! Du hast mir versprochen, dass du dich um ihn kümmerst, wenn ich in dieses Altersheim gehe. Das war die Abmachung!«
»Mama, du bist freiwillig dorthin«, protestiert Parker und versucht, das wieder lauter werdende Kratzen zu übertönen.
»Du wolltest nach Papas Tod nicht alleine sein, wolltest unter Menschen… du hättest mit deinen einundsiebzig auch gut und gerne noch einige Jahre zu Hause leben können… mit deinem Watson.«
»Das Haus war viel zu groß für mich allein, und das habe ich immer gesagt. Auch als dein Vater noch lebte. Er war damit einverstanden, dass ich es verkaufe, wenn er nicht mehr ist. Du wolltest es ja nicht. Und was soll ich mir irgendwo eine Wohnung nehmen und dort isoliert vor mich hin leben? Und ich bin froh über diesen Schritt. Ich bin vor zwei Wochen eingezogen und habe bereits jetzt netten Anschluss gefunden. Außerdem ist hier regelmäßig was los! Ausflüge und Tanzabende mit der Musikkapelle.«
Jaja, die neuen Alten. Es wird nicht mehr lange dauern und »Highway To Hell« wird den Speisesaal rocken. Und das war’s dann für die Capri-Fischer.
»Hast ja recht«, bricht Parker das entstandene Schweigen. »Und ich kümmere mich auch sofort um den Kater, versprochen!«
»Kommst du denn heute vorbei? Ich hab doch noch was für dich.«
»Klar, Mama! Ich denke, ich werde in einer Stunde bei dir sein. Bis gleich!«
Er schmeißt sein Handy aufs Bett, atmet schwer aus und genießt den plötzlichen Moment der Ruhe. Dann setzt das Lärmen an der Tür wieder ein. Parker weiß dieses Scharren zu deuten. Hier geht es keineswegs um eine Art von Zuneigungsbekundung. Der Kater möchte nicht von Parker gekrault werden oder es sich gar auf seinen Schoß gemütlich machen. Im Gegenteil– er dreht sich jedes Mal um, sobald Parker den Raum betritt, und zeigt ihm demonstrativ sein Hinterteil. Nein, das Verhältnis zwischen ihnen ist klar: Watson mag ihn nicht, und er mag Watson nicht. So einfach ist das.
Bloß, dass der Kater nicht mit einem Dosenöffner umgehen kann.
***
Parker klemmt seine eins fünfundachtzig hinter das Steuer des roten 1995er MX5 und wirft das ausgepackte Geburtstagsgeschenk samt Papier und Schleife neben sich auf den Beifahrersitz. Er steckt den Schlüssel ins Schloss und überlegt, ob er das Verdeck aufklappen soll. Er blickt durch die Frontscheibe zum Himmel, knurrt enttäuscht, dreht den Schlüssel und startet den hunderteinunddreißigPS starken Motor des Roadsters. Dieser erste Mai lässt, was das Cabriofahren angeht, wettertechnisch noch einiges zu wünschen übrig.
Er schaltet in den Rückwärtsgang, und der kleine Sportwagen rollt aus der Parktasche. Ein kurzer Seitenblick auf die Seniorenresidenz Rodenkirchen, und Parker flüstert ein »Tschüss, Mama«, dann lenkt er den Roadster auf die Ringstraße.
Ja, er ist verärgert. Auch wenn er es sich nicht richtig eingestehen will. Eigentlich wundert er sich auch eher über sich selbst. Hätte man ihm vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass er ein Problem mit dem Liebesleben seiner Mutter haben werde, hätte er wohl laut gelacht. Doch er kann es nicht verhehlen: Es wurmt ihn, dass seine Mutter allem Anschein nach einen Verehrer hat. Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber sie scheint es zu genießen! So lange ist Vater nun auch noch nicht unter der Erde. Zwei Jahre gerade mal! Dabei wollte er nur mal kurz seiner Mutter Hallo sagen. Immerhin hat er heute Geburtstag. Er wollte sich von ihr einen Kuss auf die Stirn geben lassen, sein Geschenk abholen und ein Stück Kuchen mit ihr essen. Was ja auch alles so war! Doch mit einem Mal stand da so ein weißhaariger rüstiger Rentner bei ihnen am Tisch, streckte die Hand aus und sagte:
»Guten Tag, ich bin der Heinz! Und du musst das Geburtstagskind sein, der Lou! Herzlichen Glückwunsch! Deine reizende Frau Mutter hat mir schon so viel von dir erzählt. Du bist also bei der Polizei…?«
Parker war gerade dabei gewesen, die Kaffeetasse zum Mund zu führen, blickte nun aber auf und ließ die Tasse wieder auf den Teller sinken. Er erhob sich, nahm die Hand und antwortete: »Ähm, ja, vielen Dank! Nein, ich bin nicht mehr bei der Polizei, ich… ich bin Privatdetektiv.«
»Wir duzen uns hier alle«, hörte er hinter sich seine Mutter mit leicht verstimmtem Tonfall sagen, »und es ist wirklich schade, dass du kein Beamter mehr bist. Die schöne Pension…«– »Mama!«, hatte er sie schroff unterbrochen. »Ich glaube nicht, dass das Herrn… ähm, Heinz interessiert!«
Parker versucht seinen Ärger abzuschütteln, indem er das Radio anmacht, in der Hoffnung, dass mal was Ordentliches herauskommt, und er hat Glück! Adeles Stimme schleicht sich an und erfüllt den kleinen Innenraum. »This is the end. Hold your breath and count to ten.« Parker dreht augenblicklich den Knopf nach rechts, die Boxen dröhnen, und er singt lauthals mit, als die Sängerin den epochalen Refrain anstimmt: »Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall, face it all together at skyfall– at skyfall…« Sein Handy vibriert in der Brusttasche. Parker unterdrückt einen Fluch und stellt das Radio leiser.
»Hallo, Jo!«, ruft er etwas zu laut in das Mobiltelefon. »Warum ich so schreie? Sorry, Adele sitzt gerade neben mir im Auto, und die röhrt immer so gewaltig. Und? Wieder auf den Beinen? Mir geht’s blendend. Wie? Heute Abend? Passt mir gut! Wie kann ich da Nein sagen, wenn Marie mich sehen will und mir zu Ehren kocht? Ach, du wirst auch da sein! Hm? Na, ich komm trotzdem. Neunzehn Uhr? Super! Ich freu mich!«
Parker fährt in dem Moment in die Dagobertstraße, als Adele das endgültige Ende einläutet: »Let the skyfall, we will stand tall, at skyfall– oh.« Vor dem Altbau mit der Hausnummer30 lenkt er den Wagen mit den rechten Vorder- und Hinterreifen auf den Bordstein und schaltet den Motor aus. Seine Laune hat sich erheblich aufgehellt. Erst Adele, dann die Einladung zum Essen und nun auch noch ein Parkplatz direkt vor der Haustür! Was will man mehr!
Er schließt leise summend die Wohnungstür auf und kassiert prompt den verächtlichen Blick von Watson, der wie in Beton gegossen im Flur sitzt. Für Parker hat der Kater Ähnlichkeit mit einem Piraten. Mit einem fetten Piraten! Nix Jack Sparrow! Und es fehlen bloß noch die Augenklappe und das Holzbein.
Parker geht vor Watson in die Hocke und fixiert ihn. Watson hält den Augenkontakt– ohne das geringste Blinzeln.
»Was ist, Alter«, zischt Parker, »ich hab heute Geburtstag, willst du deinem Herrn und Gebieter nicht gratulieren?«
Und es kommt so, wie es immer kommt: Der Kater erhebt sich betont langsam, dreht sich um, bleibt für einen Moment mit hoch gestrecktem Schwanz stehen, um dann schließlich gemächlich ins Wohnzimmer zu verschwinden.
***
Kaum hat Parker seinen Wagen vor dem Einfamilienhaus zum Stehen gebracht, setzt der Regen ein. Er greift rasch nach dem Frühlingsstrauß, wuchtet sich aus dem Sitz, schmeißt die Autotür zu und beeilt sich, zum Hauseingang zu kommen. Marie öffnet, noch bevor er seinen Finger auf die Klingel legen kann.
»Herzlichen Glückwunsch!«, begrüßt sie ihn mit einem strahlenden Lächeln, breitet die Arme aus und ruft: »Lass dich drücken!«
Parker lächelt zurück, antwortet: »Mit dem größten Vergnügen!«, und zwinkert seinem Freund Jo Degen zu, der jetzt schmunzelnd hinter Marie auftaucht und zur Begrüßung die Hand hebt.
Im Wohnzimmer nimmt Marie Parker die Blumen, mit den Worten »Wie lieb von dir! Aber du hast doch Geburtstag!« ab und geht in die Küche.
»Hach, nicht der Rede wert«, ruft Parker hinter ihr her, »die standen so am Wegesrand!«
»Willst du ein Bier? Oder lieber einen Wein?«, fragt Degen.
Parker hebt die Hände vor die Brust und reißt die Augen auf.
»Nee, nee, lass mal! Weder das eine noch das andere! Die Resteverwertung vom gestrigen Abend ist noch nicht komplett abgeschlossen!«
»Jo, dann sei so gut«, sagt Marie, die sich wieder zu ihnen stellt, »und hol deinem angeschlagenen Freund eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank. Wir können nämlich jetzt essen.«
Parker inhaliert den Duft, der von der Küche ins Esszimmer weht, tief durch die Nase.
»Was ist das denn, was da so gut riecht? Kommt mir bekannt vor.«
»Kleftiko«, antwortet Marie, »dir zu Ehren. Da wir ja wissen, dass du ein Griechenland-Fan bist! Das Fleisch hat Jo extra bei deinem griechischen Metzger in der Weidengasse gekauft. Lammhaxe. Kurz angebraten, mit einer scharfen Tomaten-Rosmarin-Soße, haben wir es vier Stunden bei kleiner Hitze im Backofen vor sich hin schmoren lassen. Dazu bekommst du Safranreis und einen griechischen Salat mit Oliven und Fetakäse. Na, was sagt der Griechenland-Experte?« Marie grinst ihn breit an.
»Dass Jo verdammt viel Glück gehabt hat!«, antwortet Parker, und er meint es genauso, wie er es sagt.
Sein langjähriger Kumpel kann sich in der Tat glücklich schätzen, eine Frau wie Marie an seiner Seite zu wissen. Knapp drei Jahre sind die beiden nun ein Paar. Auch wenn ihr Start alles andere als unproblematisch war. Jo hatte Marie kennengelernt, als sie sich in einer schweren Krise befand. Sie hatte sich damals auf eigenen Wunsch in psychiatrische stationäre Behandlung begeben. Jo war die ganze Zeit über für sie da. Am Anfang hatte es Parker ein wenig gekniffen, dass sein Freund nicht mehr so häufig mit ihm um die Häuser gezogen ist. Die Zeiten vor Marie waren schon recht turbulent gewesen.
Männerfreundschaft halt. Blutsbrüder!
Jo und er lernten sich damals auf der Polizeischule kennen. Beide Anfang zwanzig, beide ohne rechte Vorstellung, wie es nach dem Abi weitergehen sollte. Beide hielten sich für Rebellen. Punkmusik und Filme von den Wachowski-Brüdern. »On the road« von Jack Kerouac war ihre Bibel, und sie hielten sich für die deutsche Ausgabe von Jack und Neal, vor allem dann, wenn sie mal wieder die Nacht zum Tag gemacht hatten. Am Morgen saßen sie dann mit kleinen Augen und mit einer Achterbahn im Kopf auf der Schulbank.
Polizei und Punk? Wie ging das zusammen? Was bei ihren Bekannten bloßes Kopfschütteln auslöste, verstanden Jo und er als Herausforderung. Sie wollten die Polizei reformieren. Wollten keinen Polizeistaat, der die Bürger überwachte, sondern wollten für mehr Gerechtigkeit sorgen. Ja, der Plan war, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und es würde ihnen auch gelingen. Davon waren sie überzeugt. Was rückblickend vielleicht naiv anmutet, war damals ihre Anschauung und Triebfeder. Nach ihrem Studium kam der Praxisschock, und es begann die Wirklichkeit.
Sie waren beide im Dienstrang eines Kommissars unterwegs, beide bei der Kriminalpolizei. Zuständig für den Bereich Prostitution, Menschenhandel und Drogendelikte. Keine einfache Zeit, besonders zu Beginn ihrer Laufbahn. Sie hielten zusammen und beschützten ihre Ideale, so gut es eben ging. Dabei machten sie sich nicht nur Freunde.
Wie sagt Jo noch bis heute so treffend: »Wer im Dreck wühlt, bekommt nun mal schmutzige Finger!«
Und Dreck fand sich auch vor der eigenen Haustür. Was schon mal zu handfesten Auseinandersetzungen mit den Kollegen führte. Besonders Parker konnte seinen Mund häufig nicht halten und machte sich zunehmend unbeliebt. Er war einfach kein Leisetreter, besaß kein diplomatisches Geschick. Und als er einigen hohen Herrn zu häufig und zu fest auf die Füße getreten war – Parker ermittelte gegen sie wegen des Verdachtes auf Sex mit Minderjährigen–, ließ man ihn kalt lächelnd über die Klinge springen. Die Falle wurde aufgestellt, und der finale Höhepunkt fand direkt und für jedermann sichtbar unter dem Eigelsteintor statt.
Parker stürzte hinein– und er fiel so tief, dass selbst sein Kumpel Degen ihm nicht mehr auf die Beine helfen konnte. Erst wurde er suspendiert. Dann wurde gegen ihn ermittelt. Degen versuchte in dieser Zeit alles, um seinen Freund zu entlasten. Er stellte eigene Ermittlungen an, stieß dabei aber recht schnell an seine Grenzen. Und auch er holte sich eine blutige Nase. Man versetzte ihn für ein Jahr in den Streifendienst. Danach konnte und wollte er nicht mehr zurück in sein altes Dezernat und wechselte stattdessen zur Mordkommission.
Hingegen war die Beweislage gegen Parker erdrückend. Parker musste seinen Dienst quittieren. Da war er zweiunddreißig.
Tja, und mit dem Rausschmiss verlor er auch Paula. Als sie eines Abends ihre Sachen packte und ging, fehlte Parker die Kraft, sie vom Bleiben zu überzeugen. Er konnte es ihr nicht verübeln, er hielt sich ja selber kaum noch aus. Parker war ganz unten aufgeschlagen, und außer Degen war keiner von seinen Freunden und Kollegen noch an seiner Seite.
»Hey, Lou«, sagt Degen schmunzelnd, »das fällt mir ja erst jetzt auf! Du siehst so verändert aus. Wie kommt es zu diesem modischen Experiment? Spontan weg von Blütenweiß und Dämonenschwarz, oder hast du etwa eine neue Klientin, die du beeindrucken willst?«
Marie lacht, und Parker schaut erst seinen Freund fragend an und dann, als Degen darauf zeigt, auf das Hemd.
»Das ist das Geburtstagsgeschenk von meiner Mutter«, gibt er maulend zurück. »Steht mir Grün etwa nicht?«
»Doch, doch«, antwortet Degen schnell. »Farbe ist nur so ungewohnt an dir. Du bist halt eher der Typ ›verdeckter Ermittler‹. Also bis auf deinen roten Flitzer, den mal ausgenommen.«
»Und das müsst ihr euch mal vorstellen«, erklärt Parker aufgebracht, nachdem er dem Verdauungsespresso drei Löffel Zucker zugeführt hat, »da stellte sich mir doch so ein Heinz vor, also der heißt so, und tut so, als gehöre er schon seit Jahren zur Familie!«
Parker starrt in die amüsierten Gesichter von Marie und Jo und bemerkt, dass er das Heißgetränk eine Spur zu geräuschvoll umrührt. Er legt den Löffel rasch auf die Serviette, führt die kleine Tasse vorsichtig an die Lippen und leert sie mit einem Schluck. Sogleich spürt er, wie sich die wohltuende Wärme in seinem Magen ausbreitet.
»Du solltest froh sein, dass deine Mutter so kontaktfreudig ist«, antwortet Marie. Und Jo schüttelt mit ungläubiger Miene den Kopf.
»Also«, sagt er, und es klingt leicht spöttisch in Parkers Ohren, »dass du so spießig bist, hätte ich wirklich nicht gedacht. In welchem Zeitalter lebst du denn? Sex im Alter sollte doch wohl kein Tabuthema mehr sein! Gönn deiner Mutter doch das Gefühl, begehrt zu sein. Oder wäre es dir lieber, sie würde sich einigeln?«
»Nein«, erwidert Parker gedehnt. Er hat mit einem Mal keine Lust mehr, weiter darüber zu sprechen. »Natürlich nicht. Und stimmt, es ist auch spießig, aber…«
Mit Erstaunen sieht Parker, wie sein Freund unvermittelt den Platz verlässt und ins Wohnzimmer geht. Er schaut Marie fragend an. Sie lächelt und zuckt mit den Schultern.
»Jo ärgert sich schon den ganzen Tag– aber nicht über dich!«
»Da hat sie recht!«, knurrt Degen, der wieder zurück an den Tisch kommt. Er wirft Parker die neuste Ausgabe des »Express« zu. Parker fängt sie und legt sie aufgeschlagen vor sich hin. »WAR ES EIN RITUALMORD
DREI
Parker leert seine Taschen aus, legt die Schlüssel und das Portemonnaie auf den Telefontisch im Flur und hängt seine Lederjacke an die Garderobe. In Gedanken ist er noch bei seinem Freund. Er kann Jos Ärger verstehen. Da hat ganz offensichtlich einer seiner Kollegen der Presse Insiderwissen weitergegeben, gegen Bezahlung vermutlich. Dabei ist das, was da vorgestern in Deutz passiert ist, eine echte Schweinerei. Wie krank muss man sein, so etwas zu tun. Er zieht die Schuhe aus und geht auf Socken ins Schlafzimmer. Unterwegs begegnet ihm Watson, der etwas ungelenk aus dem Wohnzimmer in Richtung Küche tappt.
»Na, du Faultier, hab ich dich aufgeweckt?«, ruft Parker hinter ihm her. »Oder treibt dich der Hunger in die Küche? Was? Ich versteh dich nicht! Ach, du sprichst nicht mit mir! Selbst schuld, wer nix sagt, bekommt auch nix ins Näpfchen!«
Parker knöpft sein Hemd auf und sieht aus dem Augenwinkel, wie Watson an ihm vorbeistolziert, um sich demonstrativ in den Türrahmen zu setzen. Der Kater beobachtet jede seiner Bewegungen, stumm und stoisch. Parker dreht sich zu ihm um.
»Tu bloß nicht so«, sagt er, »du kannst miauen, das habe ich schon mit eigenen Ohren gehört.« Parker steht da, mit halb aufgeknöpftem Hemd, und wartet. Es herrscht Stille. Kein Laut, weder von Mensch noch Tier. Nur das Ticken der Armbanduhr ist zu hören. Minuten vergehen. Dann der tiefe, schwere Seufzer von Parker:
»Also gut, du hast gewonnen, und ich bin der Trottel mit dem viel zu weichen Herz! Oh Mann, das darf echt nicht wahr sein, ich lass mich von einer fetten Miezekatze versklaven!«
Parker stürmt schnaufend an Watson vorbei in die Küche und erschreckt sich, als der Kater bereits vor seiner Schüssel auf ihn wartet.
»Hey, Dicker, wie haste denn das gemacht?« Antwort? Fehlanzeige! Alles was Parker zu hören bekommt, ist ein ausgiebiges Schmatzen, in das sich jetzt das Klingeln des Telefons mischt. Parker schaut auf die Uhr – fünf vor zwölf–, ein Gratulant auf den letzten Drücker? Schnell hastet er in den Flur und hebt das Telefon von der Station.
»Parker!«
»Verdammt, Lou«, blafft ihn die raue Stimme unvermittelt an, »die Polizei war da! Eigentlich… verdammt… eigentlich wollte ich dir zum Geburtstag gratulieren… aber scheiße, es ist was passiert… du musst sofort zu mir kommen! Ich brauche dich. Jetzt! Irgendeine Drecksau hat Mike umgebracht. Hat ihn massakriert. Lou, ihm wurden die Eier abgeschnitten… Los, schwing deinen Arsch in dein Frauenauto und komm her!«
***
Sie hatten es getan. Gemeinsam. Nach all der Zeit hat er wieder gemordet. Dabei hatte er die Tradition nicht mehr fortsetzen wollen. Es war wider seine Überzeugung gewesen. Er bedeckt sein Gesicht mit beiden Händen. Sie fühlen sich kalt an. Er schließt die Augen. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben.
Es war leicht gewesen, und es war kaum Blut geflossen. Zumindest nicht am Anfang. So ist es fast immer. Nur wenn er mal ungenau zugestochen hatte, weil ihn irgendetwas abgelenkt hatte, schoss das Blut aus der Wunde. Selten, ganz selten, kam das vor. Schließlich weiß er, wie er das Stilett durch die Bauchdecke stechen muss, um die Aorta zu treffen.
Alles eine Frage der Technik. Es ist dabei nicht sehr viel Kraft vonnöten. Und das Blut, es strömt nach innen.
Immer gleich ist auch dieser ungläubige Gesichtsausdruck. Sie scheinen es nie zu fassen, wollen einfach nicht begreifen, dass sie sterben werden. Der Tod kommt innerhalb von nur dreißig bis vierzig Sekunden. Sie verstehen erst, wenn es bereits zu spät ist. Wenn die Kälte sie durchströmt, sie packt, sich ihrer bemächtigt. Er fragt sich, ob sie wissen oder ahnen, warum sie sterben müssen. Fragt sich, was sie in der Sekunde des Todes empfinden. Was sie wahrnehmen, was ihnen als Letztes durch den Kopf schießt.
Und was ist mit Gott? Wird er uns dafür bestrafen?
Es ist ganz leicht. Wenn er sich ihnen nähert, sind sie arglos. Und steht er zu ihnen in der richtigen Position, geht alles ganz schnell. Schwierig ist bloß, den Körper zu halten – tote Körper sind schwerer als lebende–, sodass sie nicht umkippen.
Nein, er hilft ihnen dabei, sich auf den Boden zu legen.
Sanft, auf den Rücken.
Manchmal zucken sie noch, müssen dann nach unten gedrückt werden, bis sie sich beruhigen. Das ist anstrengend.
Nicht so der Letzte, der verhielt sich wie die meisten. Der war verträglich, lag still und friedlich vor ihnen, und er konnte den Gürtel lösen und die Hose öffnen. Um den Schnitt sauber durchzuführen, muss die Hose ein Stück heruntergezogen werden. Dann kommt der unschöne Teil. Doch muss es sein! Das Teppichmesser mit der Hakenklinge, rasch geführt. Jetzt fließt Blut. Aber es schießt nicht heraus, es sickert mehr.
Wenn das Herz einmal aufgehört hat zu schlagen, wird auch kein Blut mehr durch die Venen gepumpt. Dennoch ist es ratsam, Gummihandschuhe zu tragen. Sie schützen die Hände vor dem Schmutz.
***
Jeanne Moreau! Parker muss jedes Mal an die französische Schauspielerin denken, wenn er ihr gegenübersteht. Gerade mal eins sechzig groß und zierlich. Sie trägt die ehemals brünetten Haare unverändert mit Seitenscheitel schulterlang. Ja, sie mag mit den Jahren ergraut sein, doch hat sie kaum an Attraktivität eingebüßt. Fein gezupft und absolut identisch, die schmalen Bogen über den dunklen Augen. Schwarz die Wimpern, schwarz und dünn der Lidstrich. Und rot der volle Mund. Ihre bevorzugten Kleidungsstücke sind Jackett und Bundfaltenhose, immer in schwarz. Dazu hochhackige Stiefeletten oder an warmen Tagen auch mal Pumps. Kein Schmuck, abgesehen von der Submariner aus Stahl an ihrem linken Handgelenk. Natürlich die für den Herrn.
Wie alt sie ist, vermag Parker nicht zu sagen. Er käme nicht im Traum darauf, sie danach zu fragen.
Für ihn, der in diesem Viertel rund um den Eigelstein groß geworden ist, war sie eigentlich schon immer da. Seine Eltern wohnten in einer Wohnung, die ihr gehörte. Sie besaß eine beachtliche Anzahl von Mietshäusern auf dem Eigelstein und in der Weidengasse. Und in seiner Erinnerung war sie schon immer eine große Nummer gewesen. Und das über die Stadtgrenzen hinaus.
In den sechziger Jahren hatte sie einen schwerreichen Industriellen geheiratet. Vier Jahre nach der Hochzeit wurde ihr Mann entführt, und trotz der Zahlung einer sechsstelligen Lösegeldsumme fand man seine Überreste zwei Jahre später verscharrt im Königsforst.
Gerade mal vierzehn Tage darauf wurden an exakt derselben Stelle drei männliche Leichen von Spaziergängern entdeckt. Alle drei hatten mittig auf der Stirn ein Einschussloch. Wie die kriminaltechnische Untersuchung ergab, wurden die Schüsse aufgesetzt abgegeben. Eine Hinrichtung. Die Polizei konnte ihr nie etwas nachweisen.
Seitdem trägt sie im Viertel den Namen »Die schwarze Witwe vom Eigelstein«.
Bereits ein halbes Jahr später heiratete sie ein zweites Mal. Diesmal war es eine bekannte und gefürchtete Milieugröße. Enrico Gemma. Rico, der »der Italiener« genannt wurde, war fast dreißig Jahre älter als sie. Man munkelte hinter vorgehaltener Hand, sie habe ihn nur geheiratet, weil er sie beschützen könne. Immerhin musste sie um ihr Leben fürchten, nachdem die Entführer ihres Mannes tot aufgefunden worden waren. Rico starb im hohen Alter von sechsundneunzig Jahren. Unspektakulär





























