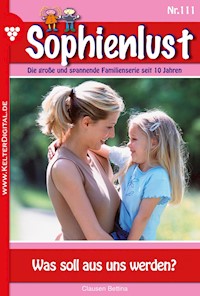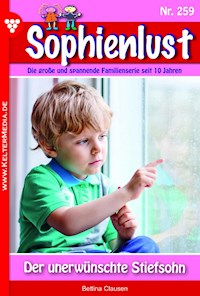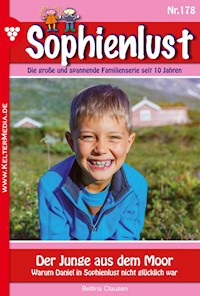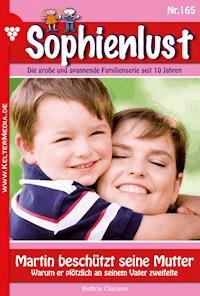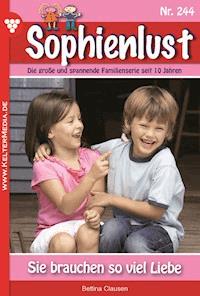Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. Drei Wochen Urlaub! Drei Wochen, auf die sich Eric Peters schon seit Monaten gefreut hatte. Endlich war es so weit. In einer Stunde würde er das Schiff verlassen, auf dem er als Erster Offizier arbeitete. Es war ein deutsches Passagierschiff, das diesmal ohne ihn auslaufen würde. Eric Peters war mit seinen Gedanken schon in Frankfurt bei seiner Frau und seiner Tochter. Eine knappe Stunde später ging er von Bord. Ein Taxi brachte ihn zum Hamburger Hauptbahnhof, wo er im letzten Moment den Intercity-Zug nach Frankfurt erreichte. Von dem Augenblick an dachte er nur noch an seine Tochter und seine Frau, aber eigentlich mehr an seine Tochter. Doris wurde in diesem Sommer vier Jahre alt. Eric zog ein Foto aus seiner Brieftasche. Doris mit einer Puppe im Arm auf seinem Schoß. Süß sah sie aus in ihrer roten Latzhose, mit dem kurz geschnittenen Haar und dem ernsten Gesicht. Senta hatte das Bild aufgenommen. Bei dem Gedanken an seine Frau überschattete sich Erics Gesicht. Ich bin neugierig, worüber sie sich diesmal beschweren wird, dachte er. Er wusste, Senta war nie zufrieden. Vor fünf Jahren, kurz nach der Hochzeit, war er ihr zu arm gewesen. Jetzt verdiente er genug, um ihre kostspieligen Wünsche zu erfüllen, hatte aber zu wenig Zeit für sie. Über irgendetwas beschwerte sich Senta immer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 310 –Komm bald wieder, Papi!
Ein allein erziehender Vater und die Sorge um seine Tochter …
Bettina Clausen
Drei Wochen Urlaub! Drei Wochen, auf die sich Eric Peters schon seit Monaten gefreut hatte. Endlich war es so weit. In einer Stunde würde er das Schiff verlassen, auf dem er als Erster Offizier arbeitete. Es war ein deutsches Passagierschiff, das diesmal ohne ihn auslaufen würde.
Eric Peters war mit seinen Gedanken schon in Frankfurt bei seiner Frau und seiner Tochter. Eine knappe Stunde später ging er von Bord. Ein Taxi brachte ihn zum Hamburger Hauptbahnhof, wo er im letzten Moment den Intercity-Zug nach Frankfurt erreichte. Von dem Augenblick an dachte er nur noch an seine Tochter und seine Frau, aber eigentlich mehr an seine Tochter. Doris wurde in diesem Sommer vier Jahre alt.
Eric zog ein Foto aus seiner Brieftasche. Doris mit einer Puppe im Arm auf seinem Schoß. Süß sah sie aus in ihrer roten Latzhose, mit dem kurz geschnittenen Haar und dem ernsten Gesicht. Senta hatte das Bild aufgenommen.
Bei dem Gedanken an seine Frau überschattete sich Erics Gesicht. Ich bin neugierig, worüber sie sich diesmal beschweren wird, dachte er. Er wusste, Senta war nie zufrieden. Vor fünf Jahren, kurz nach der Hochzeit, war er ihr zu arm gewesen. Jetzt verdiente er genug, um ihre kostspieligen Wünsche zu erfüllen, hatte aber zu wenig Zeit für sie. Über irgendetwas beschwerte sich Senta immer.
Eric seufzte. Dann nahm er seinen Koffer und seinen Mantel und ging zur Tür. Der Intercity näherte sich Frankfurt.
Seine Wohnung lag in einer ruhigen Gegend, am Rande der Großstadt in einem Zweifamilienhaus. Verwundert schaute Eric an der Fassade empor. Sämtliche Fenster waren dunkel. Dabei wusste Senta doch, dass er an diesem Tag kam. Er hatte es ihr geschrieben.
Eric stellte seinen Koffer vor der Haustür ab und suchte nach dem Schlüssel.
Dabei drückte er auf den Klingelknopf. Nichts. Noch einmal. Wieder nichts. Offensichtlich war tatsächlich niemand zu Hause. Und das um neun Uhr abends.
Eric fand seinen Schlüssel und sperrte die Haustür auf. Einen Lift gab es nicht. Das Haus hatte nur zwei Stockwerke. Eric stieg die Treppe empor und schloss im zweiten Stock seine Wohnungstür auf. Dann rief er nach Doris. Das tat er immer, wenn er nach Hause kam. Aber diesmal kam die Kleine ihm nicht entgegengelaufen und warf sich nicht in seine Arme. Dabei hatte er sich gerade darauf am meisten gefreut.
Eric schluckte enttäuscht und knipste das Flurlicht an. Danach stellte er seinen Koffer ab und ging ins Wohnzimmer. Es war aufgeräumt und leer. Das Schlafzimmer ebenfalls.
Auf dem Tisch in der Küche fand Eric einen Brief. Er zögerte, ihn aufzureißen. Eine seltsame Ahnung streifte ihn.
Eric holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank.
Nach einem kräftigen Schluck öffnete er Sentas Brief. Er setzte sich und begann zu lesen. Dass er blass wurde, merkte er nicht. Dass seine Finger zu zittern begannen, sah er auch nicht. Er sah nur die Buchstaben, die vor seinen Augen hin und her tanzten. Senta schrieb, dass sie ihn verlassen habe. Für immer.
Ich gehe nach Südamerika, schrieb sie. Mit einem Mann, der mir alles das bieten kann, was ich von Dir nicht bekommen habe.
Erics Hände zitterten wie im Fieber. Er dachte nur noch an Doris. Wenn sie das Kind mitgenommen hatte …
Doris liegt im Krankenhaus, schrieb Senta weiter.
Eric ließ den Bogen aufatmend sinken. Doris war in Frankfurt. Er hatte sein Kind also nicht verloren. Aber warum war sie im Krankenhaus?
Eric griff wieder nach dem Brief und las weiter. Mumps hatte die Kleine und lag im Städtischen Krankenhaus.
Eric sprang auf und begann im Wohnzimmer hin und her zu laufen. Dann nahm er Sentas Brief und las ihn noch einmal. Es stand noch immer dasselbe darin. Er hatte nicht geträumt. Von Südamerika aus wolle sie die Scheidung einreichen, schrieb Senta.
Soll sie, dachte Eric wütend und schleuderte den Brief weg. Dann schenkte er sich einen Weinbrand ein.
Während er trank, dachte er über die vergangenen Jahre nach. Weil sie verliebt gewesen waren, hatten sie geheiratet. Und vom ersten Tag an hatten sie gestritten. Nein, eine gute Ehe war es nicht gewesen.
Trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, Senta zu verlassen, dachte Eric. Oder sie zu betrügen. Und sie geht mit einem anderen Mann auf und davon, lässt ihr Kind einfach im Stich. Aber eine gute Mutter war sie nie. Und sie wäre es auch nicht geworden, dachte er. Also ist es vielleicht besser so.
Eric stand auf. Im Telefonbuch fand er die Nummer des Städtischen Krankenhauses. Obwohl es schon spät war, rief er noch an.
Am nächsten Tag sei eigentlich keine Besuchszeit, sagte die Nachtschwester an der Pforte. »Aber wenn Sie Ihre Tochter so lange nicht gesehen haben, machen wir natürlich eine Ausnahme. Außerdem würde ich Ihnen raten, mit der Ärztin zu sprechen, die Ihre Tochter behandelt.«
»Das werde ich morgen Nachmittag tun. Vielen Dank für den Rat, Schwester.«
Eric legte auf. Dann holte er Sentas Bild von der Wohnzimmerkommode. Er nahm die Fotografie aus dem Rahmen und warf sie weg.
»Ich werde dir die Mutti ersetzen«, sagte er zu dem Bild von Doris. »Dass sie nicht mehr da ist, wirst du gar nicht merken.« Liebevoll betrachtete er die Aufnahme. Es war die gleiche, die er in seiner Brieftasche trug.
Zwei Monate hatte er Doris nicht mehr gesehen. Bestimmt war sie inzwischen wieder ein Stück gewachsen.
*
Am Nachmittag des nächsten Tages saß Eric im Krankenhaus der Kinderärztin Dr. Schöne gegenüber.
»Doris geht es schon wieder besser«, sagte die Ärztin. »In acht Tagen können wir sie entlassen.«
»Gott sei Dank.« Eric atmete auf. »Ich habe nur drei Wochen Urlaub. Die möchte ich natürlich mit Doris verbringen.«
»Ich verstehe. Nur frage ich mich, was Sie hinterher machen werden.« Eric hatte der sympathischen Ärztin von seiner gescheiterten Ehe erzählt.
»Über dieses Problem denke ich seit heute früh ununterbrochen nach«, gab Eric zu. »Wenn ich einen normalen Beruf hätte, würde ich überhaupt nicht zögern, Doris bei mir zu behalten.«
»Selbst dann wäre es schwierig«, sagte Frau Dr. Schöne. »Bei Ihrem Beruf aber ist es unmöglich, Herr Peters. Haben Sie keine Verwandten, die …?«
»Nein.« Eric schüttelte den Kopf. »Überhaupt keine, leider.«
»Dann bleibt eigentlich nur noch eine Lösung, Herr Peters. Sie müssen Ihre Tochter in ein Heim geben.«
»Nein! Nein, das möchte ich nicht. Ein Heim ist doch …, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.«
»Ich weiß, was Sie meinen, Herr Peters. Nur glaube ich, dass Sie gar keine andere Wahl haben. Außerdem ist Heim nicht gleich Heim. Ich kenne da zum Beispiel eins, das ein wahres Paradies für Kinder ist.«
»Trotzdem«, sagte Eric. »Der Gedanke, Doris in ein Heim zu geben, erschreckt mich. Vielleicht finde ich noch eine andere Lösung. Ich habe ja jetzt drei Wochen Zeit, mich darum zu kümmern.«
Für Frau Dr. Schöne war das Gespräch beendet. Sie stand auf.
»Dann bringe ich Sie jetzt zu Ihrer Tochter.«
Die beiden betraten die Kinderabteilung des Krankenhauses. Vor Zimmer sieben verabschiedete sich die Ärztin von Eric Peters.
Der Besucher betrat ein Zimmer mit vier Betten. Neben dem Fenster lag Doris. Auf ihrem Bettrand saß ein Mädchen, das ungefähr im gleichen Alter sein mochte. Es hielt eine Puppe in den Händen, der Doris gerade ein Kleid anzog. Beide Mädchen schauten nur flüchtig auf, als Eric eintrat.
Plötzlich flog Doris’ Kopf nach oben. Sie ließ die Puppe los und sprang aus dem Bett. »Vati!« Barfuß rannte sie ihm entgegen und warf sich in seine Arme. »Vati!«
Neugierig schauten die drei anderen Mädchen zu.
»Meine Doris!« Eric hielt die Kleine fest in seinen Armen. Er strich ihr übers Haar, küsste sie und presste seine Wange an ihr Gesicht. Dann trug er sie zum Bett und setzte sie hinein.
Das zweite Mädchen räumte schnell die Puppe weg, damit Eric sich auf den Bettrand setzen konnte.
»Das ist mein Vati«, sagte Doris zu den anderen Mädchen. Und zum Vater: »Das sind Ingrid und Bärbel, und das hier ist Heidi. Sie ist meine Freundin geworden. Stimmt’s, Heidi?«
Die Kleine, die vorher mit Doris gespielt hatte, nickte eifrig.
Doris hatte noch immer ein geschwollenes Gesicht. Besonders auffällig waren die Hamsterbäckchen an den Wangen. Zärtlich strich Eric darüber.
»Das geht wieder weg, hat die Tante Doktor gesagt.«
»Natürlich.« Erich räusperte sich. »Sag mal, Schätzchen, hat dich die Mami eigentlich einmal besucht?«
»Nein.«
Eric war auf Tränen gefasst gewesen, hatte sich schon Worte zurechtgelegt, mit denen er sein Töchterchen trösten wollte, aber Doris schüttelte nur den Kopf und sagte trocken: »Sie kommt auch nicht mehr.«
Eric wusste nicht, was er sagen sollte.
»Sie ist für immer weggegangen«, fuhr Doris fort.
»Hat sie das zu dir gesagt?«
»Ja.« Doris nickte.
»Und du bist gar nicht traurig darüber?«
»Nein, Vati. Ich habe ja dich.« Treuherzig schaute die Kleine zu ihm empor.
Eric schluckte und nahm seine Tochter in die Arme. »Du hast recht, Kleines. Solange wir beisammenbleiben, ist alles gut.« Er wusste, dass Doris nicht sonderlich an der Mutter gehangen hatte. Trotzdem hatte er einen Schock befürchtet und war nun froh, dass Doris es so leicht aufnahm.
»In acht Tagen darfst du nach Hause. Dann spielen wir den ganzen Tag zusammen oder machen Ausflüge.«
»Gehen wir auch einmal in den Zoo, Vati?«
»Natürlich. Sooft du willst.«
»Dann könnt ihr mich ja auch einmal besuchen«, warf Heidi ein.
»O ja, Vati!« Doris klatschte in die Hände. »Heidi wohnt in einem Heim mit vielen Tieren und einem großen Garten.«
»In einem Heim?«, fragte Eric.
Die Fünfjährige im Nebenbett nickte. »Kommt ihr wirklich?«
Eric versprach es. Das Heim interessierte ihn. Aber er kam nicht mehr dazu, Heidi auszufragen.
Eine Schwester brachte das Abendessen. Für Eric war das das Signal zu gehen. »Ich komme morgen wieder«, versprach er.
»Bestimmt, Vati?«
»Ganz bestimmt.« Er küsste Doris und verabschiedete sich auch von den anderen Mädchen. Neben Heidis Bett zögerte er einen Augenblick. »Gefällt es dir in dem Heim?«
»Natürlich«, sagte Heidi. Ihr Ton verriet, dass sie seine Frage gar nicht verstand. Natürlich gefiel es ihr. »Allen gefällt es bei uns.«
»Aha.« Eric nickte, obwohl er diesmal derjenige war, der nicht verstand. Wie konnte es Kindern in einem Heim gefallen?
»Sie müssen jetzt leider gehen, Herr Peters«, sagte die Schwester.
Eric nickte. »Ich bin schon unterwegs.« Er warf Doris eine Kusshand zu. »Bis morgen.«
Als die Schwester wieder gegangen war, fragte die kleine Heidi: »Sag mal, Doris, kommt deine Mutti wirklich nicht wieder?«
»Nein. Sie ist nach Amerika gegangen.« Doris biss in ein Schinkenbrötchen.
»Aber deswegen kann sie doch wiederkommen?«
Kopfschütteln. Doris aß den Rest des Brötchens und sagte dann kauend: »Sie hat ja gesagt, dass sie nicht wiederkommt.«
»Warum ist sie überhaupt weggegangen?«
»Weil sie Vati nicht mehr lieb hat«, antwortete Doris gleichgültig.
Da mischte sich Ingrid, das älteste Mädchen im Zimmer, ins Gespräch ein. »Macht es dir gar nichts aus, dass deine Mutti fort ist?«
Doris überlegte. »Ich weiß nicht … Eigentlich nicht. Sie hat sowieso bloß immer geschimpft.«
»Aber sie ist doch deine Mutti«, rief Ingrid.
»Vati hat gesagt, sie war eine Rabenmutti.«
»Dann hast du deinen Vati wohl lieber?«, fragte Heidi.
»Viel lieber. Er würde nie fortgehen und mich allein lassen. Er schimpft auch nicht, und er hat mich noch nie geschlagen.«
»Hat deine Mutti dich geschlagen?«, wollte Heidi wissen.
»Ja, oft.« Doris’ Gesicht bekam einen bockigen Ausdruck. Sie erinnerte sich an Schläge und böse Worte. Lieb und zärtlich war die Mutti nie gewesen. »Sie hat auch nie mit mir gespielt.«
»Warum nicht?«
Doris zuckte mit den Schultern. »Weiß ich nicht. Sie hat immer gesagt, sie hat keine Zeit.«
»Ist sie arbeiten gegangen?«, fragte Ingrid.
»Nein. Mit einem fremden Mann ist sie oft weggegangen, und dann musste ich immer allein bleiben. Einmal habe ich geheult, weil ich Angst hatte. Es war schon dunkel.«
»Und dann?«, fragte Heidi.
»Dann ist Mutti mit dem Mann zurückgekommen, und er hat gesagt, dass ich böse und unartig bin und dass ich eine Tracht Prügel verdient hätte …« Sie begann zu weinen.
»Warum weinst du, Doris?«
»Ich wollte gar nicht unartig sein«, schluchzte Doris. »Ich hatte doch bloß Angst. Es war ganz dunkel und hat geblitzt.«
»Ein Gewitter?«
Doris nickte.
»Dann ist Mutti mit dem Mann ins Wohnzimmer gegangen, und ich musste allein in meinem Zimmer bleiben. Aber ich hatte Angst vor dem Donner. Er hat so laut gekracht und …«
»Und was?«
»Da bin ich doch ins Wohnzimmer gegangen.« Wieder sah Doris dieses grässliche Bild vor sich: Die Mutti in den Armen des fremden Mannes.
»Und was ist dann passiert?«, wollte Ingrid wissen.
»Mutti hat mich geschlagen, weil ich hereingekommen bin.« Doris begann zu weinen.
Heidi kam zu ihr. »Weine doch nicht, Doris.«
Doris schnüffelte und fuhr sich über die Augen.
»Reden wir lieber von etwas anderem«, schlug Ingrid vor. »Erzähle uns von deinem Vati, Doris. Was macht er? Warum ist er nie zu Hause?«
»Weil er auf einem Schiff fährt«, erzählte Doris stolz.
»Wirklich?« Heidis Augen glänzten vor Aufregung. »Ist er ein Kapitän?«
»Wenn er auf einem Schiff fährt, dann ist er ein Matrose«, sagte Ingrid.
Doris widersprach ihr. »Er ist – jetzt hab ich’s vergessen. Aber ihr könnt ihn ja morgen fragen, wenn er kommt.«
Heidi setzte sich auf Doris’ Bett. »Warst du auch schon einmal auf einem Schiff?«
»Noch nicht. Aber irgendwann nimmt mich Vati einmal mit. Das hat er mir versprochen.«
*
Eric verbrachte den Rest des Tages in seinem Stammlokal. Die leere Wohnung ertrug er nicht. Er bestellte sich ein Bier, einen Klaren und ein Wiener Schnitzel.
Der Wirt selbst bediente ihn. Die beiden kannten sich seit vielen Jahren.
»Auch wieder einmal im Lande, Herr Peters?«
»Ja, drei Wochen Urlaub. Trinken Sie einen Klaren mit mir?«
»Danke, gern.« Der Wirt schenkte ein. »Wie geht’s der Familie?«
Eric musste lachen. »Meine Tochter liegt mit Mumps im Krankenhaus, meine Frau ist mir davongelaufen. Prost!«
»Prost«, sagte der Wirt erschrocken und kippte den Schnaps hinunter. »Das tut mir leid, Herr Peters.«
»Das mit der Frau oder das mit der Tochter?«, fragte Eric in einem Anflug von Zynismus.
»Beides, Herr Peters.«
Eric winkte ab. »Meiner Frau traure ich nicht nach, und Doris wird wieder gesund.«
»Und wo werden Sie das Kind lassen?«, fragte der Wirt und traf damit den Kern des Problems.
Eric seufzte.
»Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich möchte Doris nicht in ein Heim geben, aber«, er zuckte mit den Schultern, »eine andere Lösung fällt mir nicht ein.«
Der Wirt wusste, dass Eric keine Verwandten hatte. »Wenn Sie wollen, höre ich mich einmal um. Es gibt doch oft alleinstehende Frauen, die gern ein Pflegekind annehmen würden.«
Eric nickte. »Das wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall besser als ein Heim. Wenn Sie etwas hören …«