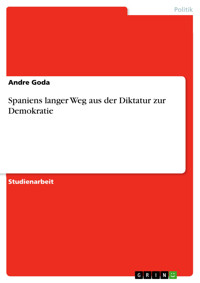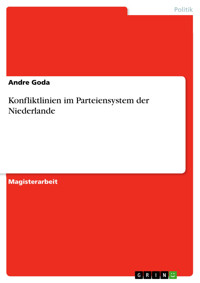
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Region: Westeuropa, Note: 2, Universität Osnabrück (Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Niederlande blicken auf eine lange bürgerlich-demokratische Tradition in Verbindung mit einer parlamentarischen Monarchie zurück. Das heutige politische System der Niederlande ist eine seit Jahrzehnten bestehende Konkor-danzdemokratie, die auf Konsens- und Kompromissfindung angelegt ist und so die Stabilität des politischen Systems sichert. Die Verständigung durch Kooperation und Kompromiss ist insbesondere ein Merkmal des niederländischen Parteiensystems. Da im Verhältniswahlrecht nur eine geringe Sperrklausel von 0,67 % existiert, genügt bereits ein sehr geringer Stimmenanteil, um in die zweite Kammer einzuziehen. Dementsprechend sind auch regelmäßig zwischen acht und zehn Parteien im Parlament vertreten. Dieses Vielparteiensystem erweist sich aufgrund der Konsensorientierung im Kern als äußerst stabil. Für die soziologische Struktur, die dem politischen System der Konkordanz-demokratie in den Niederlanden zugrunde lag, haben führende Sozialwis-senschaftler den anschaulichen Begriff der „Versäulung“ verwandt (Lepszy 1979, 13). Mit dem Begriff „Versäulung“ wurde bildhaft deutlich gemacht, dass in den Niederlanden religiös und ideologisch voneinander getrennte „Säulen“ nebeneinander existierten, ohne dass zwischen ihnen ein hohes Maß an Kommunikation und sozialer Integration festzustellen wäre. Die „Säulen“ bildeten sich aus Katholiken, Protestanten, Sozialisten und Liberalen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Page 4
Abkürzungsverzeichnis
ANWV Algemeen Nederlands Werkliedenverbond
AOV Algemeen Ouderen Verbond
ARP Anti-Revolutionaire Partij
BP Boerenpartij
CDA Chisten-Democratish Appél
CDU Chistelijk-Democratische Unie
CHU Christelijk-Historische Unie
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CPB Centraal Planbureau
CPN Communistische Partij van Nederland
DCP De Constitutioneele Partij
D´66 Democraten 66
DS´70 Democratish-Socialisten 70
EVP Evangelische Volkspartij
GPV Gereformeerd Politiek Verbond
LN Leefbar Nederland
LPF Lijst Pim Fortuyn
LSP Liberale Staatspartij
LU Liberale Unie
KVP Katholieke Volkspartij
NKV Nederlands Katholiek Vakverbond
NVV Nederlands Verbond van Vakbewegingen
NWV Nederlandse Werkliedenverbond
PPR Politieke Partij Radikalen
PSP Pacifistisch-socialistische Partij
PvdA Partij van de Arbeid
PvdV Partij van de Vrijheid
RKSP Rooms-Katholieke Staatspartij
RKWV Rooms-Katholiek Werkliedenverbond in Nederland
RPF Reformatorisch Politieke Federatie
SDAP Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
SDB Sociaal-Democratischen Bond
SER Sociaal-Enconomische Raad
SGP Staatskundig Gereformeerde Partij
SvdA Stichting van de Arbeid
VDB Vrijzinning Democratische Bond
VVD Verenigung voor Vrijheid en Democrat
Page 5
Page 1
1. Einleitung
„The two basic cleavages which divide the Dutch population are class and religion. Religious differences are felt deeply and have a long historical background in the Netherlands“ (Lijphart 1968, 16).
„Perhaps the best example of institutionalized segmentation is found in the Netherlands; in fact, the Dutch wordVerzuilinghas recently become a standard term for tendencies to develop vertical networks (zuilen, columns or pillars) of associations and institutions to ensure maximum loyalty to each church and to protect the supporters from cross-cutting communications and pressures.“ (Lipset/ Rokkan 1990, 103).
Die Niederlande blicken auf eine lange bürgerlich-demokratische Tradition in Verbindung mit einer parlamentarischen Monarchie zurück. Das heutige politische System der Niederlande ist eine seit Jahrzehnten bestehende Konkordanzdemokratie, die auf Konsens- und Kompromissfindung angelegt ist und so die Stabilität des politischen Systems sichert. Die Verständigung durch Kooperation und Kompromiss ist insbesondere ein Merkmal des niederländischen Parteiensystems. Da im Verhältniswahlrecht nur eine geringe Sperrklausel von 0,67 % existiert, genügt bereits ein sehr geringer Stimmenanteil, um in die zweite Kammer einzuziehen. Dementsprechend sind auch regelmäßig zwischen acht und zehn Parteien im Parlament vertreten. Dieses Vielparteiensystem erweist sich aufgrund der Konsensorientierung im Kern als äußerst stabil.
Für die soziologische Struktur, die dem politischen System der Konkordanzdemokratie in den Niederlanden zugrunde lag, haben führende Sozialwissenschaftler den anschaulichen Begriff der „Versäulung“ verwandt (Lepszy 1979, 13).
Mit dem Begriff „Versäulung“ wurde bildhaft deutlich gemacht, dass in den Niederlanden religiös und ideologisch voneinander getrennte „Säulen“ ne-beneinander existierten, ohne dass zwischen ihnen ein hohes Maß an Kommunikation und sozialer Integration festzustellen wäre. Die „Säulen“ bildeten sich aus Katholiken, Protestanten, Sozialisten und Liberalen. Historisch gesehen ließe sich die Versäulung sowie die damit entstandenen Konflikte der verschiedenen kulturellen und sozialen Gruppen bis ins 16.
Page 2
Jahrhundert zurückverfolgen, doch erst im Voranschreiten der Demokratie-und Parteienentwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etablierte sich die Versäulung.
Der Begriff der „Versäulung“ hat sich in der politischen Alltagssprache und in der Literatur niedergelassen. Dennoch hat sich bis heute keine eindeutige Definition herausgebildet. Rudolf Steininger hat sich in seiner vergleichenden Untersuchung der Versäulungsstruktur in den Niederlanden und Österreich dem Definitionsproblem angenommen (Steininger 1975, 38-51).1Steininger bezieht sich in seiner Untersuchung vor allem auf die Definition von J. P. Kruijt und Walter Goddijn in „Versäulung und Entsäulung als soziale Prozesse“.
„Wenn in einem Lande bedeutende Gruppen unterschiedlicher religiöser oder weltanschaulicher Prägung mit Hilfe einheitlich ausgerichteter und kontrollierter Organisationen und Einrichtungen die gleiche gesellschaftliche Aufgabe für ihre Gruppenzugehörigen zu erfüllen suchen, wird man von Versäulung sprechen.“ (Goddijn/Kruijt 1965, 143)
Steininger kritisiert ihre Definition von Versäulung aufgrund der begrifflichen Unschärfe und der daraus resultierenden analytischen Unbrauchbarkeit. Seiner Auffassung nach sei es falsch, den Begriff der „Versäulung“ gleichermaßen auf die gesamte niederländische Gesellschaft und auf die Struktur der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen anzuwenden. Ein weiterer Aspekt seiner Kritik bezieht sich auf die ungenaue Trennung in der Definition, dass heißt auf die Frage, ob der Begriff der „Versäulung“ einen institutionalisierten Zustand oder einen soziologischen Prozess beschreibt. An dieser Unterscheidung entwickelte Steininger seine eigenen nun folgenden Definitions-vorschläge, in denen er zwischen „Versäulung“ und „Versäultheit“ unterscheidet:
„Versäulung ist der Prozess der politischen Mobilisierung kategorialer Gruppen, bei gleichzeitiger, weltanschaulicher oder religiös motivierter, tendenziell vollständiger Konzentration der Sozialbe-1Diefolgenden Ausführungen stützen sich wesentlich auf die Diskussion bisheriger Definiti- onen von „Versäulung“, die von R. Steininger untersucht worden sind.
Page 3
ziehungen möglichst aller Mitglieder auf die eigene kategoriale Gruppe.“ (Steiniger 1965, 39.)
„Versäultheit ist die institutionelle Absicherung der gleichberechtigten Teilnahme aller relevanten Gruppierungen am politischen Entscheidungsprozess in demokratisch verfassten, weithin durch Versäulung geprägten Gesellschaften.“ (Steininger 1965, 51.) Die Struktur der Versäulung führte zu einer vollständigen Integration des einzelnen Bürgers in die jeweiligen gesellschaftlichen Bereiche seiner Säule. Die Versäulung konnte sogar soweit gehen, dass ein niederländischer Bürger in seinem ganzen Leben nur Personen und Einflüsse aus seiner eigenen „Säule“ kennen lernte. Zur Verständigung zwischen den einzelnen „Säulen“ kam es in den Führungseliten der Parteien. Die Führungseliten arbeiteten auf höchster Ebene zusammen und führten und leiteten die Niederlande als Staat.
Das auf der Versäulung beruhende Parteiensystem erwies sich bis in 1960er als äußerst stabil. Von da an kam es zu ökonomischen Wachstums- und Strukturproblemen sowie zur Auflösung traditioneller Werte und gesellschaftlicher Strukturen. Dieser Prozess wurde mit dem Begriff der „Entsäulung“, der „Auflockerung der bisher streng voneinander segmentierten Säulen“, beschrieben (Lepzsy 1979, 300). Der Entsäulungsprozess hatte weit reichende Folgen für das Parteiensystem und die Parteienentwicklung der Niederlande und wirkt sich bis in die Gegenwart aus.
Das Parteiensystem der Niederlande ist im Verlauf des 19. Jahrhunderts ent-standen und entwickelte sich entlang verschiedener Konfliktlinien. Die Ursprünge sind in den Massenemanzipationsbewegungen des 19. Jahrhunderts zu sehen. Dabei schlossen sich große Bevölkerungsgruppen entlang der Klassen- und vor allem auch der Konfessionslinien (katholisch, niederländisch reformiert und calvinistisch) zusammen. Diese Spaltung der Gesellschaft fand ihren Niederschlag auch in der Ausgestaltung des Parteiensystems wieder. Zwischen diesen politischen und kulturellen Milieus entbrannten regelmäßige Konflikte.
Page 4
Die Auswirkungen und Folgen dieser Konfliktlinien für die Entstehung und weitere Entwicklung des niederländischen Parteiensystems stehen als Un-tersuchungsgegenstand im Mittelpunkt meiner Arbeit mit dem Titel „Konfliktlinien im Parteiensystem der Niederlande“.
Das Ziel der Arbeit ist es, die These zu untersuchen, ob der Bedeutungsverlust der traditionellen Konfliktlinien in Folge der Entsäulung Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des niederländischen Parteiensystems hatte oder haben wird.
Um diese These zu untersuchen, stehen die folgenden Fragen im Mittelpunkt der Arbeit:
1. Welche Rolle spielten die Konfliktlinien bei der Entwicklung des Parteiensystems und dem folgenden Prozess der „Versäulung“?
2. Welche Auswirkungen und Folgen hatte der Prozess der „Entsäulung“ auf die Konfliktlinien im Parteiensystem der Nieder-lande?
In diesem Zusammenhang treten zunächst folgende Fragen auf: Was sind Konflikte beziehungsweise Konfliktlinien? Welche Verbindung gibt es zwischen Konfliktlinien und Parteiensystemen?
Um diesen Fragen zu bearbeiten, werde ich im ersten Teil meiner Arbeit die von Seymour M. Lipset und Stein Rokkan in „Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments“ (Lipset/ Rokkan 1990, 91-138) dargestellte Theorie der sozialen Konfliktlinien erläutern. Lipset und Rokkan analysieren darin systematisch den Zusammenhang zwischen Konflikten innerhalb einer Gesellschaft und deren Auswirkungen auf das Parteiensystem. Die Theorie führt die Struktur der westeuropäischen Parteiensysteme auf die Zahl und Art, der in einer Gesellschaft vorhandenen Konfliktlinien oder politischen Spaltungslinien zurück.
Page 5
Sie unterscheiden dabei vier verschiedene Kategorien - die sozialstrukturelle, die interessensorientierte, die wertorientierte und die parteipolitische Ka-tegorie. Die Theorie der sozialen Konfliktlinien nennt im Hinblick auf die europäische Demokratisierung vier zentrale Konfliktlinien:1.Zentrum-Peripherie2.Kirche-Staat3.Stadt-Land4.Arbeit-Kapital
Im Weiteren beschreiben Lipset und Rokkan die Ursachen dauerhaft institutionalisierter Konfliktlinien. Wenn Eliten gesellschaftliche und soziale Konflikte aufgreifen, können sie diese in Parteipolitik je nach Rahmen des politischen Systems umsetzen. Hintergrund dieser Politik ist, dass Parteien regelmäßig Konflikte aktivieren, um politische Identität und Parteibindung zu aktivieren oder zu erneuern. Die Theorie sozialer Konfliktlinien verknüpft Auswirkungen sozioökonomischen und sozialen Wandels mit dem Handeln politischer Eliten. Diese Frage nach dem Verhältnis von gesellschaftlichen Konflikten und Parteiensystemen berührt zentrale Felder der Demokratiethe-orie, da Parteien einen Hauptbestandteil moderner Demokratien darstellen. Die Parteien sollten eine intermediäre Organisation repräsentieren, die zwischen Gesellschaft und Politik vermittelt.
Abschließend stellen Lipset und Rokkan die These auf, dass die Wettbewerbsstrukturen der Parteien der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts eine Widerspiegelung der politischen Konfliktlinien, die am Ende des Ersten Weltkrieges ausdifferenziert wurden, waren. Sie bezeichneten diese These als „freezing-hypothesis“, d. h. als Annahme von einem „Einfrieren der sozialen Konfliktlinien“.
Das Modell der vier zentralen Konfliktlinien wurde in der Folgezeit zumindest für die entwickelten Demokratien um eine weitere Konfliktlinie ergänzt. In „Kultureller Umbruch - Wertewandel in der westlichen Welt“ sah Ronald Inglehart als Folge des Übergangs zur postindustriellen Gesellschaft das
Page 6
Aufkommen einer neuen Konfliktlinie, die er als Materialismus-Postmaterialismus-Konfliktlinie bezeichnete (Inglehart 1990). Durch den aufkommenden Werte- und Interessenwandel Mitte und Ende der 1960er Jahre veränderten sich die Parteiensysteme allmählich. Die Auswirkungen dieser Wandlungsprozesse betrafen auf der einen Seite das Verhältnis von sozialen Gruppen und Parteien, sowie auf der anderen Seite den aufkommenden Wandel in den Einstellungen und Werten vorwiegend jüngerer Menschen. Dieser neue Konflikt überlagert beziehungsweise verdrängt zunehmend den alten Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital, dass heißt den Gegensatz zwischen sozialdemokratischen und bürgerlichen Positionen. Lipset und Rokkan wollten mit der Theorie sozialer Konfliktlinien ein allgemein gültiges Modell für das Verhältnis zwischen den gesellschaftlichen Konfliktlinien und den westeuropäischen Parteiensystemen herstellen. Im zweiten Teil meiner Arbeit nenne ich die für die Niederlande entscheidenden Konfliktlinien. Unter der Berücksichtigung der zuvor von Lipset und Rokkan dargelegten Ergebnisse wird die Entstehung der Konfliktlinien in den Niederlanden dargestellt.
Im Vordergrund stehen vor allem die Konfliktlinien, die prägend für die Entwicklung des Parteiensystems waren, der Staat-Kirche-Konflikt sowie der Arbeit-Kapital-Konflikt.
Der Staat-Kirche-Konflikt in den Niederlanden gliedert sich in zwei Phasen. Die erste Phase beschreibt die Entwicklung der konfessionellen Konfliktlinie seit dem 16. Jahrhundert. Die zweite Phase kennzeichnet den Konflikt zwischen den Katholiken und Protestanten auf der einen Seite und den Liberalen auf der anderen Seite Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch der Arbeit-Kapital-Konflikt gliedert sich in zwei Phasen. Die erste Phase ist der Konflikt zwischen der sozialistischen Arbeiterbewegung und dem liberalen Großbürgertum, das vor allem aus Unternehmern und Kapitaleignern bestand.
Die zweite Phase ist gekennzeichnet vom Arbeit-Kapital-Konflikt innerhalb der konfessionellen Lager. Sowohl Arbeiter als auch Unternehmer waren Mitglieder der katholischen und protestantischen Kirche, dadurch wurde der Konflikt innerhalb des jeweiligen konfessionellen Lagers ausgetragen.
Page 7
Der vierte Teil beschreibt zunächst die parlamentarische Entwicklung in den Niederlanden bis ins 20. Jahrhundert. Dadurch wird zunächst ein allgemein historischer Überblick vermittelt sowie eine weitere Grundlage für das Verständnis des Entstehens des Parteiensystems gelegt. Weiterhin wird der Prozess der Versäulung in den Niederlanden dargestellt. Zur Einführung wird die Bedeutung des Begriffes „Säule“ erläutert sowie die Dynamik der einzelnen Bevölkerungsgruppen zur Bildung von ideologisch, religiös und weltanschaulich getrennten „Säulen“. In den darauf folgenden Unterkapiteln wird die Entwicklung der protestantischen, katholischen, sozialistischen und liberalen Säule dargestellt.
Des Weiteren steht die Rolle der traditionellen Konfliktlinien im Prozess der Versäulung im Vordergrund. Dabei wird vor allem auf den Prozess der Konfliktregelung innerhalb des Parteiensystems eingegangen. Als wichtiges Ereignis steht dabei die 1917 errungene „Pacificatie“ im Vordergrund. Abschließend wird die Blütezeit der Versäulung von 1945 bis 1965 untersucht. Für die weitere Entwicklung des Parteiensystems ist die Wiederaufnahme der Versäulung nach dem Krieg ein wichtiges Ereignis und beschreibt die ersten Anzeichen für die beginnende „Entsäulung“. Das fünfte Kapitel stellt den Prozess der „Entsäulung“ in den Niederlanden dar. Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die Ereignisse, die Veränderungen und die Folgen, die durch die Krisenphase Mitte der 1960er Jahre ausgelöst worden sind. Anhand der Darstellung neuer Parteien, der Wahlergebnisse von 1967 bis 2003, dem Zusammenschluss der konfessionellen Parteien sowie der Liste Pim Fortuyn wird der Wandel innerhalb des Parteiensystems untersucht.