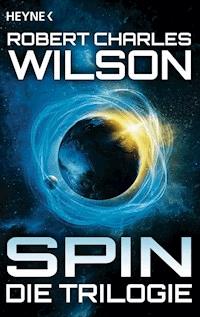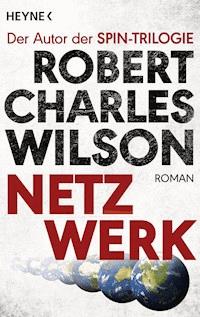4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Amerika im Jahr 2014. Die achtzehnjährige Cassie lebt in einer scheinbar perfekten Welt: Seit hundert Jahren herrscht Frieden, es gab keine Wirtschaftskrisen und keine Anschläge am 11. September 2001. Stattdessen regieren Wohlstand und soziale Sicherheit. Doch der Preis für das schöne Leben ist hoch: Was es nämlich ebenfalls nicht gibt, sind Fortschritt und Freiheit, denn die Menschen werden seit Jahrzehnten von einer außerirdischen Spezies kontrolliert. Als Cassie eines Tages hinter das Geheimnis ihrer heilen Welt kommt, gerät sie in Lebensgefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Die achtzehnjährige Cassie Iverson lebt im Paradies – denn nichts weniger ist Amerika im Jahr 2014: Die Wirtschaft boomt, es gibt keine sozialen Ungleichheiten, und das Land feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: hundert Jahre Frieden. Aber der Preis für dieses scheinbar so perfekte Leben ist hoch, ist das Land doch auf dem technologischen Stand der 1950er-Jahre stehen geblieben und eine freie Kommunikation der Menschen untereinander unmöglich. Das weiß niemand besser als Cassie selbst, denn ihre Eltern wurden acht Jahre zuvor ermordet, weil sie die Wahrheit hinter der heilen Welt entdeckten: Die Erde wird von einer geheimnisvollen außerirdischen Macht kontrolliert. Einer Macht, die keine Gnade kennt, wenn es darum geht, den Status quo zu erhalten. Auch Cassie weiß davon, und als die Mörder ihrer Eltern eines Tages vor dem Haus ihrer Tante auftauchen, wo sie mit ihrem kleinen Bruder lebt, muss sie fliehen. Für Cassie beginnt eine gefährliche Odyssee quer durch die USA, an deren Ende sich das Schicksal der Menschheit entscheiden wird …
Der Autor
Robert Charles Wilson, geboren 1953 in Kalifornien, wuchs in Kanada auf und lebt mit seiner Familie in Toronto. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren der modernen Science-Fiction. Er hat zwölf Romane veröffentlicht, darunter den Bestseller Die Chronolithen, der 2001 auf der New-York-Times-Bestenliste stand. Neben zahlreichen Nominierungen wurde er mehrfach für seine Romane ausgezeichnet, unter anderem mit dem Philip K. Dick Award, dem John W. Campbell Award und dem Hugo Award. Zuletzt ist von Robert Charles Wilson im Heyne Verlag die Spin-Trilogie erschienen.
Mehr über Robert Charles Wilson und seine Romane erfahren Sie auf:
diezukunft.de
Robert Charles Wilson
KONTROLLE
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Friedrich Mader
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
BURNING PARADISE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 02/2017
Redaktion: Tamara Rapp
Copyright © 2013 by Robert Charles Wilson
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,unter Verwendung von shutterstock / stockmdm
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-15463-9V001
www.diezukunft.de
»Der Geist glaubt von Natur, und der Wille liebt von Natur, sodass sie in Ermangelung eines wahren Gegenstandes sich an einen falschen hängen müssen.«
– Blaise Pascal
ERSTER TEIL
UNAUSSPRECHLICHEWAHRHEIT
»Die Natur ist bewusstlos, doch siebeherrscht die Kunst der Täuschung.«
Ethan Iverson:Der Fischer und die Spinne
1
Buffalo, New York
Alles, was danach kam, hätte sich vielleicht anders abgespielt – oder wäre möglicherweise gar nicht geschehen –, wenn Cassie in dieser Nacht nicht wach gelegen hätte.
Sie wollte schlafen und hatte es auch versucht. Pflichtbewusst war sie um halb zwölf ins Bett gegangen, doch jetzt war es schon nach drei Uhr, und ihre Gedanken kreisten und kreisten. Schließlich stand sie auf und schaltete das Licht an. Sie schlüpfte in eine graue Trainingshose und ein gelbes Flanellhemd und tappte barfuß über den kalten Parkettboden im Gang zur Küche.
Es kam nicht oft vor, dass sie allein in der Wohnung war. Wenn man von Thomas absah natürlich. Thomas war ihr zwölfjähriger kleiner Bruder, der in seinem Zimmer nebenan fest schlief. Cassie und Thomas lebten bei ihrer Tante Nerissa, und für Cassie war das hier immer noch Tante Ris’ Apartment, obwohl sie inzwischen schon seit fast sieben Jahren hier zu Hause war. Normalerweise hätte ihre Tante um diese Zeit auf dem Ausziehsofa im Wohnzimmer gelegen, doch heute Abend hatte sie sich mit jemandem zu einer Verabredung getroffen, und das hieß, dass sie vielleicht erst am Samstagnachmittag zurückkommen würde.
Cassie hatte sich über die Gelegenheit gefreut, endlich mal allein zu sein. Sie war achtzehn, hatte im Frühjahr ihren Highschool-Abschluss gemacht und arbeitete jetzt tagsüber drei Straßen weiter im Kaufhaus Lassiter. Rechtlich und auch sonst in jeder Hinsicht war sie erwachsen, auch wenn Tante Ris noch immer eine überfürsorgliche Haltung erkennen ließ. Auch diesmal hatte sie vor dem Ausgehen ein völlig unnötiges Theater gemacht: Kommst du alleine klar? Ja. Ganz bestimmt? Natürlich. Und du passt gut auf Thomas auf? Sicher! Jetzt fahr schon und amüsier dich. Mach dir keine Sorgen um uns!
Cassie und Thomas hatten einen netten, entspannten Abend zusammen verbracht, der wie im Flug verging. In der Wohnung gab es keinen Fernseher, und sie hatte nach dem Essen Musik laufen lassen. Wie üblich machte Bachs Wohltemperiertes Klavier ihren Bruder schläfrig, während es Cassies Kopf durchdrang wie das Läuten einer göttlichen Glocke, die noch in ihr nachhallte, als Thomas schon längst im Bett lag und es im Haus unheimlich still geworden war. Schließlich hatte sie außer der Lampe auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer alle Lichter gelöscht und sich mit einer Schüssel Popcorn und einem Buch auf dem Sofa eingerichtet, bis ihr die Augen zufielen.
Warum schlich sie dann jetzt herum wie eine nervöse Katze? Cassie öffnete den Kühlschrank. Auf nichts darin hatte sie Lust. Der Linoleumboden unter ihren Füßen war kalt. Sie hätte Pantoffeln anziehen sollen.
Schließlich schob sie einen Küchenstuhl ans Fenster und setzte sich hin. Als sie die Ellbogen auf das verstaubte Fensterbrett stützte, bemerkte sie hinter der Baumwolljalousie die Leichen von sechs Sommerfliegen. »Widerlich«, murmelt sie leise. Der November hatte Kälte und Stürme gebracht, und wie tastende Finger stahl sich durch das einfache Fenster ein Hauch spätherbstlicher Luft herein.
Das Fenster zeigte auf die Liberty Street. Tante Ris’ Apartment lag über einem Geschäft, das Gebrauchtmöbel reparierte und verkaufte, in einem zweistöckigen Backsteinbau, der sich in nichts von den anderen im Block unterschied. Die unmittelbaren Nachbarn waren ein chinesisches Restaurant links und ein schmuddeliger Antiquitätenladen rechts. Von ihrem Platz aus konnte Cassie das breite Schaufenster des Supermarkts und ein halbes Dutzend andere Geschäfte bis hinauf zur Pippin Street und zur Antioch Avenue sehen. Nicht viel Verkehr um diese Zeit, doch die Nachtclubs im Vergnügungsviertel machten gerade erst zu. In anderen rastlosen Freitagnächten – selbst zu besten Zeiten hatte Cassie höchstens einen unruhigen Schlaf – hatte sie beobachtet, wie irgendwelche Kerle in betrunkener Selbstvergessenheit über rote Ampeln fuhren und den Motor aufheulen ließen, um ihre Männlichkeit auszuleben. Doch jetzt lag die Straße wie ausgestorben da. Kein Fußgänger weit und breit.
Nein, nicht ganz. Da war ein einzelner Passant: ein Mann, der allein am Ende der schmalen Gasse zwischen dem Supermarkt und dem Antiquariat Tuck’s stand.
Cassie hatte ihn zunächst nicht entdeckt, weil an den hohen Masten der Straßenlampen Fahnen wehten. Diese waren vor zwei Tagen von der Stadt aufgezogen worden. Der Waffenstillstand von 1914 wurde jeden November mit einer Parade begangen, doch diesmal machte die Stadt (wie auch der Staat, das Land und die ganze Welt) eine richtig große Sache aus dem Jubiläum: hundert Jahre Frieden. Relativer Frieden. Annähernder Frieden.
Den Waffenstillstandstag hatte Cassie immer geliebt. Neben Weihnachten war das für sie der schönste Feiertag. Sie erinnerte sich noch gut, wie ihre Eltern sie in Boston zur Parade mitgenommen hatten – erinnerte sich an die Straßenverkäufer, die in Papier eingeschlagene geröstete Esskastanien anboten, an die unwahrscheinlich bunten Trachten der Schulkinder auf den Umzugswagen, an das lärmende Durcheinander der Highschool-Blaskapellen. Durch den gewaltsamen Tod ihrer Eltern hatte Cassie Dinge über die Welt erfahren, die bei einer Parade zu Ehren des Waffenstillstandstags keine Beachtung fanden. Trotzdem fühlte sie noch immer eine bittersüße Sehnsucht nach dieser Zeit.
Eine im frischen Wind flatternde Jubiläumsflagge zeigte den Mann im Schatten immer nur kurz, bevor sie ihn wieder verdeckte. Jetzt, da sie ihn bemerkt hatte, konnte Cassie den Blick nicht mehr von ihm abwenden. Dabei war seine Erscheinung ganz durchschnittlich. Wahrscheinlich ein Geschäftsmann, der passend zur Jahreszeit einen grauen, bis zu den Knien reichenden Mantel und einen Filzhut trug. Was Cassie beunruhigte, war das Gefühl, dass er zu ihr hinaufgeschaut und sich sofort abgewandt hatte, als sie auf ihn aufmerksam wurde.
Andererseits, was war schon dabei? Um diese Zeit war außer ihrem vielleicht kein einziges anderes Fenster in der ganzen Straße beleuchtet. Warum sollte ihm das nicht auffallen? Nur eine tief verwurzelte Gewohnheit machte sie misstrauisch. Tante Ris und die anderen Überlebenden der Korrespondenzunion aus der Gegend hatten Cassie geheime Regeln eingeschärft, deren erste die einfachste war: Vorsicht vor Fremden, die Aufmerksamkeit bekunden.
Der einsame Unbekannte sah nicht mehr hinauf zu ihrem Fenster, doch sein Interesse galt anscheinend weiterhin dem Haus, in dem sie wohnte. Sein Blick wirkte seltsam leer und starr – bei genauerer Betrachtung sogar leicht irre. Cassie spürte einen Knoten im Magen. So was musste natürlich ausgerechnet dann passieren, wenn Tante Ris nicht da war. Wobei eigentlich nichts passiertwar. Trotzdem hätte sie jetzt gern jemanden gehabt, um eine zweite Meinung einzuholen. Sollte sie sich wirklich Sorgen machen wegen eines einsamen Mannes, der nach Mitternacht auf der Straße stand und dem Wind trotzte? Die Vorstellung der leeren Zimmer um sie herum und der vielen Schatten darin machte es Cassie schwer, die Sache nüchtern abzuwägen.
Sie war so in diese Gedanken versunken, dass sie erschrak, als der Wind die Jubiläumsfahne erneut hochriss und den Blick auf den Unbekannten freigab. Er war mehrere Schritte weit aus der Gasse heraus auf den Gehsteig getreten und stand jetzt mit den Spitzen seiner braunen Schuhe direkt am Bordstein zur Liberty Street. Sein Gesicht war wieder nach oben gewandt, und obwohl Cassie seine Augen nicht erkennen konnte, malte sie sich unwillkürlich die Anspannung aus, mit denen sie das Haus erkundeten. Schnell zog sie den Kopf ein und huschte durch die Küche, um die Deckenleuchte auszuschalten. Jetzt konnte sie ihn aus dem Schatten heraus beobachten.
Bis zu ihrer Rückkehr zum Stuhl am Fenster hatte er sich kaum merklich bewegt. Ein Fuß stand auf dem Gehsteig, der andere schon auf der Straße. Was kam als Nächstes? War er womöglich bewaffnet? Hatte er vor, die Straße zu überqueren, das Haus zu betreten, an die Wohnungstür zu klopfen? Sie einzuschlagen, wenn niemand öffnete? Wenn es so weit kam, wusste Cassie, was sie zu tun hatte: Thomas holen und mit ihm über die Feuertreppe fliehen. Und, wenn sie sicher sein konnte, dass ihnen niemand folgte, zum Haus des nächsten Korrespondenten rennen … auch wenn der nächste Korrespondent der unsympathische Leo Beck war, der in einem billigen Apartment fünf Straßen weiter Richtung See wohnte.
Doch nun schien der Mann wieder zu zögern. Hätte ein Mörder gezögert? Natürlich hatte sie keinen echten Grund, ihn für einen Killer oder ein Simulakrum zu halten. Seit der Serie von Morden vor sieben Jahren hatte es keine Gewalt mehr gegeben. Wahrscheinlich war der Mann bloß betrunken und enttäuscht nach einer glücklosen Nacht in den Bars, oder vielleicht litt er genauso an Schlaflosigkeit wie Cassie. Das Interesse an dem Haus, in dem sie wohnte, war sicher nur eine optische Täuschung; möglicherweise hatte er bloß sein Spiegelbild im Schaufenster des Möbelgeschäfts Pike Brothers angestarrt.
Jetzt machte er einen weiteren Schritt hinaus auf die Straße. Genau in diesem Moment bog von der Pippin Street ein Auto in die Liberty Street. Eine dunkle Limousine, ob blau oder schwarz konnte sie im fahlen Licht der Straßenlampen nicht genau erkennen. Der Wagen kam schlingernd um die Ecke geschossen, und der Motor heulte laut auf. Der Fahrer war offenbar betrunken.
Der einsame Unbekannte schien nichts davon zu merken. Als wäre er zu einem Entschluss gelangt, schritt er über die Straße, während das Auto auf ihn zuraste. Cassie wollte ihren Augen nicht trauen, als sie vom Wagen zu dem Passanten blickte und unwillkürlich die Bewegungslinien der beiden überschlug. Das Auto musste doch in letzter Sekunde ausweichen! Oder konnte der Fremde gerade noch rechtzeitig zur Seite springen?
Weder das eine noch das andere geschah.
Die Jubiläumsflagge knatterte zweimal im Novemberwind. Cassie drückte die Stirn gegen die kalte Glasscheibe. Ihre Hände umklammerten das fliegenübersäte Fensterbrett, und sie beobachtete mit klopfendem Herzen, wie aus der Möglichkeit eines Zusammenstoßes in Sekunden etwas Unvermeidliches und zuletzt eine grausige Tatsache wurde.
Die Stoßstange des Autos traf den Fußgänger auf Höhe der Knie. Er wurde umgerissen und kippte unter die Kühlerhaube, als hätte sie ihn verschluckt. Einen schrecklichen Moment lang verschwand er einfach. Cassie, die dem überwältigenden Drang widerstand, die Augen zu schließen, sah bloß den doppelten Ruck der Wagenaufhängung, als die Räder den Mann überrollten. Dann hörte sie das Kreischen der Bremse. Das Auto schlitterte seitlich weg, ehe es zum Stillstand kam. Aus dem Auspuff qualmte weißer Rauch und wirbelte im Wind davon. Der Fahrer stellte den Motor ab, und kurz darauf kehrte auf der Liberty Street wieder Stille ein.
Der Passant war nicht bloß verletzt – er lag im Sterben oder war wahrscheinlich schon tot. Cassie zwang sich hinzusehen. Sein Genick musste gebrochen sein, denn der Kopf war so verdreht, dass er auf seine linke Schulter zu starren schien. Die Brust war zerquetscht und aufgerissen. Nur seine Beine schienen völlig unversehrt. Ein gut erhaltenes Paar Beine. Ungeduldig schüttelte Cassie den abstrusen Gedanken ab.
Die Autotür schwang auf, und der Fahrer taumelte heraus. Ein junger Mann in einem zerknitterten Anzug. Er trug keine Krawatte, und sein Hemdkragen stand offen. Er musste sich auf die Motorhaube stützen, um sich zu stabilisieren. Zweimal schüttelte er den Kopf. Er starrte auf die sterblichen Überreste des Passanten, dann wandte er den Kopf ab, als hätte er in gleißendes Licht geblickt. Die Flagge mit der Aufschrift WIR FEIERN EIN JAHRHUNDERT FRIEDEN knatterte so laut über ihm, dass es für Cassie fast wie ein Schuss klang. Schließlich öffnete der Fahrer den Mund, wie um etwas zu sagen. Stattdessen krümmte er sich nach vorn und erbrach seinen Mageninhalt auf den Asphalt der Liberty Street.
Das war allerdings nichts im Vergleich zu den Hinterlassenschaften des Toten. Jede Menge Blut. Überall Blut. Aber nicht nur. Noch etwas anderes war aus ihm herausgequollen: eine sirupartige grüne Flüssigkeit, die in der Nachtluft dampfte.
Still und starr stand Cassie da, während sich das gerade beobachtete Geschehen in ihrem Kopf mit der Erinnerung an andere Todesfälle vermischte, die viele Jahre zurücklagen.
Weil sie sicher sein musste und sich keinen Fehler erlauben durfte, warf sie hastig eine Jacke über und eilte die Treppe von Tante Ris’ Wohnung hinunter in das kleine geflieste Foyer.
Die Tür zur Straße öffnete sie nur einen Spalt breit. Solange Thomas noch schlief, wagte sie es nicht, das Haus zu verlassen. Sie wollte sich nur vergewissern, dass sie richtig gesehen hatte.
Kalte Luft rauschte an ihr vorbei. Die Jubiläumsfahne knallte wütend und unstet. Der Fahrer lehnte schluchzend an der Motorhaube seines Autos. Die ganze Straße entlang gingen in den Wohnungen im ersten Stock Lichter an. Wie bleiche, verhüllte Monde erschienen in den Fenstern Gesichter. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Polizei kam.
Cassie steckte den Kopf so weit aus der Tür, dass sie einen guten Blick auf die Leiche hatte.
Eine der letzten Monografien, die die Korrespondenzunion nach den Morden in Umlauf gebracht hatte, trug den Titel Hinweise zur Anatomie der Simulakra. Der Verfasser dieser Schrift war Werner Beck, der wohlhabende Vater von Leo Beck. Natürlich hatte Cassie sie damals nicht gelesen, weil sie noch zu jung war. Doch letzten Winter hatte sie zwischen Tante Ris’ Andenken ein Exemplar entdeckt und es sorgfältig studiert. Teile daraus konnte sie auswendig. Neben Skelett und Muskulatur gibt es Lunge, Herz und Verdauungstrakt, die die einzigen erkennbaren inneren Organe des Simulakrums bilden. Diese Organe sind umhüllt von einer amorphen grünen Matrix, die ihrerseits mit Schichten von Fettgewebe und menschlicher Haut bedeckt ist. Der rudimentäre Kreislauf zieht bei schweren Verletzungen relativ geringe Blutungen nach sich, und selbst hoher Blutverlust muss bei einem Simulakrum wohl nicht unmittelbar zum Tod führen. Die grüne Substanz füllt unterschiedslos große Teile der Brust und der Bauchhöhle sowie des Schädels. Bei Luftkontakt verdampft sie und hinterlässt einen elastischen Film aus eingetrockneten Zellen.
Das hatte Werner Beck notiert, und er musste es wissen: Er hatte zwei dieser Wesen in seinem Haus mit einer Schrotflinte verwundet und dann die Geistesgegenwart besessen, eine Obduktion vorzunehmen.
Das Zeug auf der Straße passte zu dieser Beschreibung, und Cassie versuchte, es mit der gleichen soldatenhaften Ungerührtheit zu betrachten wie Beck. Blut, aber nicht so viel, wie man hätte erwarten können. Gelbliches Fettgewebe. Und diese grüne Matrix, nach allen Seiten verschmiert. Cassie konnte sie riechen, und in ihr stieg eine flüchtige Erinnerung an ihre Mutter auf, die Rosen gezüchtet und Cassie manchmal zur Gartenarbeit eingeteilt hatte. Im Alter von acht Jahren hatte Cassie einen endlosen Nachmittag lang Läuse und Fransenflügler von den Blättern und Stielen der Alba-Rosen gezupft, bis ihre Hände mit einer duftenden Schicht aus Chlorophyll, Lehm, Laubresten und Insektenteilen bedeckt waren. Selbst nachdem sie sie mit Seife und Wasser gewaschen hatte, haftete das Aroma noch mehrere Stunden an ihren Fingern.
Und genauso roch der Überfahrene.
Jetzt trat Mrs. Theodorus, die über dem Schuhgeschäft auf der anderen Straßenseite wohnte, in einem rosa Nachthemd und flaumigen weißen Pantoffeln auf den Gehsteig. Sie schien kurz davor, den weinenden Fahrer zu schelten, weil er sie aus dem Schlaf gerissen hatte, doch beim Anblick des Toten verschlug es ihr die Sprache. Lange starrte sie ihn reglos an. Dann presste sie die Hand vor den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken.
Durch all diese Geräusche – Mrs. Theodorus’ erstickten Schrei, das Schluchzen des Fahrers, das Knattern der Flagge – hörte Cassie das ferne Heulen einer Polizeisirene, das sich rasch näherte.
Höchste Zeit zu verschwinden, dachte sie. Und plötzlich wurde sie ganz ruhig. Es war eine mechanische Ruhe, so exakt wie Algebra, unter der die Panik dahinglitt wie ein Hai in einem sonnenbeschienenen Meeresarm. Den Luxus von Panik konnte sie sich jetzt nicht leisten. Ihr Leben stand auf dem Spiel. Und das von Thomas.
In einer Krise muss man immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Das hatte ihr Tante Ris beigebracht, und Cassie versuchte, sich an diese Anweisung zu halten. Das hieß, sie musste damit rechnen, dass wieder ein groß angelegter Angriff im Gang war. Und diesmal sollte anscheinend niemand, der mit den Korrespondenten in Verbindung stand, verschont bleiben. Wenn nicht durch eine glückliche Fügung dieser Unfall dazwischengekommen wäre, hätte sich das Simulakrum, dessen Überreste jetzt die Liberty Street bedeckten wie grünrotes Kompott, Zutritt zur Wohnung verschafft und Cassie und Thomas umgebracht. Tante Ris war vielleicht schon tot, auch wenn Cassie diesen Gedanken gleich wieder von sich schob. Bestenfalls würde Tante Ris morgen in das leere Apartment zurückkehren und feststellen, dass sich ihr Leben erneut verändert hatte – unwiderruflich und zum Schlechteren.
Ich könnte doch auf sie warten, überlegte Cassie. Eine Verabredung am Freitagabend bedeutete zwar normalerweise, dass ihre Tante nicht vor Samstagmittag heimkam, doch sie konnte auch schon früher auftauchen. Und womöglich bestand keine unmittelbare Gefahr mehr, da das Simulakrum, das es auf sie abgesehen hatte, nicht mehr lebte. Einige Stunden hin oder her, das machte doch sicher keinen Unterschied.
Ja, vielleicht … Andererseits war Cassie seit dem Tod ihrer Eltern auf genau so einen Moment vorbereitet worden, nicht zuletzt von Tante Ris persönlich, und sie konnte sich nicht dazu überwinden, sich über die Regeln hinwegzusetzen. Packen, warnen und fliehen – so lautete die Vorschrift. Der erste Punkt war einfach. Wie ihre Tante und ihr kleiner Bruder hatte Cassie jederzeit fertig vorbereitete Sachen in ihrem Zimmer. Sie schloss die Haustür, stürmte nach oben und zerrte den Koffer unter dem Bett hervor. Erst letzten Monat hatte sie ihn überprüft und neu gefüllt, um sicher zu sein, dass ihr die Kleider darin noch passten. Nun stellte sie ihn aufs Bett und zog sich eilig an. Da es draußen kalt war und der Winter bevorstand, schlüpfte sie in zwei Hemden und streifte einen alten Wollpullover darüber. Im Kommodenspiegel erhaschte sie einen Blick auf sich: blass, unförmig und verängstigt. Aber was spielte es für eine Rolle, wie sie aussah?
Tante Ris hatte eine Nummer hinterlassen, unter der sie im Notfall zu erreichen war – und von einem Notfall konnte man hier sicher sprechen. Trotzdem zog Cassie gar nicht in Erwägung, die Nummer zu wählen. Denn das war eine weitere Regel: keine Telefonanrufe. Unter solchen Voraussetzungen musste alles Wichtige unter vier Augen besprochen werden – oder gar nicht. Selbst ein scheinbar harmloser Anruf von dieser Nummer wäre ein Warnsignal für die Wesenheit, die sie als Hyperkolonie bezeichneten. Dort draußen in der Dunkelheit, bewusstlos, aber äußerst aufmerksam, würde sie es hören. Und sofort Maßnahmen ergreifen.
Cassie konnte natürlich eine Nachricht hinterlassen, doch auch in diesem Fall musste sie ihre Worte sorgfältig wählen.
Sie holte ihren Rucksack aus dem Flurschrank und füllte ihn mit einfachen Lebensmitteln aus der Speisekammer: ein halbes Dutzend Müsliriegel, Apfelsaft in Tetrapaks, eine Tüte mit gemischten Nüssen und Rosinen. Einer spontanen Regung folgend, nahm sie auch noch ein zerrupftes Taschenbuch aus dem Regal im Flur und stopfte es in eine Seitentasche. Der Verfasser dieses Werks mit dem Titel Der Fischer und die Spinne war ihr Onkel. Cassie hatte es schon zweimal gelesen.
Unerbittlich verstrich die Zeit. Sie schnallte sich ihre Uhr ums Handgelenk und bemerkte, dass seit dem Tod des Sims fast zwanzig Minuten vergangen waren. Die Polizei war längst unten auf der Straße. Wirbelnde rote Lichter blinkten durch die Jalousien. Vermutlich wunderten sich die Beamten über die Leiche des Opfers – zumindest über das, was noch nicht in die Nachtluft verdampft war. Und der Rechtsmediziner, der die Aufgabe hatte, die sterblichen Überreste zu untersuchen, würde letztlich vielleicht an seinem eigenen Verstand zweifeln. Mit Sicherheit war keine Meldung in der Morgenzeitung zu erwarten. Der betrunkene Wagenlenker würde nie vor Gericht gestellt werden. Das war eine ausgemachte Sache.
In der Küche nahm Cassie einen Stift und einen Zettel und überwand das Zittern ihrer Hand, um zu schreiben:
Liebe Tante Ris,
ich muss los – du weißt ja, warum.
Wollte mich nur noch mal bedanken (für alles). Ich werde gut auf Thomas aufpassen.
Ich umarme dich
Cassie
Es wäre gefährlich gewesen, mehr zu sagen, doch ihre Tante würde auch so verstehen: »Ich muss los« war der zwischen ihnen vereinbarte Code für Alarmstufe Rot. Trotzdem war es nicht genug, nicht annähernd genug. Wie hätte es das auch sein können? Sieben Jahre lang hatte sich Tante Ris um sie gekümmert, voller Güte, Geduld und, wenn auch vielleicht nicht mit Liebe, so doch mit etwas sehr Ähnlichem. Es war Tante Ris gewesen, die Cassie nach dem Tod ihrer Eltern beruhigt hatte, wenn sie aus Angstträumen hochschreckte, und es war Tante Ris, die sie auf sanfte Weise mit der Wahrheit über die Korrespondenzunion vertraut gemacht hatte. Auch wenn sie mit ihrer Fürsorglichkeit für Cassies Geschmack ein wenig zu weit ging, Tante Ris hatte ihr geholfen, eine Balance zu finden zwischen der Welt, wie sie erschien, und der Welt, wie sie wirklich war. Zwischen der Welt, die Cassie geliebt hatte, und der Welt, vor der ihr graute.
Ein lapidares Danke reichte da nicht aus. Sie zögerte, weil sie noch so viel mehr sagen wollte. Doch wenn sie es versucht hätte, wären ihr die Tränen gekommen, und für so etwas hatte sie jetzt keine Zeit. Also klebte sie den Zettel mit seiner unbeholfenen Botschaft an die Kühlschranktür und konzentrierte sich auf die Notwendigkeiten des Augenblicks.
Schließlich schlich sie auf Zehenspitzen in Thomas’ Zimmer und weckte ihn mit einer Hand an der Schulter.
Sie beneidete ihren jüngeren Bruder um die Fähigkeit, tief, still und zuverlässig zu schlafen. Sein kleines Zimmer war ausnahmsweise einigermaßen aufgeräumt. Thomas’ Spielsachen saßen ordentlich in einem Holzregal, seine Kleider hingen frisch gewaschen im Schrank. Er selbst lag auf dem Rücken und hatte die Bettdecke bis zum Kinn hochgezogen, als hätte er sich nicht mehr bewegt, seit Cassie ihn vor einigen Stunden zu Bett gebracht hatte. Vielleicht hatte er sich wirklich nicht bewegt. Zwölf Jahre alt, das Gesicht immer noch kindlich rund. Mit dem blonden, leicht zerzausten Haar, sah er aus wie ein Cherub in einem gelben Pyjama. Er erwachte, als würde er nach langer Abwesenheit in seinen Körper zurückkehren.
»Cassie.« Er blinzelte sie an. »Was ist los?«
Sie forderte ihn auf, sich anzuziehen und seinen Koffer unter dem Bett hervorzuholen. Sie mussten das Haus verlassen. Sofort.
Obwohl er noch ganz benommen war, wusste er, was die Stunde geschlagen hatte. »Tante Ris …«
»Sie ist nicht da. Wir müssen ohne sie aufbrechen.«
Sie hasste die Furcht, die in seinen Augen aufblitzte, und empfand sie als Vorwurf. Am liebsten hätte sie gerufen: Ich kann doch nichts dafür! Es ist nicht meine Schuld – mir bleibt keine andere Wahl!
Vielleicht noch schlimmer war der Ausdruck verängstigter Resignation, der sich nun über sein Gesicht legte. Thomas war zu jung, um sich gut an die Ermordung seiner Eltern zu erinnern. Doch das Wenige, das er noch wusste, hatte sich nicht nur in sein Gedächtnis, sondern in seinen ganzen Körper gebrannt. Er setzte sich auf und stützte sich mit einer Hand auf die Matratzenkante. »Wohin gehen wir?«
»Zu Leo Beck. Danach sehen wir weiter. Jetzt zieh dich erst mal an. Schnell! Du weißt Bescheid. Und nimm warme Sachen, okay?«
Er nickte und richtete sich auf wie ein Soldat beim Morgenappell. Bei diesem Anblick wäre sie fast in Tränen ausgebrochen.
Das hohe Fenster am Ende des Flurs öffnete sich auf eine hölzerne Feuertreppe, die an das verrußte Mauerwerk geschraubt war und hinab zur Gasse hinter dem Haus führte. Dadurch konnten Cassie und Thomas geschützt vor den Blicken der Polizei hinuntersteigen. Ohnehin waren die Beamten immer noch damit beschäftigt, den Hergang des Geschehens auf der Liberty Street zu analysieren, und machten sich bestimmt keine Gedanken, was hinter dem Haus passierte.
Als sie das Fenster aufmachte, erhaschte Cassie einen Blick auf ihr Spiegelbild in der verstaubten Scheibe. Eine junge Frau in einem viel zu großen Pullover und mit wachsamen Augen, die unter einer schwarzen Rollmütze hervorlugten – der Mund zu groß, die Brauen zu dunkel und dicht, unattraktiv auf eine Weise, die Cassie entgegenkam: Sie musste nicht damit rechnen, wegen ihres Aussehens angestarrt zu werden, und das war ihr mehr als recht.
In der Highschool hatten die anderen Schüler nicht nur ihr Aussehen, sondern sie selbst für merkwürdig gehalten. Hinter ihrem Rücken hatten manche Jungen sie als »toten Fisch« bezeichnet. Und es stimmte tatsächlich, dass sie es meisterhaft verstand, nichts von sich preiszugeben. Bei einem Korrespondenzkind gehörte das einfach dazu. Es gab Wahrheiten, zu denen man sich nie bekennen konnte, Gefühle, die immer verborgen bleiben mussten. Deshalb war es in Ordnung, ein toter Fisch zu sein, Abstand zu wahren von den Cliquen in den Schulgängen und den Wochenendtreffs und sich auf dem Weg von einem Unterrichtsraum zum nächsten schief anschauen zu lassen. Selbst dass man verspottet wurde, war manchmal nicht zu vermeiden. Ihr langweiliges Äußeres half in dieser Hinsicht und bildete eine wertvolle Schranke zwischen ihr und den anderen. Sie tat alles, um nicht aufzufallen: meldete sich im Unterricht nie von sich aus, erwartete und forderte keine echte Freundschaft, machte ihre Hausaufgaben gut, aber nicht außergewöhnlich gut.
In Gegenwart anderer Leute aus Korrespondenzkreisen konnte sie etwas aus sich herausgehen. Aber auch diese Gesellschaft hatte ihr nie viel gegeben. Korrespondenzkinder bildeten meistens eine verschworene Gruppe, waren schroff und auf komplexe Weise verkorkst. Und Cassie sah sich da selbst nicht als Ausnahme.
Sie biss sich auf die Lippe und holte tief Luft. Dann kletterte sie über das niedrige Fensterbrett auf die Feuertreppe, hob die beiden Koffer heraus und half schließlich ihrem Bruder hinüber. Die verwitterte Holzplattform bebte unter ihrem gemeinsamen Gewicht. Die Gasse unten zog sich als ziegelgesäumte Asphaltbahn hin, leer bis auf eine einsame Mülltonne und den böigen Novemberwind. Auch das war ihr recht.
Sie verscheuchte jeden Gedanken daran, was sie zurückließ. Unten angekommen, packte sie Thomas fest an der Hand – er reagierte mit einem leisen »Au« – und führte ihn vor zur Ecke, wo die Gasse in die Pippin Street mündete. Dort bog sie nach links ab, um zum Haus des unsympathischen Leo Beck zu laufen. Hinein in eine Zukunft, die sie sich gar nicht ausmalen wollte.
2
Vermont, auf dem Land
Früh am Morgen, nicht lange nachdem die ersten Sonnenstrahlen die kahlen Äste der Ahornbäume berührt hatten und allmählich die Frosthaut aus den Schatten vertrieben, näherte sich ein Mann dem Farmhaus von Ethan Iverson. Der Unbekannte war allein und ging so langsam, dass Ethan reichlich Zeit blieb.
Ethan verfolgte das Vorankommen des Fremden auf einem Bildschirm im Speicher, wo er seine Schreibmaschine, seine Korrespondenzunterlagen und ein kleines Arsenal von Schusswaffen aufbewahrte. Beim Schrillen des Alarms war er gerade in der Küche damit beschäftigt gewesen, sein Standardfrühstück aus Eiern und Schinken in einer Eisenpfanne zu braten. Jetzt wurde das Gericht unten auf dem Herd kalt, und die Eier erstarrten im Fett.
Ethan lebte seit sieben Jahren in dem Farmhaus – seit sieben Jahren und drei Monaten inzwischen. Manchmal sprach er wochenlang mit niemandem außer der Kassiererin im Lebensmittelgeschäft Kierson und dem Angestellten im Buchladen Back Pages, seinen zwei unvermeidlichen Anlaufstellen, wenn er nach Jacobstown fuhr, um seine Vorräte aufzustocken. Wie er festgestellt hatte, war ein nützliches Mittel für einen allein lebenden Menschen, der nicht den Verstand verlieren wollte, ein strikt eingehaltener fester Tagesablauf. Jeden Abend stellte er den Wecker auf sieben, jeden Morgen zog er sich nach dem Duschen an und hatte bis acht sein Frühstück beendet, gleich, an welchem Wochentag und zu welcher Jahreszeit. Und genauso gewissenhaft achtete er auf die Instandhaltung der zahlreichen Bewegungsmelder und Videokameras, die er schon bald nach seinem Einzug auf dem Grundstück installiert hatte.
Sieben Jahre lang hatte dieses System nichts von Belang angezeigt. Ausnahmen hatten lediglich einige verirrte Jäger und Pilzsammler gebildet, dazu ein religiöser Flugblattverteiler, der der Auffassung war, dass die vielen gut sichtbaren BETRETEN-VERBOTEN-Schilder auf dem Gelände für einen Stellvertreter Gottes keine Gültigkeit besaßen, ein zu allem entschlossener Volkszähler und bei zwei Gelegenheiten ein Mitglied der Schwarzbärenfamilie, die hinter der westlichen Grenze von Ethans Grundstück lebte. Bei jedem Anschlagen des Alarms war Ethan hinauf in den Speicher geeilt, wo er den Eindringling auf dem Bildschirm beobachten und sein Gefahrenpotenzial abschätzen konnte. Und jedes Mal bisher hatte sich der Eindringling als harmlos erwiesen.
Er schaltete um auf eine neue Kamera. Der Unbekannte näherte sich in gleichmäßigem Schritt auf dem unbefestigten Zugangsweg. Der Mann, den Ethan auf dem Monitor erblickte, wirkte völlig gewöhnlich, wenn auch ein wenig fehl am Platz. Er wirkte wie höchstens fünfundzwanzig, das Haar braun, der Kopf unbedeckt, leicht übergewichtig, nach Art eines Stadtbewohners gekleidet in eine graue Jacke und schwarze Schuhe, die ihren Glanz in der feuchten Erde des Wegs eingebüßt hatten. Dem Aussehen nach hätte er ein Immobilienmakler sein können, der Ethan fragen wollte, ob er nicht vielleicht Lust hatte, sein Grundstück zu verkaufen. Doch Ethan war sich ziemlich sicher, dass der Typ nicht mal ein Mensch war.
Natürlich hatte das Äußere des Mannes überhaupt nichts zu sagen. Es sei denn, man wollte die ins Auge springende Harmlosigkeit als strategisches Mittel deuten. Was Ethan hingegen aufmerksam machte – und vielleicht sogar absichtlich darauf ausgelegt war, ihn aufmerksam zu machen –, war, dass der Fremde beim Passieren der Kameras in jedes einzelne Objektiv blickte, als wüsste er genau, dass er beobachtet wurde, und als wollte er Ethan sein Kommen ankündigen.
Während sich der Mann der Tausendmetergrenze näherte, dachte Ethan über die Wahl der Waffen nach.
Hier oben verfügte er über ein ansehnliches Arsenal. Überwiegend Jagdbüchsen, weil man sie problemlos und legal erwerben konnte. Aber er verfügte auch über zwei militärische Pistolen. In dem Gestell beim Fenster stand ein voll geladenes Remington-Elchgewehr mit deutschem Zielfernrohr bereit, mit dem er dank jahrelangem Üben so vertraut war, dass er den Eindringling mit einem einzigen Schuss durch das kleine Speicherfenster leicht hätte erledigen können. Dank ihrer besonderen Anatomie waren Simulakra weniger verletzungsanfällig als Menschen, doch sie waren längst nicht unangreifbar. Ein gut gezielter Kopfschuss genügte.
Ethan überlegte. Das war sicher das Einfachste in dieser Situation. Den Eindringling erschießen, dann eine Tasche packen und abhauen. Denn wenn ihn die Hyperkolonie aufgespürt hatte, war es Selbstmord zu bleiben. Und wenn er ein Sim tötete, musste er bald mit dem Auftauchen der nächsten rechnen.
Falls es sich hier überhaupt um ein Sim handelte. War er sich seiner Sache völlig sicher? Zumindest so sicher, dass er einen hohen Geldbetrag darauf gewettet hätte. Doch ein Instinktgefühl reichte nicht, um das Todesurteil über jemanden zu sprechen.
Mit einem bedauernden Blick wandte er sich von dem langen Gewehr ab. Stattdessen griff er nach einer Schrotflinte und einem Gerät, das an eine klobige Pistole erinnerte, mit dem man jedoch über zwei Kupferstifte einen Stromschlag von dreihundert Kilovolt verabreichen konnte. Aufgrund eigener Forschungen war er zu der Auffassung gelangt, dass dies eine wirksame Waffe für den Nahkampf gegen ein Simulakrum war, ohne für einen Menschen tödlich zu sein. Allerdings hatte er noch keine Gelegenheit gefunden, diese Theorie auf die Probe zu stellen.
Den Blick auf den Bildschirm gerichtet, versuchte er, seine Angst abzuschütteln. Er hatte von Anfang an damit gerechnet, dass dieser Tag kommen würde. Er hatte sich darauf vorbereitet und ihn sich in seiner Fantasie tausendmal ausgemalt. Warum zitterten ihm dann jetzt die Hände? Die Antwort war so naheliegend, dass er nicht danach suchen musste. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, trotz seiner hohen Feuerkraft und der sorgfältig geplanten Fluchtrouten zitterten seine Hände, weil sich hinter dem Mann, der auf sein Haus zusteuerte, möglicherweise eines jener Wesen verbarg, die vielen seiner Freunde und Verwandten das Leben genommen hatten – ein Wesen, das kein Bewusstsein hatte und mit der gleichen Beiläufigkeit den Tod bringen konnte wie ein Blitzschlag.
Er schob die Schockpistole in seinen Gürtel und vergewisserte sich noch einmal, dass die Schrotflinte geladen war. Zur Sicherheit steckte er zwei zusätzliche Patronen in die Hemdtasche. Plötzlich spürte er den Drang, seine Blase zu leeren, doch dafür blieb keine Zeit mehr.
Der Tod schritt die knarrende Außentreppe herauf und läutete höflich an der Tür. Ethan stieg nach unten, um ihm zu öffnen.
Die innen grünen Männer (und Frauen – Ethan durfte nicht vergessen, dass einige von ihnen auch Frauen waren) hatten ihn seine Ehe und seine Karriere gekostet. Und diese bemerkenswerte Leistung hatten sie an einem einzigen Tag des Jahres 2007 vollbracht.
Damals war Ethan ordentlicher Professor an der University of Massachusetts in Amherst gewesen, Autor von mehreren positiv aufgenommenen Fachartikeln und von zwei relativ erfolgreichen populärwissenschaftlichen Büchern, ein angesehenes Mitglied seines Instituts und ein aktiver Forscher mit großem Rückhalt in der Studentenschaft. Sein Fachgebiet war die Entomologie, doch in letzter Zeit hatten ihn seine Projekte in den Bereich der Paläobotanik geführt, die sich mit fossilen Pflanzen beschäftigte. Er arbeitete in einem Team, das Sporen in zehntausend Jahre alten antarktischen Eiskernen isolierte. Darüber hinaus betrieb er auch geheime Forschungen, die für die Korrespondenzunion von Interesse waren.
Die Korrespondenten waren Wissenschaftler und Akademiker, die ihre Ergebnisse nie in offiziellen Fachjournalen veröffentlichten. Die Union war eine geschlossene Gruppe, deren Mitglieder sich zur strikten Geheimhaltung verpflichtet hatten. Schon als Student war Ethan von seinem Doktorvater am Massachusetts Institute of Technology eingeführt worden, dessen Intelligenz und Moral Ethan vorbehaltlos bewunderte. Dennoch war er anfangs skeptisch. Korrespondenzunion – das klang nach einem exzentrischen, äußerst altmodischen Relikt aus den klösterlichen Hallen von Oxford und Cambridge. Und er hätte sie umstandslos als Witz – und zwar als ziemlich läppischen Witz – abgetan, wenn die dort vertretenen Namen nicht eine andere Sprache gesprochen hätten. Mathematiker, Physiker, Anthropologen, viele von ihnen mit ausgezeichneten Referenzen. Und die Liste der Toten, falls sie der Wahrheit entsprach, war noch beeindruckender: Dirac, von Neumann, Fermi …
Man hatte ihn vor der Gefahr gewarnt, die er durch die Verbindung mit der Gruppe einging. Es galten strenge Regeln. Die Korrespondenten durften über ihre Angelegenheiten nur per Post oder unter vier Augen kommunizieren. Wer sich mit Äußerungen über die Union zu weit aus dem Fenster lehnte, musste mit Repressalien rechnen, allerdings nicht vonseiten anderer Mitglieder, sondern aus anderen, unbekannten Kanälen. Wenn Ethan gegenüber der falschen Person eine falsche Bemerkung machte, konnte es passieren, dass seine Forschungsprojekte ohne ersichtlichen Grund abgelehnt wurden, dass er in Fachkreisen und bei Prüfungsausschüssen in Ungnade fiel und dass er vielleicht sogar seine Professur verlor. Er war sich dieser Risiken bewusst und ließ daher nach seinem Beitritt zur Union größte Vorsicht walten. Doch niemand hatte ihn davor gewarnt, dass er getötet werden könnte. Dass seine Familie gefährdet war.
Das Massaker im Juni 2007 überlebte Ethan nur durch Zufall. Man hatte ihn in letzter Minute zur ESA-Konferenz eingeladen, und er wartete gerade auf dem Flughafen in Boston auf seinen Flug nach Phoenix, als im Boardingbereich die ersten Meldungen über den Fernseher flimmerten. Wie gebannt starrte er auf den Bildschirm, auf dem nacheinander Fotos gezeigt wurden. Es war, als würde sich eine eisige Hand um sein Herz schließen, denn er kannte diese Gesichter alle: Benson aus Yale, Kammerov aus Cornell, Neiderman aus Edinburgh, Linde aus Sankt Petersburg. Und so weiter, insgesamt ein Dutzend. Die Bildunterschrift lautete: UNIVERSITÄTSMORDE. Ethan trat auf den Fernseher zu, ihm war bereits schlecht vor Grauen. Trotz der niedrigen Lautstärke konnte er genug von dem Gemurmel des Nachrichtensprechers verstehen, um sich in seinen schlimmsten Befürchtungen bestätigt zu sehen. Es gibt keine eindeutigen Beweise für eine Verbindung zwischen den zahlreichen Morden, die am Mittwoch auf drei verschiedenen Kontinenten begangen wurden, doch es scheint kein Zufall zu sein, dass so viele bekannte Akademiker und Gelehrte in derart kurzer Zeit einen gewaltsamen Tod fanden … Die örtlichen Behörden stehen im intensiven Austausch mit dem Polizeiressort des Völkerbunds, um festzustellen, ob diese Todesfälle Teil eines größeren Zusammenhangs sind …
Anscheinend stammten die Meldungen von den Nachrichtenagenturen. Die Morde in Asien und Europa waren in der Nacht passiert, die in Amerika lagen erst wenige Stunden zurück. Und Ethan brauchte nicht die Hilfe des Völkerbunds, um »einen größeren Zusammenhang« zu erkennen. Alle genannten Opfer hatten der Korrespondenzunion angehört.
Er suchte sich ein Münztelefon und rief in seinem Büro in Amherst an. Als Korrespondent wusste er natürlich, dass Telefone unzuverlässig waren. Selbst Ortsgespräche wurden als Teil des weltweiten Telekomnetzes routinemäßig durch die Radiosphäre geleitet. Trotzdem hoffte er, dass ein kurzer Anruf nicht auffallen würde. Während er wählte, kam über den Lautsprecher die Aufforderung, in die Maschine nach Phoenix einzusteigen. Er ignorierte sie.
Ethans Sekretärin Amy Winslow meldete sich nach dem dritten Klingelton. »Professor Iverson! Alles in Ordnung bei Ihnen?«
Mit betont neutraler Stimme teilte er ihr mit, dass es ihm gut ging. Bevor er weitersprechen konnte, fragte sie, ob er schon in Phoenix war oder vielleicht noch zurück ins Büro kommen konnte. Etwas Furchtbares war passiert. Tommy Chopra war erschossen worden! Ein Hausmeister hatte ihn tot aufgefunden! Überall war Polizei, redete mit Leuten, sammelte Spuren!
Ethan konnte seinen Schock nicht verbergen. Tommy Chopra war einer seiner Studenten. Ein Frühaufsteher und zwanghafter Perfektionist; Ethan hatte ihm den Schlüssel zu seinem Büro überlassen, und er war oft schon vor Sonnenaufgang dort, um Daten zusammenzutragen, während der Rest des Campus erst allmählich erwachte. Nach Amys Schilderung war er irgendwann vor sieben Uhr morgens erschossen worden. Niemand hatte den Mörder gesehen.
Bloß dass er nicht Tommy umbringen wollte, sondern mich.
»Können Sie zurückkommen und mit der Polizei reden?«
»Natürlich. Rufen Sie bitte bei der Konferenz an und sagen Sie für mich ab. Die Nummer steht in der Broschüre auf meinem Schreibtisch. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen.«
Das war natürlich eine Lüge. Ethan hatte nicht vor, jemals wieder einen Fuß in sein Büro zu setzen.
Stattdessen fuhr er mit dem Auto die zweistündige Strecke zu der Wohnung im Süden von Amherst, in der Nerissa seit der »Trennung auf Zeit« von ihm lebte – so nannte sie den Probelauf für ihre Scheidung. Er hatte ihr versprochen, nicht unangemeldet hereinzuschneien, doch angesichts der Umstände musste er diese Vereinbarung über Bord werfen. Obwohl er keine Ahnung hatte, was die Ereignisse für den Fortbestand der Union bedeuteten, lag der nächste Schritt für ihn auf der Hand. Er musste Nerissa über die Ereignisse aufklären, damit sie verstand, warum sie ihn vielleicht nie wiedersehen würde und was sie als Nächstes zu tun hatte.
Der innen grüne Mann wartete geduldig auf der Veranda. Drinnen betrachtete Ethan sein Bild auf einem Monitor über der Tür, der mit einer im Dach versteckten Kamera verbunden war. Er bemühte sich, nicht zusammenzuzucken, als der Unbekannte erneut direkt in das Objektiv schaute.
Wenn das ein Simulakrum war, folgte es einer neuen Strategie, denn es war weder bewaffnet, noch hatte es einen Hehl aus seinem Erscheinen gemacht. Dadurch wurde es in Ethans Augen allerdings nicht ungefährlicher. Im Gegenteil.
Zu der Kameraschaltung gehörten ein Mikrofon und ein Lautsprecher. Nie mit einem Sim sprechen – das war eine der Regeln, die Ethan ausgehend von seinen und Werner Becks Theorien über die Funktionsweise der Hyperkolonie für sich aufgestellt hatte. Aber was war die Alternative? Die Tür aufreißen und jemandem eine Schrotladung ins Gesicht jagen, der trotz allem vielleicht ein harmloser Unbeteiligter sein mochte?
Er schaltete das Mikrofon ein. »Egal, was Sie verkaufen, ich bin nicht interessiert. Sie befinden sich auf einem Privatgrundstück. Bitte verlassen Sie sofort das Gelände.«
»Hallo, Dr. Iverson.« Die Stimme des Sims klang ruhig und näselnd und hatte einen leichten New Yorker Akzent. »Ich weiß, wer Sie sind, und Sie wissen, was ich bin. Aber ich bin nicht hier, um Sie anzugreifen. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Darf ich es erklären?«
Hinter diesen Worten stand kein Bewusstsein, das durfte Ethan nicht vergessen. Nichts außer eine Reihe hoch entwickelter Algorithmen, die auf ein strategisches Resultat zielten. Ein Dialog mit so einem Wesen war ungefähr so nützlich wie der Versuch, mit einem Voltaire-Zitat einen Skorpion abzuwehren. Trotzdem, Ethan war einfach neugierig. »Haben Sie eine Waffe dabei?«
Das Simulakrum bedachte die Kamera mit einem herzlichen Lächeln. »Nein, Sir.«
»Können Sie das beweisen? Vielleicht fangen Sie damit an, dass Sie Hut und Jacke ablegen.«
Das Simulakrum nickte und nahm den Hut ab. Es hatte braunes Haar und eine kahle Stelle oben am Kopf. Es schlüpfte aus der Jacke und deponierte sie ordentlich gefaltet neben dem Hut auf einem verblichenen Gartenstuhl.
»Jetzt noch Hemd und Hose«, forderte Ethan.
»Muss das sein, Mr. Iverson?«
Er schenkte sich die Antwort. Die Stille zog sich in die Länge. Schließlich knöpfte das Simulakrum sein Hemd auf. Wie die Hose gesellte es sich zu Hut und Jacke, und zum Vorschein kam ein bleicher, dickbäuchiger Körper, der von dem eines Menschen nicht zu unterscheiden war.
»Auch die Schuhe und Socken.«
»Es ist kalt hier draußen, Dr. Iverson.« Trotzdem folgte das Wesen der Anweisung. Zuletzt stand es bloß noch in seiner weißen Unterhose da.
Ein Monster in Unterwäsche, dachte Ethan.
»Kann ich jetzt reinkommen und mit Ihnen reden?«
Ethan riss die Tür auf, sodass nur noch das Fliegengitter zwischen ihm und dem innen grünen Mann war. Ethan richtete den kurzen Lauf seiner Schrotflinte auf die Brust des Wesens.
Das Sim fixierte die Waffe. »Bitte nicht schießen.«
»Was wollen Sie?«
»Nur ein paar Minuten Ihrer Zeit. Ich möchte Ihnen etwas erklären.«
»Wie wär’s mit der Kurzfassung gleich hier?«
»Sie und einige andere Mitglieder der Korrespondenzunion sind in unmittelbarer Lebensgefahr. Das ist keine Drohung. Ich bin nicht Ihr Feind. Wir haben gemeinsame Interessen.«
»Warum sollte ich Ihnen das glauben?«
»Ich kann es erklären. Ob Sie mir glauben, liegt ganz bei Ihnen. Darf ich reinkommen?«
Ohne die Position der Waffe zu verändern, zog Ethan mit der freien Hand das Fliegengitter auf. »Schön langsam.«
Das Simulakrum trat über die Schwelle. »Wollen Sie jetzt ständig mit dieser Schrotflinte auf mich zielen?«
»Ich glaube nicht.« Ethan nahm das Gewehr in die linke Hand und ließ den Lauf sinken.
»Vielen Dank.«
»Es geht auch so.« Ethan riss die Schockpistole aus dem Gürtel und presste die Stifte in den wabbeligen Bauch des Sims, als er abdrückte.
Dreihundert Kilovolt. Der innen grüne Mann brach zusammen wie ein gefällter Baum.
3
Buffalo, New York
Durch den Marsch gegen den Wind zu Leos Adresse wurde Cassie warm. Ihr Bruder, dem die Angst allmählich anzumerken war, umklammerte ihre linke Hand so fest, dass sie blaue Flecken befürchtete. Dabei hatte Thomas schon seit seinem siebten Lebensjahr nicht mehr die Hand seiner Schwester gehalten. »Bald kommt die Sonne raus«, sagte sie, um ihn abzulenken. Sie kamen an einer schwerfälligen Maschine vorbei, die auf ihrer langsamen Fahrt Ströme von Seifenwasser in die Kanaldeckel schickte. »Die Straßenreinigung ist schon unterwegs, siehst du?« Thomas zuckte die Achseln.
Buffalo war eine wohlhabende Stadt, doch an den alten Gebäuden hier in der South Side war dieser Wohlstand vorübergegangen. Das niedrige Wohnhaus, in dem Leo lebte, saß gedrungen wie ein müder Troll auf seinem Eckgrundstück, tätowiert vom Ruß, der in den Jahrzehnten vor der Verschärfung der Umweltschutzgesetze aus den Fabriken und Raffinerien in West Seneca und Lackawanna herübergeweht war. Hier musste Cassie vorsichtig sein, denn es war möglich, dass die Simulakra es auch auf Leo abgesehen hatten. Sachte zog sie die äußere Metalltür auf und trat in den Hausflur. Drinnen war es warm, und ein Geruch nach Kohl und saurer Milch wallte ihr entgegen. Hastig überflog sie die Namen der Mieter. Eine Taste hatte sich aus der Klingeltafel gelöst und baumelte wie ein herausgerissenes Auge aus ihrer Fassung. Gleich darunter befand sich der Knopf, neben der BECK, LEO stand.
»Sind wir hier sicher?« Thomas’ Frage spiegelte Cassies eigene Befürchtungen wider.
Unterwegs hatte sie ihm von dem Sim erzählt, das auf der Liberty Street von einem Auto überfahren worden war. Das bedeutete, dass sie und Thomas sofort die Wohnung verlassen mussten, auch wenn Tante Ris sie nicht begleiten konnte. Wo gehen wir dann hin? Cassie hatte keine klare Antwort auf seine Frage. Das kommt darauf an.
Ich muss doch in die Schule.
Nicht mehr. Wir haben sozusagen Ferien.
Aber Thomas ließ sich nicht so leicht trösten, dazu war er zu intelligent. Und nein, sie konnte nicht behaupten, dass sie hier sicher waren. Im Grunde war nicht einmal auszuschließen, dass Leo Beck tot auf dem Boden seiner Zweizimmerwohnung lag. Trotzdem, als Überlebende der Union hatte sie die Pflicht, das nächste potenzielle Opfer zu warnen, wenn es möglich war. Sie behielt die Treppe hinter der inneren Flurtür im Blick, bereit, beim Anblick eines verdächtigen Unbekannten sofort zu fliehen. Erneut drückte sie die Klingel.
Kurz darauf meldete sich Leo, und er klang alles andere als erfreut. »Egal, wer das ist, wenn du noch mal läutest, komm ich runter und verpass dir einen Tritt in deinen blöden Arsch.«
Thomas riss die Augen auf.
»Hier ist Cassie Iverson«, sagte sie hastig. »Ich muss mit dir reden, Leo.«
Schweigen. Nach längerem Warten öffnete sich klackend die elektronische Sperre der Innentür. Mit Thomas im Schlepptau hastete Cassie die Treppe hinauf in den ersten Stock, wo im Korridor die Blumentapete von den Wänden blätterte. Leos Apartment hatte die Nummer 206. Sie klopfte leise, um die Nachbarn nicht zu wecken.
Nicht Leo öffnete die Tür, sondern Beth Vance.
Eine Überraschung, andererseits auch wieder nicht. Schon beim letzten Überlebendentreffen hatte Cassie beobachtet, dass Leo und Beth mehr als nur freundschaftlich miteinander umgingen. Beth war die Tochter von Carl Vance, dessen Frau ordentliche Professorin an der New York University und ein Mitglied der Korrespondenzunion gewesen war. Amanda Vance war bei den Attentaten 2007 ums Leben gekommen.
Beth war nur ein Jahr älter als Cassie, gab sich jedoch viel erfahrener und stilbewusster (was ihr normalerweise auch gelang, wie Cassie zugeben musste). Beth war groß und geradezu melodramatisch dünn. Das strohgelbe Haar hatte sie modisch kurz geschnitten. An diesem Morgen trug sie Jeans und ein Flanellhemd, in die sie wohl gerade erst geschlüpft war. Das Hemd gehörte vermutlich Leo. Sie bedachte Cassie mit einem herablassenden Blick.
»Ich muss zu Leo«, sagte Cassie.
Beth verdrehte die Augen und rief: »Ja, es ist die Iverson. Und ihr kleiner Bruder.«
Leos Stimme kam von irgendwo aus der Wohnung: »Ihr was?«
»Der kleine Bruder!«
Als wüsste sie nicht genau, wie Thomas hieß.
Cassie reichte es jetzt. Sie drängte sich an Beth vorbei und schleifte Thomas hinter sich her. In diesem Moment trat Leo barfuß aus dem Schlafzimmer. Er steckte in einer schwarzen Denimhose und einem ärmellosen Unterhemd. Er war einundzwanzig Jahre alt und ungefähr eins fünfundachtzig groß. Auf konventionelle Weise attraktiv, bis auf die Augen, wie Cassie schon öfter aufgefallen war: die Art, wie sie in den Winkeln nach unten zeigten, als wären sie verkehrt herum eingesetzt worden. Das verlieh ihm ein leicht eingebildetes Aussehen.
Dabei war er gar nicht eingebildet und mit Sicherheit auch nicht dumm. Nachdem er Cassies und Thomas’ Gesichter gemustert hatte, holte er tief Luft. »O verdammt. Es ist wieder was im Gang, oder?«
Nur mühsam brachte Cassie ein Nicken zustande. »Ja, genau.«
»Und ihr seid als Erstes hierhergekommen?«
»Tante Ris ist aus. Ja. Wir haben noch mit niemand gesprochen.«
Sie erzählte, was sie vom Küchenfenster aus gesehen hatte, ohne die grässlichen Details auszusparen, obwohl Thomas bei ihrer Schilderung die Furcht anzumerken war.
»Okay.« Leos Gesicht wurde ernst. »Danke, Cassie.« Er wandte sich an Beth. »Alles, was du behalten willst – such es schnell zusammen und wirf es ins Auto.«
»Ins Auto?«
»Wir fahren sofort los.«
Thomas kauerte neben ihr auf dem verschlissenen Sofa, während Leo und Beth sich in fliegender Hast fertig machten.
Cassie fragte sich, wie viel er von dem Ganzen begriff. Tante Ris hatte dafür gesorgt, dass Thomas nicht ahnungslos blieb. Er wusste von dem Massaker 2007, zumindest in allgemeiner Form. Er wusste, dass er außerhalb der Familie nicht über bestimmte Themen reden durfte, zum Beispiel über den Tod seiner Eltern. Und er wusste, dass der Koffer unter seinem Bett aus einem bestimmten Grund dort abgestellt worden war. Diese bedrückenden Informationen hatten ihn reservierter und zaghafter gemacht, als die meisten Zwölfjährigen es waren. Thomas sprach bloß selten über diese Dinge, nur gelegentlich kam er mit Fragen, die ihn beunruhigten, zu Cassie: Stimmt es, dass die Radiosphäre lebt? Wie kann uns die Hyperkolonie hören, wenn wir am Telefon reden? Warum will sie die Menschen umbringen? Cassie hatte sich immer bemüht, ihm möglichst aufrichtig zu antworten. Das hieß, dass sich Thomas oft mit »Keine Ahnung« zufriedengeben musste.
Beth blieb skeptisch, und als Leo mit ihr aus dem Schlafzimmer kam, musste er noch immer gegen ihre Einwände ankämpfen. »Cassie würde in so einer Sache nie lügen«, sagte er dankenswerterweise. »Das ist Alarmstufe Rot, verdammt noch mal.« Er stopfte mehrere Lebensmitteldosen zu den Kleidern in seiner Sporttasche. »Wir waren immer darauf vorbereitet, dass das passieren kann. Wenigstens sind wir zusammen.« Die letzte Bemerkung sollte Beth wohl besänftigen, doch sie erwiderte sie nur mit einem gereizten Blick. Wenigstens das Packen ging schnell und reibungslos. Nach allem, was Cassie in der Wohnung sah, schien Leo mit Ausnahme zweier Bücherregale nicht viel zu besitzen. Und Beth hatte nur eine kleine Tasche dabei, in der vermutlich nicht viel mehr war als ein Schminkset, Tampons für den Notfall und zwei Kondome.
»Und wo steht das Auto?«, fragte Beth.
»Zwei Straßen weiter. Meinst du, wir brauchen sonst noch was?«
Beth schaute sich unzufrieden um und schüttelte den Kopf.
»Okay, dann los.«
»Was ist mit denen?« Beths Wortwahl war ziemlich grob, doch Cassie hatte sich schon das Gleiche gefragt.
»Wir können die beiden nicht hierlassen. Was meinst du, Cassie? Ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Trotzdem seid ihr mit uns bestimmt besser dran als allein auf der Straße.«
»Ja.« Thomas hatte sich zu Wort gemeldet, bevor Cassie antworten konnte. Sie nickte bloß. Leo wusste so gut wie jeder andere, was die Stunde geschlagen hatte. Auch wenn sie ihn nicht besonders sympathisch fand – er war der Sohn von Werner Beck, dem einflussreichsten Mann in der Union. Es war sicherer, wenn sie zusammenblieben.
So verließen sie das Gebäude. Draußen stahl sich das Morgenlicht in die Straßen. Schon traten die ersten Arbeiter aus den alten Wohnhäusern. Stämmige Männer und einige wenige Frauen, die meisten wohl unterwegs zu den Produktionsstätten in Lackawanna und West Seneca. Einmal, als sie mit Tante Ris durch dieses Stadtviertel fuhr, hatte sich Cassie laut gefragt, ob die nach Hause stapfenden Männer die Welt tatsächlich für so blühend und fortschrittsorientiert hielten, wie sie im Sozialkundeunterricht immer dargestellt wurde. »Wahrscheinlich nicht«, hatte Tante Ris geantwortet. »Schließlich wirken sie nicht besonders inspiriert, oder? Sie sind noch lange nicht reich. Aber immerhin haben sie Arbeit. Die Stahlwerke und Maschinenfabriken zahlen einen Lohn, der zum Leben reicht, und Zusatzleistungen. Ohne Alkohol, Alimente oder einfach nur Pech könnten sich viele von diesen Menschen wahrscheinlich sogar eine bessere Wohngegend leisten. Langfristig könnte ihr Leben leichter werden. Und sie bekommen Hilfe, wenn sie welche brauchen.« Anders ausgedrückt: Im Sozialkundeunterricht wurde zum größten Teil die Wahrheit gesagt.
Tante Ris hatte immer gewissenhaft darauf geachtet, auch dem Teufel sein Recht zu lassen.
Leos Auto war ein alter Ford, dessen brauner Lack mit Rostblasen überzogen war. Der Wagen war vermutlich älter als Thomas. Etwas Besseres konnte sich Leo nicht leisten mit dem Geld, das er mit seiner abendlichen Arbeit in einem Restaurant verdiente. Sein Vater war zwar berühmt für seinen Reichtum, doch er lehnte es ab, ihn zu verhätscheln. Und ab jetzt würde Leo sowieso keine Tische mehr bei Julio’s abräumen. Cassie hievte ihr und Thomas’ Gepäck neben die wenigen Sachen von Beth und Leo in den leeren Kofferraum des Autos, dann ließ sie sich mit ihrem Bruder auf die Rückbank gleiten.
»Und wo fahren wir jetzt hin?«
Beths Frage war berechtigt. Cassie wartete gespannt auf eine Antwort, denn früher oder später musste auch sie in diesem Punkt zu einer Entscheidung gelangen.
»Erst mal zu dir. Wir schauen nach, ob mit deinem Vater alles in Ordnung ist. Sobald wir mehr wissen, können wir weitersehen.«
Nach dem Massaker im Jahr 2007 waren zehn Korrespondenzfamilien nach Buffalo geflohen. Die meisten stammten aus dem Umkreis von Harvard, dem Massachusetts Institute of Technology und der University of Massachusetts. Tante Ris, die alle persönlich kannte, organisierte den Exodus.
All diese Familien waren zum Ziel von Anschlägen geworden. Alle trauerten um den Verlust von Ehemännern oder Vätern, Müttern oder Ehefrauen. Für sie war es einfach ein Gebot der Vernunft, nicht weiter in den Häusern oder Wohnungen zu bleiben, in denen ihre Liebsten ermordet worden waren. Auch wenn sie vielleicht nicht in unmittelbarer Gefahr waren – die Attentate hatten ausschließlich auf aktive Mitglieder der Union gezielt –, war ihnen auf eindringliche Weise ihre Anfälligkeit vor Augen geführt worden. Das letzte allgemein verbreitete Korrespondenzdokument, ein Brief an die überlebenden Angehörigen von Werner Beck, geizte nicht mit düsteren Warnungen und Tipps zur Wahrung der Anonymität.
Ähnliche Enklaven von Überlebenden gab es im gesamten Land und auch anderswo auf der Welt. Obwohl die derart zersplitterte Korrespondenzunion nur noch ein Schatten ihrer selbst war, blieb ihre emotionale und bisweilen auch finanzielle Unterstützung von unschätzbarem Wert. Nur bei den Treffen der Überlebenden konnte man Trauer und Zorn, die vor Fremden sorgfältig verborgen werden mussten, offen zum Ausdruck bringen und auf Verständnis hoffen.
Allerdings hatte die unvermeidliche Geheimhaltung auch eine zersetzende Wirkung, vor allem auf die Kinder dieser Familien. In diese Kategorie fielen Cassie und Thomas. Leo und Beth ebenfalls.
Zum Beispiel in der Schule. Bis zum Abschluss im Frühjahr hatte Cassie die Millard Fillmore Secondary School besucht, und es verging kein Tag, an dem sie nicht daran erinnert wurde, dass sie eine Außenseiterin war, die ihre Normalität nur vortäuschte, ein Flüchtling von einem anderen, dunkleren Ort. Besonders der Geschichtsunterricht war eine Qual für sie. Vor dem Massaker von 2007 hatte sie mit Duldung ihrer Eltern an das Märchen vom technologischen und gesellschaftlichen Fortschritt glauben dürfen, in dem die Lehrbücher so gern schwelgten: die Entdeckung der Funkwellen verstärkenden Schicht über der Erdatmosphäre (der sogenannten Radiosphäre) Ende des neunzehnten Jahrhunderts; der Große Krieg und seine Folgen, die Abschaffung der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten in den Dreißigerjahren, die europäischen und eurasischen Friedensverträge, die Gleichberechtigung der Frauen in den Fünfzigerjahren … und vor allem die tröstliche Gewissheit, dass die Welt von Tag zu Tag ein wenig reicher und gerechter wurde. Erst nach dem Tod ihrer Eltern hatte Cassie die Wahrheit erfahren: dass die Geschicke der Menschheit von einer unsichtbaren Hand gelenkt wurden, deren Wirken trotz ihres scheinbaren Wohlwollens gleichgültig, oft grausam und manchmal sogar mörderisch war.