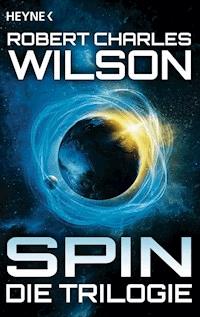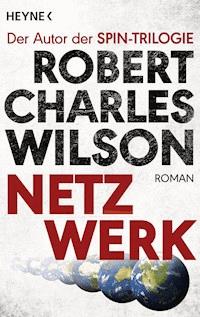
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Aus diesem Netz entkommst du nicht
Das Leben des jungen Grafikdesigners Adam Fisk erfährt eine entscheidende Wende, als er sich eines Tages einem Persönlichkeitstest bei der Firma Inter Alia unterzieht. Die hat ein Computersystem entwickelt, mit dessen Hilfe sich ermitteln lässt, welche Menschen besonders gut miteinander kooperieren können, und bringt die Probanden in sogenannten Netzwerken zusammen. Auch Adam wird so einem Netzwerk zugeordnet, doch was sich anfangs wie eine paradiesische Form des sozialen Miteinanders anfühlt, wird bald zum tödlichen Albtraum …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Ähnliche
Das Buch
Was wäre, wenn irgendwo genau die Gemeinschaft auf dich wartet, nach der du dich immer gesehnt hast? Adam Fisk, dessen Grafikstudium nicht besonders gut läuft und der auch sonst mit seinem Leben nicht zufrieden ist, befürchtet, bald in das verhasste Elternhaus zurückkehren zu müssen. Und so entscheidet er sich spontan, an den Tests teilzunehmen, die von einer geheimnisvollen neuen Organisation durchgeführt werden: den »Affinitäten«. Diese wollen herausgefunden haben, dass fast jeder Mensch einer von zweiundzwanzig Gruppierungen zuzuordnen ist, innerhalb derer größte Harmonie herrscht. Tatsächlich wird Adam der Affinität »Tau« zugewiesen und fühlt sich in deren lokalen Ableger so glücklich wie nie zuvor in seinem Leben – plötzlich läuft alles wie am Schnürchen, er scheint genau dort gelandet zu sein, wo er hingehört. Doch dann machen sich in den Affinitäten Machtansprüche breit. Und schon bald bereiten sie sich – obwohl sie ja eigentlich für eine friedlichere Welt erschaffen wurden – auf den Kampf gegeneinander vor. Adam, zerrissen zwischen verschiedenen Loyalitäten, muss sich erneut entscheiden …
Mit Netzwerk legt Bestseller-Autor Robert Charles Wilson ein hochspannendes Zukunftsszenario vor, das eine neue soziale Weltordnung entwirft.
Der Autor
Robert Charles Wilson, geboren 1953 in Kalifornien, wuchs in Kanada auf und lebt mit seiner Familie in Toronto. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren der modernen Science-Fiction. Er hat etliche Romane veröffentlicht, darunter den internationalen Bestseller Spin. Neben zahlreichen Nominierungen wurde er mehrfach für seine Romane ausgezeichnet, unter anderem mit dem Philip K. Dick Award, dem John W. Campbell Award und dem Hugo Award. Zuletzt sind von Robert Charles Wilson im Heyne-Verlag die Spin-Trilogie und Kontrolle erschienen.
Mehr über Robert Charles Wilson und seine Romane erfahren Sie auf:
ROBERT CHARLES WILSON
NETZ WERK
ROMAN
Titel der amerikanischen Originalausgabe:THE AFFINITIES Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 07/2017 Redaktion: Tamara Rapp Copyright © 2015 by Robert Charles Wilson Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von shutterstock/Banex Satz und E-Book: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-16953-4V001www.diezukunft.de
ERSTER TEIL –
EIN HAUS IN EINER WINTERNACHT
Als eine obskure Data-Mining-Firma vor zwei Jahren die von ihr so genannten »Affinitäten« ins Leben rief, blieb das praktisch unbeachtet. Die Idee war quichottisch und scheinbar ohne jede Zugkraft. Abgesehen von einigen Großstädten, gab es keine Werbekampagne, und selbst dort blieb das Medienecho eher bescheiden. Doch unbemerkt von der Öffentlichkeit, geschah etwas Erstaunliches …
Einer Einladung folgend, erschien ich mit sehr geringen Erwartungen zu einem örtlichen Treffen. Ich war auf eine Begegnung mit einer Gruppe ganz gewöhnlicher Menschen gefasst, die sich dazu hatten überreden lassen, für das Privileg gegenseitiger Schmeichelei einen Jahresbeitrag zu entrichten – ein kommerzieller Kunstgriff, der einem Schausteller wie P. T. Barnum Ehre gemacht hätte. Aber die Versammlung strahlte eine soziale, sexuelle und intellektuelle Energie aus, die mich überraschte. Das veranlasste mich zu der Überlegung, wohin das alles steuerte, und ich fragte eine junge Frau, was die Mitglieder ihrer Affinität wohl in zwanzig oder dreißig Jahren machen würden.
Sie lachte. »Wahrscheinlich schreiben wir unsere Memoiren. Oder vielleicht unsere Bekenntnisse.«
–The Atlantic, »Teleodynamik, Meir Klein und der Aufstieg der Affinitäten« (Leitartikel)
1
Ich fasste meinen Entschluss, als ich das Blut im Spiegel bemerkte. Das Blut gab den Ausschlag.
Natürlich hatte ich vorher schon darüber nachgedacht. Ich hatte die Anzeige aus den hinteren Seiten der Lokalzeitung geschnitten, mich auf der Website umgesehen und mir die Adresse des örtlichen Testzentrums eingeprägt. Erst diesen Nachmittag war ich an dem Gebäude vorbeigeschlendert und hatte aus reiner Neugier – wie ich mir auch selbst weiszumachen versuchte – an der Mattglastür mit Messinggriff gezögert. Ich malte mir aus, in die kühle, schwach beleuchtete Lobby hinter dem Logo INTERALIA zu treten und damit vielleicht den Lauf meines Lebens zu ändern. Letztlich ging ich mit einem Achselzucken weiter. Ob mich der Mut verließ oder ob ich einfach bloß zu skeptisch war, ich konnte es nicht sagen.
So stark die Versuchung war, mit dem Öffnen dieser Tür hätte ich mir meine Unzulänglichkeit eingestanden, und dazu war ich nicht bereit.
Erst beim Anblick meines blutverschmierten Gesichts überlegte ich es mir anders.
Vom InterAlia-Gebäude ging ich nach Süden, um mich mit meinem ehemaligen Mitbewohner Dex am Fährhafen zu treffen. Wir wollten zu einem Open-Air-Konzert auf den Toronto Islands übersetzen. Dummerweise war ich so mit mir selbst beschäftigt, dass ich nichts von der großen, in den Nachrichten angekündigten Demo mitbekommen hatte, die genau jetzt zwischen mir und dem Seeufer im Bankenviertel stattfand.
Zuerst nahm ich das Geräusch wahr. Ein Geräusch, wie man es aus einem Sportstadion hört, wenn ein Spiel läuft: kein erkennbarer Inhalt, nur das tosende Auf und Ab vieler menschlicher Stimmen. Zwei Blocks später dachte ich: zorniger Stimmen. Vielleicht ein oder zwei Megafone in dem Gemisch. Dann bog ich um eine Ecke und sah es. Eine Masse von Demonstranten, die die Straße in beiden Richtungen füllte und ungefähr so leicht zu durchqueren war wie ein reißender Strom. Schlecht für mich, weil ich nach der Trödelei vor der InterAlia-Filiale sowieso schon Verspätung hatte.
Die Menschenmenge setzte sich offenbar aus Studenten, Akademikern und Gewerkschaftsleuten zusammen. Laut ihren Transparenten waren es die neuen Schuldengesetze und eine saftige Erhöhung der Studiengebühren an der University of Toronto, die sie an diesem heißen Abend Ende Juni auf die Straße getrieben hatten. Einen Block weiter westlich, wo am Himmel noch der Sonnenuntergang glühte, hatte eine ernste Auseinandersetzung begonnen. Alle starrten in diese Richtung, und in der Luft hing ein saurer Hauch, der wohl auf Tränengas hindeutete. Eigentlich wollte ich in diesem Augenblick nur ans Wasser, wo die Luft vielleicht ein, zwei Grad kühler war, und Dex treffen, obwohl er bestimmt schon sauer auf mich war. Also wandte ich mich nach Osten zur nächsten Kreuzung, um mir am Zebrastreifen einen Weg mitten durch die Menge zu bahnen. Eine schlechte Entscheidung, wie ich erkannte, als ich von der Flutwelle menschlicher Leiber erfasst wurde. Ich hatte erst wenige Schritte zurückgelegt, da wurden alle durch eine neue Bedrohung oder ein Hindernis enger zusammengedrängt.
Ich reckte den Kopf – ich bin ziemlich groß – und bemerkte, dass sich von Westen Polizisten in Kampfausrüstung näherten und mit den Schlagstöcken auf ihre Schilde trommelten. In hohem Bogen flogen Tränengaskanister in die Menge und zogen Rauchfahnen hinter sich her. Rechts von mir streifte sich eine Frau ein Halstuch über Nase und Mund. Einen Meter vor mir kletterte ein Typ in einem verblichenen PROPAGHANDI-Shirt auf das Dach eines parkenden Autos und schleuderte eine Wasserflasche nach den Cops. Ich wollte umkehren, doch inzwischen gab es kein Vorankommen mehr gegen den Strom der Demonstranten.
An der nächsten Kreuzung waren berittene Polizisten in Stellung gegangen, und allmählich dämmerte mir, dass ich schlimmstenfalls sogar damit rechnen musste, eingekesselt zu werden und im Zuge einer Massenverhaftung in einer Arrestzelle zu landen. (Und wen sollte ich anrufen, wenn das passierte? Meine Verwandten in New York State würden bestürzt und verständnislos auf meine Festnahme reagieren, und meine wenigen Bekannten in Toronto waren arme Kunststudenten, die sicher keine Kaution für mich aufbringen konnten.) Die Menge wogte nach Osten, und ich versuchte, zum nächsten Gehsteig auszuscheren. Trotz mehrerer Ellbogenstöße in die Rippen schaffte ich es schließlich zur Nordseite der Straße. In dem Gebäude unmittelbar vor mir befand sich ein Café, verriegelt und verrammelt, doch Stufen führten zu einer weiteren, ebenfalls vergitterten Ladenfront im Untergeschoss, und ich konnte mich unter die überhängende Betontreppe kauern.
Wegen der Tränengasschwaden kniff ich weiter die Augen zu, daher nahm ich nur verschwommene Schemen wahr: zumeist vorbeilaufende Beine auf Straßenniveau, einmal das Gesicht einer Frau mit großen Augen und panisch aufgerissenem Mund, die gestürzt war und sich verzweifelt hochrappelte. Ich zog mir das T-Shirt über die Lippen und atmete schluckend, als eine neue Ladung Tränengas zu mir herabschwappte. Das Dröhnen von Stimmen wurde allmählich von vereinzelten Schreien und dem mechanischen Poltern der Cops übertönt. Wie eine unheimliche Prozession zogen die berittenen Polizisten an der Nische vorbei, in der ich mich versteckt hatte.
Gerade als ich mich endlich in Sicherheit wähnte, stapfte ein Cop in Kampfausrüstung die Stufen herunter und entdeckte mich, wie ich da im Schatten kauerte. Hinter dem zerschrammten Plastikvisier des Helms war sein Gesicht gut zu erkennen. Kaum älter als ich, vielleicht Teil der Einsatztruppe, die bei den Auseinandersetzungen angegriffen worden war. Er wirkte fast ebenso verängstigt wie die Frau, die vor einigen Minuten hingefallen war. Die gleichen großen, hektischen Augen. Aber er war auch wütend.
Beschwörend hob ich die Hände: Hey, warten Sie. »Ich gehör nicht dazu.«
Ich gehör nicht dazu. So ziemlich das Feigste, was ich sagen konnte, allerdings auch vollkommen wahr. Das war praktisch mein verdammtes Lebensmotto. Ich hätte es mir gut auf die Stirn tätowieren lassen können.
Der Cop holte mit dem Schlagstock aus. Vielleicht hatte er sich nur einen leichten Hieb auf die Schulter vorgestellt, um mir Beine zu machen, doch der Knüppel zuckte nach oben und traf mich voll am rechten Jochbein. Ich spürte, wie die Haut riss. Heiße Taubheit, die zu Schmerz erblühte.
Selbst der Cop schien erschrocken. »Raus da!«, bellte er. »Los!«
Ich stolperte die Stufen hinauf. Die Straße war fast nicht mehr wiederzuerkennen. Ich befand mich hinter der Linie von Berittenen, die östlich der Kreuzung eine Gruppe von Demonstranten umzingelt hatten. Der Block, wo ich war, war leer bis auf verstreute Flugblätter, zurückgelassene Rucksäcke und Transparente, vor sich hin zischende Tränengaskanister und körnige Glasscherben von zerbrochenen Windschutzscheiben. Ein Stück weiter westlich stand ein Auto in Flammen. Das Blut aus meinem Gesicht malte rostrote Paisleymuster auf mein Shirt. Ich drückte die Hand auf den Riss, und das Blut sickerte mir wie warmes Öl durch die Finger.
Als ich um die nächste Ecke bog, kam ich an einer Polizistin vorbei, die keine Schutzausrüstung trug. Sie warf mir einen besorgten Blick zu und schien drauf und dran, mir Hilfe anzubieten, doch ich winkte ab. Ich zog mein Telefon aus der Tasche und wählte Dex’ Nummer. Er meldete sich nicht. Offenbar war er sauer, weil ich ihn versetzt hatte. An der University Avenue wankte ich durch einen Subway-Eingang und stieg in einen Zug, ohne auf die betroffenen Mienen der Fahrgäste zu achten. In diesem Moment wollte ich mich bloß an einen sicheren Ort verkriechen und meine Ruhe haben.
Bis ich nach Hause kam, hatte die Blutung fast aufgehört. Ich wohnte in einem Junggesellenapartment im zweiten Stock eines niedrigen gelben Backsteinbaus mit Blick auf einen Parkplatz. Billiger Parkettboden und ein paar kümmerliche Möbelstücke. Das Persönlichste an dem Ganzen war der Name auf dem Schild neben der Tür: A. Fisk. A für Adam. Der andere A. Fisk der Familie war mein Bruder Aaron. Unsere Mutter war eine eifrige Bibelleserin mit einer Schwäche für Alliterationen gewesen.
Der Badspiegel war zugleich die Tür zum Medizinschränkchen. Ich kramte ein Fläschchen Ibuprofen heraus, machte wieder zu und starrte mich an. Nein, es musste wohl nicht genäht werden. Über dem Riss hatte sich ein dicker, bräunlich roter Klumpen gebildet. In den nächsten Tagen würde ich garantiert mit einem Veilchen herumlaufen.
Blut im Gesicht, an den Händen, am Shirt. Das Wasser im Waschbecken rosig.
Da wusste ich auf einmal, dass ich bei InterAlia anrufen würde. Schließlich hatte ich nichts zu verlieren. Ein Treffen zu vereinbaren konnte nicht schaden. Was erwartete mich hinter der Mattglastür mit Messinggriff?
Vermutlich irgendein Schwindel.
Oder mit Glück vielleicht etwas Neues, anderes, zu dem ich endlich gehören konnte.
Mein Termin war am Dienstag nach den Vorlesungen. Ich erschien zehn Minuten zu früh.
Hinter der Tür und der gefliesten Lobby des neu gestalteten, zweistöckigen Baus war die Filiale von InterAlia mit Wänden aus Glasbaustein in Büroparzellen unterteilt. Aus Deckenschlitzen blies flüsternd kühle Luft, und durch ein getöntes Fenster fiel bernsteinfarbenes Sonnenlicht. Es herrschte ein reges Kommen und Gehen. Einige Leute trugen Business-Kluft, andere Straßenkleidung. Die Angestellten unterschieden sich nur durch ihre geprägten Namensschilder von den Klienten. Eine Rezeptionistin schlug meinen Namen in einer Anmeldeliste nach und schickte mich weiter zum Büro neun. »Ihre Aufnahme macht Miriam.«
Miriam erwies sich als eine etwa dreißigjährige Frau mit offenem Lächeln und einem leichten karibischen Akzent. Sie bedankte sich für mein Interesse an InterAlia und erkundigte sich, wie viel ich über die Affinitätstests wusste.
»Ich habe die Website ziemlich genau studiert«, antwortete ich. »Und auch den Artikel in der Atlantic.«
»Dann ist Ihnen das meiste, was ich Ihnen erzählen werde, schon vertraut. Trotzdem muss ich sichergehen, dass unsere Klienten verstehen, wie wir bei der Zuordnung vorgehen und was von ihnen erwartet wird. Manche Leute kommen mit völlig falschen Vorstellungen zu uns, und die möchten wir gleich am Anfang ausräumen. Schenken Sie mir also Ihre Aufmerksamkeit, und ich werde mich bemühen, Sie nicht zu langweilen.« Lächeln.
Ich erwiderte das Lächeln und lauschte ihrem Monolog, der wohl das verbale Pendant zum Kleingedruckten auf pharmazeutischen Beipackzetteln war.
»Zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir Ihnen keine Zuordnung garantieren können. Wir bieten hier eine Reihe von Tests, aus denen wir erschließen, ob Sie zu einer der zweiundzwanzig Affinitätsgruppen passen. Dafür verlangen wir zu Beginn eine kleine Anzahlung, die Ihnen zurückerstattet wird, falls Sie sich nicht qualifizieren. Letztlich qualifizieren sich etwas über sechzig Prozent der Bewerber, das heißt, die Chancen stehen etwas besser als eins zu eins. Trotzdem gilt, dass vier von zehn Bewerbern abgewiesen werden. Es ist also gut möglich, dass auch Sie betroffen sind. In Ordnung?«
Ich bejahte.
»Darüber hinaus weisen wir unsere Klienten darauf hin, dass eine Nichtqualifikation kein Werturteil darstellt. Wir suchen nach bestimmten Mustern komplexer sozialer Eigenschaften. Das ändert aber nichts daran, dass alle Menschen verschieden sind. Wenn Sie außerhalb dieser Parameter liegen, ist das also kein Mangel. Es bedeutet bloß, dass unsere Dienstleistung für Sie ungeeignet ist. Alles klar?«
Alles klar.
»Sie müssen auch begreifen, was wir Ihnen für den Fall der Qualifizierung anbieten. Erstens sind wir keine Partnervermittlung. Viele Menschen haben über ihre Affinität einen Lebenspartner gefunden, doch das lässt sich in keinster Weise garantieren. Manchmal kommen Leute zu uns, weil sie in Schwierigkeiten stecken, sozial oder psychisch. Unabhängig davon, ob diese Menschen eine therapeutische Betreuung benötigen, möchte ich festhalten, dass wir auch dafür nicht zuständig sind.« Sie blickte betont auf das Pflaster unter meinem Auge.
»Das ist nicht … Ich meine, ich laufe nicht rum und prügle mich ständig. Es war nur …«
»Geht mich nichts an, Mr. Fisk. Ihre Persönlichkeit wird von Fachleuten bewertet, und die Tests sind physisch und psychisch völlig objektiv. Niemand fällt ein Urteil über Sie.«
»Schön.«
»Sollten Sie sich qualifizieren, werden Sie einer der zweiundzwanzig Affinitäten zugeordnet und erhalten eine Einladung, sich einer örtlichen Gruppe anzuschließen. Jede Affinität ist überregional und lokal gegliedert. Die überregionalen Gruppen heißen ›Sodalitäten‹ und die lokalen ›Zweige‹. Ein Zweig hat maximal dreißig Mitglieder. Sobald er voll ist, bilden wir eine neue Gruppe. Sie stoßen also entweder zu einem bereits existierenden oder zu einem neuen Zweig. So oder so kann es vor Ihrer Zuordnung zu einer Wartezeit kommen. Zurzeit sind das nach Abschluss der Untersuchung im Schnitt zwei bis drei Wochen. Irgendwelche Fragen dazu?«
Keine.
»Angenommen, Sie werden einem Zweig zugeordnet, dann begeben Sie sich in Gesellschaft von Menschen, die polykompatibel sind. Manche Klienten sind der irrigen Meinung, dass sie in einem Zweig auf Menschen treffen, die genau wie sie sind. Das ist nicht richtig. Als Gruppe wird Ihr Zweig in physischer, ethnischer, sozialer und psychischer Hinsicht voraussichtlich eine hohe Vielfalt aufweisen. Unsere Bewertungen blicken weit über Rasse, Geschlecht, sexuelle Neigung, Alter und nationale Herkunft hinaus. In einer Affinitätsgruppe geht es nicht um den Ausschluss von Unterschieden. Es geht um Kompatibilitäten, die tiefer reichen als eine oberflächliche Ähnlichkeit. Unter Menschen der eigenen Affinität ist es statistisch wahrscheinlicher, dass man anderen vertraut, dass man auf Vertrauen stößt, dass man Freunde oder Partner findet und dass man ganz allgemein erfolgreiche soziale Beziehungen knüpft. In der eigenen Affinität wird man seltener missverstanden, und man hat einen intuitiven Zugang zu vielen Zweigfreunden. So weit?«
So weit.
»Noch einmal, Sie bekommen Ihre Anzahlung in voller Höhe zurück, wenn wir Sie nicht zuordnen können. Doch die Untersuchung ist auch mit einem zeitlichen Aufwand verbunden, den wir nicht zurückerstatten können. Sie müssen zu fünf Testsitzungen erscheinen, die jeweils mindestens zwei Stunden dauern. Bei den Terminen können wir uns ganz nach Ihren Wünschen richten. Fünf Abende nacheinander, einmal pro Woche oder auch in anderem Abstand – so wie es Ihnen passt.« Sie wandte sich dem Monitor auf ihrem Schreibtisch zu und tippte auf ein paar Tasten. »Das Online-Formular haben Sie schon ausgefüllt, sehr gut. Falls Sie sich für die Teilnahme entscheiden, brauchen wir jetzt von Ihnen noch eine gültige Kreditkarte und eine Unterschrift auf dieser Einverständniserklärung.« Sie nahm ein Blatt aus einer Schublade und schob es mir zu. »Außerdem müssen Sie mir ein amtliches Ausweisdokument mit Foto vorlegen. Bevor Sie gehen, wird Ihnen eine Schwester eine Blutprobe abnehmen.«
»Eine Blutprobe?«
»Eine gleich, damit wir mit der grundlegenden DNA-Sequenzierung beginnen können, und dann eine bei jeder Sitzung, um Sie auf Drogen zu testen. Abgesehen von den Blutproben, sind all unsere Untersuchungen nicht invasiv. Aber die Blutproben sind unverzichtbar, weil die Resultate wertlos sind, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln hier erscheinen. Die Ergebnisse sind natürlich streng vertraulich. Klienten, die regelmäßig Medikamente nehmen, müssen uns vorab davon in Kenntnis setzen. Aus den Angaben in Ihrer Bewerbung schließe ich, dass Sie nicht in diese Kategorie fallen.«
Die einzigen Medikamente, die ich in letzter Zeit geschluckt hatte, waren frei verkäufliche Schmerzmittel. Ich nickte.
»Also schön. Lesen Sie sich die Vereinbarung in aller Ruhe durch, bevor Sie unterschreiben. Wenn es Ihnen recht ist, gehe ich kurz mal raus und hole mir einen Kaffee. Möchten Sie auch eine Tasse?«
»Ja, bitte.«
Das Logo auf dem Vertragsformular –
INTERALIA
Mit anderen zu sich selbst finden
– war das Verständlichste daran, der Rest bestand aus juristischem Kauderwelsch, das für mich zum größten Teil zu hoch war. Trotzdem las ich es sorgfältig durch. Ich war so gut wie fertig, als Miriam zurückkehrte. »Irgendwelche Fragen?«
»Bloß eine. Da steht, dass die Testergebnisse in den Besitz des Unternehmens übergehen?«
»Nur die Ergebnisse, ohne Ihren Namen und andere Identifizierungsmerkmale. Anhand dieser Daten können wir unseren Klientenstamm bewerten und unsere Forschung besser ausrichten. Wir geben die von uns gesammelten Informationen nicht an Dritte weiter.«
Behauptete sie. Ungefähr so glaubwürdig wie Der Scheck ist schon in der Post. Aber mir war es eigentlich egal, wer meine Testergebnisse zu Gesicht bekam. »Ich denke, das geht in Ordnung.«
Miriam schob mir einen Stift zu und beobachtete lächelnd, wie ich unterschrieb und das Dokument datierte.
Später am Abend rief Dex an. Beim Anblick seiner Nummer überlegte ich, ob ich ihn auf die Mailbox sprechen lassen sollte. Dann hob ich doch ab.
»Adam!«, rief er. »Was treibst du?«
»Ich seh fern.«
»Was denn? Porno, oder was?«
»Irgendeine Doku.«
»Bestimmt Porno.«
»Es ist eine Sendung über Alligatoren. Und ich steh nicht auf Alligatorenporno.«
»Aha. Was war denn neulich abends?«
»Hab ich dir doch in einer SMS erklärt.«
»Der Quatsch von wegen Demo? Ich hab ewig auf dich gewartet und dann noch fast die Fähre verpasst.«
»Ich kann von Glück reden, dass ich nicht in der Notaufnahme gelandet bin.«
»Hättest du nicht einfach die Subway nehmen können?«
»Ich war fast dort und hatte schon Verspätung, deswegen …«
»Du hattest schon Verspätung – das sagt doch alles.«
Im letzten Jahr hatte ich sechs Monate lang mein Apartment mit Dex geteilt. Wir hatten uns bei den Kursen am Sheridan College kennengelernt. Aber letztlich klappte es mit der Wohngemeinschaft nicht. Bei seinem Auszug ließ er seine Bong und seine Katze zurück. Später kam er noch mal und holte die Bong. Die Katze überließ ich der Obhut der pensionierten Bibliothekarin zwei Türen weiter – sie freute sich. »Danke für dein Verständnis.«
»Soll ich rüberfahren zu dir? Wir könnten uns einen Film anschauen oder so.«
»Bin nicht in der Stimmung.«
»Ach komm, Adam. Du schuldest mir was.«
»Ja … Nein.«
»Du kannst mich doch nicht zweimal in einer Woche hängen lassen.«
»Da bin ich anderer Meinung«, sagte ich.
Natürlich war Dex nicht schuld an meiner Gereiztheit. Allerdings hätte er sowieso nie zugegeben, an irgendetwas schuld zu sein.
Wenn ich es mir durch den Kopf gehen ließ, gab es gute und schlechte Gründe für meine Bewerbung bei InterAlia. Die Tatsache, dass sich mein gesellschaftliches Leben um einen Typen wie Dex drehte, war ein guter. Und ein schlechter? Die Vorstellung, dass ich mir für zweihundert Dollar und eine Batterie von Psychotests ein besseres Leben kaufen konnte.
Immerhin hatte ich meine Hausaufgaben gemacht. Komplett naiv war ich nicht. Inzwischen hatte ich einiges über die Affinitäten erfahren.
Ich wusste, dass es diese Dienstleisung seit vier Jahren gab. Ich wusste, dass ihre Popularität im letzten Jahr nach Leitartikeln im New Yorker, in der Atlantic und in BoingBoing stark zugenommen hatte. Ich wusste, dass sie die Erfindung des israelischen Teleodynamikers Meir Klein war, der für die Arbeit bei der Firma InterAlia eine erfolgreiche akademische Karriere abgebrochen hatte. Ich wusste, dass insgesamt zweiundzwanzig größere und kleinere Affinitätsgruppen existierten, die jeweils nach einem Buchstaben des phönizischen Alphabets benannt waren. Die fünf großen waren Beth, Zai, Het, Semk und Tau.
Allerdings wusste ich mit Ausnahme der allgemeinen Angaben im Netz nicht, wie der Bewertungsprozess eigentlich genau funktionierte.
Zum Glück wurde mir eine kommunikative Testleiterin zugeteilt: Miriam, die schon mein Aufnahmegespräch geführt hatte. Als ich zur ersten Sitzung aufkreuzte, grinste sie wie eine gute alte Bekannte. Obwohl mir das Geschäftsmäßige dieses Lächelns nicht entging, war ich dankbar dafür. Ich sann darüber nach, ob Miriam wohl Mitglied einer Affinität war.
Sie eskortierte mich zu einer Schwesternstation im hinteren Bereich der InterAlia-Filiale, wo man mir wieder eine Ampulle Blut abzapfte, und anschließend in einen kleinen Untersuchungsraum. Dieser war fensterlos und auf knapp über kühl klimatisiert. Er bot einen Teakholzschreibtisch und zwei Stühle. Auf dem Schreibtisch befanden sich ein Vierzehn-Zoll-Monitor, ein Notebook und ein Kopfbügel aus Leder mit zwei USB-Eingängen.
»Muss ich den tragen?«, fragte ich.
»Ja. Heute benutzen wir ihn für ein paar Basismessungen. Wenn Sie möchten, können Sie ihn jetzt aufsetzen.«
Sie half mir beim Anbringen. Trotz der schweren Elektronik war der Kopfbügel erstaunlich bequem. Miriam schloss den Bügel mit einem Kabel an das Notebook an. Was sie auf dem Bildschirm des Notebooks sah, war für mich nicht zu erkennen.
»Die Initialisierung des Vorgangs dauert ein oder zwei Minuten«, erklärte sie. »Die meisten Informationen, die wir sammeln, werden erst später analysiert. Aber allein für die Datenerhebung müssen Unmengen von Zahlen verarbeitet werden.«
Ich überlegte, ob sie schon jetzt Daten erhob. War unser Gespräch Teil des Tests?
Anscheinend hatte sie meine Gedanken erraten. »Der Test hat noch nicht begonnen. Heute werden Sie bloß am Monitor eine Reihe von Bildern anschauen. Wie schon erwähnt, geht es dabei um die Ermittlung von Basiswerten.«
»Und wofür ist die Blutprobe? Nur zum Erkennen von Drogen und Medikamenten?«
»Auch zum Erkennen von primären und sekundären Stoffwechselprodukten. Sicher kommt Ihnen das ziemlich wahllos vor, Mr. Fisk, aber es ist alles miteinander verbunden. Wenn wir noch eines bräuchten, könnte das ein Motto von InterAlia sein: Alles ist verbunden. Die moderne Wissenschaft beschäftigt sich viel mit der Suche nach Interaktionsmustern. In der Vererbungslehre geht es dabei um das Genom. Im Hinblick auf die Ausdrucksformen der DNA sprechen wir vom Proteom. In der Hirnforschung ist vom Konnektom die Rede – wie Gehirnzellen einzeln oder in Gruppen zusammenwirken. Meir Klein hat für die Bandbreite charakteristischer menschlicher Interaktionen den Begriff Sozionom geprägt. Und alle beeinflussen sich gegenseitig, von der DNA zum Protein, vom Protein zu den Gehirnzellen, von den Gehirnzellen zum sozialen Verhalten, beispielsweise in der Arbeit oder in der Schule. Damit wir Sie einer Affinität zuordnen können, müssen wir untersuchen, wo genau Sie sich in jedem dieser Spektren befinden.«
Nachdem ich verständnisvoll genickt hatte, wandte sie sich wieder ihrem Notebook zu. »Okay, wir können loslegen. Ich verlasse das Zimmer, und der Monitor wird Ihnen eine Reihe von Fotos zeigen. Wie bei einer Diavorführung, fünf Sekunden pro Bild. Nach zwanzig Minuten gibt es eine Kaffeepause, dann noch mal zwanzig Minuten. Sie müssen nichts tun außer hinsehen. Okay?«
Und so lief es. Die Bilder waren schwer einzuordnen. Die meisten zeigten Menschen, einige auch Landschaften oder unbelebte Objekte wie einen Apfel oder einen Uhrturm. Die Fotos von Menschen erstreckten sich auf einen breiten Ausschnitt von Kulturen und Lebensaltern und waren auch im Hinblick auf das Geschlecht ausgewogen. Auf den meisten waren die Leute mit völlig undramatischen Dingen beschäftigt. Sie plauderten, kochten, arbeiteten. Ich bemühte mich, nicht zu viel in die Bilder und meine Reaktion auf sie hineinzudeuten.
Und das war es: die erste von fünf Sitzungen.
»Dann bis morgen Abend«, sagte Miriam zum Abschied.
Am nächsten Tag kam derselbe Kopfbügel zum Einsatz, aber keine Fotos. Stattdessen erschienen auf dem Monitor einzelne kleingeschriebene Wörter. Meine Aufgabe beschränkte sich darauf, das jeweilige Wort laut vorzulesen. Nach einigen Sekunden folgte das nächste. Und so weiter. Zuerst kam es mir komisch vor, dass ich allein in einem Zimmer saß und Dinge sagte wie Tier, Ansatz, Versöhnung, Tiefsee, Lied, Schuld, Aussicht … Doch nach einer Weile war es einfach wie eine eher langweilige, nicht besonders schwere Arbeit.
Zur mittleren Pause kehrte Miriam mit einer Tasse Kaffee zurück. »Ich habe mich erinnert, wie Sie ihn trinken. Einmal Milch, einmal Zucker, richtig? Oder hätten Sie lieber ein Glas Wasser?«
»Nein, Kaffee passt. Vielen Dank. Kann ich Ihnen eine Frage stellen?«
»Natürlich.«
»Eine persönliche Frage?«
»Probieren Sie’s.«
»Gehören Sie zu einer Affinität? Ich meine, falls Sie das überhaupt sagen dürfen.«
»Klar darf ich. Mitarbeiter können den Test kostenlos ablegen. Das hab ich getan. Ich kenne meine Affinität. Trotzdem bin ich nie einem Zweig beigetreten.«
»Warum nicht?«
Sie hob die linke Hand, an deren Ringfinger ein schlichter Goldreif saß. »Mein Mann wurde auch getestet, ohne sich zu qualifizieren. Ich möchte mich nicht in einem sozialen Kreis engagieren, von dem er ausgeschlossen ist. Eigentlich ist das kein unüberwindbares Problem, denn die Zweige organisieren auch partnerfreundliche Veranstaltungen. Aber er hätte keine offiziellen Funktionen ausüben können. Und das wollte ich nicht. Das ist auch der Grund, warum die bestehenden Zweige einen leicht überdurchschnittlichen Prozentsatz an jungen Singles, Geschiedenen und Verwitweten aufweisen. Wir gehen davon aus, dass sich dieses Missverhältnis im Lauf der Zeit ausgleichen wird, wenn mehr Menschen in ihren Affinitätsgruppen zusammenfinden. Jedenfalls zeigt der Trend schon in diese Richtung.«
»Haben Sie je bedauert, dass Sie nicht beigetreten sind?«
»Sicher bedauere ich, dass ich nicht habe, was für viele unserer Klienten so hilfreich und erfüllend ist. Aber ich habe meine Entscheidung getroffen, als ich meinen Mann geheiratet habe, und bin glücklich damit.«
»Für welche Affinität haben Sie sich qualifiziert?«
»Also, das ist wirklich eine persönliche Frage. Ich bin eine Tau, zumindest laut Analyse. Und ich finde es beruhigend zu wissen, dass ich eine Anlaufstelle habe, falls ich mich je an Menschen wenden muss, denen ich wirklich vertrauen kann. Aber jetzt sollten wir besser weitermachen, okay?«
Am nächsten Tag erhielt ich einen Anruf von Jenny Symanski.
Manche Leute hielten Jenny für meine Freundin. Ich war nicht sicher, ob auch ich zu diesen Leuten gehörte. Ich meine, nichts gegen Jenny. Es war einfach so, dass unserer Beziehung etwas permant Ungewisses anhaftete, und keiner von uns beiden sprach darüber.
»Hi«, sagte sie. »Passt es gerade?«
Sie rief aus meiner Heimatstadt Schuyler an. Der Ort liegt im Bundesstaat New York, und all meine Verwandten lebten dort. Vor zwei Jahren war ich aus Schuyler weggezogen, um am Sheridan College Grafikdesign zu studieren. Seither hatte ich Jenny nur bei meinen gelegentlichen Besuchen zu Hause gesehen. »Klar, warum nicht.«
»Bestimmt? Du klingst irgendwie abgelenkt.«
»Bin ich auch. Ich glaub, ich hab dir erzählt, dass ich mich um ein Praktikum bei einer Werbeagentur hier beworben habe – bis heute hab ich allerdings noch nichts gehört. Am Vormittag hatte ich Kurse, aber jetzt bin ich zu Hause, also …«
»Ich will dich nicht belästigen, wenn du so viel im Kopf hast.«
Ich fand ihre Besorgnis übertrieben. »Mach dir keine Gedanken.«
»Anscheinend kommst du ganz gut klar mit der Situation.«
»Welcher Situation? Meinst du das Praktikum? Die Chancen auf eine Stelle sind mies. Was gibt’s sonst Neues?«
Lange Pause.
»Jenny?«
»Ach, Scheiße. Aaron hat dich nicht angerufen, oder?«
»Nein, warum sollte er mich anrufen?« Wieder Schweigen. »Jen, was ist denn?«
»Deine Großmutter liegt im Krankenhaus.«
Ich sank aufs Sofa. Dex und ich hatten das Ding gekapert, nachdem eine Nachbarin es zur Sperrmüllabholung rausgestellt hatte. Die Polster waren zusammengedrückt und abgewetzt, und auch wenn man noch so viel darauf herumrutschte, es wurde einfach nicht bequem. Doch in diesem Moment war ich völlig betäubt. Man hätte mir ein Schwert in den Bauch rammen können – ich hätte nichts gespürt. »Was ist passiert?«
»Also, pass auf, eigentlich geht’s ihr ganz gut. Okay? Sie ist nicht tot und liegt auch nicht im Sterben. Anscheinend ist sie in der Nacht mit Schmerzen in der Brust aufgewacht. Hat geschwitzt und musste sich übergeben. Dein Dad hat den Notarzt gerufen.«
»O Gott, Jen – ein Herzinfarkt?«
Ich malte mir Grammy Fisk in ihrem verschlissenen alten Flanellnachthemd aus. Weiß mit rosa Blumenmuster. Sie liebte dieses Nachthemd, auch wenn sie sich uns darin nie vor neun Uhr abends oder nach sechs Uhr früh zeigte. Fremde sahen sie nie darin. Die Vorstellung, dass Sanitäter in ihr Schlafzimmer eindrangen, hätte sie bestimmt entsetzt.
»Das dachten alle. Aber ich war heute Morgen bei euch, und dein Dad hat erzählt, die Ärzte meinen, es war die Gallenblase.«
Ich war mir nicht sicher, was das bedeutete. Immerhin klang es etwas weniger bedrohlich als eine Herzgeschichte. »Und was passiert jetzt? Wird sie operiert?«
»Das steht noch nicht fest. Zurzeit wird sie im Krankenhaus untersucht, aber sie glauben, dass sie morgen nach Hause kann. Es war die Rede von Diät und Medikamenten, Genaueres weiß ich nicht.«
»Das klingt doch nicht schlecht …«
»Unter diesen Umständen.«
»Ja, unter diesen Umständen.«
»Tut mir echt leid, dass ich so schlimme Neuigkeiten für dich habe.«
»Nein«, widersprach ich. »Ich bin dir dankbar.«
Das stimmte auch. In mancher Hinsicht war es besser, schlechte Nachrichten von Jenny zu hören als von Aaron. Mein Bruder betrachtete mich und Grammy Fisk mit einer gewissen Skepsis. Mein Vater hatte Aarons Betriebswirtschaftsstudium finanziert, und Aaron war inzwischen stellvertretender Leiter des Familienunternehmens. Doch für mein Grafikdesignstudium war allein Grammy Fisk aufgekommen, und zwar gegen den erklärten Willen meines Vaters.
In mir stieg eine Frage auf. »Wie hast du überhaupt davon gehört?«
»Na ja, Aaron hat es mir erzählt.«
Die Fisks und die Symanskis standen sich schon seit Jahrzehnten nahe. Jenny und ich waren zusammen aufgewachsen, sie war ständig bei uns zu Hause. Dennoch war ich verwundert. »Aaron hat es dir erzählt, aber mir nicht?«
»Ich schwöre, er wollte dich anrufen. Hast du dein Handy gecheckt?«
Das tat ich nur selten. Ich bekam nicht viel Anrufe oder SMS. Jetzt sah ich nach. Und tatsächlich: zwei entgangene Anrufe von einer vertrauten Nummer. Aaron hatte zweimal versucht, mich zu erreichen. Beide Male gestern Abend, als ich zu der Testsitzung bei InterAlia war und das Telefon abgestellt hatte.
Wenig später rief ich Aaron an und erklärte ihm, dass mir Jenny bereits alles erzählt hatte. Ich entschuldigte mich, dass ich mich nicht früher gemeldet hatte.
»Tja, anscheinend alles halb so wild. Inzwischen ist sie schon wieder zu Hause.«
»Kann ich mit ihr reden?«
»Sie schläft und braucht Ruhe, also besser nicht.«
Ich konnte mir mühelos vorstellen, wie Aaron im Wohnzimmer in den Hörer des uralten Telefonapparats sprach. In Toronto war es warm und in Schuyler vermutlich ebenfalls. Sicher standen die Frontfenster offen, und die Vorhänge waren schattig gesprenkelt von der Weide im Garten. Im Haus war es wahrscheinlich etwas stickig, weil mein Vater die Klimaanlage grundsätzlich nur bei der ärgsten Hitze einschaltete.
Und Aaron selbst: angezogen wie immer, wenn er nicht in der Firma war – schwarze Jeans, weißes Hemd, keine Krawatte. Vielleicht wischte er sich gerade mit dem Daumen eine Schweißperle von der Stirn.
»Wie haben Dad und Mama Laura es aufgenommen?«
Mama Laura war unsere Stiefmutter.
»Ach, du kennst doch Dad. Hat die Sache an sich gerissen und den Sanitätern praktisch Befehle erteilt. Trotzdem hat er sich natürlich Sorgen gemacht. Mama Laura war fast den ganzen Tag in der Küche. Ständig kommen Nachbarn mit Essen vorbei, als wäre jemand gestorben. Wirklich nett, aber inzwischen wissen wir schon gar nicht mehr wohin vor lauter Lasagne und Fleischklößchen.«
»Was ist mit Geddy?«
Geddy, unser dreizehnjähriger Stiefbruder, Mama Lauras Geschenk an die Familie. »Anscheinend kommt er klar«, antwortete Aaron. »Aber Geddy ist sowieso immer ein Rätsel.«
»Sag Grammy Fisk, dass ich morgen früh bei ihr bin.« Dafür musste ich ein Auto mieten. Aber wenn ich beim Grenzübertritt nicht aufgehalten wurde, war es nur eine fünfstündige Fahrt.
»Sie will nicht.«
»Wer will was nicht?«
»Grammy Fisk. Ich soll dir ausrichten, dass du nicht kommen sollst.«
»Das waren ihre Worte?«
»Der ungefähre Wortlaut war: Sag Adam, er soll sich nicht vom Studium abhalten lassen, bloß damit er nach mir schaut. Und sie hat recht. Sie ist zäh wie eine Ziege. Ich würde dir raten, warte bis zum Semesterende.«
Vielleicht, aber das wollte ich direkt aus Grammy Fisks Mund hören.
»In den nächsten zwei Monaten kommst du uns doch sowieso mal besuchen, oder?«
»Klar, auf jeden Fall.«
»Also schön. Dann geb ich dir jetzt mal Dad. Er kann dir erzählen, was die Ärzte meinen.«
Mein Vater käute zehn Minuten lang alles wieder, was er über das Wesen und die Funktion der Gallenblase erfahren hatte. Das Fazit war, dass Grammy Fisks Zustand zwar nicht unbedenklich, aber alles andere als lebensbedrohlich war. Inzwischen war sie wach und in der Lage, am Schlafzimmeranschluss zu sprechen. Sie bedankte sich für meine Nachfrage und beschwor mich, in Toronto zu bleiben. »Bloß weil ich eine schlechte Nacht hatte, will ich doch nicht die Ausbildung ruinieren, für die ich bezahlt habe. Besuch mich lieber, wenn’s mir wieder besser geht. Das meine ich ernst, Adam.«
Ich hörte die Erschöpfung in ihrer Stimme, aber auch die Entschlossenheit.
»Wir sehen uns auf jeden Fall in ein paar Wochen.«
»Und ich freu mich schon darauf«, sagte sie.
Die dritte Testsitzung war die unangenehmste. Eine halbe Stunde lag ich festgeschnallt unter der Kuppel eines MRT-Geräts. Miriam wies darauf hin, dass die Bilder mit den EEG-Daten der früheren Sitzungen kombiniert werden sollten, um die Ergebnisse abzugleichen.
Am nächsten Abend trug ich wieder den Kopfbügel und hörte mir aufgezeichnete Stimmen an, die nichtssagende, kryptische Sätze sprachen. Wenn es regnet, kannst du meinen Schirm benutzen. Wir haben dich heute im Laden gesehen.
»Letztlich dient das alles dazu«, erklärte Miriam, »Sie auf dem Raster des menschlichen Sozionoms zu verorten.«
Da ich es nicht nachprüfen konnte, musste ich ihr wohl glauben. Die Einzelheiten des Verfahrens waren ein gut gehütetes Geheimnis. Meir Klein, der Erfinder des Tests, hatte zu seiner Zeit als Professor am Israel Institute of Technology in Haifa die Grundzüge der sozialen Teleodynamik entwickelt und darin die Voraussetzungen für eine Taxonomie des menschlichen Sozialverhaltens skizziert. Doch der Hauptteil seiner Arbeit war erst seit seiner Anstellung bei InterAlia entstanden, und die genauen Details waren durch wasserdichte Geheimhaltungsvereinbarungen geschützt. Der Prozess, der die Menschen in zweiundzwanzig Affinitäten klassifizierte, war nie vollständig beschrieben oder von Gutachtern geprüft worden. Im Grunde konnte man nur konstatieren, dass es anscheinend funktionierte. Mir reichte das.
Überhaupt fand ich die Idee aufregend. Ich wünschte mir, dass es stimmte. Die Menschen sind die kooperativste Gattung auf dem ganzen Planeten. Wer kann von sich behaupten, dass er irgendwas mit eigenen Händen und aus Materialien geschaffen hat, die er allesamt persönlich aus der Natur gewonnen hat? Ohne dieses Netz von Kooperation sind wir so anfällig wie dreibeinige Antilopen im Revier eines Löwen. Dennoch neigen wir gleichzeitig zu Gier, zu moralischer Gleichgültigkeit und zu Eroberungskriegen jeder Dimension – vom Kindergarten bis zur UN. Wer hat sich noch nie nach einem Ausweg aus diesem Dilemma gesehnt? Es ist, als wären wir für das Leben mit einer Art Bilderbuchfamilie in einem Haus bestimmt, das keine verschlossenen Türen kennt und sie auch nicht kennen muss. Jede noch so unausgereifte Utopie ist ein Traum von diesem Haus. Unser Wunsch danach ist so stark – wir wollen einfach nicht glauben, dass es nicht existieren kann oder wird.
Hatte Meir Klein einen Zugang zu diesem Bilderbuchhaus entdeckt? Er hatte das nie behauptet, zumindest nicht ausdrücklich. Aber selbst wenn er bloß die zweitbeste Lösung gefunden hatte, war es immerhin die zweitbeste Lösung.
Bei der letzten Testsitzung saß ich, verkabelt mit einem Wust an Messgeräten, vier Stunden vor einem Monitor. Miriam ließ sich nur in den Pausen blicken und verwöhnte mich mit Kaffee und Haferrosinenkeksen.
Auf dem Monitor lief ein Programm interaktiver Tests mit Fotos, Symbolen, Text, bewegten Bildern und gelegentlich gesprochenen Worten. Der Computer setzte meine Ergebnisse in Beziehung zu meinem Gesichtsausdruck, den Augenbewegungen, der Haltung, dem Blutdruck, den-EEG-Werten und meinem Herzschlag.
Die Tests selbst waren ziemlich einfach. In einem ging es um räumliches Vorstellungsvermögen, und er funktionierte wie ein Tetrisspiel. Eine animierte Sequenz zeigte einen herrenlosen Zug voller Passagiere auf dem Weg in den sicheren Untergang. Nun stand man vor der Wahl, den Zug mit einem Knopfdruck auf ein anderes Gleis zu lenken und damit alle Passagiere zu retten, aber dabei zwei zufällig erscheinende Fußgänger zu töten, oder den Zug weiterfahren zu lassen und damit alle Menschen an Bord in den Tod zu schicken. Manche Tests befassten sich mit erkennbaren Themen wie ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion, doch die meisten waren ziemlich obskur. Gegen Ende der vier Stunden hatte ich das Gefühl, dass in Wirklichkeit meine Geduld auf die Probe gestellt wurde.
Schließlich wurde der Monitor leer, und Miriam trat mit einem strahlenden Lächeln ein. »Das war’s!«
»Das war’s?«
»Sie haben’s geschafft, Mr. Fisk. Jetzt fehlt bloß noch die Analyse. In zwei Wochen sollten Sie Ihre Ergebnisse kriegen, vielleicht sogar schon früher.«
Sie half mir beim Abnehmen des Kopfbügels und der Messverbindungen. »Schwer zu glauben, dass es vorbei ist«, sagte ich.
»Im Gegenteil«, erwiderte sie. »Mit ein bisschen Glück geht es für Sie jetzt erst so richtig los.«
Ich verließ das Gebäude und trat hinaus in eine schwülwarme Nacht. Die letzten Büroangestellten waren nach Hause gegangen und hatten das Viertel eiligen Taxis und zwei spärlich besuchten Cafés überlassen. Ich schlenderte zur Subway-Station College Street, wo ein Obdachloser mit einem Kleingeldbecher vor sich an der Wand lehnte. Er bedachte mich mit einem Blick, der entweder flehend oder verächtlich war. Ich warf ihm eine Dollarmünze in den Becher. »Danke, Kumpel«, nuschelte er. Oder hatte ich da doch Trottel gehört?
Als ich in meinem Apartment ankam, hatte ein heftiger Regenguss eingesetzt. Nach dem kurzen Weg von der Subway war ich völlig durchweicht, aber sobald ich ein Dach überm Kopf hatte und nach einem Handtuch greifen konnte, erschien mir das gar nicht mehr schlimm. Im Bad inspizierte ich die Stelle an der Wange, wo mich der Cop erwischt hatte. Der blaue Fleck verblasste bereits. Von dem Riss war nur noch eine blasse rosa Linie übrig. Trotzdem träumte ich nachts von dem Vorfall. Im Zimmer war es dunkel, und der an die Fensterscheiben prasselnde Regen klang wie das Brüllen einer großen Menschenmenge.
Zehn Tage vergingen.
Zwei Vorstellungsgespräche für ein Sommerpraktikum führten zu nichts. Ich stellte ein zum Semesterende fälliges Flash-Video fertig und gab es ab. Meine Zukunft machte mir Sorgen.
Am zehnten Tag öffnete ich eine E-Mail von InterAlia. Sie hatten meine Testergebnisse ausgewertet, stand da, und mich einer Affinität zugeordnet. Und zwar nicht bloß irgendeiner Affinität, sondern Tau, einer der fünf großen. Die Gebühren für die Untersuchung würden von meiner Kreditkarte abgebucht, hieß es weiter. In Kürze würde ich von einem örtlichen Zweig hören. Auf dem Weg zur Uni piepte mein Telefon. Ich ließ den Anruf nicht auf die Mailbox gehen, sondern hob ab wie ein braver Bürger.
Es war Aaron. »Die Lage hat sich verschlimmert«, sagte er. »Grammy Fisk ist wieder im Krankenhaus. Diesmal musst du wirklich kommen.«
2
Das Städtchen Schuyler lag im nordöstlichen Zipfel des County Onenia im Bundesstaat New York. Onenia war eine Verballhornung des Mohawk-Begriffs onenia’shon:’a, der so viel bedeutete wie Verschiedene Felsen. Über ein Jahrhundert lang hatte Schuyler hauptsächlich von den Steinbrüchen der Umgebung gelebt: Gruben, die in den spröden Karst unter dem unfruchtbaren Ackerland der Region geschlagen wurden. Ab den Siebzigerjahren waren die meisten dieser Steinbrüche nicht mehr rentabel und wurden geschlossen. Danach füllten sie sich mit öligem braunen Wasser, das im Frühjahr anstieg und im Verlauf des langen Sommers wieder verdunstete. Als kleiner Junge hatte man mich vor dem Spielen in den alten Steinbrüchen gewarnt, und natürlich waren sie für jedes Kind, das ich kannte, ein unwiderstehlicher Magnet gewesen. So oft wie möglich fuhren wir über die Landstraßen hin, auf denen sich in der Hitze Heuschrecken zusammendrängten wie flirrender brauner Schnee.
Auf dem Weg zum Haus meines Vaters fuhr ich an Zugängen zu Schotterstraßen vorbei, auf denen früher Lastwagen den Kalkstein zu verarbeitenden Betrieben im ganzen Bundesstaat transportiert hatten. Der Stein aus Onenia County hatte zur Errichtung von Dutzenden Bibliotheken und öffentlichen Gebäuden beigetragen, als diese noch ein gewisses Ansehen genossen. An der Hauptstraße von Schuyler befanden sich ein paar Relikte dieser Ära: eine alte Bank, in der inzwischen eine Gap-Filiale untergebracht war, die jedoch noch immer ihre Kalksteinfassade zur Schau trug; eine Carnegie-Bibliothek im Federal Style mit einem kleinen öffentlichen Park, der sie von der Spirituosenhandlung auf der einen und dem Sozialamt auf der anderen Seite trennte. Alles war schon dunkel, denn ich hatte Toronto am Nachmittag verlassen und war erst kurz nach einem regnerischen Sonnenuntergang in Schuyler angekommen.
Trotz schwerer Zeiten gab es noch immer einen »guten« Teil von Schuyler, wo der schwindende Bestand der wohlhabenden Alteingesessenen residierte: Familien wie die Fisks, die Symanskis, die Cassidys, die Muellers. Ihre Fenster strahlten, als wäre ihr Reichtum zu rechteckigen Scheiben aus goldenem Licht zusammengepresst worden, und die Häuser verhießen die Behaglichkeit, den Komfort und die Geborgenheit eines intakten Familienlebens, wenngleich die Realität oft anders aussah.
Ich lenkte meinen Wagen in die Einfahrt und parkte neben Aarons Lexus und hinter dem Lincoln Navigator meines Vaters. Auch hier warfen die Fenster ihr tröstliches Licht auf die regennassen Blätter der Weide im Hof. Doch im Haus war niemand glücklich. Als ich durch die Tür kam, drängten sich alle um mich: mein Vater, mein Bruder, meine Stiefmutter Laura. Der dreizehnjährige Geddy stand hinter Mama Laura, und als ich auf ihn zutrat, bot er mir die Hand mit einer Feierlichkeit, die unter anderen Umständen komisch gewesen wäre. Mir fiel sofort auf, dass sein Haar militärisch kurz geschoren war – wahrscheinlich ein neuer Vorstoß meines Vaters, um Geddy »männlicher« zu machen. Ich erkannte die Symptome, denn auch mir hatte er früher des Öfteren auf diese Weise zugesetzt.
»Wir haben mit dem Abendessen auf dich gewartet«, erklärte Mama Laura. »Komm rein und mach dich frisch. Geddy bringt deine Sachen hoch auf dein Zimmer, nicht wahr, Geddy?«
Erfreut bemächtigte sich Geddy der Reisetasche, in die ich ein paar Kleider zum Umziehen geworfen hatte. »Danke«, sagte ich.
»Aber beeil dich«, mahnte mein Vater. Seit unserer letzten Begegnung hatte er sich nicht im Geringsten verändert. Das gleiche frisch gebügelte, blaue Hemd, die gleiche zerknitterte, schwarze Krawatte lose um den Kragen. Er war groß und mager. Allgemein hieß es, dass ich aussah wie er, und das stimmte wohl auch, obwohl ich selbst diese Ähnlichkeit nur wahrnahm, wenn ich müde oder zornig war. Es schien, als hätte sich eine permanente Unzufriedenheit in sein Gesicht gegraben.
Bei Tisch sprachen wir nicht über Grammy Fisk – zumindest nicht gleich. Das Wesentliche wusste ich schon durch das Telefonat. Vergangene Nacht war meine Großmutter erneut in den frühen Morgenstunden mit Beschwerden aufgewacht, die allerdings nichts mit ihrer Gallenblase zu tun hatten. Diesmal hatte sie sich nicht dafür entschuldigt, dass sie allen bloß zur Last fiel, und auch nicht darauf bestanden, sich vor dem Eintreffen der Sanitäter anzuziehen. Nach dem Aufwachen konnte sie ihre rechte Körperseite nicht mehr spüren und bewegen; sie war auf einem Auge blind; sie sprach lallend und undeutlich; die nackte Angst war ihr anzumerken.
Als sie ins Onenia County Hospital eingeliefert wurde, hatte sie das Bewusstsein verloren. Die MRT-Bilder zeigten massive Gehirnblutungen. Mit anderen Worten, sie hatte einen Schlaganfall erlitten und lag im Koma. Obwohl mein Vater es nicht direkt aussprechen wollte – »es sieht nicht so gut aus«, war das Äußerste, was er sich abringen konnte –, war nicht damit zu rechnen, dass sie sich wieder erholen würde. Das Krankenhaus hatte versprochen, bei einer Änderung ihres Zustands sofort anzurufen. Am nächsten Morgen wollten wir alle hinfahren, um an ihrem Bett zu wachen.
»Allerdings kriegt sie anscheinend sowieso nichts mit«, hatte mein Vater am Telefon hinzugefügt. »Ich glaube, sie merkt gar nicht, dass wir da sind.«
Mama Laura hatte ein wahres Festmahl gekocht, unter anderem Süßkartoffeln in braunem Zucker und Brathähnchen, aber niemand hatte großen Appetit. Ich am allerwenigsten. So saßen wir da und stocherten auf unseren Tellern herum. Mit zweiundvierzig hatte Mama Laura, die zehn Jahre jünger war als mein Vater, immer noch das schüchterne Benehmen, das sie bei ihrer Heirat mitgebracht hatte: eine instinktive Vorsicht, die an ihrer Körpersprache und ihrem immer leicht abgewandten Gesicht zu erkennen war. Hinter dieser Unterwürfigkeit verbarg sich eine echte Liebe zu der Arbeit, die sie in der Familie verankerte. Wir hätten uns Personal leisten können, doch Mama Laura wollte nichts wissen von einer Hausangestellten oder einer Köchin. Nicht dass sie sich als Dienerin betrachtete. Sie erwartete durchaus Anerkennung für ihre Leistung. Aber für sie stellte diese Leistung zugleich den Beweis dar, dass sie ein Recht hatte, bei uns zu sein. Sie gab uns zu essen und hielt das Haus sauber, und dadurch hatte sie Anspruch auf ein gewisses Minimum an Respekt sowohl für sich als auch für ihren Sohn Geddy. Jetzt starrte sie bedrückt auf die immer noch voll beladenen Servierplatten. Auch sie selbst hatte kaum etwas angerührt.
»Diese ganzen Scherereien im Südchinesischen Meer und im Persischen Golf«, sagte mein Vater jetzt. »Das tut unserem Geschäft nicht gut. Und der Stadt auch nicht.«
Das war seine Vorstellung von einem neutralen Thema. Er richtete die Bemerkung an meinen älteren Bruder. Aaron saß neben mir, die Schultern vorgeschoben, Messer und Gabel über dem Teller – er war der Einzige, dessen Appetit kaum gelitten hatte. Und wie immer wusste er, was von ihm erwartet wurde. »Ja, die Chinesen.« Er nickte. »Und diese verdammten Saudis …«
Die Dynamik war mir so vertraut, dass ich nur mit halbem Ohr hinhören musste, um der Unterhaltung zu folgen. Die Ansichten meines Vaters, verstärkt von meinem Bruder. Nicht etwa, dass Aaron sich verstellt hätte. Er teilte die Auffassung meines Vaters, dass Amerika ein gefallenes Paradies war, vor dessen Toren eine Wildnis aus Armut, Laster und Niedertracht lauerte.
Ausnahmsweise meldete sich Mama Laura zu Wort und fragte, ob ich noch Kartoffelbrei wollte.
Nein danke.
»Wie geht es mit dem Studium?«, fragte sie in einer Gesprächspause.
»Ganz gut.«
»Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ich meine Grafikdesign. Zeichnet man da viele Bilder?«
»Ein bisschen mehr ist es schon.«
»Das denke ich mir.«
Mit ungeduldiger Miene kamen Aaron und mein Vater wieder auf den Nahen Osten und die explodierenden Ölpreise zurück. Ich schaute zu Geddy, der mir gegenübersaß. Er starrte versunken auf seinen Teller und schob die Speisen hin und her, ohne viel davon zu essen. Sein Gesicht wirkte müde und ein wenig schwammig. Er war ein ängstlicher Junge, und seine beste Verteidigungsstrategie war auch jetzt der Rückzug in sich selbst. Grammy Fisk war immer gut zu Geddy gewesen – genau wie zu mir. Was sollte Geddy ohne sie anfangen? Sicher, seine Mutter kümmerte sich um ihn, aber wer würde ihn verstehen?
Nachdem die Wohnzimmeruhr elf geschlagen hatte, gingen wir alle zu Bett. Ich schlief in meinem alten Zimmer und schob das Fenster einen Spalt auf. Der Regen hatte eine Kaltfront nach Onenia County gebracht. Eine frische, feuchte Brise hob den Vorhangsaum. Alle Geräusche waren so vertraut: die im Wind wogende Weide im Vorgarten, das aus den Fallrohren schießende Regenwasser, der Hall von allen Seiten des Zimmers. Nur der Rest des Hauses fühlte sich hohl an, als würde ihm das Herz fehlen.
Am Morgen fuhren wir ins Krankenhaus zu Grammy Fisk.
Wir ließen uns im Wartebereich nieder und verbrachten abwechselnd Zeit mit ihr. Ich war nach meinem Vater und Aaron dran.
Grammy Fisk war nicht ansprechbar, und ein Arzt hatte uns möglichst schonend erklärt, dass kaum noch höhere Gehirnfunktionen vorhanden waren. Dennoch war es denkbar – das wollten wir uns zumindest einreden –, dass sie unsere Anwesenheit registrierte. Sobald ich sie erblickte, bekam ich Zweifel. Grammy Fisk war nicht in diesem Zimmer. Natürlich lag dort ihr Körper auf dem Bett, angeschlossen an Infusionen und Monitore, mit eingefallenen Wangen, weil man ihr das Gebiss herausgenommen hatte – eine Demütigung, die sie sich bei wachem Verstand nie hätte gefallen lassen. Aber sie war fort. Einfach fort. Ihre Hand, nach der ich fasste, fühlte sich unbelebt an, wie ein aus Pfeifenreinigern und Pappmaschee gebastelter Gegenstand.
Trotzdem dankte ich ihr für alles, was sie mir gegeben hatte. Und das war nicht wenig. Nicht zuletzt die Vorstellung, dass ich vielleicht nicht völlig allein war auf der Welt.
Am Spätnachmittag traf Jenny Symanski im Krankenhaus ein. Wir umarmten uns und wechselten ein paar Worte, dann verbrachte auch sie einige Minuten bei Grammy Fisk. Während wir warteten, schlug Mama Laura vor, dass ich Jenny zum Essen ausführen sollte. Der Rest der Familie konnte sich mit dem Krankenhausangebot begnügen, doch sie fand, dass Jenny etwas Stilvolleres verdient hatte, wenn ich schon mal in der Stadt war.
Wir nahmen mein Auto. Ich fuhr mit Jenny vorbei am Outlet-Zentrum im Vorort und über die alte Hauptstraße zu unserem alten Stammlokal in Schuyler, einem chinesischen Restaurant namens Smiling Dragon. Grüne Linoleumböden, ein ums Überleben kämpfender Ficus am Fenster, kein Schnickschnack.
Jennys Dad war über dreißig Jahre lang der Freund und Trinkkumpan meines Vaters gewesen. Beide hatten mit einem bescheidenen Startkapital aus der Familie begonnen, und beide hatten für die Verhältnisse von Onenia County einen bescheidenen Wohlstand erreicht. Jennys Dad besaß nördlich von Schuyler ein riesiges Areal an ertragsarmem Ackerland, auf dem er in den besseren Tagen der Stadt erfolgreich Wohnsiedlungen und Einkaufszentren realisiert hatte; mein Vater hatte die geerbte Eisenwarenhandlung zu einer Kette für Landwirtschaftsgeräte mit Filialen im ganzen Bundesstaat ausgebaut. Die Familien waren miteinander groß geworden. Als wir noch jünger waren, war ich oft bei Jenny zu Besuch gewesen. Später ging das nicht mehr, weil ihre Mutter Alkoholikerin war; und so wurde Jenny praktisch zum Ehrenmitglied der Fisks.
Bei ein paar Frühlingsrollen redeten Jenny und ich über Grammy Fisk. »Sie war der Beatnik der Familie«, erzählte ich. »Einmal hat sie mir ihr Highschool-Jahrbuch gezeigt. Jahrgang siebenundfünfzig. Irgendeine Schule in Allentown.« Dort hatte sie auch mein Großvater in einer Bude am Jahrmarkt entdeckt. »Sie war wohl ein ziemlich erstaunlicher Anblick. Langes, schwarzes Haar, unglaublich mitreißend. Sie hat dann ihr Studium abgebrochen und ist zwei Jahre lang ohne festen Beruf in der Gegend rumgezogen. Vor allem auf Folk-Musik hat sie geschworen, zumindest bis sie geheiratet hat, und selbst danach hat sie sich noch manchmal mit ihren alten Freundinnen zu einer Vorstellung davongeschlichen. In ihr Fotoalbum waren jede Menge abgerissene Eintrittskarten geklebt.«
»Wirklich? Davon hat sie mir nie was erzählt.«
Aus naheliegenden Gründen. Mein Großvater hatte den Republikaner Barry Goldwater verehrt, und Grammy Fisk hatte nie ein Wort des Widerspruchs geäußert. Als mein Vater geboren wurde, waren ihre Schallplatten von Charlie Parker und Bob Dylan bereits permanent eingemottet. Aber sie kannte Dinge, für die die anderen Fisks blind waren. Wenn die Welt ein Rätsel war, dann wurde Grammy von den Puzzlesteinen angezogen, die nicht passten. »Du weißt ja selbst, wie sie war.«
»Ja.«
Jenny war eins sechzig klein und zog sich an, als wollte sie unbedingt übersehen werden: Jeans und unscheinbares Baumwollshirt, das blonde Haar so fest nach hinten gezurrt, dass es wehtat. Ihr Mund, der sonst so gern zu einem Lächeln erblühte, war ernst vom Kummer über Grammy Fisks Zustand. Sie neigte den Kopf in meine Richtung. »Und wie geht es dir wirklich da oben in Kanada? Was ist überhaupt mit deinem Gesicht passiert?«
Ich schilderte ihr den Vorfall bei der Demo. Am Ende fragte sie: »Entschuldige, bist du jetzt ein linker Polizistenhasser?«
»Willst du eine ehrliche Antwort? Ich erinnere mich vor allem daran, wie der Cop aussah. Angefressen natürlich und total angespannt. Aber auch verängstigt, weißt du? Als wäre der Schlag gegen mich nichts, worauf er stolz ist. Und auch nichts, was er nach der Arbeit gegenüber seiner Frau erwähnt.«
»Oder es war einfach ein Arschloch.«
»Vielleicht.«
»Er hatte die Wahl. Er hätte dich auch zum Weitergehen auffordern können.«
»Sicher, bloß dass ihn die Situation eben in eine andere Richtung gedrängt hat. Und das hat mich auf den Gedanken gebracht, wie verkorkst und wahllos unser Umgang mit anderen Leuten ist. Das muss doch besser gehen.« Und weil das hier Jenny war, mit der ich praktisch über alles reden konnte, verriet ich ihr, dass ich den Affinitätstest abgelegt hatte.
Sie zögerte kurz. »Diese Affinitätsgruppen … was ist das eigentlich? Eine Art … Partnervermittlung?«
»Nein, nein, überhaupt nicht.« Ich erzählte ihr von Meir Klein und InterAlia. »Im Grunde hatte ich einfach die Nase voll davon, dass ich dort niemanden zum Reden habe, außer vielleicht zwei Typen aus den Kursen am College.«
»Die von InterAlia erschaffen also irgendwie einen sozialen Kreis für dich?«
»Nicht unbedingt, aber es ist schon so, dass man unter Umständen viele neue Freunde findet.«
»Aha. Und das funktioniert wirklich?«
»Angeblich. Ich weiß es noch nicht.«
»Soso.« Das war typisch Jenny. Es bedeutete: Was ich da höre, gefällt mir nicht, aber ich will mich deswegen auch nicht streiten. »Vielleicht sollte ich