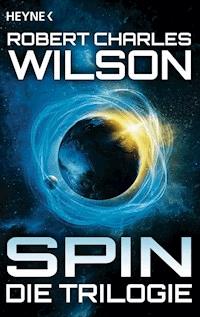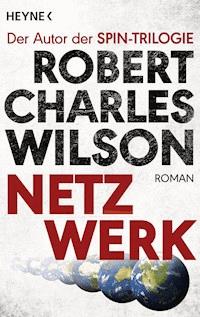7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die Sterne am Himmel verschwinden
Der junge Tyler Dupree sitzt eines Abends mit seinen Freunden auf dem Dach – als plötzlich die Sterne verschwinden. Am nächsten Morgen geht zwar die Sonne auf, aber ihr Licht erscheint wie durch einen Filter. Satelliten fallen aus, der Mond ist verschwunden. Ein riesiger Energieschirm scheint sich um die Erde gelegt zu haben. Wie ist so etwas möglich? Wer ist dafür verantwortlich? Und was wird damit bezweckt? Während die Erde in Hysterie versinkt, beginnt für Tyler das Abenteuer seines Lebens …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 794
Ähnliche
Das Buch
Eines Nachts im Oktober beobachtet der junge Tyler Dupree gemeinsam mit seinen Freunden, den Zwillingen Jason und Diane, den Abendhimmel – als das Unfassbare geschieht: Die Sterne erlöschen, der Himmel verdunkelt sich. Am nächsten Tag geht zwar die Sonne auf, die Lichteinstrahlung aber ist gefiltert. Die Satellitenverbindungen fallen aus, und der Mond ist verschwunden. Ein gigantischer Energieschirm hat sich um die Erde gelegt – die Menschheit ist abgeschnitten vom Rest des Universums.
Jahre vergehen, doch die Forschung findet keine Erklärung für die unheimliche Membran. Während Jason als ehrgeiziger Wissenschaftler sein Leben der Lösung dieses Rätsels widmet, gerät Diane an eine der zahlreichen Sekten, die infolge der Massenhysterie wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und Tyler, inzwischen als Arzt in die Mission zur Rettung der Erde eingebunden, beginnt zu ahnen, dass eine außerirdische Macht die Erde zu einem bestimmten Zweck manipuliert hat. Doch zu welchem?
Der Autor
Robert Charles Wilson, geboren 1953 in Kalifornien, wuchs in Kanada auf und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Toronto. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren der modernen Science Fiction und wurde mehrfach für seine Romane ausgezeichnet, unter anderem mit dem Philip K. Dick Award und dem John W. Campbell Award. Zuletzt ist bei Heyne der Roman »Die Chronolithen« erschienen.
Mehr zu Autor und Werk unter: www.robertcharleswilson.com
Inhaltsverzeichnis
4 × 109 N. CH.
Wir alle fallen, und ein jeder landet irgendwo.
Diane und ich mieteten uns also ein Zimmer im dritten Stock eines im Kolonialstil gehaltenen Hotels in Padang, wo wir für eine Weile unbemerkt bleiben würden.
Für neunhundert Euro die Nacht kauften wir uns Ungestörtheit und einen Balkonausblick auf den Indischen Ozean. Bei gutem Wetter – und daran hatte in den letzten Tagen kein Mangel geherrscht – konnten wir den nächstgelegenen Teil des Torbogens sehen: eine wolkenfarbene vertikale Linie, die sich aus dem Horizont erhob und, immer weiter aufsteigend, im blauen Dunst verschwand. So eindrucksvoll allein dies schon wirkte, war es doch nur ein Bruchteil des gesamten Bauwerks, den man von der Westküste Sumatras aus sehen konnte. Das entferntere Ende des Torbogens tauchte bis zu den unterseeischen Gipfeln des Carpenter Ridges hinab, überspannte den Mentawai-Graben wie ein in einer flachen Pfütze stecken gebliebener Ehering. Auf dem Land hätte er sich von Bombay an der Ostküste Indiens bis nach Madras im Westen erstreckt. Oder sagen wir, ganz grob geschätzt, von New York bis nach Chicago.
Diane hatte den Nachmittag auf dem Balkon verbracht, schwitzend im Schatten eines Sonnenschirms mit ausgeblichenen Streifen. Die Aussicht faszinierte sie, und ich war froh und erleichtert darüber, dass sie – nach allem, was geschehen war – noch immer Vergnügen an solchen Dingen empfinden konnte.
Bei Sonnenuntergang setzte ich mich zu ihr. Sonnenuntergang war die schönste Zeit. Ein Frachter, der an der Küste entlang zum Hafen von Teluk Bayur schipperte, wurde auf dem dunklen Wasser zu einer sanft dahingleitenden Lichterkette. Das nahe Bogenende schimmerte wie ein roter Nagel, der den Himmel ans Meer befestigte. Wir beobachteten, wie der Schatten der Erde, während die Stadt dunkel wurde, an dem Pfeiler emporkletterte.
Es war eine, nach dem berühmten Zitat von Arthur C. Clarke, »von Magie nicht zu unterscheidende« Technologie. Was sonst, wenn nicht Magie, würde den steten Fluss der Luft und des Meeres vom Golf von Bengalen bis zum Indischen Ozean ermöglichen, gleichzeitig aber Überwasserfahrzeuge in gänzlich unvertraute Häfen transportieren? Und was war das für ein Wunder der Ingenieurskunst, das ein Bauwerk mit einem Radius von eintausend Kilometern sein eigenes Gewicht tragen ließ? Woraus war es gemacht, wie stellte es das alles an?
Jason Lawton wäre vielleicht in der Lage gewesen, diese Fragen zu beantworten. Aber Jason war nicht bei uns.
Diane lümmelte auf einem Liegestuhl, ihr gelbes Sommerkleid und der breite Strohhut wurden in der zunehmenden Dunkelheit zu bloßen Schattenrissen. Ihre Haut war rein, glatt, nussbraun. Es war bezaubernd, wie das letzte Licht in ihren Augen glänzte, doch ihr Blick war immer noch wachsam – daran hatte sich nichts geändert.
Sie sah zu mir hoch. »Du bist schon den ganzen Tag so zapplig.«
»Ich überlege, ob ich etwas schreibe«, erwiderte ich. »Bevor es anfängt. Memoiren sozusagen.«
»Angst davor, dass du alles verlierst? Aber das ist irrational, Tyler. Es ist nicht so, dass deine Erinnerung gelöscht würde.«
Nein, nicht gelöscht, aber möglicherweise eingetrübt, geschwächt, verwischt. Die anderen Nebenwirkungen der Substanz waren vorübergehend und zu ertragen, doch die Möglichkeit eines Gedächtnisverlustes schreckte mich.
»Außerdem«, fuhr sie fort, »spricht alles dafür, dass es gut geht. Das weißt du selbst am besten. Ein Risiko gibt es zwar … aber es ist eben nur ein Risiko, und ein kleines noch dazu.«
Und sofern dieser Fall bei ihr eingetreten war, konnte man eigentlich nur froh darüber sein.
»Trotzdem«, sagte ich. »Mir ist wohler, wenn ich etwas aufschreibe.«
»Also, du musst nicht, wenn du jetzt noch nicht möchtest. Du weißt selber, wann du bereit bist.«
»Nein, ich will es tun.« Jedenfalls redete ich mir das ein.
»Dann muss es heute Abend sein.«
»Ich weiß. Aber in den nächsten Wochen …«
»Wirst du zum Schreiben wahrscheinlich keine Lust haben.«
»Es sei denn, ich kann nicht anders.« Schreibwut gehörte zu den harmloseren der möglichen Nebenwirkungen.
»Mal sehen, was du denkst, wenn die Übelkeit einsetzt.« Sie schenkte mir ein Lächeln. »Vermutlich haben wir alle etwas, das wir nicht loslassen wollen.«
Das war eine beunruhigende Bemerkung, ich mochte gar nicht darüber nachdenken.
»Was soll’s«, sagte ich. »Vielleicht sollten wir einfach anfangen.«
Die Luft roch nach Tropen, vermischt mit dem Chlor aus dem Hotel-Swimmingpool drei Stockwerke unter uns. Padang war ein bedeutender internationaler Hafen, voll mit Ausländern: Indern, Filipinos, Koreanern, sogar versprengten Amerikanern wie Diane und ich; Leuten, die sich keinen Luxustransit leisten konnten und nicht die Voraussetzungen für von der UN anerkannte Umsiedlungsprogramme erfüllten. Es war eine lebendige, aber oft auch gesetzlose Stadt, vor allem seit die New Reformasi in Jakarta an die Macht gekommen waren.
Das Hotel jedoch war sicher, und jetzt waren auch die Sterne in ihrer ganzen verstreuten Pracht aufgezogen. Der Scheitelpunkt des großen Bogens bildete den hellsten Fleck am Himmel, ein fein geformtes silbernes U (wie Unbekannt, Unkenntlich), verkehrt herum aufgemalt von einem legasthenischen Gott. Ich hielt Dianes Hand, während wir zusahen, wie er verblich.
»Woran denkst du?«, fragte sie.
»Daran, wie ich das letzte Mal die alten Sternbilder gesehen habe.« Jungfrau, Löwe, Schütze – das Lexikon des Astrologen, nur noch eine Fußnote in den Geschichtsbüchern.
»Sie hätten von hier aus allerdings anders ausgesehen, oder? Südliche Halbkugel?«
Ja, vermutlich.
Dann, in der vollkommenen Dunkelheit der Nacht, gingen wir zurück ins Zimmer. Ich schaltete das Licht ein, während Diane die Jalousien herunterließ und dann Spritze und Ampullenkasten auspackte, in deren Gebrauch ich sie eingewiesen hatte. Sie füllte die sterile Spritze, runzelte die Stirn, ließ fingertippend eine kleine Blase heraustreten. Es sah alles recht professionell aus, doch ihre Hand zitterte.
Ich zog mein Hemd aus und legte mich aufs Bett.
»Tyler …« Plötzlich war sie diejenige, die Bedenken hatte.
»Keine Diskussionen mehr. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Und wir haben das alles ein Dutzend Mal besprochen.«
Sie nickte, dann rieb sie meine Armbeuge mit Alkohol ein. Sie hielt die Spritze in der rechten Hand, mit der Nadel nach oben. Die Flüssigkeit darin wirkte so unschuldig wie Wasser.
»Das ist so lange her«, sagte sie.
»Was?«
»Dass wir die Sterne beobachtet haben, damals.«
»Es freut mich, dass du es nicht vergessen hast.«
»Natürlich hab ich’s nicht vergessen. So, und jetzt mach eine Faust.«
Der Schmerz war nicht der Rede wert. Jedenfalls am Anfang.
DAS GROSSE HAUS
Ich war zwölf und die Zwillinge waren dreizehn, in jener Nacht, als die Sterne vom Himmel verschwanden.
Es war Oktober, wenige Wochen vor Halloween, und wir drei waren für die Dauer einer »Geselligkeit nur für Erwachsene« in den Keller des Lawtonschen Hauses – wir nannten es das Große Haus – beordert worden.
In den Keller verbannt zu sein, bedeutete jedoch keine Strafe. Nicht für Diane und Jason, die einen großen Teil ihrer Zeit freiwillig dort verbrachten, und schon gar nicht für mich. Zwar hatte ihr Vater eine genau definierte Grenze zwischen der Erwachsenen- und der Kinderzone des Hauses abgesteckt, doch in dem uns zugewiesenen Bereich hatten wir eine brandneue Spielkonsole, DVD’s und sogar einen Billardtisch … und keinerlei Beaufsichtigung außer durch eine der Damen vom Partyservice, eine Mrs. Truall, die jede Stunde einmal nach unten kam, um sich vom Kanapeedienst zu erholen und uns mit neuen Informationen über den Verlauf der Party zu versorgen (ein Mann von Hewlett-Packard hatte sich mit der Frau eines Post-Kolumnisten daneben benommen; ein betrunkener Senator hatte sich in den Hobbyraum verirrt). Alles, was uns fehlte, sagte Jason, war Ruhe – auf der Anlage im Wohnzimmer lief Tanzmusik, die durch die Decke dröhnte wie der Herzschlag eines Monsters – und ein freier Ausblick auf den Himmel.
Ruhe und Ausblick: typisch für Jason, dass er beides wollte.
Diane und Jason waren im Abstand von wenigen Minuten geboren worden, sie waren aber offenkundig keine eineiigen Zwillinge; tatsächlich wurden sie von niemandem außer ihrer Mutter als »die Zwillinge« bezeichnet. Jason pflegte zu sagen, sie seien das Produkt eines »in gegensätzlich disponierte Eizellen eingedrungenen dipolaren Spermiums«. Diane, deren IQ zwar ebenso eindrucksvoll war wie Jasons, die sich aber eines zurückhaltenderen Vokabulars bediente, verglich sich und ihren Bruder mit »zwei Gefangenen, die aus ein und derselben Zelle ausgebrochen sind«.
Ich bewunderte sie beide.
Jason war mit seinen dreizehn Jahren nicht nur beängstigend klug, sondern auch körperlich überaus fit – gar nicht mal sehr muskulös, aber dennoch kräftig und mit einigen Erfolgen in der Leichtathletik. Er war schon damals über eins achtzig groß, eher mager, die harsche Knochigkeit des Gesichts ausbalanciert durch ein etwas schiefes, aber aufrichtiges Lächeln. Seine Haare waren blond und borstig.
Diane war gut zehn Zentimeter kleiner, rundlich allenfalls im Vergleich zu ihrem Bruder, und sie hatte eine dunklere Haut. Ihr Teint war makellos rein, abgesehen von den Sommersprossen rund um die Augen, die sie als »meine Waschbärenmaske« zu bezeichnete. Was mir an Diane am meisten gefiel – und ich hatte ein Alter erreicht, in dem derlei Details eine kaum verstandene, aber unbestreibare Bedeutung annahmen –, das war ihr Lächeln. Sie lächelte selten, aber wenn, dann war es spektakulär. Sie war überzeugt (zu Unrecht), dass ihre Zähne zu weit vorstanden, und hatte sich daher angewöhnt, die Hand vor den Mund zu halten, wenn sie lachte. Ich brachte sie gern zum Lachen, doch es war ihr Lächeln, nach dem ich mich im Geheimen sehnte.
Eine Woche zuvor hatte Jason von seinem Vater ein teures astronomisches Fernglas geschenkt bekommen. Nun spielte er die ganze Zeit damit herum – nahm etwa das gerahmte Reiseplakat über dem Fernseher ins Visier und gab vor, er würde von unserer Washingtoner Vorstadt aus Cancun ausspähen – und schließlich erhob er sich und sagte: »Wir sollten mal einen Blick auf den Himmel werfen.«
»Nein«, erwiderte Diane sofort. »Es ist kalt draußen.«
»Nun ja, die erste klare Nacht in dieser Woche. Außerdem ist es höchstens ein bisschen kühl.«
»Auf dem Rasen war heute Morgen eine Eisschicht.«
»Frost.«
»Es ist schon nach Mitternacht.«
»Aber Freitag, Wochenende.«
»Wir sollen den Keller nicht verlassen.«
»Wir sollen die Party nicht stören. Niemand hat was davon gesagt, dass wir nicht nach draußen dürften. Es wird uns auch niemand sehen – falls du Angst hast, erwischt zu werden.«
»Ich hab keine Angst, erwischt zu werden.«
»Wovor hast du dann Angst?«
»Davor, dass mir die Füße abfrieren, während du mir die Ohren vollplapperst.«
Jason wandte sich mir zu. »Was ist mit dir, Tyler? Willst du dir den Himmel angucken?«
Ich wurde oft aufgefordert, bei den Meinungsverschiedenheiten der Zwillinge den Schiedsrichter zu machen, was mir ziemlich unangenehm war. Für mich gab es in diesen Situationen nichts zu gewinnen. Ergriff ich Jasons Partei, lief ich Gefahr, Diane vor den Kopf zu stoßen; wenn ich aber allzu oft für Diane entschied, würde es – nun ja, ziemlich offensichtlich wirken. Ich sagte: »Ich weiß nicht, Jase, es ist wirklich ziemlich kühl da draußen. Ich …«
Diane erlöste mich aus meiner Verlegenheit. Sie legte mir die Hand auf die Schulter und sagte: »Lass nur. Ein bisschen frische Luft ist wahrscheinlich besser, als wenn er die ganze Zeit rumjammert.«
Also holten wir unsere Jacken aus dem Kellerflur und gingen durch die Hintertür nach draußen.
Das Große Haus war nicht so gewaltig, wie der ihm zugedachte Spitzname es nahe legen mochte, aber doch größer als das Durchschnittsheim in dieser mittel bis gut situierten Wohngegend. Außerdem stand es auf einem ziemlich großen Grundstück. Eine ausgedehnte, sanft ansteigende und überaus gepflegte Rasenfläche ging hinter dem Haus in ein sich selbst überlassenes Fichtenwäldchen über, das an einen leicht verschmutzten Bach grenzte. Zum Sternegucken suchte Jason einen Platz irgendwo auf halbem Weg zwischen dem Haus und den Bäumen aus.
Es war bislang ein schöner Oktober gewesen, erst gestern hatte eine Kaltfront dem Nachsommer den Garaus gemacht. Diane schlug demonstrativ die Arme umeinander und zitterte vor sich hin, doch das tat sie nur, um Jason zu strafen – die Nachtluft war kühl, aber nicht unangenehm. Der Himmel war kristallklar und das Gras einigermaßen trocken, wenn es auch zum Morgen hin wieder Frost geben mochte. Kein Mond und nicht die Spur einer Wolke. Das Große Haus war erleuchtet wie ein Mississippi-Dampfer und warf ein grelles gelbes Licht auf den Rasen, aber wir wussten aus Erfahrung, dass man in einer Nacht wie dieser im Schatten eines Baumes so vollständig verschwand, als wäre man von einem schwarzen Loch verschluckt worden.
Jason lag auf dem Rücken und richtete sein Fernglas auf den Sternenhimmel.
Ich saß im Schneidersitz neben Diane und sah, wie sie eine Zigarette aus ihrer Jackentasche zog, vermutlich von ihrer Mutter geklaut (Carol Lawton, eine Kardiologin und nominelle Ex-Raucherin, hielt Zigarettenpackungen in ihrer Frisierkommode, ihrem Schreibtisch und einer Küchenschublade versteckt – das wusste ich von meiner Mutter). Sie steckte sie sich zwischen die Lippen, zündete sie mit einem durchsichtig roten Feuerzeug an – die Flamme bildete sekundenlang den hellsten Punkt ringsum – und blies eine Rauchwolke in die Luft, die rasch in der Dunkelheit zerstob.
Sie bemerkte, dass ich sie beobachtete. »Möchtest du mal ziehen?«
»Er ist zwölf Jahre alt«, sagte Jason. »Er hat schon genug Probleme. Auf Lungenkrebs kann er da gut verzichten.«
»Klar«, stieß ich hervor. Jetzt war es zu einer Ehrensache geworden.
Amüsiert reichte Diane mir die Zigarette. Ich inhalierte vorsichtig und schaffte es, keinen Hustenanfall zu kriegen.
Sie nahm sie zurück. »Übertreib es nicht.«
»Tyler«, sagte Jason, »weißt du irgendetwas über die Sterne?«
Ich schluckte eine Lunge voll klarer, kalter Luft. »Ja, natürlich.«
»Ich meine nicht das, was du in deinen billigen Taschenbüchern liest. Kannst du mir irgendwelche Sterne nennen?«
Ich wurde rot und hoffte, dass er das im Dunkeln nicht sehen würde. »Arkturus«, flüsterte ich. »Alpha Centauri. Sirius. Der Polarstern …«
»Und welcher davon«, fragte Jason, »ist die Heimat der Klingonen?«
»Sei nicht gemein«, sagte Diane streng.
Die Zwillinge waren beide außerordentlich intelligent für ihr Alter. Ich war auch kein Dummkopf, aber ich konnte mich nicht mit ihnen messen – das war uns allen klar. Sie besuchten eine Schule für Hochbegabte, ich fuhr mit dem Bus zur Staatlichen Schule. Und das war nur einer von diversen unverkennbaren Unterschieden zwischen uns. Sie wohnten in dem Großen Haus, ich wohnte mit meiner Mutter in dem Bungalow am östlichen Rand des Grundstücks. Ihre Eltern hatten beide einen tollen Beruf, meine Mutter machte bei ihnen das Haus sauber … Irgendwie gelang es uns, diese Unterschiede zwar anzuerkennen, aber nicht ständig darauf herumzureiten.
»Okay«, sagte Jason nach einer Weile, »kannst du mir den Polarstern zeigen?«
Der Polarstern, auch Nordstern genannt. Ich hatte über die Sklaverei und den Bürgerkrieg gelesen. Dabei war ich auf ein Lied der flüchtigen Sklaven gestoßen:
Wenn die Sonne wiederkehrt, beim Schrei der erstenWachtel,Folge dem Trinkkürbis.Der alte Mann erwartet dich, er trägt dich in die FreiheitWenn du dem Trinkkürbis folgst.
Wenn die Sonne wiederkehrt – das hieß, nach der Wintersonnenwende. Wachteln überwintern im Süden. Der Kürbis war der Große Wagen, und das breite Ende der Schüssel zeigte zum Polarstern, gerade nach Norden, dort, wo die Freiheit wartete … Ich fand den Großen Wagen und fuchtelte hoffnungsfroh in die entsprechende Richtung.
»Siehste?«, sagte Diane zu Jason, als hätte ich einen strittigen Punkt zwischen ihnen geklärt, von dem ich nichts wusste.
»Nicht schlecht«, konzedierte Jason. »Weißt du, was ein Komet ist?«
»Ja.«
»Willst du mal einen sehen?«
Ich nickte und streckte mich neben ihm aus, immer noch den beißenden Geschmack der Zigarette im Mund, worüber ich mich jetzt doch ärgerte. Jason zeigte mir, wie ich die Ellbogen auf den Boden zu stützen hatte, dann ließ er mich das Fernglas an die Augen führen und die Schärfe einstellen. Aus den Sternen wurden zuerst verschwommene Ovale, dann Stecknadelköpfe, viel zahlreicher, als man mit bloßem Auge sehen konnte. Ich schwenkte das Glas, bis ich den Punkt gefunden hatte – oder gefunden zu haben glaubte –, den Jason mir zeigen wollte: ein winziger phosphoreszierender Knoten vor dem tiefschwarzen Himmel.
»Ein Komet«, sagte Jason.
»Ich weiß. Ein Komet ist eine Art staubiger Schneeball, der auf die Sonne zufällt.«
»So könnte man sagen.« Er klang etwas höhnisch. »Weißt du, wo die Kometen herkommen, Tyler? Sie kommen aus dem äußeren Sonnensystem – aus einer Art eisigem Halo um die Sonne, der von der Umlaufbahn des Pluto bis halb zum nächsten Stern reicht. Wo es kälter ist, als du dir vorstellen kannst.«
Ich nickte – mit etwas Unbehagen. Ich hatte genug Science Fiction gelesen, um mir eine Vorstellung von der schier unfassbaren Weite des Nachthimmels machen zu können. Das war etwas, worüber ich manchmal gerne nachdachte, wenn es auch – etwa nachts, wenn das Haus ganz still war – ein bisschen beängstigend war.
»Diane?«, fragte Jason. »Willst du auch mal gucken?«
»Muss ich?«
»Nein, natürlich musst du nicht. Wenn es dir lieber ist, kannst du da sitzen bleiben, dir die Lunge ausräuchern und dummes Zeug erzählen.«
»Klugscheißer.« Sie drückte die Zigarette ins Gras und streckte die Hand aus. Ich gab ihr das Fernglas.
»Sei bloß vorsichtig damit.« Jason war völlig vernarrt in sein Fernglas. Es roch noch immer nach Zellophan und Styroporverpackung.
Sie stellte die Schärfe ein und blickte nach oben. Eine Zeit lang blieb sie still. Dann sagte sie: »Weißt du, was ich sehe, wenn ich mit so einem Ding die Sterne ansehe?«
»Was denn?«
»Na, die Sterne, weiter nichts.«
»Benutze deine Fantasie.« Jason klang ehrlich verärgert.
»Wenn ich meine Fantasie benutzen kann, wozu brauche ich dann ein Fernglas?«
»Ich meine, denke nach über das, was du siehst.«
»Oh«, erwiderte sie. Dann: »Oh. Oh! Jason, ich sehe …«
»Ja, was?«
»Ich glaube … ja … es ist Gott! Und er hat einen langen weißen Bart. Und er hält ein Schild in der Hand. Und auf dem Schild steht … JASON IST EIN TROTTEL!«
»Sehr witzig. Gib es zurück, wenn du nichts damit anzufangen weißt.«
Er streckte die Hand aus, doch sie ignorierte ihn. Sie saß aufrecht da und richtete das Fernglas auf die Fenster des Großen Hauses.
Die Party war seit dem späten Nachmittag im Gange. Meine Mutter hatte mir erzählt, Feste bei den Lawtons seien »teure Quatschrunden für hohe Tiere«, aber da sie einen feinen Sinn für Übertreibungen besaß, war man gut beraten, alles ein bisschen tiefer zu hängen. Die meisten Gäste, hatte Jason gesagt, waren Leute aus der Raumfahrtindustrie oder der Politik. Nicht die alteingesessene Washingtoner Gesellschaft, sondern gut betuchte Newcomer mit Westküstenwurzeln und Verbindungen zur Waffenindustrie. E. D. Lawton, Jasons und Dianes Vater, richtete derlei Veranstaltungen alle drei bis vier Monate aus.
»Alles wie immer«, sagte Diane hinter dem Doppeloval des Fernglases. »Im Erdgeschoss wird getrunken und getanzt. Mehr getrunken als getanzt zur Zeit. Sieht allerdings so aus, als würde die Küche schließen. Ich glaube, die Cateringleute wollen nach Hause. Im Hobbyraum sind die Vorhänge zugezogen. E. D. ist in der Bibliothek, zusammen mit ein paar Anzugträgern. Igitt! Einer von ihnen raucht Zigarre.«
»Dein Ekel wirkt nicht gerade überzeugend, Miss Marlboro.«
Diane fuhr fort, die Fenster zu katalogisieren, während Jason an meine Seite rutschte. »Da zeigt man ihr das Universum«, flüsterte er, »und sie zieht es vor, eine Dinnerparty auszukundschaften.«
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Wie so vieles von dem, was Jason von sich gab, klang es witzig und klüger als alles, was ich zu sagen hatte.
»Mein Zimmer«, sagte Diane gerade. »Leer, Gott sei Dank. Jasons Zimmer, auch leer, abgesehen von dem Penthouse unter der Matratze.«
»Haha. Das ist ein gutes Fernglas, aber so gut auch wieder nicht.«
»Carols und E. D.s Schlafzimmer, leer. Das Gästezimmer …«
»Na, was?«
Aber Diane erwiderte nichts. Sie saß ganz still, das Fernglas vor den Augen.
»Diane?«, sagte ich.
Sie schwieg weiter. Dann, nach einigen Sekunden, schüttelte sie sich, drehte sich um und warf – schleuderte fast – Jason das Fernglas zu, der sogleich protestierte, offenbar ohne zu begreifen, dass Diane etwas zutiefst Beunruhigendes gesehen hatte. Ich machte schon den Mund auf, um sie zu fragen, ob alles in Ordnung sei …
Da verschwanden die Sterne.
Es war keine große Sache.
Viele sagen das, viele von denen, die es gesehen haben. Es war keine große Sache. Wirklich nicht, und ich spreche hier als Zeuge: Ich hatte, während Diane und Jason sich in den Haaren lagen, den Himmel beobachtet. Da war nichts als ein kurzes seltsames Gleißen, das sich, ein Nachbild der Sterne hinterlassend, grün phosphoreszierend meiner Netzhaut aufprägte. Ich blinzelte. Jason sagte: »Was war das? Ein Blitz?« Und Diane sagte überhaupt nichts.
»Jason«, stieß ich hervor, noch immer blinzelnd.
»Was? Diane, ich schwöre dir, falls du eine von den Linsen kaputt gemacht hast …«
»Halt den Mund«, unterbrach ihn seine Schwester.
Und ich sagte: »Hört auf. Seht doch. Was ist mit den Sternen passiert?«
Beide wandten ihren Kopf zum Himmel.
Von uns dreien war allein Diane bereit zu glauben, dass die Sterne tatsächlich »ausgegangen« seien – ausgelöscht wie Kerzen im Wind. Das sei unmöglich, erklärte Jason entschieden: das Licht dieser Sterne sei, je nach Quelle, fünfzig oder hundert oder hundert Millionen Lichtjahre unterwegs gewesen; garantiert hätten sie nicht allesamt in einer unendlich komplizierten Folge, die darauf angelegt war, den Erdlingen als gleichzeitig zu erscheinen, aufgehört zu leuchten. Außerdem, warf ich ein, war auch die Sonne ein Stern, und die schien ja noch, jedenfalls auf der anderen Seite des Planeten – oder nicht?
Doch, natürlich. Und falls nicht, sagte Jason, wären wir bis zum Morgen alle erfroren.
Also war es logischerweise so, dass die Sterne immer noch schienen, wir sie aber bloß nicht sehen konnten. Sie waren nicht verschwunden, sondern verdunkelt, verdeckt: eine Sternfinsternis. Ja, der Himmel war plötzlich zu einer schwarzen Leere geworden – aber das war nur ein Rätsel, keine Katastrophe.
Ein anderer Aspekt von Jasons Kommentar allerdings hatte sich in meiner Fantasie festgesetzt: wenn nun die Sonne tatsächlich verschwunden war? Ich stellte mir vor, wie Schnee durch ewige Dunkelheit rieselte und wie dann die Luft, die frierende Luft, selbst zu einer Art Schnee würde, bis die ganze menschliche Zivilisation unter dem Zeug, das wir atmen, begraben wäre. Da war es doch besser, entschieden besser, anzunehmen, die Sterne seien »verfinstert« worden. Aber wovon?
»Nun, offensichtlich von etwas Großem. Und Schnellem. Du hast gesehen, wie es passiert ist, Tyler. War es alles gleichzeitig oder hat sich irgendetwas über den Himmel bewegt?«
Ich erwiderte, die Sterne hätten aufgeleuchtet und wären dann ausgegangen, alle gleichzeitig.
»Scheiß auf die blöden Sterne«, sagte Diane. (Ich war schockiert: Diane benutzte solche Ausdrücke normalerweise nicht, während Jase und ich recht locker damit umgingen, seit wir ein zweistelliges Alter erreicht hatten; vieles hatte sich verändert in diesem Sommer.)
Jason hörte die Unruhe in ihrer Stimme. »Ich glaube nicht, dass man sich Sorgen machen muss«, sagte er, obwohl ihm offenkundig selbst nicht ganz wohl war.
Diane machte ein missmutiges Gesicht. »Mir ist kalt«, erklärte sie.
Also beschlossen wir, ins Große Haus zurückzugehen und zu gucken, ob die Nachricht schon bei CNN oder CNBC angekommen war. Während wir über den Rasen liefen, war der Himmel fast unerträglich in seiner vollkommenen Schwärze, gewichtslos, aber trotzdem schwer, und dunkler, als ich je einen Himmel gesehen hatte.
»Wir müssen es E. D. erzählen«, sagte Jason.
»Erzähl du es ihm«, gab Diane zurück.
Jase und Diane nannten ihre Eltern beim Vornamen, weil Carol Lawton den Anspruch hatte, einen progressiven Haushalt zu führen. Die Realität war allerdings ein bisschen komplexer. Carol war nachgiebig, nahm aber nicht viel Anteil am Leben der Zwillinge, während E. D. sich systematisch einen Erben heranzog. Dieser Erbe war Jason, versteht sich. Jason verehrte seinen Vater. Diane hatte Angst vor ihm.
Und ich war nicht so blöd, mein Gesicht in der Erwachsenenzone zu zeigen, schon gar nicht im alkoholisch fortgeschrittenen Stadium einer Party bei den Lawtons; also drückten Diane und ich uns vor der Tür des Zimmers herum, in dem Jason seinen Vater aufgestöbert hatte. Wir konnten keine Einzelheiten ihres Gesprächs aufschnappen, aber der Ton in E. D.s Stimme war schwerlich zu verkennen: leidend, ungeduldig, cholerisch. Jason kam mit rotem Gesicht und nahezu weinend in den Keller zurück, worauf ich mich etwas umständlich verabschiedete und auf die Hintertür zuging.
Diane holte mich im Flur ein. Sie fasste mich am Handgelenk, als wolle sie uns miteinander verketten. »Tyler«, sagte sie. »Sie wird kommen, oder? Die Sonne, meine ich. Am Morgen. Ich weiß, das ist eine bescheuerte Frage. Aber die Sonne wird aufgehen, stimmt’s?«
Sie klang völlig hilflos. Ich wollte irgendetwas Flapsiges sagen – falls nicht, werden wir alle tot sein –, aber ihre Angst weckte auch in mir Zweifel. Was genau hatten wir gesehen und was bedeutete es? Jason war es offensichtlich nicht gelungen, seinen Vater davon zu überzeugen, dass etwas Bedeutsames am Nachthimmel geschehen war, also machten wir uns womöglich völlig unnötig Sorgen. Was aber, wenn die Welt wirklich vor ihrem Ende stand – und nur wir drei wussten davon?
»Wird schon alles gut gehen«, sagte ich.
Sie sah mich durch strähnige Haare hindurch an. »Glaubst du?«
Ich versuchte zu lächeln. »Zu neunzig Prozent.«
»Aber du wirst bis zum Morgen aufbleiben, nicht wahr?«
»Vielleicht. Wahrscheinlich.« Tatsächlich war mir nicht nach Schlafen zumute.
Sie machte die Telefoniergeste mit Daumen und kleinem Finger. »Kann ich dich später anrufen?«
»Klar.«
»Ich werde wahrscheinlich nicht schlafen. Und – ich weiß, das klingt blöd – falls ich doch einschlafe, kannst du mich dann anrufen, sobald die Sonne aufgeht?«
Ich sagte ihr, dass ich das tun würde.
»Versprochen?«
»Versprochen.« Ich freute mich riesig über diese Bitte.
Das Haus, in dem meine Mutter und ich wohnten, war ein hübscher Schindelbungalow auf der Ostseite des Lawtonschen Grundstücks. Ein kleiner, von einem Kiefernholzgeländer umzäunter Rosengarten fasste die Vordertreppe ein – die Rosen selbst hatten bis weit in den Herbst hinein geblüht, waren aber nach dem kürzlichen Kälteeinbruch verwelkt. In dieser mondlosen, wolkenlosen, sternenlosen Nacht leuchtete die Verandalampe wie ein Signalfeuer.
Leise trat ich ein. Meine Mutter lag schon längst im Bett. Das kleine Wohnzimmer war penibel aufgeräumt, abgesehen von einem einzelnen leeren Schnapsglas auf dem Abstelltisch: Sie war eine Fünf-Tage-Abstinenzlerin, gönnte sich am Wochenende jedoch ein bisschen Whisky. Sie sagte oft, dass sie nur zwei Laster habe, und der Whisky am Samstagabend sei eines davon. (Als ich sie einmal fragte, welches denn das andere sei, sah sie mich lange an und sagte dann: »Dein Vater.« Ich fragte nicht weiter.)
Ich legte mich mit einem Buch auf das Sofa und las, bis Diane anrief, etwa eine Stunde später. Das Erste, was sie sagte, war: »Hast du den Fernseher an?«
»Sollte ich?«
»Lass nur. Es läuft nichts.«
»Na ja, es ist zwei Uhr morgens.«
»Nein, ich meine, wirklich absolut nichts. Auf dem lokalen Kabelsender zeigen sie Infomercials, aber sonst nichts. Was bedeutet das, Tyler?«
Es bedeutete, dass sämtliche Satelliten in der Umlaufbahn um die Erde zusammen mit den Sternen verschwunden waren. Telekommunikation, Wetterbeobachtung, Militärsatelliten, das GPS-System: alles war im Handumdrehen abgestellt worden. Aber davon wusste ich nichts, und schon gar nicht hätte ich es Diane erklären können. »Könnte alles Mögliche bedeuten.«
»Es ist ein bisschen unheimlich.«
»Wahrscheinlich nichts, was einem Sorge machen müsste.«
»Hoffentlich nicht. Ich bin froh, dass du noch wach bist.«
Eine Stunde später rief sie noch einmal an, hatte Neues zu berichten. Das Internet hatte ebenfalls den Geist aufgegeben. Und im Lokalfernsehen gab es erste Meldungen über gestrichene Flüge vom Reagan-Airport und den regionalen Flughäfen, verbunden mit der Mahnung an Reisende, sich vorab über ihre Flüge zu erkundigen.
»Aber die ganze Nacht sind Düsenjets geflogen.« Ich hatte ihre Positionslichter vom Schlafzimmerfenster aus gesehen, falsche Sterne in rascher Bewegung. »Militär vermutlich. Es könnte irgendein Terroranschlag sein.«
»Jason hängt in seinem Zimmer am Radio. Holt sich Sender aus Boston und New York rein. Er meint, es würde von militärischen Aktivitäten und Flughafenschließungen gesprochen, aber nicht von Terrorismus – und kein Wort über die Sterne.«
»Irgendjemand muss es aber bemerkt haben.«
»Falls ja, reden sie jedenfalls nicht drüber. Vielleicht haben sie ja Anweisungen, nicht darüber zu reden. Vom Sonnenaufgang ist übrigens auch nicht die Rede.«
»Warum auch? Die Sonne geht in, was, einer Stunde auf? Das heißt, das sie bereits über dem Meer aufsteigt. Vor der Atlantikküste. Schiffe, die dort unterwegs sind, müssen sie gesehen haben. Wir werden sie auch sehen, schon bald.«
»Hoffentlich.« Diane klang ängstlich und verlegen zugleich. »Ich hoffe, du hast Recht.«
»Du wirst sehen.«
»Ich mag deine Stimme, Tyler. Hab ich dir das schon mal gesagt? Du hast so eine beruhigende Stimme.«
Selbst wenn das, was ich sagte, der reinste Schwachsinn war.
Aber das Kompliment berührte mich mehr, als ich sie merken lassen wollte. Ich dachte darüber nach, nachdem sie aufgelegt hatte. Spielte es mir immer wieder in Gedanken vor, wegen des warmen Gefühls, das es in mir auslöste. Und ich fragte mich, was es bedeutete. Diane war ein Jahr älter als ich und dreimal so klug – warum also hatte ich plötzlich das Gefühl, ich müsse sie beschützen, und warum wünschte ich mir, sie wäre bei mir, damit ich ihr Gesicht berühren und ihr versichern könne, es sei alles gut? Ein Rätsel, das fast so beunruhigend und fast so verwirrend war wie das, was mit dem Himmel geschehen war.
Sie rief um zehn vor fünf wieder an, als ich, gegen meine Absicht und noch vollständig angezogen, gerade dabei war einzuschlafen. Ich fummelte das Telefon aus meiner Hemdtasche. »Hallo?«
»Ich bin’s nur. Es ist immer noch dunkel, Tyler.«
Ich blickte zum Fenster, ja, dunkel. Dann zum Wecker. »Noch nicht ganz Sonnenaufgangszeit, Diane.«
»Hast du geschlafen?«
»Nein.«
»Ja, hast du. Du Glücklicher. Es ist immer noch dunkel. Und kalt. Ich hab aufs Thermometer vor dem Küchenfenster geguckt. Knapp über null. Ist das normal, dass es so kalt ist?«
»Gestern Morgen war es genauso kalt. Ist sonst noch jemand wach bei euch?«
»Jason hat sich mit dem Radio in seinem Zimmer eingeschlossen. Meine Eltern schlafen wohl und, äh, erholen sich von der Party. Ist deine Mutter wach?«
»Nicht um diese Zeit. Nicht am Wochenende.« Ich warf einen nervösen Blick zum Fenster. Inzwischen musste doch irgendein Stück Helligkeit am Himmel zu sehen sein. Selbst eine bloße Andeutung von Tageslicht hätte erheblich zur Beruhigung beigetragen.
»Du hast sie nicht geweckt?«
»Was soll sie denn tun, Diane? Machen, dass die Sterne zurückkehren?«
»Wohl nicht.« Sie machte eine Pause. »Tyler«, sagte sie dann.
»Ich bin noch da.«
»Was ist deine erste Erinnerung?«
»Wie meinst du – heute?«
»Nein. Das Erste, woran du dich in deinem Leben erinnerst. Ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber ich glaube, mir würde es besser gehen, wenn wir einfach fünf oder zehn Minuten über was anderes reden könnten als über den Himmel.«
»Meine erste Erinnerung?« Ich dachte nach. »Das müsste in L.A. gewesen sein, bevor wir nach Osten gezogen sind.« Als mein Vater noch lebte und für E. D. Lawton in ihrer gemeinsamen Startup-Firma in Sacramento arbeitete. »Wir hatten so eine Wohnung mit langen weißen Vorhängen im Schlafzimmer. Das Erste, woran ich mich richtig erinnern kann, ist, wie sich diese Vorhänge im Wind bauschten. Es war ein sonniger Tag, das Fenster war offen, und es war ein bisschen windig.« Die Erinnerung wurde von einem unerwartet wehmütigen Gefühl begleitet, wie ein letzter Blick auf eine entschwindende Küste. »Wie sieht’s bei dir aus?«
Dianes erste Erinnerung spielte ebenfalls in Sacramento, allerdings auf vollkommen andere Weise. E. D. hatte seine beiden Kinder mit in die Fabrik genommen und gab ihnen eine Führung, wollte offenbar schon damals Jason auf seine Rolle als Erbe vorbereiten. Diane war fasziniert von den riesigen perforierten Sparren, den Spulen mit mikrodünnen Aluminiumfasern, dem unablässigen Lärm. Alles war so groß, dass sie fest glaubte, irgendwo einen Märchenriesen zu finden, an die Wand gekettet, ein Gefangener ihres Vaters.
Es war keine schöne Erinnerung. Sie sagte, sie habe sich als fünftes Rad am Wagen gefühlt, verlassen, ausgesetzt inmitten einer riesigen, furchterregenden Maschinerie.
Wir sprachen noch eine Weile darüber. Dann sagte Diane: »Sieh dir den Himmel an.«
Ich blickte zum Fenster. Über den westlichen Horizont tropfte gerade genug Licht, um die Schwärze in ein tintenfarbenes Blau zu verwandeln.
Ich verbarg meine Erleichterung.
»Na, da hast du wohl Recht gehabt«, sagte sie, plötzlich ganz vergnügt. »Die Sonne geht doch noch auf.«
Natürlich war es gar nicht die Sonne. Es war eine Hochstaplersonne, eine clevere Fälschung. Aber das wussten wir damals noch nicht.
IN KOCHENDEM WASSER ERWACHSEN WERDEN
Von jüngeren Leuten werde ich oft gefragt: Warum seid ihr nicht in Panik verfallen? Warum ist niemand in Panik verfallen? Warum gab es keine Plünderungen, keine Aufstände? Warum hat eure Generation klein beigegeben, warum seid ihr in den Spin hineingeglitten, ohne auch nur den leistesten Protest zu erheben?
Manchmal sage ich: Aber es sind doch schreckliche Dinge passiert.
Manchmal sage ich: Wir haben ja nicht begriffen, was los war. Und was hätten wir daran auch ändern können?
Und manchmal gebe ich das Gleichnis vom Frosch zum Besten. Wenn du einen Frosch in kochendes Wasser wirfst, hüpft er wieder heraus. Wirfst du den Frosch aber in einen Topf mit angenehm warmem Wasser, das du langsam immer weiter erhitzt, dann ist der Frosch tot, bevor er begriffen hat, dass man ihm an den Kragen will.
Die Auslöschung der Sterne geschah zwar nicht allmählich und unauffällig, doch für die meisten von uns hatte sie zunächst keine katastrophalen Auswirkungen. Als Astronom oder Verteidigungspolitiker, oder als Beschäftigter in der Telekommunikations- beziehungsweise Raumfahrtbranche hat man die ersten Tage des Spins vermutlich in einem Zustand äußerster Erregung verbracht – für den Busfahrer oder den Angestellten in einem Burger-Restaurant aber war das alles mehr oder weniger warmes Wasser.
Die englischsprachigen Medien bezeichneten es als den »October Event« – das »Oktober-Ereignis« (»Spin« hieß es erst ein paar Jahre später), und seine erste und offensichtliche Wirkung war die vollständige Vernichtung der Milliarden Dollar schweren Weltraumsatelliten-Industrie. Der Verlust der Satelliten bedeutete das Ende des Satellitenfernsehens, das Ende der Direktübertragungen per Satellit; er machte das gesamte Fernsprechsystem unberechen- und GPS-Lokalisierer unbrauchbar; er kappte das World Wide Net, ließ den Großteil der avanciertesten Rüstungstechnologie auf einen Schlag veralten, beschnitt die Möglichkeiten globaler Überwachung und Aufklärung und zwang die Wetteransager, Isobare auf Landkarten zu zeichnen, anstatt geschmeidig durch die von Wettersatelliten gelieferten CGI-Bilder zu gleiten. Wiederholte Versuche, Kontakt mit der Internationalen Raumstation aufzunehmen, waren erfolglos. In Canaveral (wie in Baikonur und Kourou) angesetzte kommerzielle Raketenstarts wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.
Es bedeutete, auf lange Sicht, eine ungute Entwicklung für GE Americom, AT&T, COMSAT und Hughes Communications, um nur einige zu nennen.
Und tatsächlich ereignete sich viel Schreckliches in der Folge jener Nacht, wenn auch das meiste im Blackout der Medien unterging. Nachrichten verbreiteten sich wie Geflüster, zwängten sich durch transatlantische Fiberoptikkabel, anstatt durch den Weltraum zu hüpfen: es dauerte fast eine Woche, bis wir erfuhren, dass ein pakistanischer Hatf-V-Flugkörper mit nuklearem Sprengkopf, versehentlich oder auf Grund von Fehlberechnungen abgeschossen in den verwirrenden ersten Augenblicken des Ereignisses, vom Kurs abgekommen war und ein landwirtschaftlich genutztes Tal im Hindukusch ausgelöscht hatte. Es war der erste in einem Krieg gezündete atomare Sprengkörper seit 1945, und so tragisch dieser Vorfall war, konnten wir angesichts der vom Verlust der Telekommunikation verursachten globalen Paranoia froh sein, dass so etwas nur einmal passierte. Einigen Berichten zufolge standen wir damals kurz davor, Teheran, Tel Aviv und Pjöngjang zu verlieren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!