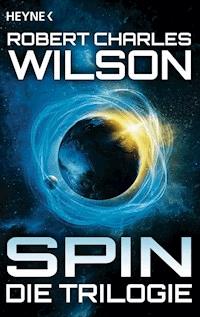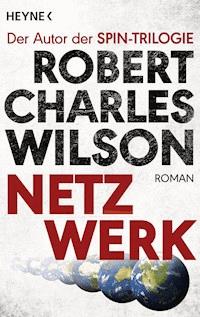7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Botschaften aus der Zukunft
Rätselhafte Artefakte erscheinen eines Tages auf der Erde – doch sie stammen nicht von Außerirdischen, sondern von uns selbst, von einer zukünftigen Menschheit, die Botschaften in
die Vergangenheit schickt. Doch was haben diese Botschaften zu bedeuten? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Ähnliche
Das Buch
Aus dem Nichts taucht in Thailand plötzlich ein siebzig Meter hoher Obelisk auf und richtet in weitem Umkreis durch eine Druckwelle und einen extremen Temperatursturz große Verwüstungen an. Doch nicht Außerirdische haben das Artefakt geschickt, sondern es kommt aus der Zukunft. Es besteht aus einem fremdartigen, unzerstörbaren Stoff und trägt eine Inschrift, die den Sieg eines gewissen Kuin verkündet, der sich das Land unterworfen habe … Scott Warden, der als Aussteiger mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter ein sorgloses Leben am Strand führt, wird durch das Ereignis aus der Bahn geworfen: Als er heimlich das abgesperrte Gelände betritt, um den Obelisken zu untersuchen, wird er verhaftet und vom Geheimdienst verschleppt. Und als er dann später wieder freikommt, ist seine Familie außer Landes geflohen und in die USA zurückgekehrt. Denn inzwischen ist ein weiteres Kuin-Monument mitten in Bangkok aufgetaucht, mit verheerenden Folgen. Und noch mehr dieser Obelisken erscheinen, zerstören Istanbul und Jerusalem … Wer aber ist dieser Kuin? Ist er ein kommender Welteroberer? Oder ein Messias, der seine Schatten voraus wirft in die Vergangenheit? Doch wie sollte das möglich sein? Und warum ist Scott immer in der Nähe, wenn ein weiterer Chronolith emporsteigt?
Der Autor
Robert Charles Wilson, geboren 1953 in Kalifornien, lebt mit seiner Familie in der Nähe von Toronto. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren der modernen Science Fiction und wurde mehrfach für seine Romane ausgezeichnet, unter anderem mit dem Philip K. Dick Award und dem John W. Campbell Award.
Mehr zu Autor und Werk unter: www.robertcharleswilson.com
Inhaltsverzeichnis
TEIL EINS
DIE CHRONOLITHEN TAUCHEN AUF
1
EINS
Hitch Paley schob sein ramponiertes Daimler-Motorrad über den festgetretenen Sandstrand hinter dem Haat-Thai-Tanzzelt;1 er hatte mich eingeladen, mich vom Ende einer Epoche zu überzeugen. Nicht nur der meinen. Doch ich mache Hitch keinen Vorwurf.
Es gibt keinen Zufall. Jetzt weiß ich das.
Er kam näher und grinste, was bei Hitch gewöhnlich nichts Gutes verhieß. Er trug, was man als Amerikaner in Thailand in diesem letzten intakten Sommer zu tragen pflegte: Militärshorts und Jesussandalen, ein schlottergroßes Khaki-T-Shirt und ein geblümtes Spandex-Stirnband. Er war ein Mordskerl, ein Ex-Marinesoldat, der sich der hiesigen Lebensweise angepasst hatte, bärtig und mit Bauchansatz. Eine furchteinflößende, fast schon bedrohliche Erscheinung.
Ich wusste genau, dass Hitch die Nacht im Partyzelt verbracht und mit Hasch verschnittene Gewürzplätzchen gefuttert hatte; eine Beamtin des deutschen diplomatischen Korps hatte sie ihm geschenkt und ließ sich damit füttern, bis sie bei Flut mit ihm nach draußen ging, um den Mondschein auf dem Wasser zu bewundern. Hitch wäre besser nicht wach gewesen um diese Stunde, geschweige denn vergnügt.
Auch ich wäre besser nicht wach gewesen.
Nach ein paar Stunden am Lagerfeuer war ich heimgegangen zu Janice, doch geschlafen haben wir nicht. Kaitlin war stark erkältet und Janice hatte den ganzen Abend abwechselnd unsere Tochter beruhigt und es mit lauter daumengroßen Küchenschaben aufgenommen, die in den warmen und fettigen Hohlräumen des Gasherds siedelten. Das und die Hitze der Nacht und die Spannung, die bereits zwischen uns herrschte, machten es wohl unausweichlich, dass wir fast bis Tagesanbruch stritten.
Folglich waren Hitch und ich ganz und gar nicht ausgeschlafen, vielleicht nicht einmal eines klaren Gedankens fähig, obwohl mich die Morgensonne munter stimmte und mich darin bestärkte, eine so strahlend helle Welt müsse auch verlässlich und von Dauer sein. Die Sonne legte Glanz auf das bleierne Wasser der Bucht, ließ die Fischerboote wie Punkte auf dem Radarschirm erscheinen und verhieß einen weiteren wolkenlosen Nachmittag. Der Strand war so breit und flach wie ein Highway, der zu einem namenlosen und vollkommenen Ziel führte.
»Also das Geräusch diese Nacht«, nahm Hitch das Gespräch auf, wie meistens ohne jede Einleitung, als wären wir nur kurz getrennt gewesen, »wie von einem Navy-Jet, hast du das gehört?«
Hatte ich. Ich hatte es gegen vier Uhr früh gehört, kurz nachdem Janice wütend zu Bett gegangen war. Kaitlin war endlich eingeschlafen und ich saß allein am vernarbten Linoleumküchentisch vor meinem bitteren Kaffee. Das Radio plauderte leise, ein US-Jazzsender.
Für etwa dreißig Sekunden wurde die Übertragung spröde und sonderbar. Es tat einen Donnerschlag gefolgt von rollenden Echos (Hitchs »Navy-Jet«) und knapp darauf ließ eine merkwürdige kalte Brise die eingetopften Bougainvilleas von Janice ans Fenster klopfen. Die Lamellen der Rouleaus hoben sich und fielen in einem leisen Salut; die Türe zu Kaitlins Schlafzimmer trat aus dem Schloss und Kaitlin drehte sich in ihrem netzverhangenen Bettchen und gab einen leisen, traurigen Laut von sich, wachte aber nicht auf.
Es war mehr ein Sommergewitter als ein Navy-Jet, ein aufkeimender oder sterbender Sturm, der vor sich hin murmelte draußen über dem Golf von Bengalen. Nichts Ungewöhnliches zu dieser Jahreszeit.
»Am Duc hat heute früh ein Trupp von Caterfirmen Halt gemacht und das ganze Eis aufgekauft«, sagte Hitch. »Waren unterwegs zur Datscha eines Reichen. Soll richtig was los sein draußen an der Straße in die Berge, wie Feuerwerk oder Artillerie. Ein paar Bäume wurden umgeknickt. Kommst du mit, Scotty?«
»Ist doch egal«, sagte ich.
»Was?«
»Ja, ich komme mit.«
Diese Entscheidung sollte mein Leben unwiderruflich verändern, dabei traf ich sie aus einer Laune heraus. Schuld ist Frank Edwards.
Frank Edwards war ein Rundfunksprecher des vorigen Jahrhunderts, der angeblich wahre Wundergeschichten zu einem Buch zusammentrug (»Stranger than Science«, 1959), darunter solche Dauerbrenner wie das Rätsel um Kaspar Hauser und das »Raumschiff«, das 1910 über der Tunguska in Sibirien explodierte. Dieses Buch und eine Hand voll Fortsetzungen waren ein wichtiger Bestandteil unseres Haushalts, damals, als ich noch so naiv war, solche Geschichten für bare Münze zu nehmen.
Mein Vater hatte mir eine ausrangierte (weil ziemlich lädierte) Bibliotheksausgabe von »Stranger than Science« geschenkt und ich hatte sie – mit zehn – in drei Nächten ausgelesen. Wahrscheinlich hielt mein Vater diese Lektüre für geeignet, die Phantasie eines Jungen anzuregen. Wenn ja, so hatte er Recht. Tunguska war eine Welt weit weg von dem umzäunten Gehege in Baltimore, wo Charles Carter Warden sein geplagtes Weib und sein einziges Kind gepflanzt hatte.
Ich überwand die Gewohnheit, solcherart Dinge zu glauben, doch das Wort »strange« war mir zum Talisman geworden. »Merkwürdig« war mein Lebenslauf. »Merkwürdig« war der Entschluss, nach Auslaufen der Verträge in Thailand zu bleiben. »Merkwürdig« diese langen Tage und zugedröhnten Nächte an den Stränden von Chumphon, Ko Samui und Phuket; so merkwürdig wie die schlingenförmige Geometrie der uralten Wats.2
Vielleicht hatte Hitch Recht. Vielleicht war irgendein dunkles Geheimnis in der Provinz gelandet. Wahrscheinlicher war aber ein Waldbrand oder eine Schießerei zwischen narkotisierten Junkies, doch Hitch bestand darauf, die Caterleute hätten ihm erklärt, es handle sich um etwas »aus dem Weltraum« – und wer war ich, um daran zu zweifeln? Ich war nervös und sah einem weiteren Tag fruchtloser Wortgefechte mit Janice entgegen. Was mir überhaupt nicht schmeckte. Also schwang ich mich auf den Sozius von Hitchs Daimler – scheiß auf die Konsequenzen! –, und wir fuhren in einer blauen Wolke aus Auspuffgasen landeinwärts. Ich machte nicht Halt, um Janice von meiner Spritztour in Kenntnis zu setzen. Vermutlich wär es ihr egal gewesen; wie auch immer, bei Einbruch der Dunkelheit wollte ich wieder daheim sein.
In Chumphon und Satun verschwanden damals viele Amerikaner: gekidnappt, um Lösegeld zu erpressen, oder wegen Kleingeld ermordet oder als Heroinschmuggler rekrutiert. Ich war zu jung, um mich um so etwas zu sorgen.
Wir kamen am Phat Duc vorbei, dem Schuppen, wo Hitch angeblich Angelzeug verkaufte, in Wahrheit aber einheimisches Marihuana an die vielen Party-Touris vertickte, und bogen auf die neue Küstenstraße ab. Der Verkehr war mäßig, lediglich ein paar schwere Sattelzüge aus den C-Pro-Fischfarmen, kleine Linienbusse und Songthaews, kleine Touristenbusse geschmückt wie Karnevalswagen.3 Hitch fuhr so rasant und unbekümmert wie ein Einheimischer, was die Fahrt zu einer Feuerprobe im Wasserhalten machte. Doch der Ansturm feuchter Luft brachte Kühlung, besonders als wir auf die Zubringerstraße Richtung Landesinnere abbogen, und der Tag war jung und ging schwanger mit wundersamen Dingen.
Abseits der Küste ist Chumphon gebirgig. Landeinwärts hatten wir die Straße nahezu für uns allein, bis eine Phalanx Grenzpolizei in einem Hagel aus Kies an uns vorbeibrauste. Also war tatsächlich etwas zugange. Wir hielten an einer Tankstelle namens Hawng Nam, damit Hitch sich erleichtern konnte, derweil ich mein Taschenradio auf den englischsprachigen Sender in Bangkok einstellte. Eine Menge US- und UK-Top-Forty-Hits, kein Wort über Marsmenschen. Doch gerade als Hitch von der Pissrinne zurückkam, brauste eine Brigade königlicher Thaisoldaten an uns vorbei, drei Truppentransporter und eine Hand voll greiser Hummerjeeps, der örtlichen Polizei hinterher. Hitch sah mich an, ich sah ihn an. »Nimm die Kamera aus der Satteltasche«, sagte er, diesmal ohne zu lächeln. Er wischte sich die Hände an den Shorts ab.
Weit voraus über den zusammengewürfelten Hügeln stach eine strahlend helle Säule aus Nebel oder Rauch in den Himmel.
Was ich nicht wusste, war, dass meine Tochter Kaitlin, fünf Jahre alt, mit hohem Fieber aus dem Morgenschlaf erwacht war, und dass Janice gut zwanzig Minuten vergeudet hatte, mich ausfindig zu machen, ehe sie aufgab und Kait in die Charité brachte.
Der Arzt war ein Kanadier, der schon seit 2002 in Chumphon war und mit Spendenmitteln aus irgendeinem Fond der Weltgesundheitsorganisation einen ziemlich modernen OP eingerichtet hatte. Das Strandvolk nannte ihn Doktor Dexter. Der richtige Mann bei Syphilis oder Darmparasiten. Als er Kaitlin untersuchte, hatte sie über 40° Fieber und kam nur zeitweise zu sich.
Janice war natürlich außer sich. Sie musste das Schlimmste befürchtet haben: die Japanische Enzephalitis, über die man in diesem Jahr in den Zeitungen las, oder das Denguefieber, das so viele Menschen in Myanmar getötet hatte. Doktor Dexter diagnostizierte eine gewöhnliche Grippe (wie sie seit März unter den Menschenmassen von Phuket und Ko Samui kursierte) und pumpte sie voll mit Antiviralen.
Janice saß im Warteraum und versuchte wiederholt mich zu erreichen. Doch ich hatte mein Handy in der gemieteten Hütte gelassen, im Rucksack auf dem Regal. Womöglich hätte sie versucht, Hitch zu erreichen, aber Hitch hielt nichts von unverschlüsselter Kommunikation; er hatte ein GPS und einen Kompass bei sich, seiner Meinung nach mehr als genug für einen richtigen Freibeuter.
Als ich durch den porösen Vorhang des Waldes zum ersten Mal einen Blick auf die Säule erhaschte, hielt ich sie für den Chedi eines entfernten Wat, eines buddhistischen Tempels, wie sie über ganz Südostasien verstreut sind. In jeder Enzyklopädie findet man beispielsweise ein Foto von Angkor Wat. Wer sie einmal gesehen hat, würde sie wiedererkennen: turmhohe steinerne Reliquienschreine, die seltsam organisch anmuten, als seien hier im Dschungel die Gebeine eines gigantischen Trolls versteinert.
Aber dieser Chedi – und ich habe mehrere gesehen, während wir dem Auf und Ab der langen Kammstraße gefolgt sind – hatte nicht die richtige Form, nicht die richtige Farbe.4
Wir erklommen den Kamm und stießen auf eine Straßensperre der königlichen Thaipolizei, Grenzstreifen und allerlei Bewaffneten in korrodierten Geländewagen. Jedweder Verkehr wurde abgewiesen. Vier Soldaten hatten ihre Waffen auf einen uralten Hyundai-Songthaew gerichtet, der mit zeternden Hühnern beladen war.
Die Grenzpolizisten sahen blutjung und ziemlich feindselig aus, sie trugen Khakiuniform und Pilotenbrille und hielten die Gewehre in nervöser Bereitschaft. Ich ließ Hitch wissen, dass ich sie auf keinen Fall zu provozieren gedachte.
Ich weiß nicht, ob er es gehört hatte. Seine Aufmerksamkeit galt dem entfernten Monument – wie ich es diesmal nennen will.
Wir konnten es jetzt deutlicher sehen. Es stand auf einer höheren Bergterrasse, teilweise hinter einem Dunstring verborgen. Die Größe war ohne sichtbare Relation schwer abzuschätzen, doch ich ging davon aus, dass es mindestens hundert Meter hoch war.
Bei unserem derzeitigen Wissensstand hätten wir es gut und gerne für ein Raumschiff oder eine Waffe halten können, doch die Wahrheit ist, dass ich es, sowie ich klare, unverstellte Sicht hatte, für eine Art Denkmal hielt. Man stelle sich ein abgestumpftes Washington Monument aus himmelblauem Glas und mit allseits abgerundeten Ecken und Kanten vor. Ich hatte keinen Schimmer, wer es fabriziert hatte oder wie es dorthin gekommen war – offenbar in einer einzigen Nacht –, doch bei all seiner Fremdheit sah es eindeutig nach Menschenwerk aus, und Menschen fabrizieren solche Objekte nur zu einem Zweck: um sich kundzutun, um ihre Präsenz und ihre Macht zu demonstrieren. Dass es überhaupt hier war, war schier unglaublich, doch es gab keinen Zweifel – es war massiv, wuchtig, imposant und passte hierher wie die Faust aufs Auge.
Dann stieg der Dunst und trübte die Sicht.
Zwei Uniformierte kamen forsch und sichtlich missgelaunt auf uns zu. »Wie es aussieht«, sagte Hitch – die gedämpfte, gedehnte Aussprache des Südwestlers klang in dieser Situation ein bisschen zu gedehnt –, »wimmelt es hier bald von US- und UN-Ärschen und noch mehr von diesen Scheißbullen.« Über dem Kamm kreiste bereits ein neutraler, aber unverkennbar militärischer Hubschrauber, der Abwind wühlte den Bodennebel auf.
»Dann lass uns umkehren«, sagte ich.
Er knipste ein einziges Mal, dann steckte er die Kamera weg. »Nicht unbedingt. Es gibt einen Schmugglerpfad, der sich da raufschraubt. Er zweigt eine halbe Meile hinter uns von der Straße ab. Den kennen nur wenige.« Er grinste.
Vermutlich habe ich zurückgelächelt. Dann kamen mir Bedenken, knüppeldick, doch ich kannte Hitch und wusste, er würde sich das nicht ausreden lassen. Hinzu kam, dass ich hier nicht ohne fahrbaren Untersatz zurückbleiben wollte. Er machte mit seinem Motorrad kehrt und die Thai-Cops starrten wütend unserem Auspuff hinterher.
Das war wohl gegen zwei oder drei Uhr nachmittags, um die Zeit also, da aus Kaitlins linkem Ohr blutiger Eiter zu sickern begann.
Wir fuhren den Schmugglerpfad hinauf, solange er befahrbar war, dann versteckten wir die Daimler in einem Dickicht und gingen noch eine Viertelmeile zu Fuß.
Der Pfad war beschwerlich, ausgesucht wegen der Deckung, die er bot, nicht wegen seiner Bequemlichkeit. Steile Immobilie, nannte Hitch ihn. Hitch hatte sich aus der Satteltasche der Daimler bedient und trug Wanderstiefel, ich aber musste sehen, wie ich mit meinen hohen Turnschuhen zurechtkam.
Hätten wir dem Pfad weit genug folgen können, wir wären ohne Zweifel zu irgendeinem Drogenversteck gelangt oder einer Drogendestille, vielleicht sogar zur burmesischen Grenze, doch bereits zwanzig Minuten brachten uns nahe genug an das Monument heran – näher wäre gar nicht möglich gewesen.
Wir waren keine tausend Meter mehr entfernt.
Wir waren nicht die Ersten, die es aus dieser Nähe zu sehen bekamen. Es blockierte schließlich eine Straße und das schon seit mindestens elf Stunden, vorausgesetzt das Geräusch des »Navy-Jet« letzte Nacht markierte tatsächlich die Ankunft des Artefakts.
Aber wir gehörten zu den Ersten.
Hitch machte bei den gestürzten Bäumen Halt. Der hiesige Wald – hauptsächlich Kiefern und ein bisschen wilder Bambus – war in einem radialen Muster rings um die Basis des Monuments kollabiert und die Trümmer begruben den Pfad unter sich. Die Kiefern waren offensichtlich von einer Druckwelle umgelegt worden, Feuer hatte jedenfalls keine Rolle gespielt. Im Gegenteil. Die Blätter des entwurzelten Bambus waren immer noch grün und begannen in der Nachmittagshitze erst vereinzelt zu welken. Alles hier – die Bäume, der Pfad, der Boden an sich – war auffällig kühl. Kalt eigentlich, wenn man die Hand in den Windbruch steckte. Hitch machte mich darauf aufmerksam. Ich tat mich schwer, den Blick von dem Monument zu lösen.
Hätte ich geahnt, was noch bevorstand, meine Ehrfurcht wäre nicht ganz so groß gewesen. Das hier war – im Lichte dessen, was noch kommen sollte – ein relativ kleines Wunder. Doch ich wusste lediglich, dass ich in ein Ereignis gestolpert war, das unsäglich seltsamer war als alles, was Frank Edwards in den zurückliegenden Ausgaben der Pittsburgh Press aufgedeckt hatte, und ich empfand zweierlei: Angst und eine schwindelnde Hochstimmung.
Das Monument. Es war erst einmal keine Statue; das heißt, es wies keine menschliche oder tierische Gestalt auf. Es war eine vierkantige Säule, die in einer konischen Spitze gipfelte, alles daran war glatt und abgerundet. Das Material sah wie Glas aus, aber Glas in dieser Größenordnung erschien albern und undenkbar. Es war blau: das tiefe, unergründliche Blau eines Bergsees, irgendwie friedlich und unheilvoll zugleich. Es war nicht durchsichtig, vermittelte aber den Eindruck von Lichtdurchlässigkeit. Von dieser Seite – der nördlichen – trug es weiße, schorfige Flecken: Eis, wie ich erstaunt zur Kenntnis nahm, welches sich an der feuchten Tagesluft bildete. Über dem zerstörten Wald lag feuchter Bodennebel, und der Fuß des Monuments verschwand unter schmelzenden Schneehügeln.
Das Eis und die unnatürliche Kälte, die vom zerstörten Wald herüberwehte, machten die Szenerie besonders unheimlich. Ich stellte mir vor, der Obelisk wachse wie ein gigantischer Turmalin aus irgendeinem unterirdischen Gletscher … aber so etwas gibt es nur im Traum. Ich sagte das zu Hitch.
»Dann sind wir eben im Land der Träume, Scotty. Vielleicht in Oz.«
Noch ein Hubschrauber kam um den Gipfel herum, gottlob zu niedrig. Wir knieten uns zwischen die gestürzten Kiefern, die der kühlen Luft eine erdige Note verliehen. Als der Hubschrauber über dem Gipfel verschwand, tippte Hitch mir auf die Schulter. »Genug gesehen?«
Ich nickte. Es war natürlich nicht ratsam, länger zu bleiben, auch wenn ein sturer Teil von mir lieber verweilt hätte, bis das Monument einen Sinn ergab oder bis seine eisblauen Tiefen wenigstens eine Spur Normalität preisgaben.
»Hitch«, sagte ich.
»Was?«
»Da ganz unten … sieht das nicht wie eine Inschrift aus?«
Er kniff die Augen zusammen und widmete dem Obelisken einen letzten angestrengten Blick. Machte ein letztes Foto. »Buchstaben, vielleicht. Kein Englisch. Zu weit weg und näher gehen wir nicht ran.«
Wir hatten schon zu lange gewartet.
Was ich später – viel später – von Janice erfuhr, war Folgendes:
Gegen drei Uhr nachmittags hatten Bangkoks Medien von einem amerikanischen Touristen Videoaufnahmen des Monuments bekommen. Bis vier war das halbe Strandvolk der Provinz Chumphon unterwegs, sich dieses Wunder mit eigenen Augen anzusehen und wurde en masse an den Straßensperren abgewiesen. Botschaften wurden unterrichtet; die internationale Presse begann aufzuhorchen.
Janice blieb bei Kaitlin in der Klinik. Um diese Zeit schrie Kaitlin vor Schmerz, trotz der Schmerzmittel und Antivirale, die ihr Doktor Dexter gegeben hatte. Er untersuchte sie noch einmal und erklärte Janice, unsere Tochter habe sich eine rasch nekrotisierende bakterielle Ohrinfektion zugezogen, möglicherweise beim Schwimmen am Strand. Er melde seit fast einem Monat verstärktes Auftreten von E. Coli und einem Dutzend anderer Mikroben, aber die Gesundheitsbehörden würden nicht reagieren, vielleicht weil die C-Pro-Fischfarmen ihre Muskeln spielen ließen.
Er verabreichte Kaitlin eine massive Dosis Fluorchinolone und rief die Botschaft in Bangkok an. Die Botschaft schickte einen Ambulanz-Hubschrauber und kümmerte sich um einen Platz im amerikanischen Krankenhaus.
Janice wollte ohne mich nicht fort. Sie rief wiederholt in der Hütte an und hinterließ, als das nichts half, ihre Nummer bei unserem Vermieter und ein paar Freunden, die ihr Mitgefühl bekundeten, mich aber seit Stunden nicht gesehen hatten.
Doktor Dexter sedierte Kaitlin, derweil Janice zur Hütte eilte, um ein paar Sachen zu packen. Als sie zur Klinik zurückkam, wartete der Hubschrauber bereits.
Sie erklärte Doktor Dexter, ich sei bestimmt nach Einbruch der Dunkelheit erreichbar, wahrscheinlich im Partyzelt. Wenn ich mich meldete, sollte er mir die Nummer des Krankenhauses geben; ich könnte dann Vorkehrungen treffen, um nachzukommen.
Dann hob der Hubschrauber ab. Janice nahm selbst ein Beruhigungsmittel, während ein Trio von Sanitätern noch mehr Breitband-Antibiotika in Kaitlins Kreislauf pumpte.
Sie müssen schon ziemlich hoch über der Bucht gewesen sein, als Janice aus der Vogelperspektive die Ursache für all das sah – die Kristallsäule, die wie eine unbeantwortbare Frage über dem üppig grünen Vorgebirge hing.
Der Schmugglerpfad entließ uns mitten in ein Nest thailändischer Militärpolizei.
Hitch machte den tapferen Versuch, mit eingeschlagenem Lenker zurückzusetzen und so den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, doch es gab nur einen Ausweg und der lief sich tot, wie wir wussten. Als eine Kugel die Erde neben dem Vorderrad aufwirbelte, bremste Hitch und stellte den Motor ab.
Wir mussten uns hinknien, die Hände in den Nacken legen. Ein Soldat kam herüber und setzte erst Hitch, dann mir die Pistole an die Schläfe. Er sagte etwas, das ich nicht verstand; seine Kameraden lachten.
Ein paar Minuten später saßen wir in einem Militär-Lkw, bewacht von vier bewaffneten Männern, die kein Englisch konnten oder zumindest so taten. Ich fragte mich, wie viel Schmuggelware Hitch bei sich trug und ob mich das zum Komplizen oder Mitwisser eines Verbrechens machte, das mit dem Tod bestraft wurde. Doch niemand sagte etwas von Drogen. Sie sagten gar nichts. Dann setzte sich der Wagen mit einem Ruck in Bewegung.
Wohin wir denn führen, erkundigte ich mich höflich. Der Soldat neben mir – ein Jüngling mit auseinander stehenden Zähnen und gewölbter Brust – zuckte die Achseln und hob in einer flüchtigen Drohgebärde den Gewehrkolben.
Sie nahmen Hitch die Kamera ab. Er bekam sie nie zurück. Sein Motorrad übrigens auch nicht. Was das anging, handelte das Militär durchaus ökonomisch.
Wir fuhren beinah achtzehn Stunden mit dem Lkw und verbrachten die nächste Nacht in einem Gefängnis in Bangkok, in getrennten Zellen und ohne Verständigungsmöglichkeit. Später erfuhr ich, dass sich ein sogenanntes Lagebewertungsteam von uns informieren lassen wollte (verhört sollten wir werden), und zwar bevor wir mit der Presse reden konnten; folglich hockten wir in unseren Einzelzellen mit einem Eimer als Toilette, während weltweit diverse wohlgekleidete Herren Flüge zum Don Muang Airport buchten. Solche Sachen brauchen Zeit.
Meine Familie war keine fünf Meilen von hier im Botschaftskrankenhaus, aber das wusste ich nicht. Auch Janice wusste nicht, wie nah wir uns waren.
Kaitlins Ohr blutete die ganze Nacht.
Doktor Dexters zweite Diagnose war richtig gewesen. Kaitlin hatte sich mit ominösen und weitgehend resistenten Bakterien infiziert, die ihr Trommelfell so gründlich auflösten – erklärte mir ein Arzt –, als habe ihr jemand ein Fläschchen Säure ins Ohr geschüttet. Hinzu kam, dass in der Zeit, die die Fluorchinolone brauchten, um die Infektion erfolgreich zu bekämpfen, auch Knöchelchen und Nervengewebe ringsherum befallen wurden. Am folgenden Abend stand zweierlei fest:
Kaitlin war außer Lebensgefahr.
Und sie würde nie wieder hören können mit diesem Ohr. Im rechten Ohr würde sie zwar ein gewisses Hörvermögen behalten, aber es würde beeinträchtigt sein.
Ich sollte vielleicht sagen, dass dreierlei feststand. Denn als die Sonne unterging, hatte Janice entschieden, dass meine Abwesenheit unentschuldbar war und dass sie nicht bereit war, mir die jüngste Fehlentscheidung zu verzeihen. Diesmal nicht – es sei denn, meine Leiche würde an den Strand geschwemmt, doch vielleicht nicht einmal dann.
Das Verhör gestaltete sich so:
Drei freundliche Herren trafen im Gefängnis ein und zeigten sich zutiefst zerknirscht ob der Bedingungen, unter denen wir untergebracht waren. Was das beträfe, stünden sie mit der thailändischen Regierung im Gespräch, »eben jetzt, in diesem Moment«, und ob wir in der Zwischenzeit nicht ein paar Fragen beantworten könnten?
Zum Beispiel unsere Namen und Adressen und unsere US-amerikanischen Verbindungen und wie lange wir schon in Thailand seien und was wir hier täten?
(Hitch muss sich darüber amüsiert haben. Ich sagte einfach die Wahrheit: Ich sei in Bangkok gewesen, um Software für eine Hotelkette mit Sitz in den Staaten zu entwickeln, und sei noch rund acht Monate nach Ablauf meines Vertrages geblieben. Ich ließ unerwähnt, dass ich vorgehabt hatte, ein Buch zu schreiben über Aufstieg und Fall einer Strandkultur von freiwilligen Exilanten im Land des Lächelns, wie es die thailändischen Reiseführer zu nennen pflegten – ein Buch, das sich vom Sachbuch zum Roman verwandelt hatte, bevor es endgültig scheiterte –, oder dass ich vor sechs Wochen meine Ersparnisse geplündert hatte. Ich erzählte ihnen von Janice, unterschlug ihnen aber, dass wir ohne das Geld, das sie sich von ihrer Familie geborgt hatte, arm wie Kirchenmäuse gewesen wären. Ich erzählte ihnen auch von Kaitlin, doch ich ahnte nicht, dass Kaitlin vor nur achtundvierzig Stunden fast gestorben wäre … und falls die Herren Bescheid wussten, zogen sie es vor, ihr Wissen für sich zu behalten.)
Alle übrigen Fragen betrafen das Chumphon-Objekt: Woher wir davon gewusst hätten; wann wir es zuerst gesehen hätten; wie nahe wir herangekommen wären; unsere »Eindrücke« von dem Objekt. Ein thailändischer Gefängniswärter sah finster zu, wie ein US-Arzt von uns Blut- und Urinproben nahm. Dann bedankten sich die Herren und versprachen uns, uns sobald wie möglich hier herauszuholen.
Am Tag darauf führten sich drei weitere freundliche Herren bei uns ein und stellten uns dieselben Fragen und machten uns dieselben Zusagen.
Zu guter Letzt wurden wir entlassen. Manches von dem, was sich in unseren Brieftaschen befunden hatte, wurde uns zurückgegeben, und wir traten irgendwo auf der falschen Seite des Chao Phrya in die Hitze und den Gestank von Bangkok hinaus. Verwahrlost und ohne einen Pfennig in der Tasche marschierten wir zur Botschaft, wo ich einem Beamten solange zusetzte, bis er uns das Fahrgeld für eine Busfahrt nach Chumphon und ein paar Telefonate vorschoss.
Ich versuchte Janice in unserer Miethütte zu erreichen. Vergebens. Doch es war Mittag, und ich ging davon aus, dass sie mit Kait unterwegs war, um das Nötigste für eine Mahlzeit zu besorgen. Ich versuchte es bei unserem Vermieter (ein graumelierter Brite namens Bedford), erreichte aber nur seinen Anrufbeantworter. Das war der Zeitpunkt, da uns eine hübsche Botschaftsangestellte nachdrücklich ermahnte, nur ja nicht unseren Bus zu verpassen.
Ich erreichte die Hütte, als es längst dunkel war, immer noch fest überzeugt, hier Janice und Kaitlin vorzufinden; natürlich würde sie mir böse sein, bis sie erfuhr, was passiert war; es würde eine tränenreiche Aussöhnung folgen und vielleicht sogar ein bisschen Leidenschaft.
In der Eile, rechtzeitig zur Charité zurückzukehren, hatte Janice die Tür nicht ins Schloss gezogen. Sie hatte einen Koffer für sich und Kaitlin gepackt – und den Rest hatten Diebe mitgenommen: die Sachen im Kühlschrank, mein Handy und den Laptop.
Ich lief die Straße hinauf und weckte unseren Vermieter, der sich erinnerte, dass Janice irgendwann einen Koffer an seinem Fenster vorbeigeschleppt hatte und dass Kaitlin krank gewesen war, doch in dem ganzen Wirbel um das Monument seien ihm die Einzelheiten entfallen. Ich durfte sein Telefon benutzen (ich war zum Telefonschnorrer geworden) und erreichte Doktor Dexter, der mich über die Details von Kaitlins Infektion und ihren Transport nach Bangkok aufklärte.
Bangkok. Und dahin durfte ich von Colins Telefon aus nicht anrufen; das sei ein Ferngespräch, erklärte er, und ob es nicht schon reiche, mit der Miete im Rückstand zu sein?
Ich fuhr per Anhalter zum Phat Duc, Hitchs angeblichem Fastfood- und Anglerladen.
Hitch hatte ebenfalls Probleme – er hegte die leise Hoffnung, die verschwundene Daimler aufzustöbern –, eröffnete mir aber, ich könnte vorerst im Hinterzimmer des Duc übernachten (auf einem feuchten Ballen Sinsemilla,5 malte ich mir aus) und das Telefon im Laden so oft benutzen, wie ich wollte; wir würden das später abwickeln.
Ich brauchte bis zum Morgen, um herauszufinden, dass Janice und Kaitlin das Land bereits verlassen hatten.
Ich mache ihr keinen Vorwurf.
Nicht, dass ich nicht wütend war; sechs Monate war ich wütend. Doch wenn ich versuchte, diese Wut vor mir zu rechtfertigen, kamen mir meine Entschuldigungen dürftig und unangebracht vor.
Immerhin hatte ich sie mit nach Thailand genommen, als sie viel lieber in den Staaten geblieben wäre, um ihr Postdoc-Forschungsstipendium zu beenden. Ich hatte sie hierbehalten, als meine Verträge ausliefen, und sie erfolgreich zu einem Leben unterhalb der Armutsgrenze gezwungen (nach amerikanischer Lesart, wohlgemerkt), derweil ich den Rebellen und Rückzügler mimte, was mehr mit unverarbeiteten postpubertären Existenzängsten zu tun hatte als mit etwas Substanziellem. Ich hatte Kaitlin den Gefahren eines Exillebens ausgesetzt (worunter ich vorzugsweise eine »Erweiterung ihres Horizonts« verstand) und am Ende, als meine Tochter in Lebensgefahr schwebte, war ich weder anwesend noch erreichbar gewesen.
Ohne Zweifel gab Janice mir die Schuld an Kaitlins hochgradiger Taubheit. Mir blieb nur die Hoffnung, dass Kait selbst mir nicht die Schuld gab. Zumindest nicht dauerhaft. Nicht für immer.
Inzwischen wollte ich nur eins: heimkehren. Janice hatte sich in das Haus ihrer Eltern nach Minneapolis zurückgezogen, wo sie meine Anrufe beharrlich ignorierte. Man gab mir zu verstehen, die Scheidung sei eingereicht.
Das alles war zehntausend Meilen weit weg.
Am Ende eines deprimierenden Monats eröffnete ich Hitch, dass ich ein Ticket in die Staaten brauchte, meine Mittel aber restlos erschöpft seien.
Wir saßen in der Bucht auf einem angeschwemmten Baumstamm. Windsurfer glitten in das weite Blau hinaus, unbeeindruckt von der Bakterienkonzentration. Lustig, wie einladend der Ozean wirken kann, selbst wenn er verseucht ist.
Am Strand herrschte reger Betrieb. Chumphon war zum Mekka für Bildjournalisten und neugierige Müßiggänger geworden. Tagsüber wetteiferte man um den günstigsten Standort für Stativaufnahmen des sogenannten Chumphon-Objekts; nachts trieb man die Preise für Alkohol und Logis in die Höhe. Alle miteinander hatten sie mehr Geld im Portemonnaie, als ich in einem Jahr zu Gesicht bekommen hatte.
Für Journalisten hatte ich nicht viel übrig und das Monument hasste ich bereits. Janice traf keine Schuld am Lauf der Dinge und ich tat mich verständlicherweise schwer, mir selbst die Schuld zu geben, aber ich konnte bedenkenlos das mysteriöse Objekt verantwortlich machen, von dem alle Welt so fasziniert war.
Der Witz ist, dass ich das Monument bereits gehasst habe, als noch niemand daran gedacht hatte, es zu hassen. Schon bald sollte die Silhouette dieses kühlen blauen Steins zu einem Symbol werden, das die allermeisten Menschen kannten und hassten (oder perverserweise liebten). Doch zur Zeit war ich Weltmeister in dieser Disziplin.
Die Quintessenz ist vermutlich, dass die Geschichte den Finger nicht immer auf die anständigen Leute legt.
Und nicht zu vergessen: Es gibt keinen Zufall.
»Wir brauchen beide eine Gefälligkeit«, sagte Hitch und grinste sein gefährliches Grinsen. »Vielleicht tun wir uns den Gefallen gegenseitig. Ich kann dir vielleicht helfen, nach Hause zu kommen, Scotty. Wenn du dafür etwas für mich tust.«
»Solche Vorschläge machen mir Sorgen«, sagte ich.
»Ein bisschen Sorgen können nicht schaden.«
Am Abend druckten die englischsprachigen Zeitungen den Text der Inschrift, die man am Fuß des Monuments entdeckt hatte – ein offenes Geheimnis hier in Chumphon.
Die Inschrift, zolltief in das Material der Säule getrieben und verfasst in einem Pidgin-Mandarin und Basic-English, war ein schlichtes Statement zur Erinnerung an eine Schlacht. Wir hatten es also mit einer Art Siegessäule zu tun.
Sie pries die Kapitulation von Süd-Thailand und Malaysia vor den alliierten Streitkräften von »Kuin«, wer oder was immer das war. Und unter dem Text stand das Datum dieser historischen Schlacht.
21. Dezember 2041.
Zwanzig Jahre in der Zukunft.
2
ZWEI
Ich flog in die Staaten, mit einer frischgebackenen Fluggesellschaft, die je ein Standbein in Beijing, Düsseldorf, Gander und Boston hatte – einmal um die Erde, mit nervtötenden Zwischenstationen – und landete schließlich im Logan Airport, mit imitierten Designerkoffern in bester Bangkok-Tradition, einem Fünftausend-Dollar-Guthaben und einer unliebsamen Verpflichtung, alles dank Hitch Paley. Ich war daheim, was immer ich mir davon versprach.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!