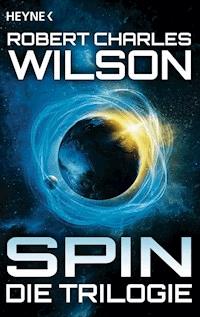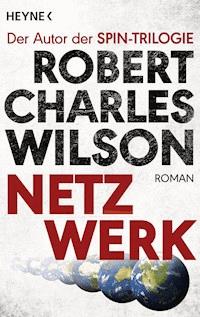8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein galaktisches, schier unlösbares Rätsel
Völlig ahnungslos wird Turk Findley zehntausend Jahre in eine Zukunft geschickt, in der sich die Menschheit auf mehrere Planeten verteilt hat, die durch Tore verbunden sind. Nur die Erde selbst ist nicht mehr zugänglich, sie gilt als sterbender Planet. Turk wird von einer Gruppe Fanatiker aufgenommen, die mit seiner Hilfe eine Verbindung zur Erde herstellen wollen, um so eine alte Prophezeiung zu erfüllen. Doch zuvor muss Turk herausfinden, zu welchem Zweck er in die Zukunft geschickt wurde – und ob seine Reise schon beendet ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Ähnliche
Das Buch
Als Turk Findley die Augen öffnet, kann er es nicht glauben: Er befindet sich tausende von Jahren in der Zukunft. Alles ist anders in dieser Zeit – nur eines ist gleich geblieben: Noch immer versuchen die Menschen verzweifelt mit den »Hypothetischen« Kontakt aufzunehmen, jenen geheimnisvollen Wesen, die die Erde mit anderen Welten verbunden haben …So jedenfalls steht es in einem Text, den die Psychologin Sandra Cole liest und der angeblich von einem ihrer Patienten geschrieben wurde. Aber wie kann das sein? Stammt ihr Patient vielleicht selbst aus dieser weit entfernten Zukunft? Haben ihn die Hypothetischen geschickt, um den Menschen der Gegenwart eine Nachricht zukommen zu lassen? Und wenn ja, wie können sie diese Nachricht entschlüsseln?
Mit »Vortex« schließt Robert Charles Wilson das große Abenteuer ab, das mit »Spin« begann und mit »Axis« weitergeführt wurde – ein Abenteuer, das in der Science Fiction seinesgleichen sucht.
Der Autor
Robert Charles Wilson, geboren 1953 in Kalifornien, wuchs in Kanada auf und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Toronto. Er zählt zu den bedeutendsten Autoren der modernen Science Fiction und wurde mehrfach für seine Romane ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hugo Award für sein Meisterwerk »Spin«. Mehr zu Autor und Werk unter:
www.robertcharleswilson.com
Robert Charles Wilson
VORTEX
Roman
Aus dem kanadischen Englisch vonMarianne und P. H. Linckens
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der OriginalausgabeVORTEX
Deutsche Erstausgabe 08/2012
Redaktion: Alexander Martin
Copyright © 2011 by Robert Charles Wilson
Copyright © 2012 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: C. Schaber Datentechnik, Wels
ISBN 978-3-641-07393-0V002
www.heyne-verlag.de
1
SANDRA UND BOSE
Nie wieder, dachte Sandra Cole, als sie in ihrem schwülheißen Apartment aufwachte. Heute würde sie zum letzten Mal zur Arbeit fahren, um den Tag mit ausgemergelten Prostituierten zu verbringen, mit Suchtkranken in den ersten schweißtreibenden Stadien des Entzugs, mit notorischen Lügnern und Kriminellen. Ja, heute würde sie ihre Kündigung einreichen.
Sie wachte jeden Morgen mit diesem Gedanken auf. Gestern hatte sie nicht gekündigt. Und heute würde sie es auch nicht tun. Aber irgendwann … Nie wieder. Beim Duschen und Anziehen kostete sie die Vorstellung aus. Auch noch, als sie den ersten Kaffee trank und das rasche Frühstück aus Joghurt, Toast und Butter aß. Dann war sie so weit, dem ungeschminkten Tag ins Gesicht zu sehen. Der Tatsache, dass alles beim Alten blieb.
Gerade als sie den Aufnahmebereich der State Care passierte, meldete ein Polizist den Jungen zur Beurteilung an.
Die ganze nächste Woche über sollte der Junge in ihrer Obhut bleiben: Man hatte die Formulare bereits an die Liste ihrer morgendlichen Fälle geheftet. Er hieß Orrin Mather und war angeblich nicht gewalttätig. Tatsächlich wirkte er verängstigt: Die Augen waren geweitet und feucht, der Kopf ruckte nach links und rechts wie bei einem Vogel, der das Terrain sichert.
Sandra konnte sich nicht an den Polizisten erinnern – ein neues Gesicht offenbar. Was an sich nichts Ungewöhnliches war, denn bei der Polizei von Houston riss man sich nicht darum, Kleinkriminelle der texanischen Fürsorge zu überstellen. Dieser Beamte allerdings schien persönlich engagiert: Der Junge ging nicht auf Abstand, sondern auf Tuchfühlung, als suche er Schutz. Der Polizist ließ die Hand auf der Schulter des Jungen und sagte etwas, das Sandra nicht hören konnte, den Jungen aber sichtlich beruhigte.
Die beiden hätten kaum gegensätzlicher sein können. Der Polizist war groß, von kräftiger Statur, aber nicht dick, hatte dunkle Haut, dunkles Haar und dunkle Augen. Der Junge war deutlich kleiner und so dünn, dass er sich in dem Gefängnis-Overall verlor. Und er war bleich wie jemand, der die letzten sechs Monate in einer Höhle gehaust hatte.
Der Diensthabende an der State-Care-Aufnahme war Jack Geddes, der, wie gemunkelt wurde, nebenher noch als Rausschmeißer in einer Bar jobbte. Geddes ging nicht selten grob mit Patienten um – zu grob, fand Sandra. Als er Orrin Mathers Unruhe bemerkte, ging er, gefolgt von der diensthabenden, mit Sedativa und Spritzen bewaffneten Schwester, sofort auf den Jungen zu.
Der Polizist – und das war sehr ungewöhnlich – stellte sich unmissverständlich vor Orrin. »Das ist nicht nötig«, sagte er; seine Stimme hatte einen leichten ausländischen Akzent. »Ich kann Mr. Mather begleiten, wo immer er hinsoll.«
Sandra trat vor, ein wenig verlegen, weil sie erst jetzt das Wort ergriff. Sie stellte sich vor und sagte: »Zuerst müssen wir ein Aufnahmegespräch führen, Mr. Mather. Dazu gehen wir den Flur hinunter in ein bestimmtes Zimmer. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen und mache mir Notizen. Dann weisen wir Ihnen ein eigenes Zimmer zu. Haben Sie das verstanden?«
Orrin Mather atmete vorsichtig aus und nickte. Geddes schien ziemlich verärgert, aber er zog sich wieder hinter den Schalter zurück.
Der Polizist bedachte Sandra mit einem taxierenden Blick. »Ich bin Officer Bose«, sagte er. »Ich würde gern mit Ihnen reden, wenn Orrin versorgt ist, Dr. Cole.«
»Das kann etwas dauern.«
»Ich kann warten«, sagte Bose. »Wenn es Ihnen recht ist.«
Und das war das Ungewöhnlichste von allem.
Seit zehn Tagen schon kletterten die Temperaturen in der Stadt tagsüber über 38 Grad Celsius. Die Diagnoseabteilung der State Care war klimatisiert, oft bis zur Absurdität (Sandra hatte im Büro einen Pullover liegen), doch hier fand lediglich ein kühles Rinnsal seinen Weg durch das Deckengitter. Orrin Mather schwitzte bereits, als Sandra sich ihm gegenüber an den Tisch setzte. »Guten Morgen, Mr. Mather«, sagte sie.
Beim Klang ihrer Stimme entspannte er sich ein wenig. »Sie können ruhig Orrin sagen, Ma’am.« Er hatte blaue Augen, und die Wimpern schienen etwas zu lang für das knochige Gesicht. Ein Riss in der rechten Wange verheilte gerade und hinterließ eine Narbe. »Das tun fast alle.«
»Danke, Orrin. Ich bin Dr. Cole, und wir werden uns in den nächsten Tagen unterhalten.«
»Sie entscheiden, wer mich behält?«
»Kann man so sagen. Ich erstelle das psychiatrische Gutachten. Aber ich bin nicht hier, um über dich zu urteilen, verstehst du? Ich bin hier, um herauszufinden, wer dir am besten helfen kann.«
Orrin nickte kurz. »Sie entscheiden, ob ich in ein State-Care-Camp komme.«
»Nicht nur ich. Alle Mitarbeiter sind beteiligt, mal mehr, mal weniger.«
»Aber wir beide unterhalten uns?«
»Vorerst, ja.«
»Okay. Ich verstehe.«
Von oben blickten vier Sicherheitskameras in den Raum, aus jeder Ecke eine. Sandra hatte Aufnahmen von ihren eigenen und von anderen Sitzungen gesehen und wusste, wie sie auf den Monitoren im angrenzenden Raum wirkte: perspektivisch verkürzt, streng in ihrer blauen Bluse und dem gleichfarbigen Rock, die Kennmarke vom Hals baumelnd, wenn sie sich über den Kiefernholztisch lehnte. Die Alchemie der Überwachungsanlage würde den Jungen auf einen anonymen Befragten reduzieren … Allerdings sollte sie aufhören, ihn als Jungen zu bezeichnen, nur weil er so jung wirkte. Der Akte nach war er neunzehn. Alt genug, um es besser zu wissen, wie Sandras Mutter immer sagte. »Du stammst aus North Carolina, Orrin, richtig?«
»So steht es vermutlich in den Papieren da.«
»Und? Haben die Papiere recht?«
»Geboren in Raleigh und dort gelebt, ja, Ma’am, mein Leben lang, bis ich nach Texas kam.«
»Darüber reden wir noch. Erst sollten wir ein paar grundlegende Dinge klären. Weißt du, warum die Polizei dich mitgenommen hat?«
Orrin senkte den Blick. »Ja.«
»Geht es etwas ausführlicher?«
»Vagabundieren.«
»So sagt es das Gesetz. Wie würdest du es nennen?«
»Weiß nicht. In einer Gasse pennen vielleicht? Und von diesen Männern verprügelt werden.«
»Verprügelt zu werden ist kein Verbrechen. Die Polizei hat dich zu deinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen, richtig?«
»So wird es gewesen sein. Ich habe ziemlich geblutet, als sie mich fanden. Ich habe nichts getan, um die Kerle zu provozieren. Sie waren betrunken und sind einfach über mich hergefallen. Sie wollten mir die Tasche wegnehmen, aber ich hab nicht losgelassen. Ich wünschte, die Polizei wäre ein bisschen früher aufgetaucht.«
Die Streife hatte Orrin Mather halb bewusstlos und blutend auf einem Bürgersteig im Südwesten von Houston gefunden. Keine Adresse, keine Papiere und offenbar kein Auskommen. Wegen »Vagabundierens« – man bezog sich auf Vorschriften, die in den Wirren nach dem Spin erlassen worden waren – hatte man Orrin festgenommen, um ihn näher unter die Lupe zu nehmen. Seine physischen Verletzungen waren leicht zu behandeln, aber sein Geisteszustand war eine offene Frage, der Sandra im Laufe der nächsten sieben Tage auf den Grund gehen sollte. »Du hast Familie, Orrin?«
»Nur meine Schwester Ariel. In Raleigh.«
»Und die Polizei hat sie verständigt?«
»Angeblich ja, Ma’am. Officer Bose meint, dass sie mit dem Bus unterwegs ist, um mich zu holen. Aber die dauert lange, diese Busfahrt. Ziemlich heiß um diese Jahreszeit, glaube ich. Ariel mag keine Hitze.«
Das musste sie mit Bose klären. Normalerweise, wenn ein Familienmitglied bereit war, die Verantwortung zu übernehmen, brauchte man wegen Vagabundierens die State Care nicht einzuschalten. Orrins Protokoll erwähnte keinerlei Gewalttätigkeiten seinerseits, er war sich augenscheinlich völlig im Klaren über seine Situation, und es gab keinerlei Hinweise auf irgendwelche Wahnvorstellungen – im Moment jedenfalls nicht. Obwohl er Sandra tatsächlich nicht ganz geheuer war. (Ein ziemlich unprofessioneller Gedanke, den sie für sich behalten würde.)
Sie begann mit dem Standard-Interview. Datum, Wochentag, etc. Er antwortete schnell und korrekt. Erst als sie ihn fragte, ob er Stimmen höre, zögerte Orrin. »Ich denke nein«, sagte er schließlich.
»Bist du sicher? Es ist okay, darüber zu reden. Wenn es damit ein Problem gibt, dann möchten wir dir helfen.«
Er nickte ernst. »Ich weiß. Eine schwere Frage. Ich höre keine Stimmen, Ma’am, nein, das nicht … aber ich schreibe manchmal Sachen.«
»Was für Sachen?«
»Sachen, die ich nicht immer verstehe.«
Das war der Einstieg.
Mögl. Wahnvorstellungen, geschriebene, notierte Sandra. Dann – weil es ihm sichtlich zusetzte – lächelte sie und sagte: »Gut, lassen wir’s genug sein.« Eine halbe Stunde war vergangen. »Fortsetzung folgt. Jetzt lernst du erst mal das Zimmer kennen, in dem du die nächsten Tage wohnen wirst.«
»Es ist bestimmt sehr schön.«
Verglichen mit den Seitengassen der Stadt Houston mochte das wohl stimmen. »Der erste Tag in der State Care fällt vielen schwer, aber glaub mir, es ist halb so schlimm. Abendessen um sechs in der Kantine.«
Orrin wirkte leicht verunsichert. »Ist das eine Art Cafeteria?«
»Ja.«
»Darf ich fragen, ob es da laut ist? Ich mag keinen Lärm beim Essen.«
Laut? Die Patientenkantine war ein Zoo und im Allgemeinen auch entsprechend laut, obwohl das Personal für Sicherheit sorgte. Lärmempfindlich, notierte Sandra. »Es kann da ein bisschen laut werden, ja. Meinst du, du kommst klar damit?«
Orrin wirkte niedergeschlagen, nickte aber. »Ich glaube schon. Danke für Ihre Offenheit, ich weiß das zu schätzen.«
Noch eine verlorene Seele – nur zerbrechlicher und weniger aggressiv als die meisten. Sandra hoffte inständig, dass ihm die Woche hier mehr nutzen als schaden würde. Aber darauf wetten wollte sie nicht.
Zu ihrer Überraschung wartete draußen vor dem Zimmer der Officer, der Orrin gebracht hatte. Normalerweise lieferten sie jemanden ab und gingen wieder. Die State Care war eingerichtet worden, um in den schlimmsten Jahren des Spins die überfüllten Gefängnisse zu entlasten. Und obwohl sich die Lage vor einem Vierteljahrhundert entspannt hatte, diente die Institution immer noch als Auffangbecken für Kleinkriminelle mit psychischen Auffälligkeiten. Praktisch für die Polizei – aber nicht für den überforderten und unterbezahlten Mitarbeiterstab der State Care. Nur selten wurde noch einmal nachgefasst; soweit es die Polizei betraf, war eine Überstellung gleichbedeutend mit dem Schließen der Akte – oder mit dem Betätigen der Wasserspülung.
Boses Uniform sah wie frisch gebügelt aus, und das bei der Hitze. Er wollte wissen, welchen Eindruck sie von Orrin Mather gewonnen hatte, und weil die Mittagspause schon begonnen hatte und Sandras Nachmittag ausgebucht war, lud sie ihn ein, mit in die Kantine zu kommen – die Personal-, nicht die Patientenkantine, die Orrin ganz sicher nicht gefallen würde.
Sandra nahm wie immer ihre Montagssuppe und einen Salat und wartete auf Bose, der es ihr gleichtat. So spät, wie sie waren, hatten sie kein Problem, einen freien Tisch zu finden. »Ich möchte Orrin nicht aus den Augen verlieren«, sagte Bose.
»Höre ich da richtig?«
»Was meinen Sie?«
»Die Polizei von Houston ist im Allgemeinen nicht so anhänglich.«
»Vermutlich nicht. Aber in Orrins Fall gibt es ein paar offene Fragen.«
Ihr fiel auf, dass er »Orrin« sagte und nicht »der Häftling« oder »der Patient«; offenbar hatte Officer Bose ein persönliches Interesse an dem Fall. »Ich sehe nichts Ungewöhnliches in der Akte.«
»Sein Name taucht im Zusammenhang mit einem anderen Fall auf. Ich darf nicht ins Detail gehen, aber … hat er seine Schreiberei erwähnt?«
Sandra hob eine Augenbraue. »Ganz kurz, ja.«
»Als man ihn festnahm, hatte Orrin eine Ledertasche mit einem Dutzend linierter Hefte dabei, alle vollgeschrieben. Die hat er verteidigt, als er angegriffen wurde. Orrin ist im Grunde ein kooperativer Bursche, aber wir hatten alle Mühe, ihm die Hefte abzunehmen. Wir mussten ihm versprechen, darauf aufzupassen – er wollte sie unbedingt zurückhaben, sobald sein Fall geklärt sei.«
»Und? Hat er sie zurück?«
»Noch nicht, nein.«
»Wenn ihm die Hefte so viel bedeuten, könnten sie für meine Beurteilung aufschlussreich sein.«
»Das leuchtet mir ein, Dr. Cole. Darum unser Gespräch. Die Sache ist die: Der Inhalt dieser Hefte hängt mit einem anderen Fall zusammen, den wir bearbeiten. Ich lasse sie gerade abschreiben, aber das ist ein mühseliger Prozess – Orrins Handschrift ist nicht leicht zu entziffern.«
»Kann ich die Abschriften sehen?«
»Genau das wollte ich Ihnen vorschlagen. Aber ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Solange Sie nicht den gesamten Text kennen, darf die Sache nicht aktenkundig werden. Okay?«
Das war ein seltsames Ersuchen, und Sandra antwortete nur zögernd. »Ich bin mir nicht sicher, was Sie unter aktenkundig verstehen. Jede wichtige Erkenntnis fließt mit in die Diagnose ein. Das ist nicht verhandelbar.«
»Sie können jede Erkenntnis berücksichtigen, solange Sie keine Textstellen kopieren oder zitieren. Nicht, bevor wir bestimmte Dinge geklärt haben.«
»Officer Bose, Orrin ist ganze sieben Tage in meiner Obhut. Dann muss ich eine Empfehlung aussprechen.« Sandra fügte nicht hinzu, dass diese Empfehlung Orrin Mathers Leben drastisch verändern würde.
»Schon verstanden, und ich will mich auch nicht einmischen. Was mich interessiert, ist Ihre Bewertung. Ich wüsste gerne – inoffiziell, versteht sich –, was Sie von dem Text halten. Wie … verlässlich er ist.«
Langsam dämmerte es Sandra. Etwas von dem, was Orrin aufgeschrieben hatte, war möglicherweise von entscheidender Bedeutung für ein anhängiges Verfahren, und Bose musste wissen, wie glaubwürdig es (oder sein Autor) war. »Falls Sie mich als Zeugin in einem Prozess …«
»Nein, nichts dergleichen. Nur eine Rückversicherung. Alles, was nicht die Intimsphäre des Patienten verletzt oder auf andere professionelle Bedenken stößt.«
»Ich weiß nicht, was Sie …«
»Vielleicht verstehen Sie es ein bisschen besser, wenn Sie das Dokument gelesen haben.«
Es war Boses ernster Gesichtsausdruck, der sie schließlich umstimmte. Sie war natürlich neugierig auf die Hefte und warum sie so wichtig waren für Orrin. Sollte sie allerdings etwas klinisch Relevantes entdecken, würde sie keine Skrupel haben, das Versprechen, das sie Bose gegeben hatte, zu ignorieren. Und das machte sie ihm auch unmissverständlich klar – ihre Loyalität galt in erster Linie dem Patienten.
Er war ohne Wenn und Aber einverstanden. Als er aufstand, hatte er noch nicht aufgegessen; zurück blieb ein grünes Salatbett, aus dem er systematisch alle Kirschtomaten herausgepickt hatte. »Danke, Dr. Cole. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Sie bekommen die ersten Seiten heute Abend per E-Mail.«
Er gab ihr seine Karte vom Houston Police Department mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse und seinem vollen Namen: Jefferson Amrit Bose. Sie murmelte den Namen vor sich hin, während sie zusah, wie er in einem Schwarm weiß gekleideter Schwestern verschwand.
Nach einem Tag voller Routine-Konsultationen fuhr Sandra unter dem flach einfallenden Licht der Sonne nach Hause.
Der Sonnenuntergang ließ sie oft an den Spin denken. Die Sonne war in den drastisch verkürzten Jahren des Spins gealtert und angeschwollen, und wenn sie am westlichen Himmel jetzt so normal aussah, war das eine ziemlich gut gemachte Illusion. Die echte Sonne war ein greises, aufgeblähtes Monster, das im Zentrum des Systems seinen Todeskampf focht – und was man am Horizont sah, war das, was die Hypothetischen aus der tödlichen Strahlung gemacht hatten. Seit Jahren – seit Sandra erwachsen war – war die Menschheit auf die geheimnisvolle Technik dieser fremden und stummen Wesen angewiesen.
Das harte Blau des Himmels wurde im Südosten von Wolken verdüstert, die an gläserne Korallenbänke erinnerten. 40,5 Grad Celsius in der Stadtmitte von Houston, wenn man dem Wetterbericht glaubte – nicht anders als gestern und vorgestern. In den Nachrichten ging es ausschließlich um die laufenden Starts in White Sands: Raketen impften die obere Atmosphäre mit Schwefelaerosolen, um die globale Erwärmung zu verlangsamen. Gegen diese drohende Apokalypse, für die sie nichts konnten, hatten die Hypothetischen keine Hilfe angeboten. Sie nahmen die Erde vor der expandierenden Sonne in Schutz, aber der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre schien sie nichts anzugehen; das war Sache der Menschen. Und dennoch krochen die Öltanker den Houston Ship Channel herauf, zumal das Rohöl inzwischen reichlich und billig aus der neuen Welt jenseits des Torbogens floss. Fossiler Brennstoff von zwei Planeten, um uns gar zu kochen, dachte Sandra. Das angestrengte Rauschen der Klimaanlage unterstrich ihre Heuchelei, aber sie konnte auf den kühlen Luftstrom nicht verzichten.
Seit sie ihr Medizinpraktikum an der UCSF beendet und bei der State Care angefangen hatte, hatte Sandra ihre Zeit damit verbracht, psychisch auffällige Menschen einem Test zu unterziehen, der von den meisten »normalen« Erwachsenen mühelos bestanden wurde. Kann sich der Betreffende in Zeit und Raum orientieren? Begreift der Betreffende die Folgen seines Tuns? Aber würde sie die ganze Menschheit diesem Test unterziehen, dachte Sandra, wäre das Ergebnis ziemlich ungewiss. Der Betreffende ist verwirrt und häufig selbstzerstörerisch. Er verfolgt kurzfristige Befriedigung auf Kosten seiner Gesundheit.
Als sie ihr Apartment in Clear Lake erreichte, war es bereits dunkel und die Temperatur um ein, zwei Grad gefallen. Sie schob ihr Abendessen in die Mikrowelle, öffnete eine Flasche Rotwein und sah nach, ob Bose inzwischen die E-Mail geschickt hatte.
Er hatte. Ein paar Seiten. Seiten, die Orrin Mather angeblich geschrieben hatte. Sie sah aber sofort, wie unwahrscheinlich das war.
Sie druckte die Seiten aus und machte es sich bequem.
Mein Name ist Turk Findley, begann das Dokument.
2
TURK
1.
Mein Name ist Turk Findley, und das habe ich erlebt, nachdem alles, was ich kannte und liebte, vergangen war. Die Geschichte beginnt in der Wüste eines Planeten, den wir Äquatoria nannten, und endet … nun, das ist schwer zu sagen.
Dies sind meine Erinnerungen. Dies ist, was geschah.
2.
Es waren an die zehntausend Jahre, die mich von meinem bisherigen Leben trennten. Das zu wissen, war schrecklich, und für eine bestimmte Zeitspanne war es nahezu alles, was ich wusste.
Ich erwachte im Freien, schwindlig, nackt. Die Sonne stach aus einem leeren blauen Himmel. Ich war entsetzlich durstig. Mein Körper schmerzte, meine Zunge lag wie tot im Mund. Ich setzte mich auf und wäre dabei fast umgekippt. Ich sah alles verschwommen. Ich wusste nicht, wo ich war oder wie ich hierhergekommen war. Und ich konnte mich auch nicht daran erinnern, woher ich kam. Ich hatte nur die grässliche Gewissheit, dass beinahe zehntausend Jahre vergangen waren (aber wer hatte sie gezählt?).
Ich zwang mich, ganz stillzusitzen, mit geschlossenen Augen, bis der Schwindel nachließ. Dann hob ich den Kopf und versuchte mir einen Reim auf das zu machen, was ich sah.
Ich befand mich mitten in einer Wüste. Soweit ich das beurteilen konnte, gab es hier meilenweit niemanden außer mir, und doch war ich nicht allein: Flugmaschinen zogen über mir vorüber. Sie waren seltsam geformt, und ich fragte mich, was sie wohl in der Luft hielt, denn ich sah weder Tragflächen noch Rotoren.
Ich beschloss, sie zu ignorieren, denn ich musste so schnell wie möglich aus der Sonne – meine Haut war stark gerötet, und ich hatte keine Ahnung, wie lange ich hier schon lag.
Die Wüste bestand bis zum Horizont aus stark verdichtetem Sand, war aber mit Bruchstücken übersät, die an riesige zerbrochene Spielsachen erinnerten: ein paar Meter entfernt eine sanft gewölbte, halbe Eierschale, mindestens drei Meter hoch und mattgrün; und weiter weg andere ähnliche Formen in heiteren, aber verblassenden Farben, als wäre hier die Teegesellschaft eines Riesen verunglückt. Und weit, weit hinter allem eine Bergkette, die an einen verrußten Kieferknochen erinnerte. Es roch nach mineralischem Staub und heißem Gestein.
Ich krabbelte auf allen vieren in den Schatten der halben Eierschale, wo mich eine wohltuende Kühle umfing. Als Nächstes brauchte ich Wasser. Und dann vielleicht etwas, um mich zu bedecken. Doch die Anstrengung hatte mich wieder schwindlig gemacht. Eine der merkwürdigen Flugmaschinen schien über mir zu schweben. Ich wollte die Arme schwenken, um auf mich aufmerksam zu machen, aber meine Kräfte hatten mich verlassen und ich verlor das Bewusstsein.
3.
Ich wachte wieder auf, als man mich gerade auf eine Art Trage hob.
Die Menschen um mich herum trugen gelbe Uniformen und Staubmasken vor Mund und Nase. Neben mir ging eine Frau. Als sich unsere Blicke trafen, sagte sie: »Bitte bleib ruhig. Ich weiß, dass du Angst hast. Wir müssen uns beeilen, aber vertrau mir, wir bringen dich an einen sicheren Ort.«
Sie trugen mich in eine der Flugmaschinen, die inzwischen gelandet waren. In einer Sprache, die mir fremd war, richtete die Frau einige Worte an ihre Begleiter. Meine Häscher (oder Retter) stellten mich auf die Füße, und ich entdeckte, dass ich stehen konnte, ohne umzufallen. Die Luke kam herunter und schnitt mir die Sicht auf Wüste und Himmel ab. Ein sanfteres Licht flutete das Innere.
Ringsherum eilten Männer und Frauen in gelben Overalls geschäftig hin und her, während ich die Frau im Auge behielt, die Englisch gesprochen hatte. »Schön langsam«, sagte sie und nahm mich beim Arm. Sie war kaum größer als eins fünfzig, und als sie die Maske abnahm, sah sie beruhigend menschlich aus. Braune Haut, leicht asiatisches Gesicht, dunkles, kurzes Haar. »Wie fühlst du dich?«
Die Antwort wäre zu lang ausgefallen, also zuckte ich nur mit den Achseln.
Wir befanden uns in einem großen Raum. Die Frau führte mich in eine Ecke, und zusammen mit einem Regal für medizinisches Gerät glitt eine bettartige Fläche aus der Wand. Die Frau forderte mich auf, mich hinzulegen. Die anderen Soldaten oder Piloten – oder was immer sie waren – kümmerten sich nicht um uns und gingen ihrer Arbeit nach, befassten sich mit Armaturen, die in den Wänden eingelassen waren, oder verließen den Raum. Es fühlte sich an wie in einem aufsteigenden Lift; offenbar hatten wir abgehoben, obwohl nichts zu hören war als die Stimmen, die in einer Sprache redeten, die ich nicht kannte. Kein Hopser, kein Schaukeln, keine Turbulenz.
Die Frau drückte eine stumpfe Metallröhre erst auf meinen Unterarm und dann auf meinen Brustkorb, und meine Angst ebbte ab. Offensichtlich hatte sie mir ein Beruhigungsmittel verabreicht, was mir ganz recht war. Auch mein Durst war wie weggewischt. »Wie heißt du?«, fragte sie.
Ich krächzte, ich sei Turk Findley. Ich sei gebürtiger Amerikaner und habe zuletzt auf Äquatoria gelebt. Dann fragte ich, wer sie sei und woher sie komme.
Sie lächelte und sagte: »Ich heiße Treya, und der Ort, von dem ich komme, heißt Vox.«
»Sind wir dahin unterwegs?«
»Ja. Es dauert nicht mehr lange. Versuch jetzt zu schlafen.«
Also schloss ich die Augen und trug Stück für Stück zusammen, was ich über mich finden konnte.
Mein Name ist Turk Findley.
Geboren in den letzten Jahren des Spins. Mal Tagelöhner, mal Matrose, mal Pilot für Kleinflugzeuge. Auf einem Frachter kam ich durch den Torbogen nach Äquatoria und blieb ein paar Jahre in Port Magellan. Ich begegnete einer Frau namens Lise Adams, die ihren Vater suchte, was uns unter Leute brachte, die mit marsianischen Drogen experimentierten, was uns tief in die äquatorianische Wüste zu den Ölfeldern brachte zu einer Zeit, da es Asche zu regnen begann und merkwürdige Dinge aus dem Boden wuchsen. Ich liebte Lise Adams genug, um zu wissen, dass ich nicht der Richtige für sie war. Wir wurden in der Wüste getrennt. Und ich glaube, die Hypothetischen bemächtigten sich meiner. Lasen mich auf, trugen mich fort wie eine Welle ein Sandkorn. Spülten mich hierher, an diesen Strand, an diese seichte Stelle, zehntausend Jahre stromabwärts.
Dies war meine Geschichte, soweit ich sie rekonstruieren konnte.
Als ich wieder zu mir kam, hatte man mich umgebettet. Ich lag jetzt ungestört in einer Kabine der Flugmaschine. Treya, meine Wächterin oder Ärztin (ich wusste nicht, wie ich sie einordnen sollte) saß an meinem Bett und summte eine Melodie. Ich trug nun eine Hose und darüber eine Art Kittel (wer hatte mich angezogen?).
Draußen war es Nacht. Durch das schmale Fenster links von mir sah man verstreute Sterne, die sich wie leuchtende Punkte auf einer Scheibe drehten, wann immer sich die Flugmaschine in eine Kurve legte. Der kleine äquatorianische Mond saß auf dem Horizont (was bedeutete, dass ich nach wie vor auf Äquatoria war, auch wenn es sich sehr verändert hatte). Tief unten weiße Schaumkronen, die vor Phosphoreszenz glitzerten. Wir flogen übers Meer, weit und breit kein Festland.
»Was ist das für eine Melodie?«, fragte ich.
Treya schrak auf. Sie war jung, vielleicht zwanzig, fünfundzwanzig. Ihre Augen verrieten Aufmerksamkeit und Vorsicht, als hätte sie eine latente Angst vor mir. Aber sie lächelte über die Frage. »Nur ein Lied.«
Ein bekanntes Lied. Eines von diesen Klageliedern im Walzertakt, die in den Wirren nach dem Spin so beliebt gewesen waren. »Es erinnert mich an ein Lied, das ich mal kannte …«
»Après Nous.«
Richtig. Ich hatte jung und einsam in einer Bar in Venezuela gesessen … Ein schönes Lied, aber wie konnte es zehn Jahrtausende überdauern? »Woher kennst du es?«
»Wie soll ich das erklären? Ich … bin damit aufgewachsen.«
»Wirklich? Wie alt bist du denn?«
Sie lächelte wieder. »Nicht so alt wie du, Turk Findley. Aber ich habe einige Erinnerungen. Deshalb bin ich dir zugeteilt. Ich bin nicht nur deine Krankenschwester. Ich bin dein Übersetzer, dein Wegweiser und dein Fremdenführer, wenn du so willst.«
»Dann kannst du mir vielleicht erklären …«
»Ich kann dir viel erklären, aber nicht jetzt. Du brauchst Ruhe. Soll ich dir etwas zum Einschlafen geben?«
»Ich habe lange genug geschlafen.«
»Hat es sich so angefühlt, als du bei den Hypothetischen warst – wie Schlaf?«
Die Frage verblüffte mich. Ich wusste, dass ich irgendwie »bei den Hypothetischen« gewesen war, aber richtig erinnern konnte ich mich daran nicht. Sie schien mehr darüber zu wissen als ich.
»Vielleicht kommen die Erinnerungen zurück«, sagte sie.
»Kannst du mir verraten, wovor wir weglaufen?«
Sie runzelte die Stirn. »Wie meinst du das?«
»Ihr konntet doch nicht schnell genug weg aus der Wüste.«
»Nun … diese Welt hat sich verändert, seit du aufgegriffen wurdest. Es gab Kriege. Der Planet wurde radikal entvölkert und hat sich nie wieder erholt. Eigentlich leben wir immer noch im Kriegszustand.«
Wie zur Bestätigung legte sich die Flugmaschine in eine scharfe Kurve, und Treya warf einen nervösen Blick durch das Kabinenfenster. Ein weißer Blitz löschte die Sterne aus und beleuchtete die rollenden Wogen tief unten. Ich setzte mich auf, um besser sehen zu können, und meinte am Horizont etwas auszumachen, als das grelle Licht verblasste – etwas wie einen fernen Kontinent oder (weil es nahezu eben war) ein riesiges Schiff. Dann wurde es von Dunkelheit verschluckt.
»Liegen bleiben!« Die Flugmaschine schlug jetzt einen regelrechten Haken, und Treya duckte sich in eine Sitzschale, die Bestandteil der gegenüberliegenden Wand war. Wieder Lichtblitze hinter dem Fenster. »Wir sind außer Reichweite ihrer Wasserfahrzeuge, aber ihre Flugmaschinen … Weißt du, es hat einige Zeit gedauert, bis wir dich gefunden haben. Die anderen müssten inzwischen in Sicherheit sein. Die Kabine wird dich schützen, falls das Schiff beschädigt wird, aber du musst dich hinlegen …«
Es geschah, kaum dass die Worte aus ihrem Mund waren.
Wie ich später erfuhr, hatte unsere Formation aus fünf Fluggeräten bestanden. Wir hatten die äquatorianische Wüste als Letzte verlassen, und der Angriff kam früher und entschlossener als erwartet: Die vier Begleitmaschinen, die uns eskortierten, stürzten ab, und danach waren wir wehrlos.
Ich weiß noch, dass Treya nach meiner Hand griff. Ich wollte sie fragen, was das für ein Krieg war. Ich wollte sie fragen, wer »die anderen« waren. Aber dazu blieb keine Zeit. Ihr Griff war wie ein Schraubstock, und ihre Haut war kalt. Dann erinnere ich mich nur noch an jähe Hitze und ein blendendes Licht – und daran, dass wir fielen.
4.
Eine Kombination aus programmierten Rettungsmanövern und schierem Glück trug unser Stück des zerborstenen Fluggeräts bis zur nächstgelegenen Insel von Vox.
Vox war ein Wasserfahrzeug, im weitesten Sinne ein Schiff, aber Vox war weit mehr als ein Schiff. Vox war ein Archipel aus schwimmenden Inseln, viel, viel größer als alles, was zu meinen Lebzeiten jemals in See gestochen war. Vox war eine Kultur und eine Nation, eine Historie und eine Religion. Seit fünfhundert Jahren befuhr das Archipel die Meere des Weltenrings – so nannte Treya die Planeten, die durch die Torbögen der Hypothetischen miteinander verbunden waren. Die Feinde des Weltenrings seien stark, erklärte sie, und sie seien ganz in der Nähe. Äquatoria war nahezu entvölkert, aber ein »Bündnis aus kortikalen Demokratien« hatte schwimmende Verfolger geschickt, die verhindern sollten, dass Vox den Torbogen erreichte, der Äquatoria mit der Erde verband. Treya glaubte nicht, dass es ihnen gelingen würde, doch die jüngste Attacke war verheerend – und unter den Verlusten war unsere Flugmaschine.
Wir hatten überlebt, weil die Kabine, in der Treya mich betreut hatte, mit raffinierten Überlebensmechanismen ausgestattet war: Aerogele, um uns vor Verletzungen zu bewahren, entfaltbare Tragflächen für den Gleitflug zu einem geeigneten Landeplatz. Wir waren auf einer der äußeren Inseln des Archipels gestrandet, die unbewohnt und weit weg von der zentralen Stadt war, die Treya Vox-Core nannte.
Vox-Core, die Nabe des Archipels, war das eigentliche Angriffsziel gewesen. Im Morgengrauen konnten wir eine Rauchsäule sehen, die sich am windwärtigen Horizont erhob. »Da«, sagte Treya heiser. »Der Rauch … Er steht über Vox-Core.«
Wir verließen die schwelende Rettungskapsel, standen im hohen Gras und sahen zu, wie die Sonne über den Horizont kletterte. »Das Netzwerk ist stumm«, sagte Treya. Mir war nicht klar, was das hieß oder woher sie es wusste. Ihr Gesicht war starr vor Traurigkeit. Unsere Flugmaschine musste ins Meer gestürzt sein, und alle an Bord waren tot, nur wir beide nicht. Ich fragte Treya, wieso ausgerechnet wir verschont worden waren.
»Nicht wir«, erwiderte sie. »Du. Die Maschine hat alles getan, um dich zu retten. Es ging um dich, nicht um mich.«
»Um mich? Aber wieso?«
»Wir haben jahrhundertelang auf dich gewartet. Auf dich und die anderen.«
Ich verstand nicht. Aber sie war benommen und tastete nach ihren Prellungen, also ließ ich sie in Ruhe. Man würde uns zu Hilfe kommen, sagte sie. Ihre Leute würden uns schon finden. Sie würden Luftfahrzeuge ausschicken, auch wenn Vox-Core beschädigt war. Man würde uns schon nicht der Wildnis überlassen.
Wie sich herausstellen sollte, irrte sie sich.
Die Rettungskapsel hatte das Gras ringsum verbrannt. Außen qualmte sie noch und innen war sie viel zu heiß, um auch nur vorübergehend als Behausung zu dienen. Treya und ich luden aus, was sich zu bergen lohnte. Während die Kapsel großzügig mit Arzneimitteln und medizinischem Gerät ausgestattet war (zumindest hielt ich die Sachen dafür), schien man an dem, was Treya als Lebensmittel identifizierte, gespart zu haben. Ich schnappte mir jede Packung, auf die sie zeigte, und wir stapelten alles unter einem nahen Baum (eine Art, die ich nicht wiedererkannte). Der Baum war alles, was wir im Moment als Zuflucht brauchten. Die Luft war warm, der Himmel klar.
Trotz der körperlichen Anstrengung ging es mir einigermaßen gut, viel besser als nach meinem ersten Erwachen in der Wüste. Ich war weder müde noch sonderlich besorgt, wohl dank der Medikamente, mit denen mich Treya vollgepumpt hatte. Ich fühlte mich aber auch nicht betäubt – ich war ruhig und verspürte nicht die geringste Lust, über aktuelle Bedrohungen nachzudenken. Ich sah zu, wie Treyas Schnitte und Schrammen verheilten, als sie die Verletzungen mit Salbe betupfte. Dann klebte sie sich eine blaue Glasröhre an die Innenseite des Arms, und kurz darauf machte sie einen genauso gesunden Eindruck wie ich – nur die Traurigkeit versteinerte nach wie vor ihr Gesicht.
Während die Sonne weiter über den Horizont stieg, zeigte sie uns immer mehr vom Ort unserer Landung. Es war eine herrliche Landschaft. Als ich klein war, las mir meine Mutter immer aus einer illustrierten Kinderbibel vor, und diese Insel erinnerte mich an Aquarellbilder von Eden – Eden vor dem Sündenfall. Wogende Wiesen voller Klee im Wechsel mit Dickichten aus Obstbäumen, wohin man auch blickte. Allerdings keine Lämmer und Löwen. Oder Menschen oder Straßen. Nicht einmal ein Pfad.
»Es wäre schön«, sagte ich, »wenn du mir helfen könntest, das alles ein bisschen besser zu verstehen.«
»Darauf bin ich spezialisiert – aber ohne das Netzwerk ist es nicht einfach. Wo soll ich anfangen?«
»Stell dir einfach vor, ich wäre ein völlig Fremder.«
Sie blickte in den Himmel, auf die Unheil verkündende Rauchsäule windwärts. In ihren Augen spiegelten sich die Wolken. »Gut«, sagte sie. »Ich erzähle dir alles, was ich weiß. So lange, bis man uns findet.«
Vox wurde von einer Gemeinschaft aus Frauen und Männern errichtet und bevölkert, die glaubten, es sei ihre Bestimmung, zur Erde zu reisen und mit den Hypothetischen in Verbindung zu treten.
Das war vor vier Welten und fünf Jahrhunderten, sagte Treya. Seither verfolgt Vox unerschütterlich seinen Plan. Durchquerte drei Torbögen, schloss vorübergehende Bündnisse, bekämpfte seine Gegner, integrierte neue Gemeinschaften auf neuen, künstlichen Inseln – bis zu seiner gegenwärtigen Form als Vox-Archipel.
Seine Gegner – die »kortikalen Demokratien« – waren der Auffassung, jeder Versuch, die Aufmerksamkeit der Hypothetischen zu erregen, sei nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern grenze an Selbstmord – und das nicht nur für Vox. Diese Meinungsverschiedenheit war zu kriegerischen Auseinandersetzungen eskaliert, und zweimal in den letzten fünfhundert Jahren hatte man Vox nahezu vernichtet. Doch die Bevölkerung von Vox hatte sich als disziplinierter und klüger als ihre Gegner erwiesen – so jedenfalls verstand ich Treya.
Als ihre atemlose Erzählung ein wenig an Tempo verlor, sagte ich: »Wie kam es dazu, dass du mich aus der Wüste geholt hast?«
»Das war von Anfang an geplant, lange bevor ich geboren wurde.«
»Und du wusstest, dass ich da war?«
»Aus Erfahrung und Beobachtung wissen wir, wie sich der ›Körper‹ der Hypothetischen erneuert. Wir haben geologische Beweise, dass sich der Zyklus alle 9875 Jahre wiederholt. Und aus historischen Aufzeichnungen war uns bekannt, dass man in der äquatorianischen Wüste bestimmte Menschen – auch dich – in den Erneuerungszyklus aufgenommen hatte. Was hineingenommen wird, wird auch wieder abgegeben. Das war fast auf die Stunde genau vorhergesagt.« In Treyas Stimme schwang Ehrfurcht. »Du warst bei den Hypothetischen. Und deshalb brauchen wir dich.«
»Mich? Wozu?«
»Der Torbogen, der Äquatoria mit der Erde verbindet, funktioniert schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Seither ist niemand mehr auf der Erde gewesen. Aber wir glauben, dass wir den Übergang schaffen, wenn wir dich und die anderen bei uns haben. Verstehst du?«
Ich verstand es nicht. »Du sagst ›die anderen‹ – welche anderen?«
»Die, die ebenfalls in den Erneuerungszyklus aufgenommen wurden. Du warst dabei, Turk Findley. Du musst ihn gesehen haben, auch wenn du dich nicht erinnerst – den Torbogen, der aus der Wüste wuchs. Er war kleiner als die zwischen den Welten und trotzdem sehr groß.«
Ich erinnerte mich – so wie man sich bei Morgenlicht an einen Albtraum erinnert. Die Erdbeben, die der Bogen verursacht hatte, waren vernichtend gewesen. Maschinen der Hypothetischen aus dem ganzen System waren dafür zusammengezogen worden, wie giftige Asche waren sie vom Himmel gefallen. Er hatte Freunde von mir getötet. Treya nannte ihn einen »temporalen Bogen«, und offenbar spielte er eine bedeutende Rolle im Lebenszyklus der Hypothetischen, aber wir hatten das damals nicht gewusst.
Ich fröstelte – trotz der Wärme und der wohltuenden Medikamente in meinem Kreislauf.
»Er hat dich aufgegriffen«, sagte sie, »und für fast zehntausend Jahre in Stasis gehalten. Und er hat dich kenntlich gemacht, Turk Findley. Die Hypothetischen kennen dich. Daher seid ihr so wichtig – du und die anderen.«
»Wie heißen sie?«
»Ich weiß es nicht. Ich war dir zugewiesen. Wenn das Netzwerk funktionieren würde … aber es schweigt.« Treya zögerte. »Zur Zeit des Angriffs waren sie wahrscheinlich in Vox-Core. Vielleicht bist du der Einzige, der noch lebt. Also muss jemand kommen. Sie kommen, sobald sie können. Sie werden uns finden und nach Hause bringen.«
Das sagte sie, obwohl der Himmel blau und leer blieb.
Am Nachmittag erkundete ich die Umgebung, blieb aber in Sichtweite des Lagers, sammelte Brennmaterial für ein Feuer. Etliche Bäume auf dieser Insel des Vox-Archipels trügen genießbare Früchte, hatte Treya gesagt, also sammelte ich auch davon. Das Brennmaterial bündelte ich mit einer Schnur aus dem Rettungsschiff, und das Obst – gelbe Früchte so groß wie Paprikaschoten – steckte ich in einen Plastiksack. Es tat gut, sich nützlich zu machen. Abgesehen von dem einen oder anderen Vogelruf und dem Rascheln der Blätter hörte ich nur den Rhythmus meines Atmens und das Geräusch meiner Füße im Gras. Die offene, wogende Landschaft hätte das Gemüt beflügeln können, wäre da nicht die Rauchsäule gewesen, die nach wie vor am Horizont stand.
Als ich zum Lager zurückkam, fragte ich Treya, ob bei solchen Angriffen Nuklearwaffen eingesetzt würden und ob wir mit Fallout oder Strahlung rechnen müssten. Davon wusste sie nichts; seit den »Ersten Glaubenskriegen«, über zweihundert Jahre vor ihrer Geburt, habe es keinen thermonuklearen Angriff mehr gegeben.
»Was soll’s«, sagte ich. »Wir können ohnehin nichts dagegen tun. Und es sieht aus, als ob wir den Wind auf unserer Seite hätten.« Die Rauchfahne zeigte jedenfalls nicht in unsere Richtung.
Treya legte die Stirn in Falten, beschattete ihre Augen und spähte windwärts. »Vox ist ein sich bewegendes Schiff«, sagte sie. »Wir halten uns am Heck auf – der Wind müsste den Rauch eigentlich in unsere Richtung blasen.«
»Das heißt?«
»Dass wir möglicherweise steuerlos auf dem Meer treiben.«
Ich hatte keine Ahnung, welche Konsequenzen das hatte (oder wie man sich das Steuer eines Wasserfahrzeugs von der Größe eines Kontinents vorzustellen hatte), aber es bestätigte, dass Vox-Core erhebliche Zerstörungen davongetragen hatte und wir nicht so rasch mit Hilfe rechnen konnten, wie Treya angenommen hatte. Vermutlich war sie zu dem gleichen Schluss gekommen. Sie war niedergeschlagen und wortkarg, half mir aber eine flache Mulde für das Feuer zu graben.
Wir hatten keine Uhr, um die Stunden zu zählen. Ich schlief ein wenig, als die Wirkung der Medikamente nachließ, und als ich aufwachte, berührte die Sonne den Horizont. Es war jetzt kühler. Treya zeigte mir, wie man eines der geborgenen Instrumente benutzte, um das Brennmaterial zu entzünden.
Als das Feuer knisterte, begann ich über unsere Position nachzudenken – das heißt, die Position von Vox relativ zur Küste von Äquatoria. Zu meiner Zeit war Äquatoria ein besiedelter Vorposten auf der Neuen Welt gewesen, jenem Planeten, zu dem man gelangte, wenn man mit dem Schiff von Sumatra aus durch den Torbogen der Hypothetischen fuhr, und sollte Vox unterwegs zur Erde sein, dann hatte man es auf die äquatorianische Seite des Torbogens ausgerichtet. Ich war also nicht sonderlich überrascht, als gleich nach Sonnenuntergang ein Glitzern am dämmrigen Himmel die Spitze des Bogens verriet.
Der Bogen war ein Bauwerk der Hypothetischen und entsprach folglich ihren unvorstellbaren Größenordnungen. Auf der Erde fußte er im Grund des Indischen Ozeans und schwang sich über die irdische Atmosphäre hinaus. Seine äquatorianische Entsprechung war genauso groß und möglicherweise sogar dasselbe Artefakt. Ein Bogen, zwei Welten. Lange nach Sonnenuntergang reflektierte seine Spitze immer noch das Licht: eine silbrige Spur hoch über uns. Zehntausend Jahre hatten nichts daran geändert. Treya blickte unverwandt empor und wisperte etwas in ihrer eigenen Sprache. Als sie fertig war, fragte ich sie, ob das ein Lied oder ein Gebet gewesen sei.
»Vielleicht beides. Du würdest wohl Gedicht dazu sagen.«
»Kannst du es übersetzen?«
»Es handelt von den Zyklen des Himmels, vom Leben der Hypothetischen. Das Gedicht sagt, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt.«
»Davon weiß ich nichts.«
»Ich fürchte, du weißt vieles nicht.«
Ihr Gesicht ließ keinen Zweifel daran, wie unglücklich sie war. Ich sagte ihr, dass ich zwar nicht wisse, was mit Vox-Core passiert sei, aber dass mir ihr Verlust sehr leidtue.
Sie lächelte traurig. »Und mir tut dein Verlust leid.«
Hatte ich denn auch etwas verloren? Ja, sie hatte recht: Ich war unwiderrufliche zehn Jahrtausende von zu Hause entfernt. Ich hatte alles verloren, was mir bekannt und vertraut war.
Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich versucht, eine Wand zwischen mich und meine Vergangenheit zu schieben – vergebens. Manches wird einem genommen, manches lässt man zurück, manches trägt man mit sich. Eine Welt ohne Ende.
Am nächsten Morgen gab mir Treya eine weitere Spritze aus ihrem scheinbar unerschöpflichen Vorrat an Arzneien. Mehr Trost hatte sie nicht anzubieten – ich nahm ihn dankbar entgegen.
5.
»Wenn sie Hilfe losgeschickt hätten, hätte sie mittlerweile hier sein müssen. Wir können nicht ewig warten. Wir müssen zu Fuß gehen.«
Nach Vox-Core, meinte sie. Zur brennenden Hauptstadt ihrer schwimmenden Nation.
»Geht das denn?«
»Ich denke schon.«
»Hier sind alle unsere Vorräte. Und wenn wir nahe bei der Kapsel bleiben, sind wir leichter zu finden.«
»Nein, Turk. Wir müssen in Vox-Core sein, bevor Vox durch den Torbogen fährt. Aber es ist nicht nur das. Das Netzwerk ist immer noch stumm.«
»Ist das so schlimm?«
Ich wusste inzwischen, was es bedeutete, wenn sie die Stirn derart in Falten legte: Sie suchte verzweifelt nach englischen Worten für etwas, was ich nicht kannte. »Das Netzwerk ist nicht nur eine passive Verbindung. Mein Körper und mein Verstand sind teilweise darauf angewiesen.«
»Inwiefern? Du funktionierst doch ganz gut.«
»Die Medikamente, die ich mir verabreiche, helfen. Aber die Wirkung lässt nach. Ich muss unbedingt nach Vox-Core, glaub mir.«
Sie beharrte darauf, und ich war nicht in der Position, mit ihr zu streiten. Vermutlich hatte sie recht, was die Medikamente anging: Heute früh hatte sie zweimal welche geschluckt, und es war nicht zu übersehen, dass sie ihr weniger halfen als tags zuvor. Also schnürten wir so viel Nützliches zusammen, wie wir tragen konnten, und machten uns auf den Weg.
Im Laufe des Morgens fanden wir einen gleichmäßigen Rhythmus. Es gab nichts, woraus man hätte schließen können, dass der Angriff noch im Gange war. (Der Gegner unterhalte keine Stützpunkte auf Äquatoria, sagte Treya, und der Angriff sei ein letzter verzweifelter Versuch gewesen, sie am Übergang zu hindern. Vox habe einen Vergeltungsschlag gestartet, bevor die Verteidigung zusammengebrochen sei, und der leere blaue Himmel sei vermutlich ein Zeichen dafür, dass dieser Gegenschlag seine Wirkung nicht verfehlt hatte.) Das wellige Land legte uns keine Hindernisse in den Weg, und so hielten wir auf die Rauchsäule zu, die noch immer am Horizont stand. Um Mittag erklommen wir einen kleinen Hügel, von wo wir die ganze Insel überblicken konnten: auf drei Seiten Meer und windwärts ein Buckel, der offenbar die nächste Insel in der Kette war.
Doch nichts sprang so ins Auge wie die Türme, die vor uns aus dem Wald ragten: vier fensterlose schwarze Artefakte, um die zwanzig oder dreißig Stockwerke hoch. Die Türme lagen meilenweit auseinander – um nur einen aufzusuchen, hätten wir einen beträchtlichen Umweg machen müssen. Sollte es dort aber Menschen geben, überlegte ich laut, könnten wir sie um Hilfe bitten.
»Nein!« Treya schüttelte energisch den Kopf. »Da sind keine Menschen. Die Türme sind Maschinen, keine Behausungen. Sie sammeln Strahlung aus der Umgebung und pumpen sie nach unten.«
»Nach unten?«
»In den hohlen Teil der Insel, wo die Farmen sind.«
»Eure Farmen sind unterirdisch?« Hier oben gab es eine Menge fruchtbares Land, ganz zu schweigen vom Licht der Sonne.
Nein, sagte sie. Vox sei entworfen worden, um unwirtliche oder wechselnde Umgebungen im Weltenring zu durchfahren. Alle Ringwelten seien bewohnbar, aber die Bedingungen seien von Planet zu Planet völlig andere; die Nahrungsquellen des Archipels müssten gegen wechselnde Tageslängen oder Veränderungen im Ablauf der Jahreszeiten gewappnet sein, gegen heftige Schwankungen von Temperatur, Sonnenlicht oder ultravioletter Strahlung. Auf lange Sicht sei oberirdische Landwirtschaft so unmöglich wie an Deck eines Flugzeugträgers. Der Wald sei hier zwar üppig, aber nur, weil Vox in den letzten hundert Jahren in freundlichem Klima geankert hatte. (»Was sich ändern kann, wenn wir zur Erde überwechseln.«) Ursprünglich seien diese Inseln einmal nackte Platten aus künstlichem Granit gewesen; der Mutterboden habe sich über die Jahrhunderte angesammelt und sei von den verwehten Samen zweier Nachbarwelten kolonisiert worden.
»Können wir denn dort runter? Zu den Farmen?«
»Ja. Aber es wäre nicht klug.«
»Warum? Sind die Farmer gefährlich?«
»Ohne Netzwerk? Gut möglich. Es ist schwer zu erklären, aber das Netzwerk funktioniert auch als soziale Kontrollinstanz. Bevor es nicht wieder repariert ist, sollten wir die weniger Gebildeten meiden.«
»Die Farmleute werden also zu Rüpeln, wenn man sie von der Leine lässt?«
Treya blickte mich beinahe verächtlich an. »Urteile nicht leichtfertig über Dinge, die du nicht verstehst.« Sie rückte ihr Gepäck zurecht und brach das Gespräch ab, indem sie sich ein paar Schritte Vorsprung verschaffte. Ich folgte ihr den Hügel hinunter und zurück in den schattigen Wald. Ich versuchte abzuschätzen, wie wir vorankamen, indem ich mir die relativen Positionen der schwarzen Türme merkte, wann immer wir eine offene Anhöhe überquerten, und kam zu dem Ergebnis, dass das windwärtige Ufer noch ein, zwei Tagesmärsche entfernt war.
Im Laufe des Nachmittags schlug das Wetter um. Schwere Wolken zogen auf, gefolgt von kaltem Wind und Regenschauern. Wir marschierten weiter, bis uns das Tageslicht abhandenkam. Dann suchten wir ein schützendes Wäldchen und spannten im dichten Astwerk eine wasserdichte Plane aus. Es gelang mir, ein kleines Feuer zu entfachen.
Die Nacht brach an, und wir kauerten unter der Plane. Es roch nach brennendem Holz und feuchter Erde. Treya summte vor sich hin, während ich das Essen aufwärmte. Es war dasselbe Lied, das sie in der Flugmaschine gesummt hatte, als wir noch nichts von dem Angriff geahnt hatten. Ich fragte sie noch einmal, wie es kam, dass sie ein zehntausend Jahre altes Lied kannte.
»Es gehörte zu meinem Training. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass es dich stört.«
»Tut es nicht. Ich kenne das Lied. Ich habe es zum ersten Mal in Venezuela gehört, während ich auf meinen nächsten Putzjob auf irgendeinem Tanker wartete. Eine kleine Bar, die amerikanische Songs spielte. Wo hast du es gehört?«
Sie blickte am Feuer vorbei ins Dunkel zwischen den Baumstämmen. »Auf einem Computer in meinem Schlafzimmer«, kam es leise über ihre Lippen. »Meine Eltern waren ausgegangen, also habe ich richtig aufgedreht und getanzt.«
»Wo war das?«
»Champlain.«
»Champlain?«
»New York State. Oben an der kanadischen Grenze.«
»Champlain auf der Erde?«
Sie sah mich befremdet an. Dann riss sie die Augen auf und legte die Hand auf den Mund.
»Treya? Geht es dir gut?«
Offenbar nicht. Sie griff nach ihrem Rucksack, stocherte darin herum, zog den Medikamentenspender heraus und drückte ihn gegen den Unterarm. Dann, als sie wieder normal atmete, sagte sie: »Tut mir leid. Das war ein Fehler. Bitte frag mich nicht nach diesen Dingen.«
»Wenn du mir erzählst, was los ist, kann ich vielleicht helfen.«
»Nicht jetzt.« Sie rollte sich neben dem Feuer zusammen und schloss die Augen.
Als der Morgen anbrach, hatte sich der Regen in Dunst und Nebel verwandelt. Der Wind hatte sich gelegt und uns eine milde Gabe an reifen Früchten gepflückt: ein bequemes Frühstück.
Die Rauchsäule von Vox-Core war in der trüben Suppe nicht zu sehen, aber zwei der finsteren Türme waren so nahe, dass sie uns als Landmarken dienten. Bis zum Vormittag hatte sich der Nebel gelichtet, und bis Mittag hatten sich auch die Wolken verzogen. Wir hörten das Meer.
Treya war redselig, vermutlich weil sie mit irgendwelchen Medikamenten vollgepumpt war. (Sie hatte sich die Ampulle bereits zweimal an den Arm gesetzt.) Offensichtlich benutzte sie diese Mittel als Kompensation für das fehlende »Netzwerk«, was immer das bedeutete. Und genauso offensichtlich war, dass ihr Problem schlimmer wurde. Kaum hatten wir das Lager abgebrochen, begann sie zu reden. Nicht dass wir uns unterhalten hätten, nein, sie hielt einen nervösen, geistesabwesenden Monolog, den ich zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort für einen Kokain-Monolog gehalten hätte. Ich hörte genau hin und unterbrach sie nicht, obwohl die Hälfte davon keinerlei Sinn ergab, und immer, wenn sie für einen Augenblick verstummte, kam mir der Wind in den Bäumen lauter vor.
Sie erzählte, sie sei in einer Arbeiterfamilie im leewärtigen Viertel von Vox-Core zur Welt gekommen. Mutter und Vater seien mit einem »neuralen Interface« ausgerüstet gewesen, das sie befähigte, einige anspruchsvolle Jobs auszuführen wie »Infrastrukturen warten oder neuartige Instrumente implementieren«. Sie gehörten zwar einer niedrigeren Kaste an als die »Manager«, seien aber sehr stolz auf ihre Vielseitigkeit. Treya selbst war von Geburt an dafür ausgebildet worden, sich einer Gruppe von Therapeuten, Wissenschaftlern und Ärzten anzuschließen, deren einzige Aufgabe darin bestand, sich mit den Überlebenden zu befassen, die man in der äquatorianischen Wüste auflas. Als »Verbindungstherapeutin«, die ausschließlich mir zugedacht war (und nicht mehr über mich wusste, als man in den historischen Aufzeichnungen festgehalten hatte: Name und Geburtsdatum und die Tatsache, dass ich in einem »temporalen Torbogen« verschwunden war), musste sie eine Umgangssprache erlernen, wie man sie vor zehntausend Jahren gesprochen hatte.
Sie hatte sie über das Netzwerk gelernt. Doch dieses Netzwerk hatte ihr nicht nur die Sprache, sondern eine komplette zweite Identität vermittelt: einen Komplex an Erinnerungen, nach Dokumenten des 21. Jahrhunderts erstellt und in die interaktiven Netzknoten gespeist, die man ihr gleich nach der Geburt aufs Rückenmark gepfropft hatte. Sie nannte diese zweite Persönlichkeit eine »Impersona« – nicht nur ein Lexikon, sondern ein Leben mit all seinem Kontext an Orten und Menschen, Gedanken und Gefühlen.
Die Hauptquelle, aus der man sich bedient hatte, um Treyas Impersona zu konstruieren, war eine Frau namens Allison Pearl gewesen. Allison war kurz nach dem Spin in Champlain, New York, zur Welt gekommen. Ihr Tagebuch war als historisches Dokument erhalten geblieben, und das Netzwerk hatte daraus Treyas Impersona geschneidert. »Immer, wenn ich ein englisches Wort brauche, ist Allison zur Stelle. Sie hat Wörter geliebt. Sie hat es geliebt, sie aufzuschreiben. Wörter wie ›Orange‹. Eine Frucht, die ich nie gesehen oder geschmeckt habe. Allison liebte Orangen. Was ich von Allison bekomme, ist das Wort und das Bild, die Form und Textur und Farbe einer Orange, nicht der Geschmack oder der Geruch. Doch solche Erinnerungen sind nicht ungefährlich. Man muss auf sie aufpassen. Ohne das Netzwerk und seine neuralen Regeln bildet Allisons Persönlichkeit Metastasen. Ich versuche mich zu erinnern und stoße auf ihre Erinnerungen. Das ist … verwirrend. Und es wird immer schlimmer. Die Medikamente helfen zwar, aber nur eine Zeit lang …«
Das alles und noch mehr erzählte Treya, und soweit ich es beurteilen konnte, schien sie die Wahrheit zu sagen. Ja, ich glaubte ihr. Ich glaubte ihr, weil sie in dieses amerikanische Näseln verfiel und Redewendungen gebrauchte, die unmittelbar aus Allison Pearls Tagebuch hätten stammen können. Es erklärte auch das Lied, das sie fast schon zwanghaft gesummt hatte, ihre zwischenzeitliche Zerstreutheit, die Art, wie sie manchmal ins Leere blickte, den Kopf gereckt, als lausche sie einer Stimme, die ich nicht hören konnte.
»Ich weiß, diese Erinnerungen sind nicht real. Sie sind Produkte aus Netzwerklogik und uralten, aufbereiteten Daten, aber allein so darüber zu reden, kommt einem merkwürdig vor, als … als …«
»Ja?«
Sie drehte sich um und sah mich an. Vielleicht hatte sie eben erst bemerkt, dass sie laut redete. Ich hätte sie nicht unterbrechen sollen.
»… als würde ich nicht hierher gehören. Als wäre das alles irgendeine seltsame Zukunft.« Sie rammte einen Absatz in die feuchte Erde. »Als ob ich hier fremd wäre. So wie du.«
Kurz vor Sonnenuntergang erreichten wir den Rand der Insel. Rand,nicht Ufer.Hier sprang einem sofort ins Auge, dass die Insel ein künstliches Konstrukt war. Der Wald wich einem nahezu senkrechten, gut hundert Meter tiefen Steilhang aus nacktem Fels. Etwa achthundert Meter entfernt war die nächste Insel des Archipels zu erkennen. »Schade, dass es keine Brücke gibt«, sagte ich.
»Gibt es«, erwiderte Treya. »Eine Art Brücke. Wir müssten sie eigentlich sehen können.«
Sie legte sich auf den Bauch, robbte an den Rand des Steilhangs und gab mir mit einem Wink zu verstehen, das Gleiche zu tun. Nicht dass ich Höhenangst hatte – in der Welt vor dieser Welt hatte ich meine Brötchen als Pilot verdient –, aber meine Nase über diese senkrechte Wand zu schieben, gehörte wahrlich nicht zu den angenehmsten Momenten meines Lebens. »Da unten«, sagte Treya und deutete mit dem Finger. »Siehst du sie?«
Die Meerenge zwischen den Inseln lag bereits im Dunkeln. Seevögel nisteten, wo Jahrhunderte aus Wind und Regen Vertiefungen in den harten, künstlichen Fels geschnitzt hatten. Weit links war zu sehen, was sie meinte. Eine Tunnelröhre verband die Inseln, wobei nur das andere Ende an der dortigen Steilwand zu erkennen war. Die Röhre war ein salzverkrusteter, dunkler Schemen, so dunkel wie die See darunter. Schwindelgefühl und ungünstige Perspektive machten es schwer, ihre wahren Dimensionen abzuschätzen, aber ich hätte gewettet, dass darin ein Dutzend Trucks nebeneinander von einem Ende bis zum anderen hätten fahren können, ohne sich in die Quere zu kommen. Und doch gab es weder Taue, Stahlseile oder Träger – irgendwie brachte dieses Bauwerk es fertig, sich selbst zu tragen. Jede Insel im Archipel verfügte über ein eigenes Antriebssystem, das zentral, also von Vox-Core aus, gesteuert wurde; trotzdem musste die Verbindung zwischen diesen gewaltigen, schwimmenden Massen enorme Torsionskräfte hervorrufen, auch wenn der Tunnel nur einen Bruchteil davon abbekam.
»Automatische Frachtschlitten transportieren die rohe Biomasse durch den Tunnel nach Vox-Core und die Raffinade zurück zu den Farmern«, sagte Treya. »Der Tunnel ist nicht für Fußgänger gedacht, aber das soll uns nicht kümmern.«
»Wie kommen wir hinein?«
»Überhaupt nicht. Dazu müssten wir zu den unterirdischen Verladestationen. Wir müssen darüberlaufen.«
Ich sah sie skeptisch an.
»Es gibt eine Treppe in der Steilwand«, fuhr sie fort. »Man kann sie von hier aus nicht sehen. Die Stufen wurden während der Bauarbeiten aus dem Granit geschnitten und sind wahrscheinlich etwas erodiert. Das wird kein Spaziergang.«
»Aber die Oberfläche des Tunnels ist gewölbt und sieht ziemlich glitschig aus.«
»Womöglich ist sie breiter, als du denkst.«
»Oder auch nicht.«
»Wir haben keine Wahl.«
Doch für heute war es zu spät für ein so zeitraubendes Unterfangen; knapp zwei Stunden Tageslicht würden nicht reichen.
Wir zogen uns ein Stück in den Wald zurück und schlugen unser Nachtlager auf. Ich sah, wie Treya sich einen weiteren Schuss setzte. »Das Ding wird wohl nie leer?«