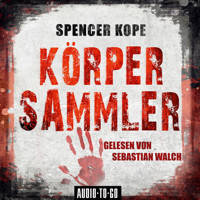4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Agent Magnus Craig
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein perfider Serienkiller, brutale Morde und ein Ermittler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten
Der FBI-Agent Magnus Craig hat eine ganz besondere Gabe: Er kann am Tatort erkennen, wohin eine Person gegangen ist und was sie berührt hat. Für ihn ist diese Nähe zu den Opfern zwar manchmal ein Fluch - aber bei seiner Arbeit bei der STU (Special Tracking Unit) ist diese Fähigkeit von unschätzbarem Wert. Als Magnus und sein Team einen Serienmörder im Norden Kaliforniens jagen, finden sie sich in einem gefährlichen Katz-und-Mausspiel mit einem brutalen Mörder wieder, der vor nichts zurückschreckt ...
»Kope überrascht uns mit einem eigenwilligen Ermittler mit düsterem Geheimnis, der eine willkommene Bereicherung der aktuellen Spannungsliteratur darstellt.« Publishers Weekly
»Ein einfallsreicher, fesselnder Thriller, von einem Experten des Verbrechens - einem Profiler.« The Boston Globe
Leserstimmen:
»Spencer Kope hat mit diesem besonderen Ermittler, bzw. seiner ganz eigenen Begabung hier eine neue Art Thriller erschaffen.« (claudi-1963, Lesejury)
»Eine faszinierende und originelle Idee, kein Thriller im üblichen Stil. Fortsetzung erwünscht.« (Sanne, Lesejury)
»Seine [Spencer Kopes] Beschreibungen von Tatorten und Opfern lassen einem das Blut in den Adern erfrieren.« (ElisaMorti, Lesejury)
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungDanksagung12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334EpilogÜber dieses Buch
Ein perfider Serienkiller, brutale Morde und ein Ermittler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten
Der FBI-Agent Magnus »Steps« Craig hat eine ganz besondere Gabe: Er kann am Tatort erkennen, wohin eine Person gegangen ist und was sie berührt hat. Für ihn ist diese Nähe zu den Opfern zwar manchmal ein Fluch – aber bei seiner Arbeit bei der STU (Special Tracking Unit) ist diese Fähigkeit von unschätzbarem Wert. Als Steps und sein Team einen Serienmörder im Norden Kaliforniens jagen, finden sie sich in einem gefährlichen Katz-und-Mausspiel mit einem brutalen Mörder wieder, der vor nichts zurückschreckt …
Über den Autor
Spencer Kope, geboren in Bellingham/Washington, studierte Russisch und arbeitete lange Zeit für die Navy. Er reiste zwei Jahre lang durch Spanien, England, Pakistan, Marokko und lebte ein Jahr in der Türkei. Seit einigen Jahren arbeitet er in der Abteilung »Crime Analyse«, was ihm Ideen und gute Dialoge für neue Krimis und Thriller liefert.
SPENCER KOPE
KÖRPERSAMMLER
Aus dem amerikanischen Englisch von Michael Krug
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Spencer Kope
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Collecting the Dead
Originalverlag: Minotaur Books, New York
COLLECTING THE DEAD
Copyright © Spencer Kope
Published by arrangement with St. Martin´s Press, LLC. All rights reserved.
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press LLC durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: Körpersammler
Übersetzung: Michael Krug
Textredaktion: Natalie Röllig
Lektorat/Projektmanagement: Anne Pias
Covergestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: llaszlo | gordan | Mirinae | Apostle
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5117-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Widmung
Dieses Buch ist den äußerst seltenen Menschen unter uns gewidmet, den Männern und Frauen, die ständig mit Gefahren konfrontiert sind, die verflucht, angespuckt, verurteilt und angegriffen werden – und dennoch bereit sind, solche Konsequenzen in Kauf zu nehmen.
Sie sind die Hüter der zivilisierten Gesellschaft, die sich der Angst stellen, damit es andere nicht tun müssen, die vorpreschen, wenn andere die Flucht ergreifen, und die zu oft das ultimative Opfer bringen, damit andere weiterleben können.
Sie schützen Eigentum, das nicht ihnen gehört, suchen Vermisste, trösten Trauernde, bergen Leichen, stellen sich vor Misshandelte und lassen Getöteten und Geschändeten Gerechtigkeit widerfahren.
Ihre Arbeit führt sie mitten hinein ins Zentrum des Elends, wo sie unter den Verdammten wandeln, und doch haben sie irgendwie ein Lächeln für ihre Partner und Kinder übrig, wenn sie nach Hause kommen.
Für diejenigen, die sich am meisten aufopfern.
Für diejenigen, die schützen und dienen.
Danksagung
Besonderer Dank ergeht zunächst an die drei begabten Menschen, die diesem Buch geholfen haben, das Licht der Welt zu erblicken: an meinen Lektor Keith Kahla, meine Redaktionsassistentin Hannah Braaten und meine tolle Agentin Kimberley Cameron. Ihr Talent und ihre Hingabe kennen keine Grenzen, und ich bin ihnen unendlich dankbar für alles, was sie getan haben.
Besonderer Dank gilt auch meinem inoffiziellen Team von Lektoren und Erstlesern vom Büro des Sheriffs von Whatcom County: Cheryl Café, Kristin Lunderville, Nickee Norris-Oaks, Altavia Chatman, Al Cheesman, Wendy Jones und Stephanie Sturlaugson.
Und Detective Kevin Bowhay und Special Agent Thom LeCompte, die mir jede Menge Informationen und grenzenlose Nahrung für meine Fantasie geliefert haben. Man weiß, dass man einen wahren Freund hat, wenn man ihn am Wochenende anrufen kann, um seine Meinung darüber einzuholen, wie übel eine Leiche nach vier Monaten im Wald riecht. Nur so am Rande bemerkt.
Und schließlich einen besonderen Dank an meine Frau Lea und meine Töchter Mary, Katie und Abby, die mich von Beginn an auf dieser Reise begleitet haben.
1
15. Juni, 10:12 Uhr
Sie hatte kleine Füße.
Ich sage bewusst, dass sie kleine Füße hatte. Zu sagen, sie hat kleine Füße, würde andeuten, dass sie noch lebt. Was sie nicht tut. Ich weiß es. Ich weiß es immer. Das ist meine besondere Fähigkeit, meine Bürde, mein Fluch. Die anderen denken, dass wir nach einer vermissten Joggerin suchen, die sich vielleicht verletzt oder verirrt hat, aber bestimmt noch lebt. Ich kann ihnen nicht sagen, dass wir zu spät kommen – wie sollte ich ein solches Wissen erklären?
Sie würden mir ohnehin nicht glauben.
Es widerstrebt den Menschen, die Toten aufzugeben.
Ich drehe den Schuh in der Hand, betrachte ihn aus jedem Winkel. Er wurde bereits vor meiner Ankunft willkürlich aus ihrem Kleiderschrank ausgewählt, die übliche Vorgehensweise bei einer solchen Spur. Eingehend untersuche ich den Verschleiß der Sohle, die Einkerbungen im Leder, die Anzeichen von Belastung am Riemen, als wolle ich dadurch das Geheimnis entschlüsseln, wie sie gegangen, wie sie aufgetreten ist, wie sie manchmal den linken Fuß fast unmerklich hinter sich her geschleift hat.
In meiner Branche lernt man so einiges über Schuhe – Damenschuhe, Herrenschuhe und leider auch Kinderschuhe. Bei diesem Exemplar handelt es sich um einen Pumps mit Knöchelriemen und siebeneinhalb Zentimeter hohem Absatz, Obermaterial Leder. Kein Spitzenerzeugnis, trotzdem schön. Ich weiß, dass sie den Schuh vor ungefähr zwei Wochen zuletzt getragen hat … aber das wird nicht in meinem Bericht erscheinen.
»Können Sie ihrer Spur folgen?«, fragt Sergeant Anderson.
Ich nicke, erwidere jedoch nichts. Für mein Publikum, das mittlerweile aus vier Deputys, einem Dutzend Freiwilliger für die Such- und Rettungsaktion und meinem Partner besteht, FBI Special Agent Jimmy Donovan, tue ich so, als würde ich den Schuh weiter untersuchen. Die Wahrheit ist, dass ich nicht wissen muss, wie sie gelaufen ist, welche Gangart sie hatte oder ob sie eher den Fußballen oder die Ferse belastet hat. Aber die Illusion muss aufrechterhalten werden.
Newsweek hat mich mal als den menschlichen Bluthund bezeichnet. Ich bin sicher, das hat genau das Bild heraufbeschworen, das man von mir zeichnen wollte, so falsch es auch war. Wenn die nur wüssten. Wenn die nur sehen könnten, was für ein Schwindler ich bin.
»Sie haben gesagt, ihr Mann hat sie als vermisst gemeldet?«, wende ich mich an den Sergeant.
»Gestern Nacht«, antwortet Anderson. »Ihm zufolge ist sie nach der Arbeit laufen gegangen, wie sie es immer tut, und nie zurückgekommen. Das war irgendwann nach 17:00 Uhr.«
»Und sie könnte nirgendwo anders hingegangen sein? Keine anderen Strecken, auf denen sie läuft?«
»Nicht, dass der Ehemann wüsste. Sie ist immer vorwiegend in der Nähe ihres Zuhauses geblieben.«
»Wo ist er? Der Ehemann.«
»Im Haus. Er ruht sich aus.«
»Er ruht sich aus?«
»Ja, er ist die Strecke gestern Nacht viermal abgegangen und hat nach ihr gesucht, bevor er Meldung erstattet hat.«
»Viermal?«
»Genau. Und heute Morgen ist er den Weg mit uns noch mal entlanggegangen.«
Ich nehme meine Brille ab und verstaue sie im Lederetui, dann stehe ich einen Moment lang da und betrachte die Rückseite von Ann Buergers bescheidenem, zweigeschossigem Haus. Mein Blick folgt ihren Schritten durch die Hintertür hinaus über den Rasen zu dem Trampelpfad aus Erde und Schotter vor meinen Füßen. Die Schritte führen nach Norden, und die Abstände vergrößern sich innerhalb der ersten zwanzig Meter von normalem Gehen zu einem gleichmäßigen Traben.
»Die Strecke ist ein knapp fünf Kilometer langer Rundweg«, erklärt mir Anderson, »obwohl man nach den ersten anderthalb Kilometern abzweigen und die Abkürzung zurück nehmen kann, bevor der Weg zum Bowman Summit hin ansteigt. Die Such- und Rettungsmannschaft ist den ganzen Weg dreimal abgelaufen.« Er hebt das Kinn und deutet damit auf besagte Such- und Rettungsmannschaft. »Auch die Abkürzung ist überprüft worden. Keine Spur von ihr.«
Ich nicke. »Dann lassen Sie es uns Schritt für Schritt angehen.«
Der Pfad verläuft anfangs flach entlang des Westrands von Crest View, einer aus siebenundneunzig Einfamilienhäusern bestehenden Gemeinde knapp fünfzig Kilometer westlich von Portland und unmittelbar nordwestlich des Henry-Hagg-Sees. Die Gebäude sind eine willkürliche Mischung aus Landhäusern, Häusern im Kolonialstil und gelegentlich einem Terrassenhaus. Die Gegend gilt in diesem Teil von Oregon als gehoben, die Rasen sind ausnahmslos penibel gepflegt und die Gehwege sauber. In jeder Hinsicht ein schönes Wohngebiet.
Jimmy und ich gehen voraus und legen ein forsches Tempo vor. Der einfache Pfad um Crest View herum mutiert schon bald zu einer steten Steigung, die einem heimtückisch die Luft aus der Lunge saugt. Nach den ersten anderthalb Kilometern mit zehn Grad Steigung atme ich schwer und werde stinksauer auf Jimmy, der die Titelmelodie von Mission Impossible vor sich hin pfeift und dabei aussieht, als fühle er sich pudelwohl. Es ist nicht so, dass ich in schlechter Form wäre. Ich kann auch fünfzehn Kilometer laufen, wenn’s sein muss. Nur mache ich das lieber in Etappen zu einem Kilometer mit vierundzwanzigstündigen Pausen dazwischen.
Ich drehe mich um und winke Sergeant Anderson vom hinteren Ende des Trosses nach vorn. Er sieht aus, als verbringe er beträchtliche Zeit damit, sich im Büro über Donuts herzumachen, und im Augenblick brauche ich einen Anker, um Jimmy abzubremsen. Der Sergeant schnauft ziemlich heftig, als er uns erreicht, und ich bleibe stehen, um ihn zu Atem kommen zu lassen. Mission Impossible wird langsamer und leiser und verstummt schließlich ganz.
»Was ist?«, fragt Jimmy.
»Nur eine kleine Verschnaufpause«, behaupte ich beiläufig und lege leicht den Kopf schief, um Andersons verschwitztes Gesicht zu betrachten. Dabei versuche ich, mir die Anstrengung nicht anmerken zu lassen.
Jimmy nickt und trinkt einen Schluck Wasser aus seiner CamelBak-Flasche. Dann fragt er Anderson: »Wie ist der Gipfel?«
»Ich weiß, was Sie denken.« Der Sergeant keucht und nickt mit dem Kopf, als hätte er auf die Frage nur gewartet. »Wir haben über den Rand geschaut und konnten keine Anzeichen finden, dass jemand abgestürzt ist.« Er ringt nach Luft, weil er zu schnell geredet hat. »Es ist auch kein steiler Abgrund. Falls sie also wirklich den Halt verloren hätte und runtergestürzt wäre« – ein Japsen – »hätte sie Furchen in der Erde hinterlassen, Wurzeln ausgerissen, irgendetwas in der Art.« Japs, keuch, schnauf. »Außerdem ist der Weg breit genug, dass sie nie in die Nähe des Rands kommen musste.«
»Wenn es kein steiler Abhang ist, dann kann man den Boden vom Gipfel aus wohl nicht besonders gut sehen, richtig?«
»Nur, wenn man sich ein Stück weit abseilt.«
»Hat das jemand gemacht?« Jimmy trinkt einen weiteren Schluck aus der CamelBak-Flasche, diesmal einen größeren, dann verstaut er sie wieder.
»Scott Johnson und Marty Horvath«, antwortet Anderson und wischt sich die Stirn und den Hals mit einem schmutzigen elfenbeinfarbenen Taschentuch ab. Dann stopft er das feuchte Tuch zurück in seine Gesäßtasche, dreht sich um und lässt den Blick rasch über die Gesichter hinter uns wandern. Schließlich zeigt er auf zwei der jüngeren und athletischeren Mitglieder der Suchmannschaft am hinteren Ende des Trosses. »Das sind sie. Scott ist der Dünne rechts. Die wissen beide, wie man sich abseilt, und konnten’s kaum erwarten, damit loszulegen. Die Trottel wollten in der Dunkelheit anfangen, aber ich habe sie bis zum ersten Tageslicht heute Morgen warten lassen. Sie haben sich ziemlich genau umgesehen, aber nichts gefunden. Natürlich erstreckt sich der Gipfel auch über gut und gern vierhundert Meter.«
»Wie hoch ist er?«, erkundigt sich Jimmy. Allerdings vermittelt er nicht den Eindruck, als würde ihn die Antwort wirklich interessieren. Und er sieht weder den Weg noch mich oder Sergeant Anderson an. Sein Blick wandert vom krummen Stamm eines entstellten Baums zu einem schnatternden Eichhörnchen, das von einem nahen Ast eine Warnung ruft, dann weiter zu einem rotschwänzigen Falken, der in der Höhe kreist und sich vor dem graublauen Himmel abzeichnet, an dem die Sonne langsam auf Mittag zukriecht.
Jimmy ist ein erfahrener Wanderer. Außerdem kann er ziemlich gut Fährten lesen. Ich weiß nicht, was ihn an der Wildnis fasziniert: die Hügel, die Wildpfade, die abgeschiedenen Seen in schwer zugänglichen Tälern. Ich glaube, er weiß es selbst nicht, jedenfalls nicht wirklich. Aber man sieht es ihm bei jeder Gelegenheit an den Augen an und hört es in seiner Stimme: Er liebt den Wald.
Ich hingegen hasse ihn.
Jedes Mal, wenn wir in der Wildnis unterwegs sind, scheint es wegen einer Leiche zu sein. Angefangen hat es mit vermissten Jägern, die den Elementen erlegen waren, und außer Form geratenen Wanderern, die ihren Herzen zu viel zugemutet hatten. Neuerdings sind es vorwiegend Mordopfer und verdächtige Todesfälle. Aber nicht das ist es, was mich stört. Der Wald und ich haben eine Vorgeschichte. Und keine der guten Art.
Ich habe mich schon oft gefragt, ob ich vielleicht die Zielscheibe irgendeines kosmischen Scherzes bin. Warum sonst sollte Gott einen Jungen, dessen Lieblingsspruch »Kumpel, pfeif aufs Zelten« lautete, zum weltbesten Fährtensucher machen – und nicht einmal zu einem echten Fährtensucher, sondern zu jemandem, der so tun muss, als wäre er einer?
Jimmy sagt, er würde es nicht tun.
Aber wir leben beide mit der Lüge, Jimmy und ich. Die Wahrheit ist ein tief verborgenes Geheimnis, das nur deshalb gewahrt bleibt, weil es für die meisten Menschen zu schwer zu glauben wäre. Es ist mein Leben, und sogar ich habe meine liebe Not damit.
Gott hegt eine Hassliebe für mich.
Auf das Wort bin ich gekommen, als ich fünfzehn war, nicht recht entscheiden konnte, ob mich Gott liebt oder hasst, und mich letztlich auf beides geeinigt habe. Hassliebe. Ich mag den Begriff; es ist irgendwie schizophren. Als ich älter wurde, erkannte ich jedoch, dass mich Gott nicht wirklich hasst – jedenfalls nicht allzu sehr – und dass meine spezielle Fähigkeit als Fährtensucher in Wirklichkeit ein Geschenk ist. Zwar ein Geschenk so ähnlich wie das hübsche Pferd, das die Griechen den Trojanern zurückgelassen haben, aber immerhin.
Und nun bin ich wieder mal im Wald gelandet. Es ist die dritte Fährte diese Woche. Die anderen zwei waren einfach und innerhalb von wenigen Stunden abgehandelt. Eine war am Stadtrand von Atlanta. Im Gebüsch neben einem Spielplatz hatte man die Leiche eines erstochenen und verprügelten Dreiundzwanzigjährigen gefunden. Die Spur war klar und deutlich und hat uns zum Haus einer Gang nur drei Blocks entfernt geführt. Es war verblüffend, wie schnell sich die Gangmitglieder gegeneinander gewandt haben, als die Ermittler anfingen, von Mordanklagen zu reden.
Die andere Spur befand sich in den baufälligen Ruinen des alten Detroit. Die Polizei dachte, das Opfer dort wäre zu Tode geprügelt worden. Aber wie sich herausstellte, war der Mann stattdessen vom Dach eines verlassenen Lagerhauses gefallen, auf dem Weg nach unten gegen mehrere Hindernisse geprallt und mitten in der Gasse gelandet. Ein hoher Preis für gestohlenes Kupfer im Wert von ein paar Dollar.
Alles in allem ist es bisher eine einfache Woche gewesen. Keine Bäume. Keine Wälder. Kein Ansturm von Stechmücken, Zecken, Fliegen, Spinnen und Schnaken.
Diesmal werde ich nicht so viel Glück haben.
Als wir uns langsam wieder in Bewegung setzen, sagt Anderson: »Also … Steps, ja? Wie sind Sie an so einen ausgefallenen Spitznamen geraten?«
Sofort kommen mir verschiedene Erwiderungen in den Sinn, aber Jimmy sagt mir immer wieder, dass ich reizbar werde, wenn wir im Wald sind, und dass ich mich entspannen und freundlich sein muss. Er meint, ich solle darüber nachdenken, was ich sage, bevor die Worte meinen Mund verlassen … und ich dachte eigentlich, das täte ich ohnehin.
Bevor er zum FBI gegangen ist, hat er seinen Abschluss in Psychologie gemacht.
Was zum Teufel weiß er schon?
»Mein richtiger Name ist Magnus Craig«, kläre ich Anderson auf. »Aber seit ich ungefähr vierzehn war, nennen mich alle Steps, sogar meine Mutter. In dem Sommer war ich bei meiner ersten Such- und Rettungsaktion dabei.«
»Verschwundener Wanderer?«
»Schlimmer. Zwei Jungen im Alter von fünf und acht. Sie waren von einem Zeltplatz ausgebüxt, und als ich aufgekreuzt bin, wurde es bereits finster. Jemand hat gefragt: ›Wie willst du die Jungen in der Dunkelheit aufspüren?‹ Und ich hab nur erwidert: ›Schritt für Schritt‹. Dreißig Minuten später habe ich die Jungen aneinandergekuschelt in einem hohlen, moosbewachsenen Baumstumpf entdeckt. Zu Tode verängstigt, aber abgesehen davon unversehrt.«
Ich halte an und kauere mich auf dem Weg hin, bringe hinter mir den gesamten Tross zum Stehen. Mein Blick tänzelt über nicht vorhandene Spuren auf dem Boden. Ich täusche neugieriges Interesse an imaginären Anzeichen vor, dass die Frau hier vorbeigekommen ist. Der Anschein, halte ich mir vor Augen. Ich muss immer den Anschein wahren. Eigentlich ist es ja ganz einfach: ab und an eine Pause, gelegentlich ein verwirrter Blick, Finger, die durch die Luft wirbeln, als ob sie dabei helfen, die Spur zu »lesen«. Der Anschein. Das habe ich auf die harte Tour gelernt.
Ich richte mich auf und gehe weiter. Die Kolonne hinter mir setzt sich schwerfällig in Bewegung. »Als wir den Zeltplatz in der Nacht erreicht haben«, erzähle ich Anderson, »meinten alle, es wäre, als könnte ich die Schritte der Jungen auf dem Boden abgedruckt sehen. Verrückt, oder? Dann hat mir einer der Deputys eine Flasche Wasser zugeworfen und gesagt: ›Schritt für Schritt, was? Tja, dann auf den Steps.‹ Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, hat es bei einer solchen Gruppe nicht lange gedauert, bis mich alle nur noch Steps genannt haben.«
Ich verzichte darauf, Sergeant Anderson zu erzählen, dass ich zu dem Zeitpunkt kein Mitglied der Such- und Rettungsmannschaft war, sondern mich mein Vater zum Zeltplatz gebracht hat, nachdem er von den verschwundenen Jungen gehört hatte. Er kannte meine spezielle Fähigkeit und wusste, dass ich helfen könnte. Jetzt, Jahre später, gibt es drei Menschen, die mein Geheimnis kennen: Dad, Jimmy und FBI-Direktor Robert Carlson.
»Wie lange sind Sie schon bei der Special Tracking Unit des FBI?«, fragt Anderson.
»Mittlerweile fünf Jahre. Seit die STU gegründet wurde.«
»Ich wette, Sie helfen einer Menge Menschen«, meint er. Ich höre Bewunderung in seinen Worten, erwidere aber nichts darauf. Im Schnitt habe ich zweieinhalb Einsätze pro Woche, und neuerdings ruft man mich nicht mehr zu den einfachen Fällen. Es ist immer etwas Ungewöhnliches, Unerklärliches oder Unheilvolles dabei, was bedeutet, dass sich die Leichen ziemlich schnell häufen.
Eine Diavorführung toter Gesichter beginnt unaufgefordert und unerwünscht vor meinem geistigen Auge abzulaufen. Ich dränge sie zurück und ersetze sie durch die Bilder der lächelnden Lebenden … aber sie sind in der Unterzahl, und schon bald tauchen die Gesichter der Leichen, die toten Augen und klaffenden Münder wieder auf.
Helfen?, geht es mir durch den Kopf. Neuerdings nicht mehr so sehr. Ich bin bloß der Vorreiter des Leichenbestatters.
Der Bowman Summit erweist sich als genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe: ein hoher, schmutziger Grat, im Osten von einem sanften Hang mit Bäumen gesäumt, großzügig gesprenkelt mit kantigem, aus der Erde ragendem Sedimentgestein; und im Westen von einem halbmondförmigen Abhang begrenzt, der zum Waldboden in sechzig Metern Tiefe hin abfällt. Durch und durch scheußlich!
»Also, das nenne ich mal eine atemberaubende Aussicht«, meint Jimmy, als er neben mich tritt.
Blödmann.
Ich liebe ihn wie einen Bruder, ehrlich. Er lacht gern und ist immer der Erste, der einer üblen Situation noch etwas Gutes abgewinnen kann. Aber manchmal …
»Komm schon, Steps«, sagt Jimmy und täuscht an, mir in die Nieren zu boxen. »Sogar du musst zugeben, dass die Aussicht umwerfend ist. Wie der Nebel zwischen den Bäumen hängt …«
Ich strecke den Zeigefinger meiner rechten Hand in die Luft. Jimmy weiß, was das bedeutet. Wir haben eine unumstößliche Regel: Wenn wir im Wald sind, reden wir nicht über den Wald.
Er verleugnet, dass ich an Hylophobie leide, der unbegründeten Angst vor Wäldern. Ich halte dem entgegen, dass insbesondere ich wissen sollte, ob ich unbegründete Angst vor Wäldern habe oder nicht. Aber dass ich unterwegs auf dem Pfad keinen totalen Zusammenbruch erlitten habe, beweist für Jimmy anscheinend, dass ich sie nicht habe.
Abschluss in Psychologie.
»Hör auf damit, Jimmy!«, blaffe ich und bleibe unvermittelt auf dem Weg stehen. Die Arme strecke ich aus, als wolle ich die von hinten Nachrückenden zurückhalten.
Der Wegabschnitt vor mir unterscheidet sich kaum vom Rest des Gipfels, aber in ihn ist für immer der letzte Absatz auf der letzten Seite des letzten Kapitels von Ann Buergers Leben eingebrannt. Ich sehe ihn so deutlich, wie ich Jimmy neben mir stehen sehe, obwohl es kaum physische Beweise dafür gibt.
Ein außergewöhnlicher Fährtensucher würde einen Teil davon sehen.
Ich sehe alles.
Ein Zittern durchläuft meinen Körper, als aus dem Süden eine warme Brise aufkommt.
* * *
Man verirrt sich nicht auf einer fünf Kilometer langen Rundstrecke, die quasi durch den eigenen Garten führt, einer Strecke, über die man Hunderte Male gegangen oder gelaufen ist. Das kommt einfach nicht vor. Ich wusste nichts über die Einzelheiten der Suche, als mich um 6:23 Uhr an diesem Morgen der Anruf erreichte. Schon um 7:30 Uhr rollten wir am Bellingham International Airport aus Hangar 7 und brachen an Bord des Gulfstream G100 Privatjets der STU südwärts nach Portland auf.
Hangar 7 ist sowohl der Hangar für den Jet als auch eine unscheinbare sichere Einrichtung, von der aus die Special Tracking Unit operiert. Der offene Bereich ist groß genug für die fast siebzehn Meter Flügelspannweite der Gulfstream. Hinten ist noch genug Platz für eine zweigeschossige Büroreihe.
Unten links befindet sich ein gemütlicher Pausenraum mit einem 60-Zoll-LCD-Fernseher an der Wand, mehreren Stühlen und einer Couch, die sich zum Schlafen eignet, was ich aus persönlicher Erfahrung bezeugen kann. In der Mitte beherbergt ein Küchenbereich einen vollwertigen Kühlschrank mit Eis- und Wasserspender, ein Spülbecken, einen Geschirrspüler und reichlich Arbeitsfläche sowie Schränke. Rechts schließt unser Besprechungsraum an, schallgedämmt verglast und mit einem langen, zweifellos sauteuren Mahagoni-Schreibtisch in der Mitte. Um den Tisch reihen sich zu weich gepolsterte, zu bequeme Stühle.
Der Raum wird nicht oft benutzt.
Aber die Drehstühle sind gut geölt, und Jimmy und ich drehen uns gern darauf, so schnell wir können, um herauszufinden, wem von uns als Erstem schlecht wird. Wir sind Profis.
Das zweite Geschoss ist weniger kompliziert aufgebaut: Jimmys Büro ist rechts, meines links, und in der Mitte eingepfercht befindet sich das von Diane Parker, der Armen.
Diane ist unsere »Informationsanalystin«, was im Wesentlichen bedeutet, sie verkörpert eine wandelnde Enzyklopädie nützlicher und nutzloser Informationen, Sekretärin, Aufzeichnungsspezialistin, Computertechnikerin und Reisemittlerin in Personalunion. Außerdem ist sie die Einzige, die mit der Müllbeseitigung in der Küche klarkommt.
Diane ist die Puzzlemeisterin, diejenige, die Datenbanken durchwühlt, die fehlenden Teile findet und sie richtig anordnet, um eine durchgehende Geschichte zu erzählen. Bei diesem Fall brauchen wir sie nicht. Die Geschichte ist einfach zu lesen.
»Er hat sich da drüben versteckt.« Ich zeige auf die rechte Seite des Wegs. »Hinter dem Felsvorsprung bei diesen Büschen da. Er hat gewartet, der Mistkerl! Gewartet, bis sie fast an ihm vorbei war. Dann hat er sie angegriffen. Vielleicht hat sie ihn aus dem Augenwinkel gesehen, vielleicht auch nicht. Er hat gewusst, dass sie Kopfhörer tragen und ihn nicht kommen hören würde, bis es zu spät wäre.« Ich bleibe auf dem Weg stehen. »Ihre Schritte enden hier.«
»Wa… Hat er sie entführt?«, stößt Sergeant Anderson atemlos hervor.
Jimmy weiß Bescheid. Sein Blick sucht bereits den Rand des Gipfels ab.
»Er hat sie geschubst«, entgegne ich. »So kräftig, dass sie zwei bis zweieinhalb Meter durch die Luft gesegelt ist. Und dann war sie bereits über dem Abgrund.« Ich gehe zu Jimmy hinüber und zeige nach unten. »Ihre linke Hand ist zuerst gelandet. Sie hat versucht, sich an dieser Wurzel festzuhalten, aber sie hatte zu viel Schwung drauf.« Ich schüttle ein Zittern ab und fahre mit leiserer Stimme fort. »Sie hat verbissen darum gekämpft, Halt zu finden, hat versucht, die Finger in die Erde zu krallen, sich mit den Füßen festgekeilt …« Meine Stimme verliert sich mitten im Satz, als mein Blick Anns Weg folgt, bis er im Abgrund verschwindet. Unwillkürlich und traurig schnappe ich nach Luft. Ich habe die Frau nicht gekannt, aber sie hat etwas Besseres verdient. Nicht das.
Der Fuß des Bowman Summit erweist sich als karges Geröllfeld aus Material, das sich über Generationen, Jahrhunderte und Jahrtausende vom Berg gelöst hat, vorwiegend das Ergebnis von Hangrutschen und Erosion. Dort ist das Geröll ungefähr zweieinhalb bis drei Meter tief, und etwa sechs Meter vom Hang entfernt beginnt es, steil anzusteigen.
Eine Heerschar von Bäumen bevölkert das Tal, genährt von einem Geflecht kleiner Bäche, die sich zweifellos in den mehrere Kilometer entfernten Henry-Hagg-See ergießen. Der breiteste der Bäche verläuft keine dreißig Meter vom Fuß des Gipfels und bietet klares, kühles Wasser, das man sich ins verschwitzte Gesicht spritzen kann. An diesem Tag herrscht Stille im Wald. In der Umgebung kann man zwar durchaus Vögel erkennen, aber sie zwitschern kaum, und sogar das Gurgeln der Bäche klingt gedämpft.
Dort wartet sie auf uns, gebrochen und still, ausgestreckt auf dem Boden liegend. Die Augen starren blicklos in den Himmel, die Beine sind seltsam verdreht. Ann Buerger. Zwei Stunden beschwerlicher Wege, geführt von einem Navigationssystem, und das ist unser Lohn.
Ich habe es gründlich satt, Tote einzusammeln.
Ihre Gesichter starren mich aus der Diavorführung in meinem Geist an, als wollten sie mich fragen: »Warum hast du mich nicht gerettet?« Obwohl sie schon längst tot waren, bevor ich auch nur ihre Namen kannte.
Ich spüre Jimmys Hand auf der Schulter, als ich neben der Leiche knie. »Wir retten diejenigen, die wir retten können«, sagt er leise. Unsere Worte. Nach Jahren, die wir das schon machen, sind sie beinah zu einer Art Motto geworden. Ursprünglich hatten sie den Zweck, uns daran zu erinnern, dass wir eine Aufgabe zu erledigen haben, auf die wir uns selbst unter den grausigsten Umständen konzentrieren müssen.
Wir retten diejenigen, die wir retten können.
Dann ist seine Hand verschwunden, und es geht ans Eingemachte. Er beginnt, die Szene zu dokumentieren: Fotos, GPS-Koordinaten, Messungen. Immerhin geht es um Mord. Alles muss in den Bericht … oder zumindest fast alles. Was nicht in den offiziellen Aufzeichnungen enthalten sein wird, sind Fotos von den Stellen an ihrem rechten Unterarm und rechten oberen Rücken, wo er sie gestoßen hat. Es gibt keine Möglichkeit, diese Informationen festzuhalten, keine Kamera und kein Filmmaterial, die aufzeichnen könnten, was ich sehe. Mein Schädel schmerzt, während ich zusehe, und meine Augen fühlen sich angespannt und prall an wie die Trauben einer Rebe, die vor zu viel Regen zu platzen drohen.
Die Zeichen sind so deutlich wie ein Leuchtfeuer, ein Licht in der Finsternis, eine Neonreklame. So eindeutig, dass sie ebenso gut als Worte auf ein Blatt Papier geschrieben sein könnten. Fast kann ich die Wucht des Stoßes fühlen, der Ann durch die Luft segeln ließ, bevor sie ins Leere fiel.
Aus der Tasche meiner Windjacke hole ich das Lederetui und die darin verstaute Brille hervor. Ich klappe die Bügel auseinander und setze die Brille auf. Sofort stellt sich Erleichterung ein, als die bedrückende Enge in meinem Schädel nachlässt und sich verflüchtigt. Beinah spüre ich, wie die Schmerzen durch meine Fußsohlen entweichen, als ich mit den Zehen wackle.
Es ist ein eigenartiges Gefühl. Ich habe mich nie richtig daran gewöhnt.
Meine Sehstärke liegt bei hundert Prozent. Die Brille dient mehr meiner geistigen Gesundheit als meinem Sehvermögen. Es handelt sich um eine sehr spezielle Brille mit dünnen Bleikristalllinsen. Eine Sonderanfertigung aus Seattle, die nicht gerade billig war. Ich besitze auch eine mit getönten Linsen, die als Sonnenbrille durchgeht, aber die habe ich für diese Reise zu Hause gelassen.
Die Canon PowerShot S95 ist tief unten in meinem Rucksack vergraben. Ich muss an einem Reservepaar Socken, einer Karte von Oregon, einigen Wasserflaschen, einer Packung Müsliriegel, einer Thermodecke und meiner Zahnbürste vorbei, bevor ich sie finde. Ich schalte die Kamera ein und durchlaufe das Ritual. Dieses Foto ist nicht für den Bericht. Nur einmal klicke ich auf den Auslöser, dann überprüfe ich das Bild, um mich zu vergewissern, dass es nicht verschwommen oder von der Sonne überbelichtet ist. Einen Moment lang starre ich Ann an.
Sie wird mir keine Ruhe lassen.
Wie die anderen wird sie meine Gedanken heimsuchen. Ich habe in einem Monat mit mehr Morden zu tun als die meisten Polizisten in einem Jahrzehnt. Was allmählich seinen Tribut fordert.
»Wir müssen den Kerl finden, der das getan hat«, sagt Sergeant Anderson und holt mich damit aus meiner Trance. Ich habe nicht gehört, wie er sich mir genähert hat. Jedenfalls steht er neben mir und starrt den steilen Hang hinauf. Sein Blick sucht nach … was? Einem Hinweis? Einer Erklärung?
Einen Moment lang beobachte ich ihn. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck: Wut, Seelenqual, ein Gefühl von Hilflosigkeit. Ich habe ihn schon in Hunderten Gesichtern an Tatorten gesehen. Ich habe ihn schon im Spiegel gesehen.
Meine Hand legt sich auf seine Schulter – warum, weiß ich nicht. »Wir retten diejenigen, die wir retten können«, höre ich mich sagen. Für ihn bedeuten die Worte nichts. Wie könnten sie das auch? Allerdings fällt mir sonst nichts zu sagen ein.
Ich bin nicht gut im Umgang mit Menschen, nicht wirklich.
Schließlich lasse ich die Hand sinken und füge hinzu: »Keine Sorge, ich weiß bereits, wer es getan hat.« Dann verstaue ich die Kamera, werfe einen letzten Blick auf Ann Buerger und stapfe davon.
* * *
Die Tür ist löwenzahngelb. Sie weist ein Milchglasfenster und einen Griff aus gebürstetem Nickel auf. Die Türglocke läutet ein zweites Mal – eine fröhliche, aus fünf Tönen bestehende Melodie, die so gar nicht zu den entsetzlichen Neuigkeiten passt, die gleich überbracht werden.
Schritte tapsen zum Eingang des Hauses. Auf der anderen Seite der Milchglasscheibe bleibt ein verschwommener Schemen regungslos stehen. Ein Riegel wird aufgezogen, der Türknauf dreht sich. Dann schaut ein Gesicht durch die schmale Öffnung der Tür: gerötete Augen, rote Nase, hängende Mundwinkel, all die bitteren Eigenschaften von Kummer und Sorge. Beim Anblick von Sergeant Anderson, Jimmy und mir öffnet Matt Buerger die Tür weiter und tritt einen Schritt vor.
Ich schiebe die Brille ein Stück die Nase runter und spähe darüber hinweg. Meine Augen mustern Matt und verraten mir mit einem Blick alles, was ich wissen muss. In der Welt der Spurensuche bezieht sich der Begriff Schein auf einen schwer zu erkennenden Abdruck in Vegetation oder auf einer schwierigen Oberfläche, in der Regel durch Druck verursacht. Zum Beispiel ein Schuhabdruck auf einem Blatt. Die einzige Möglichkeit, die Spur hervorzuheben, ist Helligkeit. Man kann sich auf die Sonne verlassen, aber die meisten Fährtensucher packen eine Taschenlampe ein, damit sie nah heran und den Einfallswinkel des Lichts steuern können.
Für mich gilt das nicht.
Ich greife nicht auf herkömmliche Methoden der Spurensuche zurück, weil ich es nicht muss. Obwohl wir uns im Schatten der Veranda befinden und ich keine Taschenlampe habe, sehe ich den Schein. Er zeichnet sich an der Tür ab, auf dem Boden, überall, wohin Matt Buerger geht, und an allem, was er berührt.
Der Schein.
Er ist die einzige Spur, die ich brauche, und überall im Überfluss vorhanden, geradezu überwältigend. Er lässt sich weder verbergen noch abwaschen. Er lässt sich nicht tarnen und ist immer einzigartig. Allerdings handelt es sich nicht um denselben Schein, wie ihn herkömmliche Fährtensucher verwenden. Dieser Schein gehört ausschließlich mir – zumindest glaube ich das. Aber vielleicht hat Gott ja noch jemand anderen mit diesem Fluch bedacht.
»Haben Sie etwas gefunden?«, presst Buerger mit erstickter Stimme hervor.
Anderson nickt. »Wir haben Ann gefunden«, sagt er mit leiser Stimme.
Doch ehe er etwas hinzufügen kann, platze ich hervor: »Sie ist verletzt, aber am Leben und bei Bewusstsein.«
Aus dem Augenwinkel bekomme ich mit, wie Jimmy rasch von hinten Andersons Ellbogen ergreift. Sein Griff ist fest, und Anderson versteht den Wink auf Anhieb. Kluger Mann. Normalerweise warne ich die Einheimischen vor, wenn ich etwas dieser Art versuche. Allerdings neige ich dazu, spontan zu sein, und in diesem Fall ist mir die Eingebung erst gekommen, als wir die Veranda erklommen haben. Ich kann mir die Verblüffung des Sergeants gut vorstellen, und ich merke auch, dass er nicht allzu erfreut ist. Immerhin ist Matt Buerger aus seiner Sicht der trauernde Ehemann, und was ich gerade getan habe, ist unverzeihlich.
»Sie wird soeben ins Adventist Medical Center in Portland gebracht«, fahre ich fort, weil ich Anderson keine Zeit lassen will, die Dinge zu durchdenken. »Aber bevor sie abtransportiert wurde, hatte sie uns noch einige interessante Dinge zu erzählen.« Damit verstumme ich und lasse die Äußerung in der Luft hängen. Bei Unschuldigen rufen solche Worte Neugier hervor und werfen Fragen auf. Für Schuldige klingen sie anklagend, verurteilend.
Buergers Miene wird erst ausdruckslos, dann hart wie Stein.
»Was hat sie gesagt?«
Ohne ein Wort fasst Jimmy nach hinten zu seinem Kreuz, öffnet den Druckknopf des an seinem Gürtel befestigten Lederetuis und holt vernickelte Handschellen hervor, die er von einem Ende baumeln lässt.
»Nein.« Buergers Mund verhärtet sich zu einer verkniffenen Linie. Die Verwandlung in seinem Gesicht und in seinen Augen vollzieht sich schlagartig – wie Pudding, der jäh zu Granit mutiert. Er versucht, die Tür zuzuschlagen, aber Jimmy ist zu schnell und wirft sich gegen die löwenzahngelbe Holzfläche. Ein lautes Krachen ertönt, als die Tür aufschwingt und gegen die Wand knallt. Buerger landet auf dem Rücken – hart. Er japst und segelt über den polierten Hartholzboden, keucht, flucht, versucht, Halt zu finden, um den eigenen Schwung abzubremsen.
Jimmy stürzt sich auf ihn.
Meinen Partner bei der Arbeit zu beobachten ist so, als sähe man einem Lassokünstler bei einem Rodeo zu. Nur fesselt er nicht in knappen drei Sekunden einem Kalb mit einem Lasso die Beine, sondern einem Verdächtigen mit Handschellen die Handgelenke. Falls es je Polizei-Rodeos gibt, bei denen es darum geht, jemanden mit Handschellen dingfest zu machen, setze ich mein Geld auf Jimmy.
Kaum ist Buerger wieder zu Atem gelangt, speit er eine Tirade erfindungsreicher Unflätigkeiten hervor. Er beendet sie mit: »Dämliche Schlampe! Nicht mal sterben kann sie richtig.«
Nah dran, aber nicht ganz ein Geständnis.
»Ich hätte sie im Fluss ersäufen sollen, statt sie zu stoßen.«
Das dürfte genügen.
2
16. Juni – zu früh
»Geh weg!«, rufe ich, grabe mich tiefer in die Couch und ziehe die Decke enger um meine Schultern. »Ich brauche Schlaf. Du sollst mir doch den Rücken stärken.«
Ich weiß, dass es Jimmy ist.
Das stakkatoartige Klopf-klopf-klopf wiederholt sich, hallt vom Boden, von der Decke und von dem riesigen Panoramafenster meines karg möblierten Wohnzimmers wider.
Natürlich ist es Jimmy.
Es ist immer Jimmy.
Ich muss mir echt ein richtiges Leben zulegen.
»Komm schon, Steps. Mach auf. Du hast um halb vier in Seattle einen Gerichtstermin.«
Ich ziehe die Hand unter der Decke hervor, taste auf dem Nachttisch nach meiner Uhr und schnalle sie mir ums Handgelenk, bevor ich mir das schwarze Zifferblatt vors Gesicht hebe und die Augen zusammenkneife. »Es ist sieben Uhr morgens. Was für ein FBI-Agent belästigt Leute um sieben Uhr morgens?«
»Es ist halb zwei am Nachmittag«, korrigiert mich Jimmy. »Du hast deine Uhr schon wieder verkehrt herum an.«
»Verdammt!«, flüstere ich bei mir, öffne den Riemen der schwarzen Movado und drehe sie um. Und tatsächlich – das Zifferblatt zeigt mir 13:30 Uhr. Verräter, denke ich und bedenke die Uhr mit einem vernichtenden Blick, als wären ihre Zahnrädchen und Federn irgendwie schuld daran. »Na ja … aber es fühlt sich wie sieben Uhr morgens an«, rechtfertige ich mich leise.
Das Klopfen setzt sich hartnäckig fort.
»Schon gut, ich komme ja.«
Mein Haus befindet sich auf einem Hügel, der den Puget Sound unmittelbar nördlich des Larrabee State Park und südlich der Stadtgrenzen von Bellingham überblickt. Durch die riesige Fensterfront in meinem Wohnzimmer habe ich eine 180-Grad-Aussicht auf die unzähligen Inselchen im tiefen Gewässer der Bucht. Links, was Süden entspricht, befinden sich Samish Bay, dann Padilla Bay, Guemes Island und dahinter die lebendige Stadt Anacortes mit ihren Raffinerien, ihrem Jachthafen und dem Washington State Fährenterminal. In Richtung Norden sieht man Cypress Island, die San Juan Islands und schließlich Lummi Island mit dem vierhundertfünfzig Meter hohen Lummi Peak, der über die Insel wacht.
Eine inspirierende Aussicht.
Mein Haus hat einen Namen.
Schräg, ich weiß.
Ich habe mich dabei ein wenig unwohl gefühlt, bis ich herausfand, dass es ganze Websites gibt, die sich mit der Namensfindung für Häuser befassen. Wer hätte das gedacht? Ich hatte immer geglaubt, damit ein Haus einen Namen bekommt, müsste es einem längst verstorbenen Patrioten oder spleenigen Industriellen gehört haben oder irgendeine ungewöhnliche Eigenschaft besitzen, zum Beispiel, dass es darin spukt. Orte wie Mount Vernon, Monticello und das Winchester-Haus kommen mir da in den Sinn.
Zu wissen, dass andere Menschen ihren Häusern bewusst Namen geben, lässt es irgendwie weniger protzig, weniger versnobt erscheinen. So ähnlich, wie wenn man seinem Auto einen Namen gibt. Und ja – auch mein Auto hat einen Namen. Es heißt Gus.
Mein Haus nennt sich Big Perch, auf Deutsch in etwa ›Hochsitz‹. Vermutlich, weil es hoch auf der Seite des Chuckanut Mountain kauert wie ein Jäger, der auf die Welt hinabblickt. Nicht ich habe es getauft, aber ob einem der Name gefällt oder nicht, er wird nicht verschwinden. Er ist nämlich in einen drei Tonnen schweren Felsblock am Ende meiner Zufahrt gemeißelt – und zwar ziemlich tief. Ich habe schon damit geliebäugelt, dem Felsblock mit Dynamit zu Leibe zu rücken, aber ich will keinen Erdrutsch verursachen. Mit meinen Nachbarn weiter unten am Hügel bewege ich mich so schon auf dünnem Eis – da verursacht ein einziges Mal eine Flaschenrakete ein kleines Feuer, und schon ist man auf Lebenszeit gebrandmarkt.
Big Perch umfasst zweihundertdreiundzwanzig über zwei Geschosse verteilte Quadratmeter mit weitläufigen Terrassen auf drei Seiten, die unter anderem einen Whirlpool und einen Kamin im Freien beherbergen. Beides habe ich im letzten Monat nie benutzt. Mir ist inzwischen klar geworden, dass ich mich in der teuflischen Situation befinde, zwar über die Mittel zu verfügen, mir solche Dinge zu leisten, nicht aber über die Zeit, sie zu verwenden.
Mir gehört auch das im Süden angrenzende Grundstück, auf dem ein ähnliches, einhundertzwanzig Quadratmeter großes Haus namens Little Perch steht – und noch einmal: Mir ist schon klar, was sich jemand denkt, der das hört, aber ich habe die Namen nicht ausgewählt, sie waren beim Kauf schon dabei.
Genau wie Ellis Stockwell.
Er ist der ehemalige Besitzer, ein Grenzschutzbeamter im Ruhestand, der die Immobilien im Zuge einer Zwangsversteigerung verloren hat. Nachdem er vor etwa zehn Jahren beim Grenzschutz in Rente gegangen war, hat er ein Sicherheitsberatungsunternehmen gegründet, das rasch zu einem internationalen Betrieb mit Millionenumsatz wuchs. Ellis meint zwar, er hätte beim Wachstum seiner Firma eine Menge Glück gehabt, aber ich vermute, die Vierzehnstundentage sieben Tage die Woche hatten auch etwas damit zu tun.
Innerhalb von vier Jahren genoss er ein feines Leben. Er ließ Big Perch nach seinen Vorstellungen bauen, kaufte sich eine Corvette, und irgendwie gelang es ihm auch noch, eine neue Frau zu finden. Vanessa, zwanzig Jahre jünger als er, mit einer Vorliebe für Champagner und Diamanten.
Fast sofort fing Ellis an, Little Perch für Vanessas geschiedene Mutter zu bauen – die zwei Frauen waren nämlich unzertrennlich. Niemand war überraschter als Ellis, als Vanessa zwei Jahre später das Firmenkonto sowie verschiedene Anlagekonten mit einer Gesamtsumme von 1,7 Millionen Dollar leerräumte. Sie versteckte das Geld auf einer Reihe von Konten im Ausland, während Ellis auf einer Geschäftsreise war, sprang in einen Flieger nach Cincinnati und zog zu irgendeinem Kerl, den sie aus dem College kannte. Nachdem sie sich online wiederbegegnet waren, hatten sie drei Jahre lang eine Facebook-Freundschaft gepflegt. Stell sich einer vor.
Jedenfalls kehrte Ellis in ein leeres Haus zurück. Vanessa hatte nur eine einzige Tasse, einen einzigen Teller und je ein Messer, eine Gabel und einen Löffel zurückgelassen. Und eine halb aufgebrauchte Rolle Klopapier im Gästebadezimmer.
Das Unternehmen war ruiniert.
Ellis war ruiniert.
Als die Bank die Immobilien dann zwangsversteigerte, muss ich sie mir wohl ein halbes Dutzend Mal angesehen haben, bevor ich ein Angebot unterbreitet habe. Bei jedem Besuch war Ellis da, pflegte immer noch die Blumenbeete, spritzte die Gehwege ab, besserte die Farbe aus. Und trotz seiner finanziellen Schwierigkeiten war er immer fröhlich. Er hatte nach wie vor seine erkleckliche Bundesrente, aber man merkte ihm an, dass er die Häuser liebte.
Bei meinem ersten Besuch unterhielten wir uns ein bisschen; bei den anderen Besuchen ein bisschen mehr. Er erwies sich als intelligent und interessant, und er hatte einen schier endlosen Vorrat an scheinbar weithergeholten Geschichten auf Lager. Sein buschiger Schnurrbart und sein ausgeprägter britischer Akzent passen zu ihm – obwohl ich mich erinnern kann, mich gefragt zu haben, wie es kam, dass ein britischer Staatsbürger für den Grenzschutz der Vereinigten Staaten von Amerika arbeiten konnte. Sechs Monate später erfuhr ich, dass Ellis gar kein Brite, sondern in Philadelphia geboren und aufgewachsen ist. Ihm gefällt bloß der britische Akzent.
Er hat mehrere solche Schrullen.
Letztlich kamen wir zu einer Vereinbarung, von der wir beide etwas haben. Ich lasse ihn mietfrei in Little Perch wohnen, und er kümmert sich dafür um das Grundstück, erledigt bei Bedarf Reparaturen und sorgt dafür, dass die Außenanlage gepflegt bleibt.
Man hätte meinen können, ich hätte ihm das gesamte Geld zurückgegeben, das ihm seine Ex-Frau geklaut hatte, so glücklich war er darüber. Das ist vier Jahre her, und ich bereue es nicht. Inzwischen ist er für mich fast wie ein Verwandter geworden … ein etwas bizarrer, manchmal an Dr. Seuss erinnernder Verwandter zwar, trotzdem ein Verwandter.
Jimmy liefert mir eine rasche Zusammenfassung über den Buerger-Fall, während ich mich rasiere und anschließend einen sauberen Anzug aus dem Schrank meines Bruders stibitze. Jens ist fünf Jahre jünger als ich, aber wir haben ungefähr dieselbe Statur – na schön, er ist ein paar Zentimeter länger am Rumpf, davon abgesehen jedoch ähneln wir uns stark.
Jens ist Doktorand an der Western Washington University. Ich habe ihn mal gefragt, warum er unbedingt Anthropologie studieren wollte. Er hat geantwortet: »Weil Menschen komisch sind.« Ich hätte ihm nicht überzeugter zustimmen können, obwohl er komisch im Sinne von schräg und ungewöhnlich meinte. Ich hingegen halte Menschen auf düstere, unheimliche Weise für komisch.
Es gefällt mir, dass er bei mir wohnt.
Die halbe Zeit bin ich ohnehin nicht da, also kann ruhig jemand die Aussicht, den Whirlpool, den Kamin, die etlichen großen Fernseher, das Spielzimmer und den nicht abreißen wollenden Strom von College-Studentinnen genießen, die der Ort magisch anzuziehen scheint … obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass Jens etwas mit Letzterem zu tun hat.
Ich finde ein gestreiftes graues Jackett, eine dazu passende Hose und ziehe mich an. Jimmy erzählt mir gerade, wie stinksauer Matt Buerger war, als er herausfand, dass Ann doch tot war. Da waren ihm allerdings bereits seine Rechte vorgelesen worden, und er hatte eine äußerst detaillierte, schriftliche Aussage darüber verfasst, wie er den Angriff wochenlang geplant hatte. So etwas wird von uns Gesetzeshütern als Vorsatz bezeichnet und kann in der Regel gegen eine saftige Prise Hochspannung oder eine Nadel in den Arm für eine Nimmerwiedersehensimpfung eingelöst werden. Er gestand sogar einen früheren Versuch, bei dem ihn der Mut verlassen hatte, als Ann an ihm vorbeigejoggt war.
Als ich mich erkundige, warum Buerger ein Problem mit seiner Frau hatte, birgt Jimmys Antwort keine Überraschung: Das egoistische Wiesel hatte nebenher eine Affäre und wollte sich die Scherereien und die finanziellen Einbußen einer Scheidung ersparen. Ist schließlich viel einfacher, die Frau in einen Abgrund zu stoßen. Mit etwas Glück wird seine Affäre im Knast ein hundertfünfzig Kilo schwerer Analliebhaber namens Fleischknüppel sein, der seinen Lustknaben gern mit den anderen Jungs im Zellenblock teilt.
Jimmy faselt weiter, labert irgendetwas von einer neuen Rechtsprechung, in die wir uns einlesen müssen, und von einem möglichen Serienmörder in Tulsa, der auf unserem Tablett landen könnte.
Ich mag Tulsa – abgesehen vom Wetter. Spielt allerdings nicht wirklich eine Rolle. Wie Jimmy oft sagt: »Wir sind schließlich keine Touristen.« Hin mit dem Jet, zurück mit dem Jet. Fahrgestell rein, Fahrgestell raus. Den Job so schnell wie möglich erledigen, und ab nach Hause. Dann irgendwo anders das Ganze von vorn.
»Kann losgehen«, verkünde ich, als ich schwungvoll in das Jackett schlüpfe. Dann fällt mir etwas ein. »Tatsächlich brauche ich noch drei Minuten.« Ich schnappe mir meinen Rucksack und eile ins Schlafzimmer, während Jimmy mit missbilligendem Blick auf die Uhr sieht.
Ich krame die Canon PowerShot S95 heraus, schließe sie am Computer an und überspiele rasch das eine Foto vom Datenträger. Dreißig Sekunden investiere ich darin, das Bild in Photoshop zuzuschneiden, die Größe anzupassen und zu korrigieren, dann übertrage ich es an den Drucker, der ein gestochen scharfes, wenngleich schreckliches Foto ausspuckt. Mit der Schere schneide ich das Bild im Format dreizehn mal achtzehn Zentimeter aus dem Fotopapier.
An der Wand über dem Rechner ist ein Ablagefach montiert. Ein Ablagefach, das nur zwei Gegenstände beherbergt: ein schwarzes Fotoalbum und ein identisches zweites Album, allerdings in Weiß. Ich ergreife das schwarze Album und schlage es im hinteren Bereich auf. Als ich die nächste freie Stelle suche, bemühe ich mich, die anderen Bilder nicht anzusehen. Ein paarmal mit dem Klebestift über die Seite gefahren, und schon ist das Foto fixiert. Ich schließe das Album und stelle es zurück aufs Ablagefach.
Bald muss ich ein weiteres schwarzes Album kaufen, wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Monate. Das weiße reicht vermutlich noch für einige Jahre. Die Bilder im schwarzen Album sehe ich mir nie an, jedenfalls nicht absichtlich. Das weiße Album ist anders. Die Bilder darin mag ich. Sie lächeln mir entgegen – glückliche, erleichterte Gesichter. Gesichter von Müttern, Kindern, Ehemännern, Ehefrauen und Schwestern. Manchmal winken sie auch mit strahlenden und so lebendigen Augen.
Das schwarze Buch sehe ich mir nie an.
* * *
Die Gulfstream G100 – wir nennen sie Betsy – ist ein geflügelter Traum und einer der Vorzüge des Jobs, die ich aufrichtig genieße. Wälder bringen mich zum Zittern, aber befördert man mich in die Luft, wähne ich mich im Himmel. Les und Marty, unser Pilot und Kopilot, haben mich aus dem Cockpit verbannt. Anscheinend stelle ich zu viele Fragen und fasse Knöpfe an, die ich nicht anfassen sollte.
Aber sie sind dabei nett geblieben, und zum Glück eignet sich die G100 nur für vier Passagiere, es war daher kein Luftsheriff an Bord, um mich zu tasern. Das wäre nicht lustig gewesen. Vor drei Jahren habe ich die Ausbildung gemacht, um einen Taser tragen zu dürfen, weil ich dachte, es könnte cool sein, falls ich ihn je brauche. Dabei hat man es allerdings verabsäumt, mir zu sagen, dass man sich selbst tasern lassen muss, um den Kurs abzuschließen.
Als man mich dann gefragt hat, ob ich auch die Schusswaffenausbildung machen will, habe ich geantwortet: »Scheiße, nein!«
Der Vertreter der Staatsanwaltschaft von King County hat mich für 15:30 Uhr eingeplant – letzter Zeuge des Tages. Sollte interessant werden. Ich muss selten vor Gericht, was gut ist, weil mich der ganze Ablauf nervös macht. Nicht der Umstand, dass ich vor Leuten im Gerichtssaal sitzen muss. Das ist einfach. Meine Zeugenaussagen sind es, die mich unrund werden lassen. Sie sind für meinen Geschmack zu nah an einer Lüge dran. Nicht dass ich vor Gericht lügen würde. Ich erzähle bloß nicht alles … und das verursacht mir ein schlechtes Gewissen, das mich fast auffrisst. Die Geschworenen bekommen etwas über Schuhgrößen, Wanderstöcke, Schrittlängen, den gewöhnlichen Schein, Zehenabdrucktiefen und Richtwirkung zu hören.
Aber ich bin kein Fährtensucher.
Ich brauche keine gute oder frische Fährte.
Alles, was ich benötige, sind Essenz und Textur … worüber ich vor Gericht nicht reden kann.
Die meisten Verdächtigen knicken in den frühen Phasen der Ermittlungen ein, in der Regel unmittelbar, nachdem ich die Leiche gefunden habe. Lange bevor der Fall bei Gericht landet, geben sie ein umfassendes Geständnis ab. Ist schwierig, das nicht zu tun, wenn einem jemand alles vorbeten kann, was man getan hat, wohin man gegangen ist, was man angefasst hat. Die meisten merken es, wenn sie überführt sind, und sind schlau genug, einen Deal auszuhandeln.
Alle außer den Soziopathen und den Psychos … den Jonathan Quillans dieser Welt.
Vor achtzehn Monaten hat Quillan bei einem durch Meth verursachten Ausflug ins Paranoia-Land den acht Monate alten Sohn seiner kiffenden, bescheuerten Freundin in einem Blutbad abgeschlachtet, das mir monatelang nachts Albträume und tags das Zittern beschert hat. Nach einer neun Tage währenden Meth-Orgie war sein Verstand zu einer abscheulichen Hölle furchterregender Halluzinationen verkommen: Schlangen, die von Bäumen tropften. Spinnen, die in seinen Ohren nisteten. In den Wänden flüsternde Stimmen. Unter seiner Haut Käfer, auf die er schlug, schlug, schlug, aber sie wollten einfach nicht verschwinden. Und da waren schreckliche, flüsternde Stimmen, die er aussperren wollte, was er jedoch nicht konnte, weil er Angst vor den Spinnen in seinen Ohren hatte.
Der Bericht liest sich wie eine moderne Horrorgeschichte.
»Die Cops beobachten dich«, flüsterten die Stimmen. »Im Bauch des Babys ist eine Kamera.« Er konnte die Kamera nicht sehen. Drücken, Quetschen – schreiendes Baby – Stochern. Musste tief drin sein.
»Tief drin«, bestätigten ihm die Stimmen.
Als seine Freundin Nancy aufwachte, hatte sie das Geräusch zweifellos noch in den Ohren, ein Geräusch, das sie nicht recht verstehen oder einordnen konnte. Dasselbe Geräusch war in ihren Schlaf eingedrungen und hatte sie aus ihren Träumen gedrängt, sich ihr aufgezwungen, sie angeschrien.
Geschrei.
Sie stieß die leere Bacardi-Flasche vom Bett, wankte zur Schlafzimmertür und stützte sich mit der rechten Hand an der Wand ab, als sich die Wirklichkeit verfestigte. Ich erinnere mich noch daran, lange auf ihren Handabdruck gestarrt zu haben: elfenbeinfarbene Essenz mit sandiger Textur. Als sie ins Wohnzimmer torkelte, war Quillan blutig bis zu den Ellbogen und wühlte, wühlte, wühlte.
Er brachte sie auch um, die arme, erbärmliche, dumme Frau.
Als zöge er einen Reißverschluss auf, hat er ihr in der Küche die Kehle von einer Seite zur anderen aufgeschlitzt, als sie versucht hat, sich mit einem Tranchiermesser zu bewaffnen.
Die Stimmen haben ihn dazu aufgefordert.
Als man Quillan am nächsten Nachmittag fand, schlief er seelenruhig wie ein Baby auf der Couch. Nancys Schwester hatte zehn Minuten lang an die Tür gehämmert, ohne eine Antwort zu erhalten, und war zunehmend panischer geworden, während ihr Blick die dünne Blutspur fixiert hatte, die über die Veranda und die Stufen hinunter verlief. Als die Polizei eintraf und die Tür eintrat, wurde Quillan in Gewahrsam genommen. Man führte eine flüchtige Untersuchung der Schlafzimmer, des Badezimmers und der Küche durch und fand nichts. Keine Anzeichen auf ein Verbrechen, nur die verräterische rote Schliere auf der Veranda, doch selbst die verlor sich auf der untersten Stufe.
Quillan hatte seine Arbeit gut gemacht.
Aber das hektische Schrubben und Putzen eines Speed-Junkies, der sich neun Tage zugedröhnt hatte, ist handfester Forensik nicht gewachsen … in diesem Fall Chemolumineszenz. Darunter versteht man die Verwendung chemischer Substanzen, in der Regel Luminol, um selbst geringste Spuren von Blut sichtbar zu machen. Ist bei Kriminalisten sehr beliebt, weil es mit dem Eisen in Blut reagiert und vorübergehend ein blaues Leuchten erzeugt. Man kann putzen, schrubben und scheuern, so viel man will, doch es ist nahezu unmöglich, Luminol zu überlisten.
In der Küche fand man einen wahren Teich, einen hässlichen neonblauen Fleck, wo sich ein veritabler Strom von Blut auf die Fliesen ergossen hatte und auf die Schranktüren, den Kühlschrank, den Edelstahlgeschirrspüler gespritzt war wie ein Wasserfall: zu viel Blut, um dessen Verlust zu überleben. Küche und Esszimmer, zuvor weiß und gelb, schimmerten nun blau. Jedes Wischen mit Reinigungslappen wurde aufgedeckt, jeder Versuch, das verräterische Blut zu beseitigen, war deutlich zu sehen.
Aber keine Leichen.
An der Stelle kam ich ins Spiel.
Elfenbeinfarbene Essenz … sandige Textur … meine besondere Gabe.
Ich sehe das Verborgene. Ich sehe den Schein, jede Berührung, jeden Schritt, jede Wange auf einem Kissen, jede Hand an einer Wand. Manch einer würde es vielleicht Aura nennen, ich bezeichne es einfach als Lebensenergie. So oder so, es hinterlässt eine sanft schimmernde Spur an allem, womit wir in Berührung kommen, und strahlt sogar von dem Blut ab, das wir zurücklassen. Manchmal ist der Rückstand hellgrün mit einer flaumigen Textur oder schlammig-malvenfarben oder grellrot-gelblich oder die rötliche Schattierung von gebranntem Ton. Jeder Schein ist anders und für einen Menschen so einzigartig wie Fingerabdrücke, Augenscans oder DNS.
In Fall von Quillan wies das, was ich als Essenz bezeichne, Elfenbeinfarbe auf und hatte eine sandige Textur.
Nach der Landung am SeaTac, dem Seattle-Tacoma International Airport, geht Jimmy zu einem wartenden Auto voraus, das ein FBI-Mitarbeiter von der Außenstelle in Seattle fährt, der uns auf direktem Weg zum Gerichtsgebäude von King County bringt.
Wir sind noch zu früh, also schlagen wir die Zeit in der Cafeteria tot. Der Quillan-Fall liegt über ein Jahr zurück, daher sehe ich meine Notizen zum dritten Mal durch, bevor ich Jimmy die Akte zurückgebe. Er stopft sie in seine Fossil-Dokumententasche, während ich bei einem stummen Gebet darum bitte, mir diese Unterlagen nie wieder ansehen zu müssen.
* * *
Der Gerichtssaal ähnelt anderen, die zu kennen ich das Pech habe, wenngleich ohne die theaterähnlichen Einzelsitze, wie man sie in neueren Gebäuden antrifft. Stattdessen sitzen Angehörige, Beobachter und Reporter auf harten, kirchenartigen Bänken. Es fehlen nur die Gebetsbücher und Kniebänke.
Die Geschworenenbank befindet sich vorne rechts im Raum: zwölf gepolsterte Stühle, je sechs in einer Reihe, die hintere Reihe gegenüber der vorderen leicht erhöht, umgeben von einem harten Eichenholzgeländer, lackiert in dunklem Kirschrot. Vorne in der Mitte ragt die Richterbank über alles andere erhaben und ebenfalls erhöht auf und beherrscht den Saal bedrohlich. Sie weist Zierschnitzereien, eine Marmoroberfläche sowie eine Unterbekleidung aus Eiche und Oberbekleidung mit dunkler Kirschholzmaserung auf.
Mein Platz ist weniger prunkvoll …
… und auch nicht so hoch.
Ich nehme im Zeugenstand zur Linken des Richters Platz und wetze auf dem harten Stuhl im Versuch hin und her, eine bequeme Position zu finden; was sich als unmöglich herausstellt. Vielleicht liegt es ja an mir, aber ich finde, dass Zeugenstandstühle eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem mittelalterlichen Folter- beziehungsweise Stachelstuhl besitzen, einer schrecklichen Erfindung, bei der unzählige stachelige Spitzen von der Sitzfläche, den Armlehnen und aus der Rückenlehne ragen. Ihr einziger Zweck besteht – wie beim Zeugenstuhl – darin, die Zunge derjenigen, die darauf sitzen, in produktive Bewegung zu versetzen. Obwohl im Mittelalter die Wahrheit weniger relevant als das Geständnis war.
Ich spähe zu den Geschworenen und beneide sie um ihre gepolsterten Stühle. Scheint sich um eine anständige Gruppe zu handeln. Keine auf den ersten Blick erkennbaren Dummschwätzer oder geistig Minderbemittelten darunter. Am seltsamsten mutet noch eine ältere Frau in einem lindgrünen Kostüm mit einer Brille mit massivem Gestell und einer toupierten Hochfrisur im Stil der 1950er an.
Ehrlich, ich weiß nicht, ob sie einfach nur auf den Retrolook steht oder gerade von einem Marge-Simpson-Doppelgängerinnen-Wettbewerb kommt, aber der Anblick ist mir unheimlich.
Na schön, vielleicht ist die Hochfrisur nicht ganz so hoch wie die von Marge Simpson. Aber ich wette, wenn sie Feuer finge, würde es ein paar Minuten dauern, bis die Frau es überhaupt merkt … und man bräuchte wohl mehrere Feuerlöscher, um es zu ersticken … und vielleicht einen Leiterwagen.
Ich schaue von Gesicht zu Gesicht, stelle mit allen Geschworenen Blickkontakt her, tausche sogar den Ansatz eines Lächelns mit Marge Simpson aus. Das sind die Männer und Frauen, die über das Schicksal von Quillan entscheiden. Ich kann ihnen vielleicht nicht alles erzählen, geht es mir durch den Kopf, aber ich werde nicht lügen; es gibt schon genug Lügner auf der Welt.
»Schwören Sie, die reine Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit …« Bla-bla, bla-bla, bla-bla.
»Ich schwöre«, sage ich, während ich gleichzeitig denke: Alles außer dem Teil mit »die reine Wahrheit«.
»Guten Tag, Steps«, begrüßt mich der Staatsanwalt von King County, Tully Stevens, als er auf mich zukommt und mir die Hand schüttelt. Ich bin Tully vorher schon zweimal begegnet. Er kommt brüsk und – manch einer würde sagen – humorlos rüber, aber er ist ein Mann mit Integrität und Prinzipien, eine heutzutage seltene Kombination, vor allem unter Anwälten. Man kann nicht behaupten, dass er attraktiv sei, aber er ist auch kein besserer Ersatzteilbehälter. Mit fünfzig besitzt er immer noch eine volle, grau melierte Haarpracht, die ihm ein kultiviertes Aussehen verleiht und Respekt von Geschworenen sichert … Außerdem verschleiert sie, wie sehr seine zu großen Ohren abstehen.