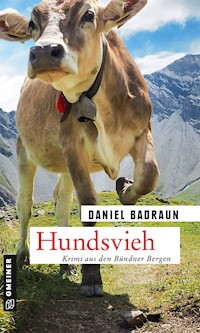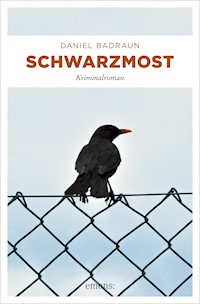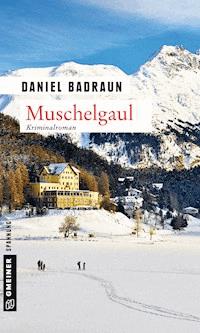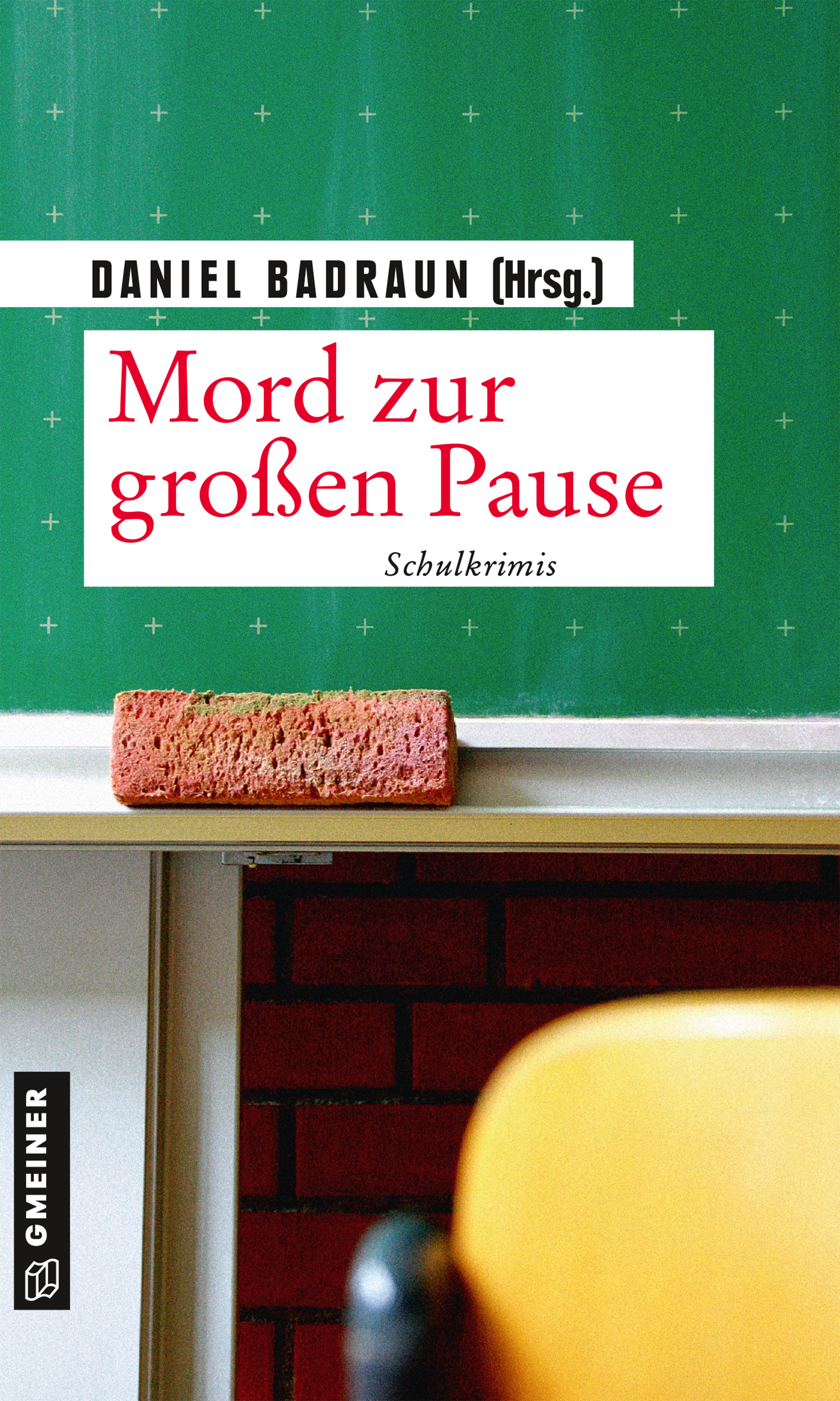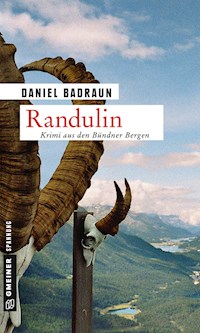Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Claudio Mettler
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Herbst im Oberengadin. Als Claudio Mettler von Mona verlassen wird, sucht er Ruhe in Indien. Am Ganges hat er die Idee für ein neues Tourismuskonzept, das er Reto Müller verkaufen will. Zurück in St. Moritz wollen ihm alle möglichen Leute seine Ideen abjagen. Als er wenig später eine Gruppe von Psychiatern und Patienten nach Nepal und hinauf ins Everestgebiet führen soll, wandert neben Mona auch ein Mörder mit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Badraun
Krähenyeti
Kriminalroman
Zum Buch
Herbst im Oberengadin Als Claudio Mettler Mona zusammen mit Reto Müller überrascht, kehrt er St Moritz den Rücken, um in Indien Ruhe zu finden. Am Ganges kommt ihm die Idee für ein neues Oberengadiner Tourismuskonzept, das laut Müller einiges wert sein könnte. Zurück in der Heimat versuchen ihm alle möglichen Leute, den Aktenkoffer mit seinen Ideen abzujagen. Nach einer Auseinandersetzung mit Seilbahnbetreibern und einer undurchsichtigen Sekte hat Mona einen Zusammenbruch und landet in der psychiatrischen Klinik. Weil Mettler immer noch blank ist, führt er eine Gruppe von Psychiatern und Patienten nach Nepal. Im Everestgebiet möchten sie eine neue Behandlungsmethode ausprobieren. Unter den Teilnehmern der kleinen Expedition befindet sich Mona. Unerkannt wandert auch ein Mörder mit.
Daniel Badraun, geboren 1960 im Engadiner Dorf Samedan, schreibt in den Sprachen Deutsch und Rätoromanisch für Erwachsene und Kinder. Seit 1989 arbeitet er als Kleinklassenlehrer in Diessenhofen. Einige Jahre war er Abgeordneter im Thurgauer Kantonsparlament. Daniel Badraun wohnt mit seiner Frau in der Nähe des Bodensees und hat vier erwachsene Kinder. Der begeisterte Sportler fuhr in seiner Jugend Bob und ist heute oft auf dem Rad oder auf Wanderwegen anzutreffen.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Muschelgaul (2015)
Gelegenheit macht Diebe (Krimispiel, 2015)
Kati und Sven und die geheimnisvolle Mitra (2015)
Kati und Sven und das Spiel der Spiele (E-Book Only, 2014)
Hundsvieh (2013)
Willkommen im Engadin (2013)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Sven Lang
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Thorsten Schier /fotolia.com und © sidewind / photocase.de
ISBN 978-3-8392-5436-3
Widmung
für Gian Fadri und Reto – zwei einmalige Brüder
Wenn i gohn
I packe mine Rucksack und nimme mit:
D’Wärmi vo der Erde,
wenn i gohn, wenn i gohn, wenn i gohn.
Preparo la valigia e poi parto con me:
Il calore della terra,
il vento fra le foglie,
wenn i gohn, wenn i gohn, wenn i gohn.
I packe mine Rucksack und nimme mit:
D’Wärmi vo der Erde,
ds Ruusche vo de Böim, dr Herbschtzug vo de Vögel,
wenn i gohn, wenn i gohn, wenn i gohn.
Wenn i gohn denn frog du d’Vögel,
sicher wüssends, wo ni bi.
Wenn i gohn, denn frog du d’Boim,
döt wo sie sind, findsch au mi.
Quando andrò, chiedi della terra,
dove è lei, anch’io sarò.
Linard Bardill
Teil 1 Von Krähen – oder: Der unendliche Knoten
Indien, September 1996
1.
Tiefer als ich kann ein Reisender wohl kaum mehr sinken. Schwach und ausgelaugt hocke ich auf den ausgetretenen Stufen, die zum Wasser hinunterführen. Auf der öligen Oberfläche wiegen Teppiche aus Algen und Abfall hin und her. Hinter dem träge fließenden Strom flimmert die Mittagshitze über der Ebene, die weit hinten ins Nichts führt. Die Geier, die sich ganz in der Nähe um ein formloses Stück Aas streiten, kümmern sich nicht um den zusammengekrümmten Mann auf der Treppe.
Weit weg wünsche ich mich, weit weg von diesem stinkenden Fluss, von dieser bedrohlichen Stadt und hoch hinauf in mein kühles Bergtal, wo ich nicht immer Reis aufgetischt bekomme und wo mit bekannten Gewürzen gekocht wird. Ein Ort, an dem einer wie ich schnell wieder gesund werden kann.
Warum nur stieg ich vor zwei Monaten in dieses verdammte Flugzeug, das mich tausende Kilometer nach Osten und zu mir bringen sollte? Die große Erleuchtung Asiens? Die innere Ruhe? Vergiss es. Wie soll ich in vollbesetzten Bussen meine Mitte finden, wenn die cholerischen Fahrer, die auf den überfüllten Straßen um jeden Meter kämpfen, erst im letzten Moment dem Gegenverkehr ausweichen? Das ewige Gedränge beim Anstehen für ein Ticket hilft meiner getriebenen Seele auch nicht weiter. Dazu kommen die Händler, die dauernd an meinen Kleidern zerren, weil sie hoffen, mir in ihren schummrigen Läden Teppiche, Schmuck oder Tücher andrehen zu können.
Es gelingt mir nicht, den Gedankengang zu Ende zu führen, wieder fühle ich, wie meine Därme und mein Magen von Krämpfen geschüttelt werden, die mein Innerstes nach außen befördern wollen, egal wo. Wer unter irgendwelchen Tierchen leidet, die sich explosionsartig in den Därmen vermehren, verliert jegliche Scham. Auch ich habe mich schon der Not gehorchend in einer Ecke niedergekauert und erleichtert, kaum beachtet von den Passanten. Mit zitternden Beinen ziehe ich mich an einem Mauervorsprung hoch und mache mich auf die Suche nach der nächsten Toilette.
Das Bengali Coffee House liegt in einer Seitenstraße. Der einstöckige Bau ist ein wirres Durcheinander aus Beton, Ziegeln und Holz. In einer Nische steht die farbige Figur des Gottes Ganesha mit dem Elefantenkopf. Für Glas hat es den Erbauern nicht mehr gereicht, so kämpfen die Straßendünste mit den Küchengerüchen um die Aufmerksamkeit der Kundschaft. Der Kellner steht neben der Theke und versucht, sich so wenig wie möglich zu bewegen. Eine angedeutete Kopfbewegung muss zur Begrüßung des Fremden reichen. Die glänzende italienische Kaffeemaschine macht dem Coffee House alle Ehre. Allerdings serviert man hier keinen dampfenden Espresso oder schaumigen Cappuccino, die Maschine ist nur dazu da, um heißes Wasser in eine Tasse mit Nescafé-Pulver laufen zu lassen.
»Black tea, sugar, no milk«, rufe ich ihm zu und verziehe mich in den Hinterhof, wo sich die Toiletten befinden.
Nachdem ich zehn Minuten über dem übel riechenden Loch verbracht habe, geht es mir etwas besser.
Unterdessen hat der Kellner ein Kännchen aus Chromstahl und eine Tasse auf einen der grob gezimmerten Holztische unter dem großen Deckenventilator gestellt und steht wieder auf seinem Platz, als hätte er sich nicht fortbewegt.
Etwas können die Inder wirklich gut: Tee zubereiten. Hier gäbe es einiges zu lernen für unsere Beizer, denn ein lausiger Beutel Abfall in einem Glas Wasser ergibt noch lange kein genießbares Getränk, auch wenn auf der Etikette »India«, »Chai«, »Highland« oder sonst etwas Exotisches steht.
Mein Freund Reto Müller würde sicher Tee-Kurse für Gastronomen anbieten, wenn man damit Geld verdienen könnte.
»Something to eat?«, fragt der Kellner höflich.
Ich bestelle Toast, obwohl ich nicht sicher bin, ob ich das Essen auch wirklich bei mir behalten kann. Es ist mehr so, dass ich herausfinden will, ob der Kellner sich bewegt oder ob die Toasts wie von Zauberhand durch den Raum schweben.
Draußen auf der Gasse ist eine Kuh aufgetaucht. Gemächlich trottet sie vorwärts. Mit langsamen Ohrenbewegungen verscheucht sie die Fliegen, die nervös über ihren Augen kreisen. Dann senkt sie den Kopf und schnuppert an einem Abfallhaufen. Der Toast wird gebracht. Vom Kellner persönlich. Ich beiße ab und sehe, wie die Kuh draußen vor dem Fenster auf einem Stück schmieriger Pappe herumkaut.
Genau in diesem Moment, also nach meinem ersten Biss in den warmen, knusprigen Toast und bevor die Kuh kauend aus meinem Blickfeld verschwindet, habe ich einen genialen Einfall.
Man muss sich das mal vorstellen. In der Mittagshitze von Varanasi kommt mir plötzlich die Idee, wie der Tourismus im Engadin revolutioniert werden könnte. Trotz Magenproblemen. Da werden alle staunen. Allen voran Reto Müller. Aber auch Mona. Sie wird es noch bereuen, dass sie mich einen Versager nannte.
Lange kann ich mich leider nicht an meinem Geistesblitz erfreuen, kurz nachdem ich die letzten Brotkrümel heruntergeschluckt habe, meldet sich mein Magen erneut und ich eile am mitleidig dreinschauenden Kellner vorbei hinaus auf den Hof. Diesmal bleibe ich länger als nötig draußen. Die kauernde Bewegungslosigkeit über dem stinkenden Loch scheint meinen Gehirnwindungen gutzutun, der so entstandene Druck hilft weiteren Gedanken hinaus ans Tageslicht. Vielleicht sind es auch die Gegensätze, die mich inspirieren. Hier der heruntergekommene Hinterhof in dieser überhitzten Stadt, dort weit entfernt die kühle Seenlandschaft mit der prächtigen Hotelarchitektur. Wenn ich es mir recht überlege, gibt es durchaus Parallelen, an denen ich arbeiten werde.
»You need a doctor«, sagt der Kellner und reibt mit einem fadenscheinigen Lappen den Tisch sauber. »I have an uncle, he does ayurvedic medicine.«
Weil ich seit mehr als drei Tagen kaum mehr etwas bei mir behalten kann und spürbar schwächer werde, und weil ich unbedingt an meiner Idee weiterarbeiten will, willige ich ein und frage nach der Adresse.
»Difficult«, sagt der Kellner und ruft einen Jungen herbei, der mich hinbringen soll.
2.
Nach einem kurzen Gang durch das Quartier, bei dem ich jede Orientierung verliere, zeigt der Junge auf ein stattliches Haus und hält mir die offene Hand vor mein Gesicht. »This the house. Rupia, Mister!«
Ich gebe dem Kleinen einige Scheine, die ein Lächeln auf sein Gesicht zaubern. War das jetzt großzügig oder schon dumm? Ich weiß nicht, ob ich lange genug in Indien sein werde, um den Unterschied zu begreifen. Mit dieser Frage beschäftigt steige ich Stufe um Stufe hinauf. Warum hat gerade dieses Haus so viele Stockwerke? Und warum ist die Praxis so weit oben? Keuchend und nassgeschwitzt erreiche ich den obersten Absatz des Treppenhauses und stehe vor der Praxis. ›Dr. Singh‹ steht auf dem großen Messingschild.
Als ich wieder atmen kann, klopfe ich, und als nichts passiert, trete ich ein. Ein großer Mann mit Bart und Turban kommt mir entgegen. Er trägt einen weißen Kittel, aus der Brusttasche schauen einige Kugelschreiber heraus.
»Dr. Singh?«, frage ich überflüssigerweise.
Er lächelt freundlich. »Welcome.«
»I have to …«
Er hebt die Hand. Im Moment muss ich gar nichts.
»Please.« Er führt mich in einen dämmrigen und kühlen Raum. Die geschlossenen Läden scheinen die Hitze abzuhalten. »Sit down.«
Zwei bequeme Ledersessel, es riecht nach Pfeifentabak.
»Mein Name ist Mettler, Claudio Mettler. Ich komme aus Switzerland, from far away, verstehen Sie? Understand? My problem is big and so …«
»Please«, sagt Mister Singh. »The pulse.«
»The pulse?«
Er greift nach meinen Armen und fühlt den Puls an verschiedenen Stellen.
»Yes«, sagt er immer wieder, und: »I understand.«
»What can I do?«, frage ich verzweifelt. »Seit Tagen geht es mit mir bergab. Irgendetwas muss es doch geben für meinen Magen. Die vielen Millionen Inder kauern auch nicht die ganze Zeit auf der Toilette oder am Straßenrand. Wenigstens nicht alle.« Die lange Rede hat mich angestrengt, der Schweiß rinnt mir über die Stirn. Hört mir der Doktor überhaupt zu? Bei uns hantieren die Ärzte mit Stethoskopen und allerlei Apparaten herum, röntgen, durchleuchten und geben den Patienten so das Gefühl, als wären sie schon auf dem Weg zur Genesung. Singh ist da anders. Er öffnet einen Füllfederhalter und schreibt etwas auf ein gelbliches Papier mit vorgedruckten Linien. Meine Krankenakte.
»What do you think?«, setze ich von Neuem an. Wenn es um meine Gesundheit geht, bin ich eine unglaubliche Nervensäge. Sagte Mona. Früher. Als wir noch zusammen waren. Aber das hat nichts mit meinem Magen zu tun. Erst gesund werden.
»Wait.« Bedächtig geht Singh hinüber zum Büchergestell und nimmt einen ledergebundenen Band heraus. Das Blättern, begleitet von einigen Brummlauten, gehört wohl zu seiner Interpretation von Medizin. Unsere Ärzte gehen da handfester vor, die Show, die sie jeweils vor uns Patienten abziehen, soll Zuversicht verbreiten und die Behandlungskosten schon im Voraus rechtfertigen. Wie aber will dieser indische Guru mit seinem Puls-Getue den sicher horrenden Preis für diese Nicht-Leistung erklären? Am liebsten würde ich abhauen und diesen Quacksalber stehen lassen, doch dazu fehlt mir die Kraft.
Singh macht weitere Notizen, schließt dann das Buch und seufzt. »I see«, sagt er nur und schaut mich einen Moment schweigend an.
Mettler ist also ein schwerer Fall. Vielleicht bin ich unheilbar krank? Wer weiß schon, welche Erreger in den Töpfen und am schlecht abgewaschenen Geschirr lauern. Hört man nicht immer wieder von rätselhaften Seuchen, die in einem kleinen Kaff in Hinter-Hindustan ausbrechen? Und die nur bekannt werden, weil ein Westler, also ich, dabei draufgegangen ist? Ein schwacher Trost. Vielleicht benennen sie die Krankheit wenigstens nach mir.
Auf dem Schreibtisch steht neben dem Block eine Glocke aus Messing. Singh bimmelt. Die Türe wird aufgerissen und ein in Tüchern gewickelter Alter kommt herein. Der Doktor kritzelt etwas auf ein Blatt und erklärt den Inhalt auf ›Unverständlich‹, das ist die Sprache, die hier meistens gesprochen wird. Neben dem Englisch natürlich, das meist so ertönt, wie es geschrieben wird. Mit ihrer speziellen Aussprache drücken die Inder der Weltsprache ihren eigenen Stempel auf.
»Pani. Chalo, chalo!« Der Alte verschwindet, um gleich darauf mit einem Glas Wasser zurückzukehren. Einen Moment bleibt er stehen, doch Singh scheucht ihn mit einem Wortschwall, der mit einigen englischen Ausdrücken gespickt ist, aus dem Zimmer.
Dann geht er hinüber zu einem Metallschrank, öffnet eine Schublade und holt eine Medikamentenpackung heraus.
»Strong stuff«, sagt er grinsend und legt zwei hellgrüne Tabletten auf den Tisch. »They kill everything inside.«
Ohne Widerrede spüle ich das grüne Gift hinunter. Man müsste mal eine Studie machen, um die Wirkung der Tablettenfarben zu untersuchen, denke ich, denn nun fühlt sich mein Magen samt den Gedärmen so an, wie sich das eben anfühlen sollte. Gut, rund und gesund.
Mit leiser Stimme erklärt mir der Doktor, dass die Chemie jetzt einfach mal die Symptome bekämpfe, was mir natürlich recht ist, dass ich da aber längerfristig etwas tun müsse, weil die Krankheit eben tiefere Ursachen habe. Wieder so ein Psychoscheiß, denke ich, auf der Couch liegen und bei den Großeltern und ihren Beziehungen zu Meerschweinchen und hartem Brot beginnen. Jeder Spur folgen, die ins Nichts führt, bis die Seele und der Geldbeutel ausgelutscht sind und nichts mehr hergeben. Ohne mich.
Stattdessen sagt Singh etwas von »herbs«, also von Kräutern. »Come«, sagt er, »have a look!«
In einem Hinterzimmer sitzt der Alte zusammen mit zwei weiteren Männern. Aus bauchigen Blechdosen holen sie Kräuter und wiegen sie ab. Auf einer Zeitung werden die Zutaten zusammengemischt und dann in einem mächtigen Mörser vorsichtig zerkleinert, bis ein grobes Pulver entsteht.
Der erste Gehilfe legt nun kleine Quadrate aus Papier auf dem Tisch aus. Darauf verteilt der Alte mit einem geschnitzten Holzlöffel kleine Portionen des Pulvers. Der zweite Gehilfe faltet die gefüllten Papiere zu kleinen Päckchen zusammen und legt alle in einen Stoffbeutel.
»Two times a day in hot water«, sagt Dr. Singh. »Beginnen Sie gleich heute Abend mit der Kur. Sie werden sehen.«
Singh legt ein Blatt Papier auf den Tisch und beginnt, einige Zahlen zu notieren.
Langsam ziehe ich meinen Lederbeutel hervor, in dem die vielen Rupiennoten stecken. Vor einigen Tagen hatte ich sie bei einem Taxifahrer in einer Seitengasse von Delhi zu einem guten Kurs gegen Dollars gewechselt.
»No Rupia«, sagt der Doktor, »Dollars are better. Give me twenty.«
Ich ziehe vier Fünfer aus der Tasche, froh, so günstig weggekommen zu sein.
3.
Das General Post Office von Varanasi gleicht einem Bienenhaus. Unzählige Menschen kommen und gehen. An den Wänden sitzen Schreiber, die für ihre Kundschaft Formulare ausfüllen, Bittschriften an Behörden verfassen oder auch Liebesbriefe auf farbigem Papier schreiben. Vor den Schaltern stehen die Wartenden in langen Schlangen.
Ausnahmsweise habe ich Glück, denn ich will keine Marken kaufen oder einen eingeschriebenen Brief aufgeben. Ich will auch kein Paket in die Heimat schicken, wie die paar Europäer oder Amerikaner ganz rechts in der Halle. Sie müssen zuerst den Inhalt ihrer Sendung dem Zoll zeigen, dann ein Formular ausfüllen und zuletzt ihre Kisten in weißes Tuch einnähen lassen, bevor die Fracht vom zuständigen Beamten kritisch begutachtet und entgegengenommen wird.
Vor dem Schalter International Telephone Service steht eine Frau im Sari, die gerade ihre Papiere zusammenpackt und hinüber zu einer der Kabinen geht. Ich kann es kaum fassen, dass ich ohne Wartezeit durchgekommen bin.
»Yes please?«
Ich erkläre dem Mann hinter dem Schalter in seiner khakifarbenen Uniform, dass ich einen Mister Reto Müller in St. Moritz in Switzerland anrufen wolle.
»Reto? Is that a name?«, fragt er und runzelt die Brauen.
»Yes. A typical name in the swiss mountains.«
»Switzerland«, murmelt er, holt ein dickes Buch von einem Schreibtisch und beginnt zu blättern.
»Switzerland near Germany, France and Italy in Europe«, versuche ich nach einigen Minuten ihm zu helfen.
»One moment«, sagt er barsch, dann blättert er betont langsam weiter, bis er die gesuchte Stelle in seinem Buch gefunden hat. Er nennt mir den Minutenpreis, dann legt er ein Formular und ein dickes Buch auf die Theke.
Obwohl im Land überall das Chaos zu herrschen scheint, lieben die Inder Formulare und Listen über alles. Auf der Bank, aber auch am Bahnhof oder im Hotel müssen ellenlange Listen mit Namen, Zahlen und Daten ausgefüllt werden, die später kaum noch jemand interessieren. Auch hier auf dem Postamt liegen überall dicke Bücher herum, auf den Schreibtischen stapeln sich Formulare, die von emsigen Bürokräften sortiert, zusammengeheftet und irgendwo versorgt werden.
»Your passport, please.« Mit einer Füllfeder schreibt Mister Ashok, so heißt mein Beamter laut dem Messingschild an seiner Brust, alle Daten aus meinem Pass in sein dickes Buch und trocknet die Schrift mit einem Löschpapier.
Dann schiebt er mir das Formular hinüber. »Phone number and name of the person.«
Folgsam schreibe ich die Daten in die dafür vorgesehenen Felder.
Hinter mir ertönt ein Räuspern. »Permesso, darf ich bitte?«
Bevor ich sagen kann, dass ich noch nicht fertig bin, zwängt sich ein kräftig gebauter Mann neben mir an den Schalter.
»I need a phone call. Now! Adesso!«, sagt der Mann energisch zum Inder, der den Neuankömmling erstaunt anschaut. »It is urgent, important«, unterstreicht der Mann die Dringlichkeit. »Non posso aspettare«, bekräftigt er sein Anliegen auf Italienisch.
»Urgent is nothing«, sagt der Beamte bestimmt und überfliegt das von mir ausgefüllte Formular.
»Really?«, fragt der schwitzende Mann neben mir und schiebt dem Beamten seinen Pass zu.
Mister Ashok blättert ihn durch, zieht einige Banknoten zwischen den Seiten hervor und lässt diese hastig in einer seiner vielen Taschen verschwinden. »Number three«, sagt er und deutet mit dem Kinn auf eine Reihe von Kabinen an der Wand links von uns.
Der Fremde klopft mir auf die Schultern. »Dollar is a strong language.«
Natürlich weiß auch ich, dass ein Bakschisch die Wartezeiten stark verkürzt und jedes Formular überflüssig macht. Leider lassen meine Finanzen diese Art der Beschleunigung nicht zu.
»Wait in number four«, sagt Mister Ashok nun zu mir und schickt mich zu den Kabinen. Meinen Pass behält er als Pfand zurück.
Nach einer Minute in der stickigen Enge klingelt es. Ich nehme den schwarzen Hörer von der Halterung an der Wand. Ein Klicken.
»Müller«, empfängt mich die resolute Stimme von Retos Mutter in der Leitung.
»Guten Tag, Frau Müller«, sage ich, »ist …«
»Wer spricht da? Ich kann Sie kaum verstehen.«
»Hier ist Claudio Mettler«, rufe ich in den Hörer hinein.
»Du brauchst nicht so zu schreien, Claudio«, brummt Mamma Müller. »Ich höre noch gut. Übrigens warst du lange nicht mehr hier«, fährt sie vorwurfsvoll fort.
»Ich konnte nicht«, sage ich unverbindlich, um die Situation nicht zu verkomplizieren.
»Können kann man immer, mein Lieber.«
»Ich nicht, ich bin im Ausland.«
»Ach so. Darum kommst du also nicht mehr zum Milchreisessen zu uns.«
»Genau«, versuche ich das Gespräch wieder unter Kontrolle zu bringen. »Ich wollte …«
»Dafür ist ja jetzt diese Mona öfters vorbeigekommen«, unterbricht mich die Herrin des größten wallenden Busens von St. Moritz.
Mona? Meine Mona geht also bei den Müllers ein und aus und lässt sich an die wunderbaren Fleischberge von Retos Mutter drücken? Das ist echt zu viel für mich.
»Ich muss mit Reto sprechen. Dringend«, sage ich knapp und unfreundlich. »Es eilt, das Gespräch kostet ziemlich viel.«
»Na dann. Einen Moment«, tönt die eingeschnappte Stimme der besten Milchreisköchin in den Alpen.
Gemurmel im Hintergrund.
»Claudio. Was für eine Überraschung«, donnert Müllers Bass an mein Ohr.
»Reto, ich habe etwas für dich.«
»Wo bist du? Du warst plötzlich weg.«
»Das ist eine andere Geschichte.« Gerne würde ich ihm sagen, dass er die Hintergründe sicher kenne, nehme mich aber zusammen, um mein Verkaufsgespräch nicht zu gefährden.
»Wo bist du?«
»In Indien.«
»Indien ist groß«, brummt Müller.
»Varanasi. Aber das tut nichts zur Sache. Ich wollte dir etwas verkaufen.«
»Du mir?«
Sein Müller-Lachen, ich sehe ihn vor mir, wie sein Bauch unter der Weste auf und ab tanzt und er sich an den Hinterkopf greift, um zu sehen, ob das eingeölte Schwänzchen, ein Überbleibsel aus einer fernen, wilden Zeit, immer noch an seinem Hinterkopf hängt.
»Dann erzähl mal.«
»Ich habe viel gearbeitet in letzter Zeit«, lüge ich. »Du weißt wie ich, dass der Tourismus im Engadin an einem toten Punkt angelangt ist. Es braucht neue Ideen, neuen Schwung. Das Gästesegment muss sich wandeln, genauso wie sich die Gesellschaft wandelt.«
»Was hat das mit mir zu tun?«
»Gemeinsam können wir meine Ideen umsetzen. Du hast doch gute Kontakte zu den Tourismusorganisationen.«
»Ich habe überall gute Kontakte.« Ich sehe ihn vor mir, wie er seinen Rücken durchdrückt und stolz zu seiner Mutter hinüberschaut, die unserem Gespräch lauscht.
»Ich weiß. Darum wende ich mich ja an dich.«
»Du bist also in Varanasi«, sagt Reto. »Das trifft sich gut.«
»Warum?«
»Ich habe einen Freund dort in der Nähe. Wie heißt dein Hotel?«
Die Star Lodge ist nicht gerade das, was sich jemand wie er unter einem guten Hotel vorstellt. Zum Glück kann er es nicht sehen.
»Ich wohne in einer kleinen Pension in der Altstadt. Nicht der Rede wert. Ich würde dir gerne kurz meine Ideen vorstellen. Meiner Meinung nach ist …«
»Später, mein Lieber, später«, unterbricht mich Reto.
»Aber ich muss doch wissen, ob mein Konzept etwas wert ist.«
»Ist es, Claudio, das garantiere ich dir jetzt schon. Du musst es nur möglichst schnell hierherbringen, dann haben wir sicher Erfolg damit.«
»Wie viel?«, will ich wissen, denn ich möchte nicht, dass Reto den Preis erst später nach seinem Gutdünken festlegt.
»Tausend. Du musst wissen, dass das viel ist für eine Idee.«
»Zehn. Für St. Moritz ist das läppisch.«
Ein Räuspern dringt an mein Ohr. Reto rechnet. Sicher will er herausfinden, wie viel bei diesem Deal für ihn herausspringt. »Zwei ist das äußerste, dass ich bieten kann.«
»Dann kann ich gleich hier bleiben.«
»Du hast mich überzeugt, Claudio. Ich gebe dir 3.000. Mein letztes Wort.«
»Viereinhalb. Und der Flug geht auf deine Rechnung.«
»Gangster«, krächzt er entnervt.
»Gleichfalls«, gebe ich zurück.
»Wie hieß noch gleich dein Hotel?«
»Star Lodge, aber es ist …«
»Schau, dass du in drei Stunden da bist, mein Freund wird sich mit dir in Verbindung setzen.«
Ohne Gruß hängt Reto ein.
Viereinhalbtausend für eine Idee. Nicht schlecht. Einmal tief durchatmen, dann stoße ich die Türe der Kabine auf und mache mich auf den Weg durch die Halle, um das Gespräch bei Mister Ashok zu bezahlen und meinen Pass auszulösen.
»Posso passare?« Ohne meine Antwort abzuwarten, drängt sich der Italiener an mir vorbei. »Sai, io deve lavorare, I have to work.« Dann baut er sich breitbeinig vor Mister Ashok auf. »How much?«
Der Inder blickt auf einen Zähler, der neben ihm an der Wand hängt. »Eight minutes Europe. Twenty Dollars.«
Der Italiener zieht seine Brieftasche hervor, bezahlt und lässt sich den Reisepass zurückgeben. Dann klopft er mir auf die Schultern. »Buone vacanze, enjoy your holidays.«
Der kann mich mal. Ab heute arbeite ich wieder. Meine Ferien sind eben zu Ende gegangen.
4.
In einem Schreibwarengeschäft kaufe ich mir eine Kartonmappe. Dazu lasse ich mir einen Schreibblock, Leim, Schere und verschiedenfarbige Kugelschreiber einpacken. In den kleinen Buden, die sich auf die vielen Pilger eingestellt haben, suche ich alle möglichen Ansichtskarten zusammen, auf denen der heilige Fluss abgebildet ist.
Die schmalen Gassen der Altstadt sind voller Menschen. Viele zieht es hinunter ans Wasser. Zu meiner Linken führt ein Torbogen in einen Innenhof mit Tempel, der eingeklemmt zwischen den Altstadthäusern steht. Eine Gruppe Gläubige kommt betend vorbei. Irgendwo klingen Glocken. In der Querstraße treffe ich auf einen Beerdigungszug auf dem Weg zum Verbrennungsplatz unten am Ganges. Der in weiße Baumwolltücher eingewickelte Leichnam wird von ernst dreinblickenden Männern mit enormen Schnurrbärten getragen. Dahinter geht ein Mann mit beinahe kahl geschorenem Kopf. Lediglich an seinem Hinterkopf baumelt ein kleiner Zopf und erinnert mich so irgendwie an Reto Müller.
Langsam folge ich dem Zug nach links. Plötzlich ertönt weiter hinten Geschrei. Die Leute weichen an den Straßenrand zurück. Die Leichenträger drängen mich zur Seite, ich komme neben dem Toten zu stehen, der in der Nachmittagshitze einen süßlichen Duft verströmt. Rechts wird das Geschrei lauter, Getrappel ist zu hören. Schwarze Köpfe mit spitzen Hörnern tauchen auf, es sind kräftige Wasserbüffel, die wohl den ganzen Tag eingesperrt waren und nun hinunter an den Fluss wollen. Für sie gibt es kein Halten mehr.
Schreiend räumen Händler ihre Waren beiseite, dann sind die schwarzen Leiber auch schon vorbei und die Straße füllt sich wieder mit Pilgern und Touristen, als wäre nichts geschehen. Vor mir das Tor, das zu den Ghats, den Treppen zum Ganges führt. Leprakranke strecken ihre Hände aus und rufen mir etwas zu. Eine Familie vor mir verteilt reichlich Almosen. Auch ich greife nach dem Geldbeutel und gebe etwas. Das ist sicher gut für mein Karma. Seit meinem letzten Besuch hier am Fluss hat sich einiges verändert, dafür lohnt es sich zu danken. Mein Magen lässt mich in Ruhe und ich habe eine Perspektive für die Zukunft. Es scheint, als ob meine überhastete Flucht aus dem Engadin doch zu etwas gut sein könnte.
Auf den Stufen und Plattformen oberhalb der träge dahinziehenden Fluten haben sich Gurus eingerichtet, die mit den Gläubigen beten. Ein Barbier rasiert einen jungen Mann. Mädchen mit Körben voller Blumenkränzen suchen nach Käufern. Hier ist es mir etwas zu hektisch. Ich gehe langsam flussaufwärts. Abseits vom Pilgerstrom hängen Wäscherinnen in farbigen Kleidern Tücher auf. Auf dem Wasser schaukeln Ruderboote.
»Mister? You want boat trip?« Ein kräftiger Mann mit einem fleckigen Tuch um den Kopf winkt mir zu.
»Yes.« Das ist eine gute Idee.
Etwas zu schnell sind wir uns handelseinig, sicher bezahle ich wieder mal einen überhöhten Preis für Westler. Vorsichtig steige ich ins wacklige Boot und er rudert mit kräftigen Schlägen hinaus aufs gelbbraune Wasser. Die Sonne senkt sich langsam und taucht die Stadt in mildes Licht. Von hier draußen hat man die beste Sicht auf die herrschaftlichen Gebäude und Tempel, die hoch über dem Fluss stehen. Lange Treppen führen bis ans Wasser. Gläubige steigen langsam hinunter, lassen Opfergaben schwimmen und tauchen ein in den heiligen Fluss. In meinen Augen ist das Bad im giftig und ätzend an der Bordwand unseres Ruderbootes vorbeirauschenden Wasser ein Roulettespiel, mich würde es sicher todkrank machen. Vielleicht habe ich auch nur die falsche Einstellung. Glauben müsste man können. Und das Schicksal annehmen.
An manchen Stellen sind die Treppen von den Monsunfluten unterspült worden und eingebrochen. Ganze Tempel sind abgerutscht und stehen schief am Ufer. Am Rand der Altstadt ist der Verbrennungsplatz für die Toten. Rauch steigt von verschiedenen Feuerstellen auf. Betende Angehörige stehen neben den Holzstößen. Zwei streunende Hunde kämpfen um einen Knochen. Ein beißender Geruch dringt mir in die Nase. Er erinnert mich an einen missglückten Grillabend bei meinem Onkel, bei dem das Fleisch verbrannte.
»Let’s go back«, befehle ich hastig.
Auf dem Rückweg vermeide ich es, tief einzuatmen, doch den Geruch nach verbranntem Fleisch bringe ich kaum mehr aus meiner Nase. Erst die jungen Männer, die beim Badeplatz in der Nähe der Pilgertreppen schreiend und prustend Wasserball spielen, bringen mich auf andere Gedanken.
»Look«, sagt mein Ruderer und zeigt auf etwas, das auf der anderen Seite des Bootes vorbeitreibt. Drei Krähen sitzen darauf und sehen interessiert zu uns herüber. Weitere Krähen kreisen etwas abseits davon.
»What ist that?«, will ich wissen.
»Dead holy cow«, sagt er.
Nun taucht auch der Kopf mit den Hörnern an der Wasseroberfläche auf. Die Krähen hacken an dem aufgedunsenen Körper herum. Die langsam flussabwärts treibende Kuh scheint ihnen zu schmecken. So wird das Tier nur noch in Einzelteilen im Golf von Bengalen ankommen. Wenn ich meinen Bootsmann richtig verstanden habe, werden Kühe, Arme und Leute mit Infektionskrankheiten direkt in den Fluss geworfen, ohne die reinigende Verbrennung. Ich weiß schon, warum ich bisher auf ein Bad im Ganges verzichtet habe. Mit toten Kühen und sonstigen unverbrannten Leichen habe ich nicht die geringste Lust, den Fluss zu teilen und ein Opfer der Krähen zu werden.
Ein Blick auf die Uhr. Es ist gleich halb fünf. Kurz nach sechs wird der Freund von Reto Müller in der Star Lodge vorbeischauen. Ich nehme meine Tasche mit den Einkäufen, bezahle für die Bootsfahrt und mache mich auf den Heimweg. Der Andrang der Pilger ist ungebrochen. Sie warten mit ihren Opfergaben geduldig, bis sie an der Reihe sind und die rituellen Waschungen ausführen können.
Unterwegs schaue ich noch im Bengali Coffee House vorbei. An einem Tisch sitzen vier deutsche Weltenbummler. Sie haben ein Brettspiel vor sich aufgebaut und diskutieren lauthals, ob ein Zug nun erlaubt sei oder nicht.
Ich bestelle mir einen Assam und packe mein Schreibzeug aus.
»How was the doctor?«, fragt der Kellner und deutet hinaus auf den Hof mit den Toiletten. »No problems anymore?«
Ich schüttle den Kopf und genieße den ersten Schluck des dunklen Tees. Dann beginne ich, meine Eindrücke aufzuschreiben, Notizen zu machen und einige Diagramme mit verschiedenfarbigen Stiften zu zeichnen. Irgendetwas möchte ich vorweisen können, falls mich der Freund von Reto Müller nach meinem Konzept fragt.
5.
Ein schlicht gekleideter, hagerer Inder sitzt in der Lobby der Star Lodge und blättert in einer Zeitschrift. Als ich reinkomme, erhebt er sich langsam aus dem knarrenden Sessel und kommt auf mich zu.
»Mister Mettler? I’m Tarun. I bring you to Mister Gupta.« Er zeigt hinüber zum dunklen Flur, an dessen Ende mein kleines Zimmer liegt.
Ein Bett, ein Regal, ein blindes Fenster und einen Deckenventilator, viel mehr gibt es da nicht zu sehen. Außer natürlich meinen Rucksack und die herumliegenden Siebensachen, die der schäbigen Absteige etwas Leben einhauchen. Ich staune nicht schlecht, als ich sehe, dass die Türe offen ist, das Zimmer aufgeräumt und mein Gepäck bei der Türe bereitsteht.
Auf dem Bett liegt ein weißes Hemd, eine dunkle Stoffhose und Wäsche. Daneben Duschzeug und ein Frottiertuch. Alles neu.
»What is this?«, frage ich.
»Please take a shower and change your clothes«, sagt Tarun.
Erst jetzt merke ich, wie schmutzig ich bin. Seit meine Magenprobleme begannen, fehlte mir die Energie, um mich umzuziehen. Jetzt ändert sich alles, denke ich, und gehe unter die Dusche. Wenig später bin ich sauber und unternehmungslustig zurück im Zimmer.
»Are you ready to leave?«, fragt Tarun, nimmt, ohne eine Antwort abzuwarten, den Rucksack und geht hinaus.
Ein Blick zurück: Es liegt nichts mehr herum, nur etwas Staub unter dem Bett, der aus der Zeit vor meinem Aufenthalt stammt und an frühere Bewohner des Zimmers erinnert. Der Hotelmanager reicht mir die Hand. Bezahlen muss ich nichts, das hat bereits mein indischer Begleiter für mich erledigt.
Tarun führt mich durch die belebten Gassen. In den kleinen Garküchen wird gebraten und gekocht. Es riecht verführerisch nach Curry und Lammfleisch. Am Rand der Altstadt winkt mein Begleiter eines der schwarzen Taxis der Marke Ambassador mit gelbem Dach und ebenso bemalten Kotflügeln heran.
»Where are we going?«, frage ich.
»You will see«, sagt Tarun und schweigt wieder.
Es ist das erste Mal in Indien, dass ich in einem Auto sitze. Bei meinen Reisen war ich nur mit dem Zug oder dem Bus unterwegs. In den Städten ging ich zu Fuß, Zeit hatte ich ja genug. Meistens blieb ich im Zentrum, wo sich auch die billigen Gästehäuser und die Restaurants für westliche Rucksackreisende befinden. Und weil ich vor allem am pulsierenden Alltagsleben interessiert war, musste ich nie weit gehen.
Nun also diese Premiere. Fluchend und gestikulierend manövriert der Taxifahrer durch den dichten Abendverkehr. Eine Hand hat er am Steuer, die andere dreht nervös an den Knöpfen des Radios und betätigt zwischendurch die Hupe. Neben Autos, Lastwagen und Bussen bewegen sich auch Rikschas, Ochsengespanne und Handwagen auf der Straße. Junge Burschen auf Mopeds und Rollern kurven in halsbrecherischer Fahrt um die anderen Verkehrsteilnehmer herum. Zwischendurch überholen wir Radfahrer, die ihre Drahtesel mit großen Taschen und Körben behängt haben. Dazu kommen die vielen Fußgänger auf dem Gehsteig, die plötzlich auf die Fahrbahn treten und unserem Fahrer einen lauten Wortschwall entlocken. Es gleicht einem Wunder, dass wir ohne Unfall unser Ziel erreichen. Nach einer halben Stunde hält der Ambassador vor einem eleganten Betonbau. ›Varanasi Radisson‹ steht über dem Eingang.
»Come on, Mister Mettler, Mister Gupta is waiting.«
Ich will meinen Rucksack aus dem Kofferraum holen, doch Tarun winkt ab. Er gibt dem Taxifahrer Geld und erklärt ihm, was mit meinem Gepäck zu tun sei.
Wir betreten das Hotel. Teppiche dämpfen unsere Schritte, Portiers in Uniformen stehen herum. Es ist kühl hier drin. Aircondition. Nicht schlecht nach der Hitze draußen auf der Straße. Nach der Taxifahrt folgt die zweite Premiere: Seit meiner Ankunft war ich noch nie in einem Hotel, das mehr als den Viertel eines Sterns verdient hätte. Außer einem müden Manager gab es in den Absteigen meiner Preisklasse nur wenig Personal. Es war oft laut in den Lodges der Rucksackreisenden, es roch und war selten sauber. Dafür lernte ich viele interessante Menschen und ihre Geschichten kennen.
»Go with him.« Tarun sagt etwas zu einem der Angestellten, dieser schüttelt den Kopf als Zeichen der Zustimmung und führt mich einen langen Flur entlang. Ich bin froh, dass ich geduscht habe und neue Kleider trage, sonst hätte mich wohl kaum jemand ins Radisson eingelassen.
Die Wände der Bar sind dunkel getäfelt. Den Boden bedecken wertvolle Teppiche. Am Tresen, der mit dicken Messingstangen versehen ist, sitzt ein rundlicher Inder in einem eleganten Anzug vor seinem Bier.
»Mister Gupta?«, frage ich.
Er zeigt auf den Barhocker neben sich.
»My name is Claudio Mettler from Switzerland. I have a … project«, stammle ich und setze mich neben ihn.
»I know.« Er schaut auf. »Wollen Sie ein Bier?«
Ich traue meinen Ohren nicht. »Sie sprechen Deutsch?«
»Sie versuchen es ja auch mit Englisch.«
Grinsend bestellt er beim herbeigeeilten Kellner ein Bier für mich. Dann streicht er sich die Haare nach hinten. Die Bewegung erinnert mich an Reto Müller, kurz bevor er ein Geschäft abschließt und sein Gegenüber um einige Tausender erleichtert.
»Ich habe in Berlin studiert«, erklärt er. »Berlin Ost.«
»Welche Fächer?«
Der Kellner bringt mein Bier.
»Was glauben Sie?« Er hebt sein Glas.
»Vielleicht Wirtschaft?«
»Möglich.« Gupta nimmt einen großen Schluck. Voller Genuss leckt er den Schaum von seiner Oberlippe. »Stimmt aber nicht.«
»Dann ist es Mathematik. Nein, warten Sie. Kunstgeschichte Asiens? Oder etwa Chorgesang?«
»Was haben Sie gelernt, Mettler?«
»Ich bin studierter Wanderleiter und diplomierter Organisator für Trekkingtouren.«
»Interessant«, sagt Gupta. »Leider weiß ich nicht mehr, für welche Fächer ich eingeschrieben war.«
»Dann konnten Sie gar nichts lernen in Berlin?«
»An der Uni brachten sie mir kaum etwas bei, darum ging ich auch nicht hin. Dafür lernte ich auf der Straße. Kaufen und verkaufen, Abschöpfen des Mehrwertes, Ausnutzen von Mangellagen. Das ganze Programm. Dazu kam der kleine Grenzverkehr mit unbeschränkten Möglichkeiten für initiative Händler. Bald schon arbeitete ein Dutzend Deutsche für mich. Auf beiden Seiten der Mauer. Spreewaldgurken gegen Nutella, Wodka gegen Westjeans.«
An den Wänden der Bar hängen gerahmte Fotos aus der Kolonialzeit in Schwarz-Weiß. Engländer mit Tropenhelmen und Khakihemden posieren mit ihren Gewehren neben toten Tigern und erlegten Elefanten.
»Und warum sind Sie nach Indien zurückgekommen?«
»Weil da irgendwelche Politiker auf die dumme Idee kamen, die Mauer einzureißen. Plötzlich konnte jeder Depp die Grenze überqueren. Und meine Geschäfte waren dahin.«
»Das tut mir leid. Aber die Demokratie lässt sich eben nicht aufhalten.«
»Demokratie ist ein System für Schwachköpfe«, brummt Gupta, nimmt den letzten Schluck Bier und steht auf. »Kommen Sie, gehen wir essen.«
Mein Gastgeber legt einige Scheine auf den Tresen und führt mich hinüber in einen Saal. Hier stehen mehrere Inder und einige Europäer herum.
»Teppichhändler aus der Gegend«, erklärt Gupta, »und Einkäufer aus Holland.«
»Darf ich kurz stören?«, fragt eine weibliche Stimme hinter uns.
Wir drehen unsere Köpfe. Da steht eine junge Frau mit kurzen Haaren und lächelt. Sie trägt einen weinroten Punjabi, bestehend aus Leggins und einer langen Bluse, die ihr bis zur Mitte der Oberschenkel reicht.
»Sie stören nicht, Vanessa.«
Gupta stellt uns vor, Vanessa Sneijder aus Holland, Claudio Mettler aus der Schweiz.
Während sich der Inder seinen anderen Gästen widmet, hole ich für die Holländerin ein Glas Weißwein.
»Was machst du hier in Indien«, fragt Vanessa.
»Ich bin im Tourismussektor tätig.« Ohne mit der Wimper zu zucken, erkläre ich Vanessa, dass ich den hiesigen Markt anschaue und Analysen erstellen würde.
»Interessant«, sagt sie. »Kann man davon leben?«
Ich zucke mit den Schultern. Diese Antwort muss für den Moment ausreichen.
»Dear friends from Holland«, unterbricht der Bass von Mister Gupta unsere Unterhaltung, »I am pleased to welcome you.« Wir treten näher und lassen uns erklären, dass im Hinterland von Varanasi die schönsten Teppiche Indiens geknüpft werden. Sie seien bekannt für die Dichte der Knoten, für ihre Farben und die Muster, die bereits zu Zeiten von … Es folgt eine lange Liste von Namen, der ich nicht folgen kann.
»Hast du das gesehen?«, flüstert Vanessa und deutet hinüber zu einem langen Tisch, auf dem die Kellner ein Buffet aufbauen. »Das Beste aus der indischen Küche.«
»Schon wieder Curry?« Das ist mir nur so herausgerutscht. Wirklich peinlich.
»Banause!«, zischt sie. »Hätte der Herr lieber ein paniertes Schnitzel mit Pommes und eine Kugel Vanilleeis gehabt?«
Da hat mich die holländische Dame glatt durchschaut, doch ich lasse mir nichts anmerken und spiele stattdessen den Experten. »Ich wollte nur sagen, dass Curry eben nicht überall das Gleiche ist.«
»Da hast du auch wieder recht. Warst du schon in Kaschmir? Die machen dir ein Tikka, davon können die hier nur träumen.«