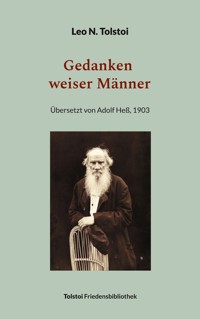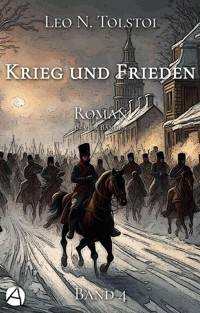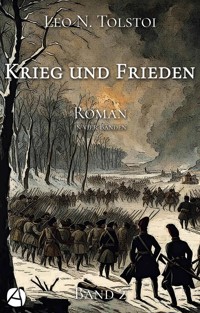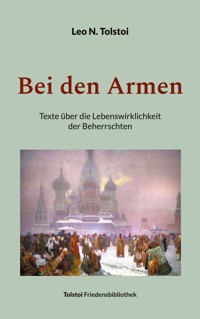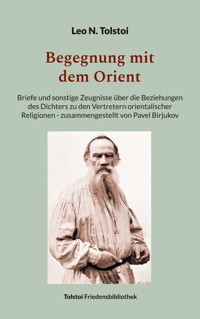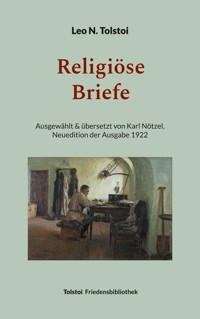2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Napoleon gegen Russland
- Sprache: Deutsch
Tolstois episches Meisterwerk verflechtet das Leben privater und öffentlicher Personen während der Zeit der napoleonischen Kriege und der französischen Invasion in Russland. Die Schicksale der Rostows und der Bolkonskys, von Pierre, Natascha und Andrej, sind eng mit der nationalen Geschichte verbunden, die sich parallel zu ihrem Leben abspielt. Bälle und Soireen wechseln sich ab mit Kriegsräten und den Machenschaften von Staatsmännern und Generälen, Szenen heftiger Kämpfe mit alltäglichen menschlichen Leidenschaften in einem Werk, dessen außergewöhnliche Vorstellungskraft nie übertroffen wurde. Die vielen kleinen und großen Charaktere scheinen zu handeln und sich zu bewegen, als wären sie durch Schicksalsfäden miteinander verbunden, während der Roman unerbittlich Ideen von freiem Willen, Schicksal und Vorsehung hinterfragt. Tolstois Darstellung der ehelichen Beziehungen und Szenen der Häuslichkeit ist ebenso wahrheitsgetreu und ergreifend wie die großen Themen, die ihnen zugrunde liegen. Dies ist der dritte Band von insgesamt vier Bänden des Meisterwerks von Leo N. Tolstoi in der Übersetzung von L. A. Hauff.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LEO N. TOLSTOI
KRIEG UND FRIEDEN
Roman
in vier Bänden
BAND 3
In der Übersetzung
von
L. A. Hauff
KRIEG UND FRIEDEN wurde in der hier zugrundeliegenden Übersetzung zuerst veröffentlicht von O. Janke, Berlin 1893.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2024
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
BAND 3
ISBN 978-3-96130-624-4
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
ROMANE von JANE AUSTEN
im apebook Verlag
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
im apebook Verlag
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Krieg und Frieden. Band 3
Impressum
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
ApePoints sammeln
Zu guter Letzt
133
Am 29. Mai verließ Napoleon Dresden, wo er drei Wochen zugebracht hatte, umgeben von einem Hof von Fürsten, von Herzögen, Königen und sogar einem Kaiser. Vor seiner Abreise schmeichelte Napoleon den Prinzen und Königen, welche das verdient hatten, und gab den Königen und Fürsten, mit denen er unzufrieden war, seine Ungnade zu erkennen, beschenkte die österreichische Kaiserin mit Brillanten und umarmte zärtlich die Kaiserin Maria Luise, welche die Trennung kaum noch ertragen zu können schien. Obgleich die Diplomatie noch fest an die Möglichkeit des Friedens glaubte, und obgleich Napoleon selbst an Kaiser Alexander einen Brief geschrieben hatte, worin er ihn »mein Herr Bruder« nannte und versicherte, er wünsche keinen Krieg, fuhr er doch zur Armee ab und gab auf jeder Station neue Befehle, um den Marsch der Armee gegen Osten zu beschleunigen. Er fuhr in einem sechsspännigen Reisewagen, umgeben von seinen Adjutanten, über Posen, Thorn, Danzig, nach Königsberg; überall kamen ihm Tausende von Menschen zitternd und zögernd entgegen.
Am 10. Juni holte er die Armee ein und übernachtete im Walde von Wilkowischki, wo auf dem Gute eines polnischen Grafen Quartier für ihn bereitgehalten wurde.
Nachdem Napoleon am anderen Tag die Armee überholt hatte, fuhr er im Wagen an den Niemen, um die Örtlichkeit des Übergangs zu besichtigen. Er trug eine polnische Uniform und fuhr ans Ufer.
Als er am jenseitigen Ufer Kosaken und die unabsehbare Ebene erblickte, gab er, für alle unerwartet und allen strategischen und diplomatischen Rücksichten entgegen, den Befehl zum Einmarsch, und am nächsten Morgen begann die Armee den Niemen zu überschreiten.
Frühmorgens am 12. Juni trat er aus dem Zelt, welches am Ufer des Niemen für ihn errichtet worden war, und blickte durch ein Fernrohr nach den Heersäulen, welche aus dem Wald von Wilkowischki hervorkamen und sich über die drei Brücken, die über den Niemen geschlagen waren, ergossen. Den Truppen war es bekannt, daß der Kaiser zugegen war, sie suchten ihn mit ihren Blicken, und als sie vor dem Zelt auf der Höhe seine Gestalt im Mantel und Hut erblickten, warfen sie die Mützen in die Höhe und riefen: »Vive l'empereur!« – »O, wenn der Kaiser selber da ist, dann geht's vorwärts! Jetzt gibt's einen lustigen Feldzug!« – »Sieh doch, da ist er! Hurra!« – »Und dort sind diese asiatischen Steppen! Wirklich ein sonderbares Land! Auf Wiedersehen. Beaugieu! Wenn ich Gouverneur von Indien bin, mache ich dich zum Minister von Kaschmir.« – »Hurra! Siehst du, da ist er! Ich habe ihn zweimal gesehen, den kleinen Korporal!« riefen die Stimmen alter und junger Soldaten von den verschiedensten Charakteren und Lebensstellungen. Auf allen diesen Gesichtern sah man nur Freude über den Anfang des langersehnten Feldzugs und Enthusiasmus für den Mann im grauen Rock, der auf dem Berge stand.
Am 13. Juni brachte man Napoleon ein kleines, arabisches Vollblutpferd. Er stieg auf und ritt im Galopp zu einer der Brücken über den Niemen, unaufhörlich von den enthusiastischen Zurufen der Soldaten begleitet, die er augenscheinlich nur ertrug, weil man den Soldaten nicht verbieten konnte, ihre Begeisterung für ihn auf diese Weise auszudrücken. Aber diese Zurufe waren ihm lästig und störend. Er ritt über die schwankende Schiffbrücke hinüber, wandte sich scharf zur Linken und ritt im Galopp in der Richtung nach Kowno weiter, wohin seine glückstrahlenden, reitenden Gardejäger ihm vorausgaloppierten. Als er an die Wilja kam, hielt er neben einem polnischen Ulanenregiment an, das am Ufer stand.
»Vivat!« schrien die Polen ebenso enthusiastisch. Ihre Reihen lösten sich auf und sie drängten einander, um ihn zu sehen. Napoleon stieg vom Pferde und setzte sich auf einen Balken, der am Ufer lag. Auf ein stummes Zeichen reichte man ihm das Fernrohr. Er legte es auf die Schulter eines herbeigeeilten Pagen und blickte nach dem anderen Ufer hinüber. Dann betrachtete er lachend die Landkarte, welche auf dem Balken ausgebreitet war. Ohne den Kopf zu erheben, sagte er etwas, und zwei seiner Adjutanten galoppierten zu den polnischen Ulanen.
»Was hat er gesagt?« fragten die polnischen Ulanen, als einer der Adjutanten sie erreichte.
Sie brachten den Befehl, die Furt aufzusuchen und auf das jenseitige Ufer überzusetzen. Der polnische Ulanenoberst, ein schöner, alter Mann, blickte errötend vor Aufregung den Adjutanten an und fragte, ob es ihm erlaubt sein werde, mit seinen Ulanen den Fluß zu durchschwimmen, ohne die Furt aufzusuchen. Wie ein Knabe, der um die Erlaubnis bittet, ein Pferd zu besteigen, erwartete er gespannt die Erlaubnis, den Fluß unter den Augen des Kaisers zu durchschwimmen. Der Adjutant sagte, wahrscheinlich werde der Kaiser über diesen Eifer nicht unzufrieden sein.
Kaum hatte der Adjutant dies gesagt, als der alte Offizier mit strahlenden Augen den Säbel in die Höhe hob und rief: »Vivat!« und den Ulanen befahl, ihm zu folgen. Er gab dem Pferde die Sporen und ritt im Galopp an den Fluß. Er trieb sein Pferd an und ritt in den reißenden Strom. Die Ulanenschwadron galoppierte ihm nach. Es war kalt in der Mitte des Stroms. Die Ulanen hingen sich aneinander, einige Pferde sanken ein und die Leute bemühten sich, nach dem anderen Ufer zu schwimmen, und obgleich eine halbe Werst weiter ein Übergang war, waren sie doch stolz darauf, über diesen Fluß zu schwimmen oder zu ertrinken unter den Augen des Mannes, der auf dem Balken saß und nicht einmal nach ihnen sah, was sie machten. Der zurückkehrende Adjutant wählte einen passenden Augenblick, um den Kaiser auf die Hingebung der Polen für seine Person aufmerksam zu machen. Der kleine Mann im grauen Mantel stand auf, rief Berthier zu sich und ging mit ihm am Ufer auf und ab, gab Befehle und blickte zuweilen gemütlich nach den ertrinkenden Ulanen.
Es war ihm nicht neu, daß seine Anwesenheit an allen Enden der Welt überall die Soldaten in einen sinnlosen Enthusiasmus versetzte.
Etwa vierzig Ulanen ertranken im Fluß, obgleich man Boote zur Hilfe sandte. Die meisten kehrten an das diesseitige Ufer zurück, der Oberst und einige Ulanen aber durchschwammen den Fluß und erstiegen mit Mühe das andere Ufer. Sobald sie es erstiegen hatten, riefen sie: »Vive l'empereur!« und blickten entzückt nach der Stelle, wo Napoleon stand.
Am Abend gab Napoleon den Befehl, dem polnischen Obersten, der sich ganz ohne Not in den Fluß gestürzt hatte, den Orden der Ehrenlegion zu verleihen, dessen Haupt Napoleon war.
134
Währenddessen hielt sich der russische Kaiser seit mehr als zwei Wochen in Wilna auf, wo er Revuen und Manöver abhielt. Nichts war zum Kriege vorbereitet, den alle erwarteten. Es existierte kein Kriegsplan, von den drei Armeen hatte jede ihren besonderen Oberkommandierenden, aber einen Befehlshaber über alle Armeen gab es nicht und der Kaiser übernahm diesen Posten nicht.
Je länger der Kaiser in Wilna war, desto weniger geschah für den bevorstehenden Krieg. Die Umgebung des Kaisers schien nur an Bälle und Festlichkeiten zu denken. An demselben Tag, wo Napoleon den Befehl zum Überschreiten des Niemen gab und seine Vortruppen die Kosaken zurückdrängten und die russische Grenze überschritten, war Kaiser Alexander auf einem Ball, den die Generaladjutanten vorbereitet hatten, im Landhaus des Generals Grafen Bennigsen, der bei Wilna ein Gut besaß.
Der Ball war glänzend. Selten hatten sich so viele Schönheiten auf einer Stelle versammelt. Auch Boris Drubezkoi, welcher seine Frau in Moskau zurückgelassen hatte, war zugegen, und obgleich er kein Generaladjutant war, hatte er sich doch mit einer bedeutenden Summe für die Kosten des Festes unterschrieben. Boris war jetzt reich, suchte nicht mehr nach Gönnerschaften, sondern stand auf gleichem Fuß mit hohen Würdenträgern. Um zwölf Uhr nachts wurde noch getanzt. Helene, die keinen würdigen Tänzer hatte, forderte selbst Boris zur Masurka auf. Gleichmütig blickte er über die glänzenden Schultern Helenes weg, welche aus einem dunklen Gazekleid mit Goldstickerei hervorsahen, erzählte von alten Bekannten und beobachtete dabei beständig den Kaiser, der nicht tanzte und bald an den einen, bald an den anderen freundliche Worte richtete, wie nur er sie auszusprechen verstand.
Beim Anfang der Masurka bemerkte Boris, daß der Generaladjutant Balaschew sich dem Kaiser näherte und stehenblieb, während der Kaiser mit einer polnischen Dame sprach. Der Kaiser blickte ihn fragend an und begriff, daß Balaschew eine wichtige Meldung zu machen habe. Er nickte der Dame zu und wandte sich an den General. Nach den ersten Worten desselben drückte sich auf dem Gesicht des Kaisers Verwunderung aus. Er nahm Balaschew unter den Arm und ging mit ihm durch den Saal, wo sich sogleich eine weite Gasse vor ihm öffnete. Boris bemerkte das aufgeregte Gesicht Araktschejews, des Kriegsministers, welcher Balaschew neidisch nachsah und dem Kaiser folgte.
Aber der Kaiser bemerkte ihn nicht und ging mit Balaschew in den hell erleuchteten Wintergarten.
Während Boris tanzte, quälte ihn beständig die Neugierde, was Balaschew Neues zu melden hatte, und wie er das früher als andere erfahren könnte. Als er eine Dame zu wählen hatte, flüsterte er Helene zu, er wolle die Gräfin Potocki auffordern, welche auf den Balkon hinausgegangen sei. Er glitt über das Parkett bis zur Eingangstür des Saales, und als er den Kaiser auf der Terrasse erblickte, hielt er an. Der Kaiser hatte sich mit Balaschew der Tür wieder zugewandt. Boris drückte sich diensteifrig, als ob er nicht mehr Zeit habe, zurückzutreten, an die Wand und senkte den Kopf.
Mit der Aufregung eines persönlich beleidigten Mannes sprach der Kaiser folgende Worte: »Ohne Kriegserklärung in Rußland einzufallen! Ich werde nur dann Frieden schließen, wenn nicht ein bewaffneter Feind mehr auf meinem Boden steht«, sagte er. Der Kaiser schien über die Ausdrucksform seines Gedankens sehr befriedigt zu sein, aber unzufrieden darüber, daß Boris seine Worte gehört hatte.
»Es soll niemand davon erfahren«, fügte der Kaiser mit finsterer Miene hinzu. Boris begriff, daß das ihm galt, schloß die Augen und senkte den Kopf. Der Kaiser trat wieder in den Saal und blieb noch eine halbe Stunde auf dem Ball.
So hatte Boris zuerst die Nachricht vom Übergang der Franzosen über den Niemen erfahren und benutzte dies auf geschickte Weise, um einigen hochgestellten Persönlichkeiten bemerklich zu machen, daß er vieles wisse, was anderen verborgen sei und dadurch in der Meinung dieser Personen zu steigen.
*
Diese Nachricht kam besonders unerwartet nach einer monatelangen Erwartung, und auf einem Ball in der ersten Aufregung hatte der Kaiser diesen später berühmt gewordenen Ausspruch gefunden, der ihm selbst so gefiel. Als der Kaiser von dem Ball zurückgekehrt war, sandte er um zwei Uhr nachts nach seinem Sekretär Schischkow und befahl, eine Proklamation an die Truppen zu schreiben, in der durchaus seine Worte wiederholt werden sollten, daß er nicht Frieden schließen werde, bis kein bewaffneter Franzose mehr auf russischem Boden stehe. Am folgenden Morgen schrieb er einen Brief an Napoleon, worin er seine Bereitwilligkeit zum Frieden aussprach.
135
Am 13. Juni um zwei Uhr nachts ließ der Kaiser Balaschew zu sich rufen, las ihm seinen Brief an Napoleon vor und trug ihm auf, den Brief dem französischen Kaiser persönlich zu übergeben. Der Kaiser hatte jene Worte in dem Brief an Napoleon nicht angewendet, weil er sie hier nicht für angebracht hielt, wo er einen letzten Versuch zur Versöhnung machen wollte, aber er schärfte Balaschew ein, sie mündlich Napoleon zu wiederholen.
Begleitet von einem Trompeter und zwei Kosaken ritt Balaschew gegen Morgen nach dem Dorfe Rykonty zu dem französischen Vorposten und wurde von einem französischen Kavallerieposten angehalten. Der französische Husarenunteroffizier in dunkelblauer Uniform und Pelzmütze rief Balaschew zu, zu halten, und als dieser im Schritt weiterritt, rief der Unteroffizier zornig den russischen General an, ob er taub sei. Balaschew nannte seinen Namen, worauf der Unteroffizier einen Soldaten zum Offizier schickte. Eben ging die Sonne auf und die Luft war frisch und tauig. Auf dem Wege vom Dorf wurde eine Herde fortgetrieben. Während Balaschew sich nach dem Offizier umsah, blickten die Kosaken und die Franzosen einander neugierig an. Ein französischer Husarenoberst, der eben erst das Bett verlassen zu haben schien, kam auf einem schönen, wohlgenährten Pferd, begleitet von zwei Husaren, vom Dorf her. Es war die erste Zeit des Feldzuges, wo die Truppen noch in bester Verfassung und in jener heiteren, unternehmungslustigen Stimmung sich befinden, welche immer den Anfang eines Feldzuges begleitet. Der französische Oberst unterdrückte mit Mühe ein Gähnen, war aber höflich und begriff die Bedeutung Balaschews. Er führte ihn an den Soldaten vorüber hinter die Kette und äußerte, sein Wunsch, dem Kaiser vorgestellt zu werden, werde wahrscheinlich sogleich erfüllt werden, da sich das Hauptquartier, soviel er wisse, in der Nähe befinde. Als sie durch das Dorf und an einem Krug vorbeigeritten waren, kam ihnen eine Gruppe Reiter entgegen. An der Spitze derselben erblickten sie einen hochgewachsenen Reiter mit einem Federhut, mit schwarzen, auf die Schultern herabhängenden Haaren und einem roten Mantel. Dieser Reiter kam Balaschew im Galopp entgegen, während seine Edelsteine an Armbändern und Goldstickereien in der Sonne glänzten.
»Der König von Neapel!« flüsterte der französische Oberst.
Es war wirklich Murat, welcher jetzt König von Neapel genannt wurde, obgleich dies ganz unbegreiflich war. Er war so fest überzeugt, daß er wirklich König von Neapel sei, daß er am Abend vor seiner Abreise von Neapel, als einige Italiener ihm bei einem Spaziergang mit seiner Frau durch die Straßen zuriefen: »Es lebe der König!« mit melancholischem Lächeln zu seiner Gattin sagte: »Die Unglücklichen, sie wissen nicht, daß ich sie morgen verlasse.«
Als er den russischen General erblickte, warf er feierlich, in königlicher Haltung den Kopf zurück und blickte fragend den französischen Oberst an. Dieser meldete seiner Majestät den Auftrag Balaschews, dessen Namen er nicht aussprechen konnte.
»De Bal-macheve! Sehr angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen, General!« sagte der König mit gnädiger Gebärde. Sogleich aber verließ ihn die königliche Würde und er verfiel in seinen gewohnten Ton.
»Nun, wie ist's, General, es scheint, es kommt zum Kriege?« sagte er.
»Der Kaiser wünscht keinen Krieg, wie Eure Majestät sehen werden«, sagte Balaschew, der bei jeder Gelegenheit die Anrede »Eure Majestät« anwendete und durch alle Fälle deklinierte.
Das Gesicht Murats strahlte in einfältigem Vergnügen. Die königliche Würde legte Verpflichtungen auf, er empfand die Notwendigkeit, mit dem Gesandten Alexanders von politischen Angelegenheiten als König und Verbündeter zu sprechen. Endlich richtete er sich feierlich auf und sagte mit einer königlichen Handbewegung: »Ich halte Sie nicht länger zurück, General, und wünsche Ihnen allen Erfolg.« Dann ritt er mit wallenden Federn zu seiner Suite zurück, die ihn ehrerbietig erwartete. Balaschew erwartete nach den Worten Murats, sehr bald dem Kaiser vorgestellt zu werden, aber er wurde zunächst nur zum Marschall Davoust geführt.
136
Davoust war der Araktschejew des Kaisers Napoleon. Araktschejew war kein Feigling, aber ebenso pünktlich und grausam und wußte seine Ergebenheit nicht anders auszudrücken als durch Grausamkeit. Im Mechanismus eines Reichsorganismus sind solche Leute notwendig, wie Wölfe im Organismus der Natur, und sie sind immer vorhanden, wie wenig auch ihre Anwesenheit an der Spitze der Regierung erklärlich scheint. Nur durch diese Notwendigkeit wird es erklärlich, wie der grausame, ungebildete, unhöfliche Araktschejew, der den Grenadieren selbst die Schnurrbarte in die Höhe drehte und aus Nervenschwäche keine Gefahr ertragen konnte, bei dem ritterlichen, edlen und milden Charakter Alexanders die Obergewalt erlangen konnte.
Balaschew traf Marschall Davoust in der Scheune eines Bauernhauses an, auf einem Fäßchen sitzend und mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt. Ein Adjutant stand neben ihm. Davoust hätte ein besseres Unterkommen finden können, aber er war einer jener Menschen, welche absichtlich die düstere Umgebung aufsuchen, um das Recht zu haben, ein finsteres Wesen zu zeigen. »Wie kann ich an die glückliche Seite des Menschenlebens denken, wenn ich hier, wie Sie sehen, in einer schmutzigen Scheune auf einem Fäßchen sitze und arbeite«, sagte seine Miene. Er vertiefte sich noch mehr in seine Arbeit, und als er auf dem Gesicht Balaschews den unangenehmen Eindruck dieses Empfangs wahrnahm, erhob er den Kopf und fragte kühl, was er wünsche. Balaschew schrieb diesen Empfang dem Umstand zu, daß Davoust nicht wußte, daß er Generaladjutant des Kaisers Alexander und dessen Vertreter sei, und beeilte sich daher, Davoust seinen Stand und seine Bedeutung mitzuteilen. Wider Erwarten aber wurde Davoust noch finsterer und unhöflicher.
»Wo ist Ihr Brief?« sagte er. »Geben Sie her! Ich werde ihn dem Kaiser übersenden.«
Balaschew erwiderte, er habe Befehl, den Brief dem Kaiser selbst zu übergeben.
»Die Befehle Ihres Kaisers werden in Ihrer Armee ausgeführt«, erwiderte Davoust, »hier aber müssen Sie tun, was man Ihnen sagt.«
Balaschew zog den Brief aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch. Davoust ergriff ihn und las die Adresse.
»Es steht Ihnen frei, mir Achtung zu erweisen oder nicht«, sagte Balaschew, »aber erlauben Sie mir, zu bemerken, daß ich die Ehre habe, Generaladjutant Seiner Majestät zu sein!«
»Man wird Ihnen erweisen, was Ihnen zukommt«, sagte Davoust, sichtlich befriedigt über die Aufregung Balaschews. Er steckte den Brief in die Tasche und verließ die Scheune. Bald darauf trat ein Adjutant des Marschalls, Herr de Castrie, ein und führte Balaschew in ein für ihn bereitetes Quartier. Balaschew speiste an diesem Tage in der Scheune mit dem Marschall auf einer Tür, welche über zwei Fässer gelegt war. Am anderen Tag fuhr Davoust frühmorgens davon, nachdem er Balaschew zu sich berufen und ihm eindringlich gesagt hatte, er bitte ihn, hierzubleiben und mit der Bagage weiterzurücken, wenn er dazu Auftrag habe, aber mit niemand zu sprechen, außer mit Herrn de Castrie.
Nach viertägiger Einsamkeit und Langweile im Gefühl der Ohnmacht und Nichtigkeit, das besonders drückend war, nachdem er sich vor kurzem erst in der Sphäre der Macht befunden hatte, wurde Balaschew mit der Bagage nach Wilna geführt, das die Franzosen eingenommen hatten. Am anderen Tage teilte ihm ein Kammerherr mit, Napoleon wünsche ihn in Audienz zu empfangen. Vier Tage zuvor hatten vor dem Hause, in das Balaschew geführt wurde, Schildwachen vom Preobraschenskischen Regiment gestanden. Jetzt standen an derselben Stelle französische Grenadiere und eine glänzende Suite von Adjutanten und Generalen erwartete Napoleons Herauskommen. Sein Reitpferd stand vor der Vortreppe des Hauses bereit neben dem Mameluken Rustan. Napoleon empfing Balaschew in demselben Hause in Wilna, von dem aus Alexander ihn abgesandt hatte.
137
Obgleich Balaschew an den Luxus des Hoflebens gewöhnt war, setzte ihn doch der Glanz am Hofe Napoleons in Erstaunen. Der Adjutant, Graf Turenne, führte ihn in ein großes Empfangszimmer, wo viele Generale, Kammerherren und polnische Magnaten warteten, von denen Balaschew viele am Hofe des russischen Kaisers gesehen hatte. Nach kurzen Worten trat ein Kammerherr in das Empfangszimmer, verbeugte sich höflich vor Balaschew und lud ihn ein, ihm zu folgen. Balaschew trat in ein kleines Empfangszimmer, von dem eine Tür in das Kabinett führte, dasselbe, aus dem ihn Kaiser Alexander abgesandt hatte. Rasch öffneten sich beide Flügeltüren, alles verstummte, und aus dem Kabinett kam Napoleon mit raschen, entschiedenen Schritten, in blauer Uniform, mit weißer Weste und Reitstiefeln. Sein weißer, dicker Hals trat scharf hervor aus dem schwarzen Kragen der Uniform, er war mit kölnischem Wasser parfümiert. Auf seinem Gesicht mit dem scharf hervortretenden Kinn lag der Ausdruck kaiserlicher Majestät und Gnade. Er beantwortete die tiefe Verbeugung Balaschews mit einem Kopfnicken, trat auf ihn zu und begann sogleich zu sprechen, wie ein Mann, der jede Minute seiner Zeit zu schätzen weiß.
»Guten Tag, General«, sagte er. »Ich erhielt den Brief des Kaisers Alexander, den Sie brachten, und bin sehr erfreut, Sie zu sehen.« Er blickte mit seinen großen Augen Balaschew in das Gesicht, sah aber dann sogleich daran vorüber. Augenscheinlich interessierte ihn die Persönlichkeit Balaschews nicht, sondern nur das, was in seiner eigenen Seele vorging. Alles, was außer ihm selbst lag, hatte für ihn keine Bedeutung.
»Ich wünsche keinen Krieg«, sagte er, »aber man hat mich dazu genötigt. Auch jetzt bin ich bereit, alle Erklärungen entgegenzunehmen, die Sie mir geben können«, begann er klar und kurz. Nach dem gemessenen, ruhigen Ton, in dem Napoleon sprach, war Balaschew fest überzeugt, daß er den Frieden wünsche und in Verhandlungen eintreten wolle. Balaschew erwiderte, der Kaiser Alexander vermöge keinen genügenden Grund zum Kriege zu erkennen und habe auch mit England keinerlei Beziehungen.
»Für jetzt noch nicht«, bemerkte Napoleon, nickte aber wieder, zum Zeichen, daß Balaschew fortfahren möge. Nachdem Balaschew die Erklärungen abgegeben hatte, zu denen er beauftragt worden war, erinnerte er sich an die Worte: »bis kein bewaffneter Feind mehr auf russischem Boden stehe«, aber er vermochte diese Worte nicht in ihrer ganzen Schroffheit auszusprechen und sagte nur: »Unter der Bedingung, daß die französischen Truppen hinter den Niemen zurückgehen.«
Napoleon bemerkte Balaschews Verlegenheit bei diesen Worten. Sein Gesicht zuckte, er sprach immer lauter und hastiger, und Balaschew bemerkte unwillkürlich, wie Napoleons linke Wade zuckte.
»Ich wünsche den Frieden nicht weniger als Kaiser Alexander«, begann er, »aber was verlangt man von mir?«
»Die Zurückziehung Ihrer Truppen hinter den Niemen«, sagte Balaschew.
»Hinter den Niemen«, wiederholte Napoleon. »Vor zwei Monaten hat man verlangt, ich soll hinter die Oder, hinter die Weichsel zurückgehen! Ein solches Verlangen kann man an einen Herzog von Baden richten, aber nicht an mich!« schrie Napoleon. »Auch wenn Sie mir Petersburg und Moskau gäben, würde ich diese Bedingung nicht annehmen! Sie sagen, ich habe diesen Krieg angefangen? Wer ist früher zu der Armee gereist? Der Kaiser Alexander, nicht ich! Und welchen Zweck hat Ihr Bündnis mit England? Was hat es Ihnen gegeben?« Je länger er sprach, desto weniger war er imstande, seine Rede zu lenken, welche sichtlich nur den Zweck hatte, sich selbst zu erheben und Alexander, zu beleidigen, was er anfangs am wenigsten beabsichtigt hatte. Sobald er bemerkte, daß Balaschew etwas sagen wollte, unterbrach er ihn hastig. »Ich weiß, Sie haben Frieden mit den Türken geschlossen, ohne die Moldau und die Walachei zu erhalten. Ich hätte Ihrem Kaiser diese Provinzen gegeben, so wie ich ihm Finnland gegeben habe, jetzt aber wird er diese schönen Provinzen nie erhalten! Er hätte können Rußland von dem Bottnischen Meerbusen bis zur Mündung der Donau ausdehnen, was Katharina die Große nicht vermochte«, sagte Napoleon, immer hitziger werdend. »Das alles hätte er meiner Freundschaft zu verdanken.« Er zog die Tabaksdose aus der Tasche und nahm gierig eine Prise.
»Was er nur wünschen konnte, hätte Ihr Kaiser von meiner Freundschaft erhalten können«, sagte Napoleon, die Achsel zuckend, »aber er fand es besser, sich mit meinen Feinden zu umgeben. Er berief Stein zu sich, den Verräter, der aus seinem Vaterland verjagt wurde, Armfeldt, den verworfenen Intriganten, Wintzingerode, den flüchtigen Untertan Frankreichs, und Bennigsen, einen Soldaten, der ein wenig besser ist als die anderen, aber dennoch unfähig, der 1807 nichts zu tun verstanden hatte.«
Napoleon vermochte kaum der raschen Folge seiner Vorstellungen mit seinen Worten zu folgen, durch welche er sein Recht beweisen wollte oder seine Gewalt, was bei ihm ein und derselbe Begriff war.
»Barclay, sagt man, sei der tätigste, aber das kann ich nicht sagen, nach seinen ersten Begegnungen zu urteilen. Und was tun sie alle, diese Höflinge? Pfuel macht Vorschläge, Araktschejew streitet, Bennigsen beweist, und Barklay weiß nicht, was er tun soll, und so vergeht die Zeit. Nur Bagration ist ein wirklicher Krieger, er ist dumm, aber er hat Erfahrung und Entschlossenheit! Und welche Rolle spielt euer junger Kaiser in dieser Menge? Schon vor vier Wochen hat der Feldzug begonnen, und sie verstehen nicht, Wilna zu verteidigen. Sie sind in zwei Hälften zerschnitten und aus den polnischen Provinzen verjagt worden. Ihre Armee ist entmutigt.«
»Im Gegenteil, Majestät«, sagte Balaschew, welcher mit Mühe diesem Feuerwerk von Worten folgte, »das Heer glüht vor Verlangen ...«
»Ich weiß alles«, unterbrach ihn Napoleon. »Ich kenne auch die Zahl Ihrer Batterien so gut wie die meinigen, ich habe nicht zweihunderttausend Mann, ich habe mehr als das Doppelte, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich fünfhunderttausend Mann auf diesem Ufer der Weichsel habe.« Auf manche Phrase Napoleons wollte Balaschew etwas erwidern, aber Napoleon ließ ihn nicht zu Worte kommen. Balaschew wußte, daß alles, was Napoleon jetzt sagte, keine Bedeutung hatte, daß er sich selbst später dessen schämen werde.
»Was frage ich nach Ihren Verbündeten?« fuhr Napoleon fort. »Ich habe auch Verbündete, das sind die Polen, sie zählen achtzigtausend und schlagen sich wie Löwen und werden ihrer bald zweihunderttausend sein!« Noch mehr aufgeregt durch das, was er sagte, sprach Napoleon augenscheinlich die Unwahrheit, und noch mehr erregt durch das Schweigen Balaschews trat er mit heftiger Gebärde ihm näher. »Wissen Sie, daß ich, wenn Sie Preußen gegen mich aufregen, es von der Karte Europas auslöschen werde!« sagte er mit vor Wut zitternder Stimme. »Ja, ich werde Sie hinter die Düna werfen, hinter den Dnjepr, und ich werde Ihnen Grenzen anweisen, welche zu verletzen Ihnen Europa nur in verbrecherischer Verblendung erlauben wird! Ja, das wird Ihr Lohn sein!« Schweigend ging er einige Male im Zimmer auf und ab. Er steckte die Tabaksdose in die Westentasche, zog sie wieder heraus und blieb vor Balaschew schweigend mit spöttischen Blicken stehen. »Und welches prächtige Reich hätte Ihr Kaiser haben können!«
Balaschew fühlte die Notwendigkeit, etwas zu erwidern, und sagte, vom russischen Standpunkt aus erscheinen die Dinge nicht in so düsterem Licht. Napoleon schwieg und hörte augenscheinlich nicht, was er sagte.
»Rußland erwartet von diesem Krieg das Beste«, schloß Balaschew. Napoleon zog wieder die Tabaksdose hervor, schnupfte und stieß zweimal mit dem Fuß auf den Fußboden. Die Tür öffnete sich, ein Kammerherr reichte mit höflichem Bückling dem Kaiser seinen Hut und Handschuhe, ein anderer brachte das Taschentuch. Ohne sie anzublicken, wandte sich Napoleon an Balaschew.
»Versichern Sie dem Kaiser Alexander«, sagte er, »meine Ergebenheit. Ich kenne ihn vollkommen und schätze seine bedeutenden Eigenschaften sehr hoch. Ich halte Sie nicht länger auf. General, Sie werden meinen Brief an den Kaiser erhalten.«
Napoleon ging rasch zur Tür. Aus dem Empfangszimmer stürzten alle vorwärts und eilten die Treppe hinab.
Balaschew wurde zur kaiserlichen Tafel gezogen. Der Brief an den Kaiser, den Balaschew erhielt, war der letzte Brief Napoleons an Alexander. Alle Einzelheiten des Gesprächs wurden dem russischen Kaiser mitgeteilt, und der Krieg begann.
138
Nach seinem Zusammentreffen mit Peter in Moskau fuhr Fürst Andree nach Petersburg, in Geschäften, wie er seinen Verwandten sagte, in Wirklichkeit aber, um dort den Fürsten Anatol Kuragin zu treffen, welchen er zu erschießen sich gedrungen fühlte. Kuragin, nach dem er sich bei seiner Ankunft in Petersburg sogleich erkundigt hatte, war nicht dort. Peter hatte seinem Schwager Nachricht gegeben, daß Fürst Andree ihn suche. Anatol erhielt sogleich eine Ernennung vom Kriegsminister und fuhr zur Armee in der Moldau. Zu derselben Zeit traf Fürst Andree in Petersburg seinen früheren General Kutusow, der ihm vorschlug, sogleich mit ihm zur Armee in der Moldau abzureisen, zu deren Oberkommandierenden der alte General ernannt worden war. Nachdem Fürst Andree dem Stab des Hauptquartiers zugezählt worden war, reiste er nach der Türkei ab. Fürst Andree hielt es für unnütz, an Kuragin zu schreiben und ihn herauszufordern. Solange Fürst Andree keinen neuen Anlaß zum Duell hatte, mußte eine Herausforderung seinerseits die Gräfin Rostow kompromittieren, und deshalb wollte er eine persönliche Begegnung mit Kuragin abwarten, um einen neuen Grund zum Duell zu erhalten. Aber auch bei der Armee in der Moldau fand er Kuragin nicht, da dieser bald nach der Ankunft des Fürsten Andree nach Rußland zurückgekehrt war. In dem neuen Lande und in einer neuen Lebensstellung wurde Fürst Andree das Leben leichter. Der Kriegsdienst war die geeignetste Tätigkeit für ihn. In der Stellung eines Adjutanten beim Stabe Kutusows nahm er sich mit Ausdauer und Eifer der Geschäfte an und setzte Kutusows durch seine Arbeitslust und Pünktlichkeit in Erstaunen. Nachdem er Kuragin in der Moldau nicht gefunden hatte, hielt er es nicht für notwendig, wieder nach Rußland hinter ihm her zu galoppieren. Er war überzeugt, ihn früher oder später zu finden, aber der Gedanke, daß die Beleidigung noch nicht gerächt war, vergiftete diese künstliche Ruhe, welche Fürst Andree bei seiner eifrigen und etwas ehrfürchtigen Tätigkeit äußerlich zeigte. Im Jahre 1812, als die Nachricht von dem bevorstehenden Krieg mit Napoleon nach Bukarest gelangte, bat Fürst Andree um Versetzung zur Westarmee. Kutusow, dem die eifrige Tätigkeit Bolkonskys ein Vorwurf wegen seiner Müßigkeit war, entließ ihn sehr gern und gab ihm eine Empfehlung an Barclay de Tolly. Ehe er zur Armee abfuhr, welche sich im Mai im Lager bei Drissa befand, machte Fürst Andree einen Besuch in Lysy Gory, das nahe an seinem Wege lag. Die letzten drei Jahre hatten Fürst Andree so viele Umwälzungen gebracht, er hatte so Verschiedenes empfunden und durchschaut und Ost und West bereist, daß er mit einer Art von Erstaunen wahrnahm, wie in Lysy Gory alles denselben Verlauf nahm wie früher. Wie in einem verzauberten, schlafenden Schloß fuhr er durch die Allee bis zum Herrenhaus. Es herrschte dieselbe Würde, Reinlichkeit und Stille in diesem Haus mit denselben Möbeln und Wänden und demselben Geruch und denselben eingeschüchterten Gesichtern. Auch die etwas gealterte Fürstin Marie war ebenso schüchtern, unschön und durch immerwährende moralische Leiden gedrückt. Mademoiselle Bourienne war dasselbe selbstzufriedene, kokette Mädchen, welches jede Minute des Lebens freudig genoß und voll fröhlicher Hoffnungen war. Sie schien Andree nur zuversichtlicher geworden zu sein. Der aus der Schweiz mitgebrachte Erzieher Desalles trug einen Rock von russischem Schnitt, sprach stotternd Russisch mit den Dienstleuten, war immer derselbe beschränkte, gebildete, tugendhafte und pedantische Erzieher. Die einzige Veränderung an dem alten Fürsten war, daß er einen Zahn verloren hatte. Sein Wesen war dasselbe wie früher, er war nur noch etwas zänkischer und verdrießlicher über das, was in der Welt vorging. Nur der kleine Nikolai war gewachsen und hatte sich verändert. Der rotwangige, lockenköpfige Knabe spielte heiter und vergnügt und zog die Oberlippe seines hübschen Mundes ebenso in die Höhe wie seine verstorbene Mutter. Er allein gehorchte nicht dem Gesetz der Unveränderlichkeit in diesem verzauberten Schloß. Aber wenn auch im Äußeren alles beim alten geblieben war, so hatten sich doch die inneren Beziehungen aller dieser Personen sehr verändert, seit Andree sie nicht gesehen hatte. Die Familie war in zwei einander fremde und feindliche Lager geteilt, welche sich nur während seiner Anwesenheit vertrugen. Zu dem einen Lager gehörte der alte Fürst, Mademoiselle Bourienne und der Architekt, zu dem anderen Fürstin Marie, Desalles, Nikolai und der ganze weibliche Anhang.
Während seiner Anwesenheit in Lysy Gory speisten die Bewohner miteinander, alle fühlten sich unbehaglich, und Fürst Andree nahm wahr, daß er ein Gast war, für welchen man Ausnahmen machte, und daß er alle durch seine Anwesenheit störte. Am ersten Tag war Fürst Andree schweigsam, und als der alte Fürst dies bemerkte, wurde er mürrisch und ging sogleich nach Tisch in sein Zimmer. Als Fürst Andree abends zu ihm kam und ihn aufzuheitern suchte, lenkte der alte Fürst unerwartet das Gespräch auf die Fürstin Marie, welche er wegen ihres Aberglaubens und ihrer Abneigung gegen Mademoiselle Bourienne tadelte, die nach seiner Meinung allein ihm wirklich ergeben war.
Der alte Fürst sagte, nur Marie sei schuld, daß er so krank sei, weil sie ihn absichtlich quäle und ärgere, und sie verderbe auch den kleinen Fürsten Nikolai durch Verwöhnung und dumme Reden. Der Alte wußte sehr gut, daß er seine Tochter quälte und ihr das Leben sehr schwer machte, aber er meinte, er könne nicht anders, und sie verdiene das. »Fürst Andree begreift das nicht, und ich muß ihn darüber aufklären«, dachte er.
Wenn Sie mich fragen«, sagte Fürst Andree, ohne seinen Vater anzublicken, den er zum erstenmal in seinem Leben innerlich tadelte, – »ich wollte nicht selbst davon reden – aber wenn Sie mich fragen, muß ich Ihnen offen meine Meinung aussprechen. An dem Mißverständnis und dem Zwist zwischen Ihnen und Marie kann ich ihr keine Schuld beimessen. Ich weiß, wie sie Sie liebt und verehrt, aber meine Meinung ist, wenn Mißverständnisse vorliegen, ist die Veranlassung dazu das nichtswürdige Frauenzimmer, welches nicht die Genossin meiner Schwester sein sollte.«
Der Alte blickte seinen Sohn anfangs erstaunt an.
»Welche Genossen? Was meinst du? Hast du dich schon bereden lassen, wie?«
»Väterchen, ich wollte nicht richten«, sagte Fürst Andree in zärtlichem Ton, »aber Sie haben mich herausgefordert, und ich kann nur sagen, Fürstin Marie ist unschuldig! Schuldig ist nur diese Französin.«
»Ah, verurteilt! Verurteilt!« sagte der Alte mit einiger Verlegenheit, wie Fürst Andree glaubte, dann aber plötzlich sprang er auf und schrie: »Fort! Fort! Lasse dich nicht wieder hier blicken!«
Fürst Andree wollte sogleich abreisen, aber Marie bat ihn, noch einen Tag zu bleiben. An diesem Tag sah er den alten Fürsten nicht, welcher nicht herauskam und niemand zu sich ließ, außer Mademoiselle Bourienne und Tichon, und mehrmals fragte, ob sein Sohn abgereist sei.
Am anderen Tag vor seiner Abreise war Fürst Andree in seinen Zimmern. Der gesunde, lockenköpfige Knabe saß auf seinem Knie. Fürst Andree erzählte ihm das Märchen vom Blaubart und verfiel in Nachdenken. Zu seinem Entsetzen empfand er keine Reue darüber, daß er den Vater gereizt hatte, noch Bedauern darüber, daß er ihn bald verlassen werde. Wichtiger als alles war für ihn das, daß er die frühere Zärtlichkeit zu seinem Sohn in sich selbst suchte und nicht fand.
»Nun, erzähle doch!« sagte der Kleine.
Fürst Andree nahm ihn vom Knie herab, ohne zu antworten und ging im Zimmer auf und ab. Sobald Fürst Andree seine alltägliche Beschäftigung aufgegeben hatte und in die frühere Umgebung zurückgekehrt war, in der er sich einst glücklich gefühlt hatte, erfaßte ihn die Schwermut mit neuer Kraft, und es drängte ihn, diesen Erinnerungen zu entgehen und recht bald irgendeine Tätigkeit zu finden.
»Du fährst wirklich fort, Andree?« fragte ihn seine Schwester.
»Gott sei Dank, daß ich fort kann«, erwiderte er. »Ich bedaure nur sehr, daß du das nicht auch kannst.«
»Warum möchtest du das?« erwiderte Marie. »Jetzt, wo du in diesen schrecklichen Krieg ziehst, und er so alt ist? Mademoiselle Bourienne sagte, er habe nach dir gefragt.« Bei diesen Worten zuckten ihre Lippen. Fürst Andree wandte sich ab und ging wieder im Zimmer umher.
»Ach, mein Gott«, sagte er, »welche geringfügigen Ursachen können das Unglück der Menschen machen!«
Sie begriff, daß er unter geringfügigen Ursachen nicht nur Mademoiselle Bourienne, sondern auch jenen Menschen verstand, der sein Glück zerstört hatte.
»Andree, ich bitte dich«, sagte sie mit strahlenden Augen, »denke nicht, daß die Menschen den Kummer verursachen. Er sendet ihn, sie sind nur seine Werkzeuge. Und wenn du auf jemand einen Groll hast, so vergiß ihn und vergib! Wir haben nicht das Recht zu strafen, und du wirst das Glück, zu vergeben, kennenlernen.«
»Wenn ich ein Weib wäre, so würde ich das tun, Marie. Das ist die Tugend der Frauen, aber ein Mann soll und kann nicht vergessen und vergeben«, sagte er, und die Wut erwachte neu in seinem Herzen. »Wenn sie mir zuredet, zu vergeben, so bedeutet das, daß ich schon lange hätte strafen sollen«, dachte er.
Sie bat ihn, noch einen Tag zu warten, stellte ihm vor, wie unglücklich der Vater sein werde, wenn er fortfahre, ohne sich mit ihm versöhnt zu haben. Aber Andree erwiderte, er werde wahrscheinlich bald von der Armee zurückkommen und wolle dem Vater schreiben.
Er nahm Abschied von seiner Schwester.
»So muß es sein«, dachte Fürst Andree, als er die Allee hinabfuhr. »Sie ist ein bedauernswertes, unschuldiges Geschöpf. Der Alte fühlt sich schuldig ihr gegenüber, kann sich aber nicht ändern. Mein Knabe wird wachsen und sich des Lebens freuen, und es wird ihm ebenso gehen wie allen, er wird betrogen werden oder selbst betrügen. Warum gehe ich zur Armee? – Ich weiß es selbst nicht. Ich muß jenen Menschen finden, den ich verachte, um ihm die Gelegenheit zu geben, mich zu töten und zu verlachen.«
139
Fürst Andree kam gegen Ende Juni im Hauptquartier an. Die erste Armee, bei der sich der Kaiser befand, lag in dem befestigten Lager bei Drissa. Die zweite Armee, welche, wie man sagte, durch starke französische Streitkräfte abgeschnitten war, suchte sich mit der ersten zu vereinigen. Alle waren unzufrieden über den Verlauf des Feldzugs, aber niemand dachte daran, daß der Krieg sich weiter erstrecken könne als über die westlichen polnischen Gouvernements.
Fürst Andree traf Barclay de Tolly, dem er zugeteilt war, am Ufer der Drissa. Da sich in der Nähe des Lagers kein größeres Dorf befand, so war die große Anzahl von Generalen und Höflingen, die sich bei der Armee befand, in einem Umkreis von zehn Kilometern in den besten Häusern verteilt. Barclay de Tolly hatte sein Quartier vier Kilometer vom Kaiser entfernt. Er empfing Bolkonsky kalt und trocken und sagte mit seiner deutschen Aussprache, er werde dem Kaiser über ihn Meldung machen, und bis der Kaiser Bestimmung über seine Verwendung getroffen haben werde, bitte er ihn, bei seinem Stabe zu bleiben. Anatol Kuragin fand Andree nicht bei der Armee. Er war in Petersburg, und diese Nachricht war Bolkonsky angenehm. Die Vorgänge des ungeheuren Krieges nahmen Fürst Andree ganz in Anspruch, und er war erfreut, den Gedanken an Kuragin auf einige Zeit loszuwerden. Während der ersten vier Tage besichtigte Fürst Andree das ganze befestigte Lager und suchte sich einen bestimmten Begriff davon zu machen. Die Frage, ob das Lager nützlich oder unnütz sei, ließ er unentschieden, er hatte aus seiner Kriegserfahrung schon die Überzeugung gewonnen, daß die tiefsinnigsten Pläne nichts bedeuten und daß alles davon abhängt, wie man unvorhergesehenen Bewegungen des Feindes begegnet, und durch wen und wie die Sache geleitet wird.
Als der Kaiser sich noch in Wilna befand, war das Heer in drei Armeen geteilt. Die erste stand unter Barclay de Tolly, die zweite unter Bagration und die dritte unter Tormassow. Der Kaiser befand sich bei der ersten Armee, aber nicht in der Eigenschaft eines Oberkommandierenden, er hatte auch nur einen Stab des Kaiserlichen Hauptquartiers bei sich und nicht den eines Oberkommandierenden. Außerdem befand sich in der Nähe des Kaisers ohne Kommando Araktschejew, der frühere Kriegsminister, dann Graf Bennigsen, im Rang der älteste General, der Großfürst, der Kanzler, Graf Rumjanzow, Stein, der frühere preußische Minister, der schwedische General Armfeldt, ferner General Pfuel, der hauptsächlich den Feldzugsplan ausgearbeitet hatte, General Paulucci und viele andere. Alle diese Personen hatten, wenn auch keine bestimmte Stellung, doch Einfluß, und oft wußte ein Korpskommandierender nicht, in welcher Eigenschaft bald von Bennigsen, bald vom Großfürsten, bald von Araktschejew ihm Befehle erteilt wurden und ob diese Herren für ihre Person sprachen, oder ob ein ihm in Form eines Rats erteilter Befehl vom Kaiser ausging, ob man ihn erfüllen müsse oder nicht. Aber das waren innerliche Umstände, der wirkliche Sinn der Anwesenheit des Kaisers und aller dieser Persönlichkeiten vom Standpunkt des Hofes aus war allen klar und war folgender: Der Kaiser nahm nicht das Oberkommando auf sich, aber verfügte über alle Armeen, die Leute, die ihn umgaben, waren seine Gehilfen. Araktschejew war der treue Vollführer, der Wächter der Ordnung und Leibwächter des Kaisers. Bennigsen war ein Gutsbesitzer aus dem Wilnaschen Gouvernement, welcher anscheinend mit der Aufnahme und Bewirtung des Kaisers beschäftigt, in Wirklichkeit aber ein guter General war, nützlich im Rat und als stets bereiter Ersatzmann für Barclay. Der Großfürst war hier, weil es ihm so gefiel. Der frühere Minister Stein war da, weil er nützlich im Rat war und weil Kaiser Alexander seine Eigenschaften hochschätzte. Armfeldt war ein boshafter Neider Napoleons, besaß großes Selbstvertrauen und hatte immer Einfluß auf Alexander. Paulucci war da, weil er dreist und entschieden sprechen konnte, die Generale waren da, weil sie überall waren, wo der Kaiser war, und endlich, was das wichtigste war, Pfuel war da, weil er den Plan zum Krieg gegen Napoleon entworfen hatte und, nachdem er Alexander von der Zweckmäßigkeit dieses Plans überzeugt hatte, die ganze Kriegsführung leitete. Bei Pfuel war Wolzogen, der die Gedanken Pfuels in leichter, verständlicherer Form wiedergab als Pfuel selbst, der scharfe Kabinettstheoretiker, dessen Selbstvertrauen bis zur Verachtung aller übrigen ging. Außer den genannten russischen und ausländischen Persönlichkeiten befanden sich noch viele Leute zweiten Ranges bei der Armee, weil ihre Vorgesetzten dort waren. Während Fürst Andree ohne Kommando bei Drissa lebte, schrieb Schischkin, der kaiserliche Sekretär, einen Brief an den Kaiser, welchen Balaschew und Araktschejew unterschrieben. In dem Brief machte er Gebrauch von der kaiserlichen Erlaubnis, seine Meinung über den Verlauf der Dinge zu äußern und riet dem Kaiser ehrerbietig, das Heer zu verlassen unter dem Vorwand der Notwendigkeit, das Volk in der Residenz zum Krieg zu begeistern.